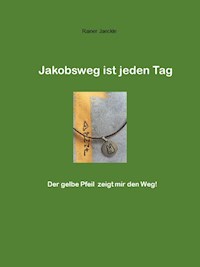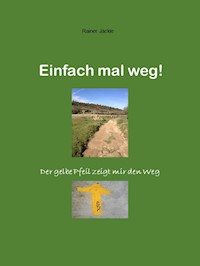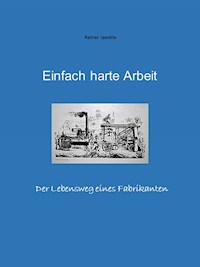
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Als mein Vater starb, das war im Jahr 1984, habe ich in seinen Unterlagen einen Stapel Blätter gefunden, die mit einer Schreibmaschine ganz eng voll getippt waren. Mein Vater bekam die Blätter sicherlich in den 60er Jahren, genau weiß ich das nicht. Es sind insgesamt vierundvierzig. Die Überschrift oben auf der ersten Seite lautet: "Lebenslauf von Christoph Heinemann, St. Georgen im Schwarzwald." Ich habe die Blätter dann auch gleich regelrecht verschlungen, so spannend erschien mir der Werdegang und der Lebensweg von Christoph Heinemann. Ich dachte dabei an die Anfangsphase von Apple, an Steve Jobs und Silicon Valley. Ich vertiefte mich in mein "Silicon Blackwood".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 156
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Rainer Jaeckle
Einfach harte Arbeit
Der Lebensweg eines Fabrikanten
2. überarbeitete Auflage, Juni 2019
Texte: © Copyright by Rainer JaeckleUmschlaggestaltung: © Copyright by Rainer Jäckle
Verlag:Rainer JaeckleBeim Kastenkamp 628844 Weyhe
E-Mail: [email protected]
Homepage: www.rainerjaeckle.de
Druck: epubli – ein Service der neopubli GmbH, Berlin
Homepage: www.epubli.de
Als ich früher aus dem Fenster sah
Meine Großeltern wohnten im dritten Stock eines großen Sandsteinhauses, in der Stadtmitte von St. Georgen, in der Gerwig-Straße 31. Das Küchenfenster in der ziemlich großen Wohnung bot einen herrlichen Ausblick auf den Stockwald. Ich stieg dann als Sechsjähriger auf einen kleinen dunklen Holzhocker, öffnete das dick weiß gestrichene zweiflügelige Küchenfenster mit dem dünnen Glas und konnte mich dann an dem Anblick der Wälder, die bis zum Horizont reichten, nicht satt sehen.
Mein Opa benutze das Küchenfenster, wenn er sich rasieren musste oder wollte. Ich weiß nicht, ob er diesbezüglich Vorgaben von der Oma bekommen hat. Jedenfalls hängte er dann seinen kleinen Rasierspiegel, mit dem dicken beige gestrichenen Rahmen und mit der kleinen Aufhängeschnurr am Kopfende, an dem Fenstergriff auf und legte dann los. Pinselte sich ein und rasierte sich mit einem extrem scharfen Rasiermesser äußerst vorsichtig, mit Blick auf den Stockwald. Danach war das Fenster für mich wieder frei.
Wenn mein Blick mal nicht in die Ferne schweifte, sondern wenn ich direkt, aus luftiger Höhe, heruntersah, dann standen die Hallen der Firma Heinemann direkt vor mir. Ich hörte die geheimnisvollen Geräusche der Maschinen und sah die Fabrik arbeiten.
Im Hintergrund des Bildes, rechts oben am Bildrand, ist das Haus meiner Großeltern zu sehen.
Inhalt
Als ich früher aus dem Fenster sah
Inhalt
„Silicon Blackwood“
Alles fing mit einem Kloster an
St. Georgen brauchte das Stadtrecht
Wirtschaftspolitik gab es auch schon
Die Infrastruktur war gut
Es gab auch immer wieder Show-Stopper
Die Uhrenindustrie war dominierend
Wer war Christoph Heinemann?
Eine Schwarzwälder Erfolgsgeschichte
Ich bin der Sohn eines Schmieds
Ein Job als Laufbube
Die Schwarzwälder Tüftler
Der große Brand
Der Wiederaufbau
Blutegel haben geholfen
Bau von Eisenbahn und Kirche
Das erste Fabrikle
Unser Gottle
Meine Konfirmation
Lehrling in der Schlosserei
Maschinen für die Uhrmacherei
Ich wollte in die Fremde
Arbeit in Pforzheim
Rosenfelder nimmt sich das Leben
An einem Sonntag kam ich nach Stuttgart
Ich hoffte auf Arbeit
Neue Arbeit in Stuttgart
In Chemnitz habe ich am meisten gelernt!
Besuch von Schwager Tobias
Dieses Treiben in Berlin
Der Fünf-Taler-Schein
Alles schrie Hurra!
Bei den Fischköpfen
Das Ende meiner Handwerksburschenzeit
Beginn des Maschinenbaus
Suche nach Aufträgen
Die Uhrenmacherei war primitiv eingerichtet
Ich musste Lehrgeld bezahlen
Kauf eines Lokomobils
Ein Brand im Jahr 1928
Zurück ins Jahr 1876, das Lokomobil im Einsatz
Joseph Heine will auch ein Lokomobil
Das neue Fabrikle
Sie hatte mich wohl gerne gesehen
Und dann hatten wir Hochzeit
Als meine Frau starb
Der Neubau
Besuch von Emilie
Wir waren ein schönes Brautpaar
Lungenentzündung
Die Geschichte ist zu Ende
Alles hatte seine Zeit
Ein paar Fakten zu Heinemann
Quellennachweis
Anmerkungen
„Silicon Blackwood“
Als mein Vater starb, das war im Jahr 1984, habe ich in seinen Unterlagen einen Stapel Blätter gefunden, die mit einer Schreibmaschine ganz eng voll getippt waren. Oben rechts, in der Ecke des ersten Blattes, stand mit Bleistift fein leserlich geschrieben: H. Jäckle.
Mein Vater bekam die Blätter sicherlich in den 60er Jahren, genau weiß ich das nicht. Es sind insgesamt vierundvierzig. Die Überschrift oben auf der ersten Seite lautet: „Lebenslauf von Christoph Heinemann, St. Georgen im Schwarzwald.“ Ich habe die Blätter dann auch gleich regelrecht verschlungen, so spannend erschien mir der Werdegang und der Lebensweg von Christoph Heinemann. Ich dachte
dabei an die Anfangsphase von Apple, an Steve Jobs und Silicon Valley. Ich vertiefte mich in mein „Silicon Blackwood“.
Zum Teil waren die vergilbten Blätter nur noch schwer lesbar. Mit einem Vergrößerungsglas habe ich versucht, die Textzeilen zu entziffern. Mein Ziel war es, zumindest sinngemäß, die ganze Story auf meinem Computer einzutippen. Dabei hatte ich beim Lesen immer wieder das Gefühl, vom Schreiber mitgenommen zu werden und sogar dabei zu sein. Auch gingen mir immer wieder Vergleiche mit der heutigen Zeit durch den Hinterkopf. Auch damals schon, wie heute im 21. Jahrhundert auch, haben sich die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und Lebensverhältnisse immer wieder sehr schnell verändert.
Beispielsweise kamen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bemerkenswerte Innovationen aus Amerika zu uns nach Europa, die Massenfertigung von Uhren, die Standarisierung von Teilen der Uhr und plötzlich kamen auch neuartige Uhren mit vereinfachter Technologie auf den Markt. Der Uhrenwecker sei in diesem Zusammenhang genannt. Und wie reagierten die Schwarzwälder darauf?
Sie nahmen diese Veränderungen und Herausforderungen, ohne zu murren, an und reagierten schnell und gekonnt darauf. Und das passierte alles in einem Umfeld, das ursprünglich ausschließlich von einer kargen ärmlichen Landwirtschaft geprägt war. Wie platzte der Knoten? Wie wurden aus Bauern stolze Fabrikanten? Wie kamen die Fabriken zu den eigentlich verstockten, wortkargen, sonderbaren Hinterwäldlern in den Schwarzwald und in das Kaff nach St. Georgen?
Sorry, ich musste meine Klischees einfach mal loswerden! Ich fange deshalb, mal geschichtlich betrachtet, von vorne an.
Eine alte Postkarte mit dem Titel: Das Laub fällt! Höhenzüge bei Bernau.
Alles fing mit einem Kloster an
Im Jahr 1084 begannen die Rodungsarbeiten für den Klosterbau St. Georgen und im gleichen Jahr noch trafen die Benediktinermönche ein. Ein Jahr später wurde bereits eine hölzerne Klosterkapelle eingeweiht und schon im Jahr 1086 hat das Kloster einen Abt mit Namen Heinrich.
Ein unbekannter Chronist schreibt im Jahr 1795:
Der Boden ist hier, so wie in der ganzen Gegend, sandig und trocken, eben deswegen unfähig, mehrere andere Produkte als Roggen, Haber, Gersten, Hanf, Flachs und Erdäpfel und selbst diese in einer hinlänglichen Quantität zu liefern.
Eben daher können sich viele Bürger nur über Handwerk und Handel ernähren. Die Handwerker sind: Bäcker, Müller, Schmied, Wagner, Schuhmacher, Schneider und Weber. Ferner gibt es: Zimmerleut, Maurer, Schreiner, Hafner, Glaser, Seiler und Uhrmacher.
Das ehemalige Klosteramtshaus vor 1900.
St. Georgen brauchte das Stadtrecht
Das Markrecht erhält St. Georgen im Jahr 1507 durch Kaiser Maximilian I. und im Jahr 1891 das Stadtrecht. Im Jahr 1891 hieß der damalige Bürgermeister Wintermantel.
Der Bürgermeister: Jacob Wintermantel.
Er schrieb an das Ministerium des Innern nach Karlsruhe einen Brief und bat darum, dass der Gemeinde St. Georgen die Eigenschaft einer Stadt verliehen werden sollte. Er schrieb in seinem Bewerbungsbrief unter anderem:
Die Gemeinde St. Georgen ist zur Zeit einer der am glücklichsten gedeihenden Industrieorte des badischen Schwarzwaldes, welcher bei rastlosem Vorwärtsstreben in den letzten Jahren einen derartigen Aufschwung genommen hat, dass er füglich anderen kleinen Städten an die Seite gestellt werden kann.
Die Bevölkerungszahl von St. Georgen ist vom Jahre 1885 bis zum Jahre 1890 von 2.394 auf 2.600 Seelen gestiegen, ferner sind in den letzten sieben Jahren etwa siebzig Neubauten daselbst entstanden. Außer den acht Handelsgeschäften und den siebenundsechzig Gewerbebetrieben bestehen daselbst elf Fabrikanlagen mit 582 Arbeitern und sechzehn Nebengeschäften für die Schwarzwälder Uhrenindustrie, sowie eine mechanische Werkstätte.
Die hohe industrielle Bedeutung des Ortes, welche durch die Leistungen des dortigen Gewerbevereins und der Gewerbehalle eine wesentliche Förderung erfährt, ist bereits bei der im Jahre 1884 daselbst veranstalteten Gewerbe- und Industrieausstellung des Gauverbandes der Schwarzwälder Gewerbevereine deutlich erkennbar zutage getreten.
Gerade in letzterer Beziehung wird seitens der Gemeindebehörde geltend gemacht, dass St. Georgen im Handel und Verkehr zurücktreten müsse, solange es nicht als Stadt bezeichnet sei, da von fremden Geschäftsleuten und Reisenden vielfach nur Städte aufgesucht würden.
St. Georgen im Jahr 1890.
Wirtschaftspolitik gab es auch schon
Es gab damals auch schon eine Wirtschaftspolitik. Es war um das Jahr 1827 das erklärte Ziel der badischen Verwaltung, wegen der Konkurrenz und des starken Verbrauchs ausländischer Strohhütte, der heimischen Strohhutfabrikation Unterstützung zu gewähren.
Der Strohhutfabrikant Philipp Ruh war der erste St. Georgener, der für seine Fabrik aus der Stuttgarter Amtskasse Unterstützung bekam.
Frauen und Mädchen beim Strohflechten.
Wie kam es eigentlich zu der Strohhutfabrikation in St. Georgen? Als Glasträger die ersten Uhren in den Schwarzwald brachten, kam auch das Strohflechten in unsere Heimat. Die damals in der Schweiz und Italien betriebene Strohflechterei wurde durch den Handel auch bei uns bekannt. Erzeugnisse wie Strohhütte, Zierbänder und Behältnisse fanden viele Abnehmer.
Das Strohflechten war für die damalige Hausindustrie besonders gut geeignet, zumal auch die Jugendlichen in diese Arbeit eingebunden werden konnten. Es wurde auch eine Flechtschule in St. Georgen gegründet. Das Problem war allerdings, dass im Laufe der Zeit diese Strohartikel nicht die volle Befriedigung der Käufer fanden. Das veranlasste Andreas Weisser, die Herstellung von Hüten fabrikmäßig zu erstellen, um die gewünschte Form und die präzise Verarbeitung zu erreichen.
Die Infrastruktur war gut
Ganz wichtig war für die Stadt St. Georgen die Verkehrsanbindung. Im Jahr 1835 begann man mit dem Bau der neuen Poststraße auch „Kunststraße“ genannt, die von Hornberg über Triberg nach St. Georgen führen und bei Peterzell in die alte Postroute nach Villingen einmünden sollte.
Im Jahr 1839 war sie dann fertig und die Badische Landstraße Nr. 29 wurde am 1. Juli eröffnet. Für St. Georgen bedeutete die Postroute den Beginn einer langanhaltenden wirtschaftlichen Blüte.
Die neue Poststraße.
Mit dem beginnenden Bahnbau brachen die letzten Jahre der Postkutschenzeit über den Sommeraupaß an und mit der Vollendung der Schwarzwaldbahn im Jahr 1873 verstummte das Posthorn für immer.
Im Jahr 1873, am 10. November, nahm die Schwarzwaldbahn den Betrieb auf. Es gab jetzt eine Eisenbahnlinie von Singen nach Offenburg mit Halt in St. Georgen.
Erbauer der Bahn war Robert Gerwig (1820 -.1885), der Badener aus Karlsruhe. Er war ein vielseitiger Ingenieur und beschäftigte sich auch mit vielen anderen Projekten:
Er war Leiter der Uhrmacherschule in Furtwangen, Politiker im badischen Parlament und im deutschen Reichstag, Fachmann für Wassererfassung und -Ableitung, Straßen- und Brückenbauer.
Der Bahnhof in St. Georgen.
Zur Feier des Tages gab es ein Platzkonzert auf dem Marktplatz. Am Abend dann hatten die Bürger ihre Häuser festlich illuminiert. Der damalige Bürgermeister, Johann Georg Braun, brachte in einem Telegramm an den badischen Großherzog, den Dank der Gemeinde „für die große Wohltat, die uns durch den Bau der Eisenbahn zuteil geworden ist“ zum Ausdruck.
In seiner telegraphischen Erwiderung hob der Großherzog Friedrich die Tatsache hervor, dass St.Georgen jetzt an dem großen Weltverkehr jetzt teilnehmen könne.
Es gab auch immer wieder Show-Stopper
Ein Großbrand zerstört die Lorenzkiche und einen Großteil der Häuser am 19. September 1865. Es war eine der größten Katastrophen in der Geschichte von St. Georgen. Dieser Brand vernichtete den größten Teil des alten Ortskerns und brachte unsägliches Leid über die Bevölkerung. Schaut man in die Geschichte von St. Georgen, dann fallen die vielen Brände auf. Höfe brennen immer wieder nieder. Ursache dafür war in aller Regel, dass sich das Heu, welches unter dem Dach gelagert wurde, entzündete oder dass es immer wieder mal Kaminbrände gab.
Die Uhrenindustrie war dominierend
Die dürftige Ackerkrume zwang, wie schon erwähnt, die St. Georgener weitere Erwerbsquellen zu suchen. Alte Schriftstücke berichten wie die Uhrmacherkunst in den Schwarzwald kam. Die Gebrüder Kreuz, auf dem Glashof bei Waldau, erhandelten von einem böhmischen Glasträger die erste Uhr.
Eine typische Schwarzwälder Uhrmacherwerkstatt.
Dieses vorher nie gesehene Kunstwerk erregte Aufsehen und Neugier in der ganzen Gegend. Ein paar Handwerker und Bauern begannen dann sogleich mit dem Nachbau. In St. Georgen. Im Stockwald, war es dann Simon Henniger, der damit begann. Normalerweise produzierte er Kübel und Wasserzuber. Das war der Startschuss für die Uhrmacherei.
Aber stimmt das wirklich? Die frühesten Anfänge einer Uhrenherstellung im Schwarzwald liegen im Dunkeln und alle Bemühungen, den Urbeginn der Schwarzwälder Uhrmacherei geschichtlich einwandfrei zu beweisen, sind bisher gescheitert.
Seit Beginn des 19. Jahrhunderts versuchen Chronisten festzustellen, wann die erste Uhr im Schwarzwald gebaut wurde und wie dieselbe zur Nachahmung in den Schwarzwald kam. Denn Räderuhren, in der Bauart der ersten Schwarzwalduhr, kennt man schon seit dem 14. Jahrhundert.
Es wird vermutet, dass die erste Schwarzwälder Uhr1 aus einem einfachen, groben Holzwerk mit drei Rädern bestanden hat, das von einem Steingewicht angetrieben wurde und eine sogenannte Waaghemmung besaß.
Schwarzwälder Lackschilduhr aus dem Jahr 1820. Es war eine Hochzeitsuhr.
Unter dem Schildbogen steht der Sinnspruch:
Die Zeit vergeht, jetzt kommt der Tod, drum lebe fromm und liebe Gott.
Für die gewerbliche Herstellung von Uhren Im Schwarzwald und deren verhältnismäßig schnelle Verbreitung waren mehrere Gründe verantwortlich. Die zum Verkauf bereitstehenden Uhren wurden von den Glasverkäufern vertrieben und brachten dem Hersteller bares Geld.
Waren aus dem Schwarzwald für halb Europa und das zu Fuß
Das bedeutete für den damaligen Schwarzwälder Kleinbauern, der mit seinem spärlichen Ertrag des kargen Bodens seine meist kinderreiche Familie nur recht und schlecht ernähren konnte, eine zusätzliche und recht willkommene Einnahmequelle. Die langen und harten Schwarzwaldwinter, konnten mit dem Uhrenmachen gewinnbringend genutzt werden.
Im Übrigen verstand es der Schwarzwälder von jeher, aus dem reichlich vorhandenen Holze, die verschiedensten Gebrauchsgegen-stände herzustellen.
Im Jahr 1905 war St. Georgen der Ort im Schwarzwald mit der größten Anzahl selbständiger Uhrmachermeister. Es waren kleine familiengeführte Betriebe, die keine Freizeit kannten. Auch Kinder arbeiteten mit. Im Zeitraum zwischen 1850 und 1914 entstanden in St. Georgen etwa zwanzig Fabriken, welche von alteingesessenen, vom Gründungseifer getriebenen Familien,
aus dem Boden gestampft wurden. Fast alle Firmen gruppierten sich um die Uhr. Eine Handvoll davon bauten Uhren, und die anderen lieferten zu: Werkzeuge, Maschinen und Kleinteile. Die junge Industriestadt St. Georgen hatte im Jahr 1925 insgesamt 1.544 ortsansässige Fabrikarbeiter. Das ist eine ganze Menge bezogen auf die paar tausend Einwohner, die es zu jener Zeit gab.
Bezogen auf das Jahr 1921, habe ich die Mitarbeiterzahlen der einzelnen, damals in St. Georgen ansässigen Firmen, feststellen können. Das Jahr passt auch ganz gut zur „Story“ in diesem Buch. Ich habe sie nachfolgend aufgelistet und versucht, diese mit den Zahlen, heute im Jahr 2018, zu vergleichen.
Firma Chr. Aberle.80 Mitarbeiter in 1921.
Das Unternehmen stellte Fahrradglocken, Türenglocken und Uhrenteile her. In Gutach gab es ein Zweigwerk, welches Stahlschalen für die Uhrenindustrie presste. Die Metallwarenfabrik wurde im Jahr 1928 verkauft. Es existiert heute nicht mehr.
Firma Mathias Bäuerle. 300 Mitarbeiter.
Das Unternehmen wird in St. Georgen nur kurz MB genannt. Es beschäftigt heute rund 120 Mitarbeiter und besteht seit 1863. MB entwickelt und produziert Maschinen für die Druckweiterverarbeitung.
Durch verschiedene richtungsweisende Erfindungen und Patente hat das Unternehmen die Automatisierung in Falzmaschinen entscheidend gestaltet und geprägt. Heute sind die Kernkompetenzen auf automatisierte Falz- und Kuvertiersysteme sowie Systemlösungen im Hochleistungsbereich ausgerichtet.
Letztes Jahr, in 2017, wurde MB vom Falzmaschinenspezialisten GUK übernommen.
Firma Mathias Bäuerle
Firma Tobias Bäuerle & Söhne. 400 Mitarbeiter.
Im Volksmund nur TB genannt. TB stellte feinwerktechnische und elektronische Geräte und Uhrwerke her. Die Firma wurde 1864 von Tobias Bäuerle gegründet. 1891 erhielt er sein erstes Patent auf eine besondere Pendelkonstruktion.
Im Jahr 1897 ließ er sich die Marke „Hirsch“ als geschütztes Warenzeichen eintragen. Am 20. August 1903 nahm Tobias Bäuerle seine beiden Söhne, Christian und Tobias, als Teilhaber in seine Firma auf, die seither als Tobias Bäuerle & Söhne firmierte.
Das Firmengebäude von Tobias Bäuerle in 80er Jahren.
Im Jahr 1991 hatte das Unternehmen 300 Mitarbeiter. Im Mai 2001 war die Firma Tobias Bäuerle & Söhne Feinwerktechnik GmbH dann zahlungsunfähig.
August 2018. Aus dem Unternehmen wird ein Hotel.
Firma Fichter & Hackenjos. 43 Mitarbeiter.
Die Firma war in der Feinmechanik tätigt. Sie fertigte Werkzeuge und lieferte Schneideisen, Gewindebohrer, Schrauben und Fasson-Teile aus.
Firma Philipp Haas & Söhne. 350 Mitarbeiter.
Philipp Haas war eine große Uhrenfabrik in St. Georgen. Der einstige Uhrenhändler Haas wurde zu einem Uhrenhersteller und fertigte von etwa 1865 an bis etwa in das Jahr 1925 eigene Uhren.
Schwerpunkt des Exportes war vor allem England und die USA. Die Produktpalette umfasste Uhren aller Art, von der einfachen Schwarzwälder Uhr bis zu den Biedermeieruhren.
Durch die Inflation und die beginnende Weltwirtschaftskrise geriet die Firma zunehmend in Schwierigkeiten, weil ihr eine ertragsstarke Massenfertigung fehlte, und die Exporte in kürzester Zeit durch starke Erhöhungen der Zölle in England zum Erliegen kamen. Im Jahr 1925 folgte dann die Schließung.
Auf dem Foto ist die Haas-Belegschaft zu sehen. In der vorderen Reihe tragen die Mitarbeiter ein paar der produzierten Uhrenmodelle.
Firma Gebrüder Heinemann. 200 Mitarbeiter.
Das Unternehme stellte alle Arten von Maschinen her. Beispielsweise Revolverdrehbänke und Schnellhobelmaschinen. Das Unternehmen schloss im Jahr 2005 die Tore für immer. Im Jahr 1976 hatte Heinemann 460 Mitarbeiter. Das war der Höchststand.
Firma Hölzle u. Hackenjos & Co. 25 Mitarbeiter.
Das Unternehmen, eine Eisengießerei, wurde im Jahr 1904 gegründet und musste dann im Jahr 1965 schließen. Das Unternehmen bot, in Zeitungsanzeigen, Maschinen-Gussteile und Massenartikel für die Maschinen- und Uhrenindustrie an.
Gießerei Hölzle, Hakenjos&Co. Aufnahme aus den 60er Jahren.
Firma Kieninger&Obergfell. 50 Mitarbeiter.
Kieninger fertigte Hausuhrwerke, Lauf- und Uhrwerke für elektrische und technische Zwecke und Registrierapparate. Die Uhren kann man im Internet immer noch ersteigern. Das Unternehmen existiert nicht mehr.
Firma A. Nicol (ehemals R. Weisser). 30 Mitarbeiter.
Bisher konnte ich keine Informationen zu dem Unternehmen recherchieren.
Firma Perpetuum, 90 Mitarbeiter.
Schwarzwälder Federmotoren und Automatenwerke. Die von Joseph Steidinger gegründete Fabrik für Feinmechanik bot Grammophon-Laufwerke, Hausuhrwerke und Rasierklingen-Schleifapparate an.
Später, zusammen mit Dual, wurde es ein weltbekanntes Unternehmen der Phono-Industrie. Im Jahr 1982 war es dann vorbei.
Firma Gebrüder Schultheiß. 65 Mitarbeiter.
Es lohnt sich, kurz näher auf das Unternehmen einzugehen, welches heuet nicht mehr existiert. Schon Mitte des 18. Jahrhunderts verwendete man in Frankreich und Wien für Stutz- und Bodenstanduhren Emailzifferblätter, die leuchtend weiß und bezüglich der Ziffernzeichnung von hervorragender Qualität waren.
Dem Schwarzwälder fehlte jedoch die Erfahrung und Fertigkeit, solche selbst herzustellen, so dass man die benötigten Emailzifferblätter von Paris und Wien beziehen musste. Die aus starkem Kupferblech gefertigten, leicht bombierten Zifferblätter wurden von einem schmalen Messingreif umschlossen und auf das Schild gesetzt.
Das Fabrikgebäude der Firma Schultheiß, 1889.
Der Schreiner und Schildmaler Johannes Schultheiß (1814-1888) in St. Georgen war der erste Schwarzwälder, der sich im Jahre 1838 an die Herstellung von Emailzifferblättern wagte.
Die großen Anfangsschwierigkeiten, die sich ihm naturgemäß mangels Erfahrung in den Weg stellten, versuchte er dadurch zu beseitigen, dass er trotz einer Familie mit drei Kindern, eine Lehre von sechs Wochen bei einem Glaskünstler in Freiburg absolvierte, um die Emailliertechnik zu erlernen.
Im Jahr 1841 begründete Schultheiß ein eigenes Unternehmen und arbeitet mit nur wenigen Leuten, die er erst ausbilden musste, unermüdlich, um das Geschäft, das mehrmals vor dem Zusammenbruch stand, zu retten. Für seine Emailzifferblätter hatte er keine Absatzsorgen.
Er stellte jedoch außer diesen noch Emailschilder her, die er als erster in Deutschland einführte und für die er sich erst einen Abnehmerkreis schaffen musste.
Um die Mitte der fünfziger Jahre, so um 1856, gelang es den Gebrüder Schultheiß nach anfänglich sehr großen Opfern, welche die vorhandenen Barmittel fast gänzlich aufzehrten, nun auch Eisenblech zu emaillieren.
Ein Familienbild um 1880 zeigt die Fabrikantenfamilie des Johannes Schultheiß.
Firma Gebrüder Staiger GmbH. 20 Mitarbeiter.
Die Installationsfabrik fabrizierte Installationsgeräte und Zubehör für die Radioindustrie. Das Unternehmen hatte im Jahr 1991 den Höchststand, mit ungefähr 400 Mitarbeiter, erreicht. Die Entwicklung war rasant.