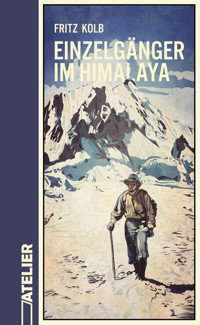
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edition Atelier
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Sommer 1939: Der junge Lehrer Fritz Kolb und sein Freund Ludwig Krenek erfüllen sich einen Traum. Die begeisterten Bergsteiger organisieren eine kleine Expedition ins Himalaya-Gebirge. Doch schon bald wird das unbeschwerte Abenteuer zu einer unglaublichen Odyssee: Nach dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs werden sie als »feindliche Ausländer« verhaftet und dürfen Britisch-Indien für viele Jahre nicht verlassen ... In »Einzelgänger im Himalaya« erzählt Fritz Kolb von dieser außergewöhnlichen Zeit in Indien: von der Natur und den Menschen, den Internierungslagern, in denen er während des Krieges festgehalten wurde, den politischen Entwicklungen, Hoffnungen und Sorgen, vor allem um die Daheimgebliebenen. Und natürlich von den Bergen, in denen sich Kolb und Krenek bei jeder Möglichkeit aufhielten. Ein lebendiges und mitreißendes Erinnerungsbuch und der Bericht einer außergewöhnlichen Freundschaft.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 304
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
FRITZ KOLB
EINZELGÄNGERIM HIMALAYA
Mit einem Vorwort von Helga Kromp-KolbHerausgegeben und mit einem Nachwortvon Ulrike Schmitzer
INHALT
Damals spannend, heute auch noch
Vorwort von Helga Kromp-Kolb
Träume werden Wirklichkeit
Tibet, Himalaya und Indien, unerreichbare Wunschziele – Ludwig – Ferienreisen mit Engländern – Im Anfang war das Wort – Die Reise in den Himalaya gesichert – Wie es zu weiteren Reisen kam
BEI KRIEGSAUSBRUCH IM HIMALAYA
Der Vortrupp
Abschied – Bargeldnöte – Frank – Ein Sendbote Indiens – Monsun im Indischen Ozean
Zurechtfinden im fremden Land
Frank muß nach Simla – Irrfahrten in Amritsar – Im Autobus nach Kangra – Das erste Rasthaus – Meldung bei der Polizei – Ein freundlicher Schotte
Am Schauplatz der kommenden Fahrten
Ohne Aufsehen nach Kailang – Ein hilfreiches Geschwisterpaar – Unser Koch, Shankr Singh – Wasserkäfer – Einblick in die Bergwelt von Inner-Lahul – Neuartige Lockungen – Hoher Besuch – Ein Fluß sperrt den Weg – Bis 5 500 Meter am M 10 empor
Die Hauptmacht kommt
Pünktliches Eintreffen in Kailang – Eine Seilbrücke – Erster Morgen im Standlager – Umschau und Einlaufen – Unser »Fahrplan« – Die Überwindung des Eisbruches – Feinmechanik im Zelt
Wir erkunden und besteigen den Mulkila
Eine böse Wand – Blick in neue Welten – Unsere drei Sherpas waren keine Neulinge – Ein Lager unter der Wand – Der große Wurf gelingt
Ablöse für die nächste Fahrt
Geänderte Pläne – Frank und Hilda an der Reihe – Schneefall – Erfolg am zweithöchsten Berg Lahuls – Wettlauf zwischen Gletscherspalten
Monsunschnee und ein Zeitungsblatt
Abstieg vom Lager I – Freudiges Willkommen im Standlager – Der Postläufer bringt die Nachricht vom Kriegsausbruch – Ich gehe nach Kailang – Ritt nach Sumdo – Ein ruhiger Abend
Der Tod tritt unter uns
Hilda verschollen – In einer Schlucht tot aufgefunden; Steinschlag
Rückmarsch und Gefangennahme
Ein höfliches Schreiben – Seelenmesse für Hilda – Die letzten Ausflüge – Lahul – Ein Aktenbündel
Von der ersten zur zweiten Reise
Dharamshala – Militärgefängnis Lahore – Internierungslager Ahmednagar – Ausflüge vom Lager Dehra Dun – Don besucht uns – Ein neuer Schuhbeschlag – Freilassung
EIN KRIEGSSCHLUSS-ABENTEUER
Bescheidenes Vorhaben
Man bewilligt mir einen Besuch des Garhwal-Himalayas – Erst jetzt fühle ich mich frei – Kungribingripaß oder Pindarigletscher das Ziel
Erster Vorstoß
Almora liegt wunderschön – Das heiße Tal dahinter – Ich spreche die Landessprache – Meine Kleidung erregt Aufsehen – Armee-Urlauber in Kapkot – Die Welt ist klein
Verhaftet
Die Polizei sieht in mir einen flüchtigen Kriegsgefangenen – Sympathien der Bevölkerung – In der Teestube
Ramayana
Der Polizeihauptmann singt uns ein indisches Heldenlied vor – Es ist zweitausenddreihundert Jahre alt – Der Sänger kann ein paar hundert Verse auswendig
Zurück nach Almora
Erst Almora kann Aufklärung bringen – In einem Verschlag eingesperrt – Rückmarsch in der Tageshitze – Begegnung mit englischen Bergsteigern – Mittagsrast – Noch eine Nacht im Verschlag – Aufklärung des Irrtums – Keine Repatriierung – Ein junger Brahmane besucht mich – Die östliche Perspektive
Zweiter Vorstoß
Wieder in meiner westlichen Haut – Entschluß, doch noch den Pindarigletscher zu besuchen – Barfuß und in Tennisschuhen – Überall als Freund begrüßt – Vier Reiseabschnitte in einem Tag – Eiertanz auf dem Pindarigletscher – Eilige Rückreise – Die Berge von Garhwal – Vogelstimmen
Von der zweiten zur dritten Reise
Ludwig wieder in Lahul – Fabian, ein neuer Gefährte – Italiener bestürmen den Mulkila – Heimkehr nach Österreich vorläufig nicht möglich – Winterpläne, Sommerpläne – Vorbereitungen für eine dritte Fahrt – Gurla Mandhata, Rakaposhi oder »unbekannte« Gruppe als Ziele – Die Kosten von Himalaya-Expeditionen – Ungewißheit der Zukunft stellt die Reise in Frage – Dennoch abgereist
DRITTE REISE
Wartetage in Srinagar
Ein Kleeblatt von »Vierzigern« – Hotelstadt Srinagar – Handel auf dem Wasser – Kaschmirs mildes Klima – Kein Büchsenfleisch erhältlich – Auf das Padargebiet abgedrängt
Neun Tage flußaufwärts
Mit Hindernissen nach Doda und Kischtwar – Der Weg wird halsbrecherisch – Karawanenleben – Heimatliche Pflanzen – Buttermilch und gebackene Holunderblüten – Ankunft in Matschehl – Erster Eindruck von den Padarbergen: überwältigend – Errichtung eines Standlagers
Kann ein Berg verschwinden?
Der große Berg verschwunden – Unser kosiges Lagerplätzchen – Wildes Gemüse – Schaffleisch – Brotsorgen – Karri-Reis und Gulasch – Hülsenfrüchte weniger empfehlenswert – Blumen und ein Kuckuck – Abendstimmung – Entschluß, einen Trabanten zu ersteigen – Die Ersteigung des »Dreikants« löst nur einen Teil der Rätsel
Zu zweit
Fabian muß zurückreisen – Neuschnee in Massen – Salzgewinnung – Es klart auf – Der Westgletscher führt nicht zum Mondsichelberg – Wir errichten ein Lager auf dem Nordgletscher – Vom frühen Aufbrechen
Entdeckers Freud – Bergfahrers Leid
Auch der Nordgletscher enttäuscht uns – Zwei Pässe neu entdeckt – Umbau unserer geographischen Vorstellungen – Die Sonnwendspitze – Umschau vom Gipfel
Was nun?
Sollen wir die Steilseite des Mondsichelberges angreifen? – Agyasol oder Abenteuer in Sanskaar? – Ergänzende Vermessungen und Erkundungen des Agyasols – Wir entscheiden uns für Sanskaar
Die Suche nach dem vergessenen Paß
In froher Erwartung – Ein Pickel bricht – Zu viele Pässe; welcher ist der Muni La? – Enttäuschung auf der Grathöhe – Tags darauf: neue falsche Pässe – Der große Gletscher – Geschlagen?
Poht La, erste Überquerung des Hauptkammes
Wir geben nicht auf – Das Darlang Nadi ist lang – Unsichtiges Wetter – Die rettende Begegnung – Nochmals den Weg verloren – Eine kalte Nacht – Der Paß – Abstieg ins Tibetische – Ein warmes, weiches Nachtlager
Sanskaar
Buddhistenkloster – Landstriche ohne Regen – Die Padumer halten uns für verrückt – Wir durchmessen weite Räume
Umasi La, zweite Überquerung des Hauptkammes
Eine niederschmetternde Entdeckung – Der kostbare Topf wieder gefunden – Zäher Anstieg, endloser Abstieg – Den sicheren Talgrund um Mitternacht erreicht – Ein langes Mahl von Milch und Tschappattis – Strohschuhe für Memsahib
Die letzten Tage
Auf dem kürzesten Wege zurück – Letzte Eindrücke – Unsere Träger – Mit Ach und Krach nach Bhadarwah – Ludwig verabschiedet sich in Lahore – Auf dem Kai in Bombay
Schriftenhinweis
Nachwort von Ulrike Schmitzer
Biografien
DAMALS SPANNEND, HEUTE AUCH NOCH VORWORT VON HELGA KROMP-KOLB
Die Zeit, in der mein Vater als Pionier des Alpinismus aktiv war – in den Alpen, im Elbrus, im Kaukasus und im Himalaya –, war vorbei, als meine Schwester und ich auf die Welt kamen. Die Eltern hatten angesichts der bedrohlicher werdenden politischen Situation in Österreich und Europa beschlossen, ihren Kinderwunsch hintanzustellen; sie empfanden es als unverantwortlich, Kinder in die Welt zu setzen, wenn ein Weltkrieg droht. Wir sind daher beide erst nach dem Krieg und der Internierung unseres Vaters zur Welt gekommen. An diese Entscheidung meiner Eltern denke ich oft, wenn junge Leute heute, besorgt wegen der Klimakrise, unsicher sind, ob sie dem Kinderwunsch nachgeben sollen oder nicht.
Während unserer Kindheit war mein Vater vor allem als Diplomat tätig – in Paris, Luxemburg und Pakistan. Aber das Bergsteigen blieb Teil seines und damit auch unseres Lebens. Er nutzte seinen Urlaub für Bergfahrten mit alten Freunden, im Sommer kletternd und wandernd, im Winter mit Skiern. Meine Mutter war gewöhnlich mit von der Partie; seit sie Mutter war, mied sie allerdings Riskanteres – die schwierigeren Touren ließ sie aus. Selbst im bergarmen Luxemburg fand mein Vater für seine Leidenschaft Betätigung: Mit dem dortigen Kletterverein versuchte er sich an Kletterübungen über zwar sehr kurze, aber trotzdem nicht immer leichte Routen. Ich erinnere mich, dass ihn einmal auch Fritz Moravec, der bekannte, deutlich jüngere österreichische Bergsteiger, der mit meinem Vater in Kontakt stand, anlässlich eines Besuches zu einer Kletterpartie begleitete und beeindruckt zurückkam.
Diese Kletterpartien waren nette Übungen, aber Bergsteigen war für meinen Vater immer mehr als eine Kraftoder Geschicklichkeitsübung. Es war Naturerlebnis und Abenteuer, und es ging auch um Gemeinschaft, Freundschaft und Verantwortung füreinander. Das wird in seinem kleinen Büchlein »Wir Wandern«, eine Anleitung für das Wandern mit Kindern, sehr deutlich. Der Weg und die Natur, was man am Weg sieht und erlebt, sind das Ziel; der Gipfel nur ein Extrabonus.
Während seiner Dienstzeit in Pakistan reizten unseren Vater die vergleichsweise nahe gelegenen, gewaltigen Berge des Himalayas aber nochmals sehr. Er besuchte als Botschafter Fürstentümer im Gebirge, und wir durften ihn in unseren Ferien u. a. in das Fürstentum Swat begleiten. Bei dem Flug der kleinen Verkehrsmaschine zwischen den Bergriesen des westlichen Himalayas in Gilgit im pakistanischen Teil von Kaschmir bewunderten meine Schwester und ich die Bergwelt vom Cockpit aus. Als meine Schwester staunend meinte »so nah war ich einem 8 000er noch nie!«, schwenkte der Pilot das Flugzeug noch näher an den Nanga Parbat heran. Ich erinnere mich auch, dass wir während der dienstlichen Gespräche der Erwachsenen mit einem jungen Prinzen »spielen« geschickt wurden und er uns das Schönste zeigte, das er kannte: mit Auto und Chauffeur des Vaters auf der Landebahn des kleinen Flughafens richtig schnell fahren! In dem gebirgigen Land konnte man das auf keiner der engen, kurvigen Straßen. Mein Vater reiste noch öfters nach Swat und erkundete zusammen mit meiner Mutter erfolgreich Möglichkeiten, ein Skigebiet an den Südabhängen des Himalayas zu errichten. Die Umsetzung mit Hilfe Österreichs erfolgte erst lange nachdem er Pakistan verlassen hatte.
Das Buch »Einzelgänger im Himalaya« schrieb er in der Luxemburger Zeit – wir gingen in die Volksschule. Ich erinnere mich deutlich daran, dass er aus unserem Matador-Baukasten ein Gerät bastelte, mit dem er kleine Karten und Skizzen in einen größeren Maßstab für das Buch übertrug – der Vorgang faszinierte mich. Ich vermute, dass auch auf diese Zeit die über Jahre hinweg gepflegten Arbeiten in der »Dunkelkammer« zurückgehen; dass damals die sorgfältig katalogisierten Abzüge der Aufnahmen von den Expeditionen gesichtet und die für das Buch ausgewählten im verdunkelten Badezimmer von den Negativen vergrößert wurden. Meine Mutter unterstützte das Schreiben – ihre Maschinschreibfertigkeit überstieg die seine bei Weitem. Auch an seinen späteren, politischen Büchern – »Amerikas Zukunft – Europas Schicksal« (1974), »Es kam ganz anders. Erinnerungen eines alt gewordenen Sozialisten« (1987) und »Die Retortengesellschaft« (2014 posthum veröffentlicht) hatte sie solcherart Anteil. Ich bezweifle nicht, dass sie daher auch inhaltlich und sprachlich mitwirkte. Heute ist es fast nicht mehr vorstellbar, wie mühsam Schreiben damals war, und dass ein Fehler am Ende der Seite bedeutete, dass die ganze Seite neu geschrieben werden musste!
Mein Vater war in allem, was er tat, sehr sorgfältig. Er plante seine größeren und pionierhaften Bergfahrten akribisch – studierte Karten, Beschreibungen anderer Bergsteiger die Gegend betreffend, Klima- und Wetterinformationen und überlegte Eventualitäten und wie auf diese zu reagieren wäre. Er führte auch Buch über neu gefundene Zustiege auf Gipfel oder Routen durch Eis- und Felswände. Er suchte sich seine Berggefährten sorgfältig aus bzw. schloss er sich einer Gruppe nur an, wenn ihm die Teilnehmer zusagten.
Die Bergfahrt in den Himalaya – für die damalige Zeit war allein die Anreise schon ein Großunternehmen – plante er gemeinsam mit seinem Wiener Bergfreund und Lehrerkollegen Ludwig Krenek. Das Gebiet im Himalaya suchten sie danach aus, wo während der österreichischen Schulferien mit gutem Wetter gerechnet werden konnte, unbeeinträchtigt vom regen- und schneebringenden Monsun, und wo die Anreise nicht zu lang war, denn die Schulferien plus einer kleinen vom Landesschulrat gewährten Zugabe an Zeit setzten eine enge zeitliche Grenze – so dachten sie bei der Planung. Das gewählte Gebiet im westlichen Himalaya reizte meinen Vater auch, weil die Landkarten hier weiße Flecken aufwiesen. Die Gruppe vervollständigten etwas finanzkräftigere englische Bergfreunde, ohne die sich Fritz und Ludwig ihr Vorhaben nicht hätten leisten können; die englischen Bergfreunde kannten Fritz als guten Bergführer, ohne den auch sie sich ihren Himalaya-Traum nicht hätten erfüllen können.
Das bergsteigerische Vorhaben war erfolgreich – aber noch vor dem geplanten Ende musste es abgebrochen werden, weil der Zweite Weltkrieg ausgebrochen war. Die englischen Freunde mussten nach Hause, solange das Mittelmeer noch sicher befahrbar war, die beiden Österreicher wurden verhaftet. Statt weniger Monate verbrachte Fritz letztlich neun Jahre in Indien – großteils in Internierungslagern für feindliche Ausländer. Aber ich habe meinen Vater nie darüber klagen hören, so schwierig die Bedingungen und die Trennung von seiner Frau auch waren: Es war ihm bewusst, dass es den in die Wehrmacht eingezogenen Freunden zu Hause noch viel schlechter ging.
Es gelangen ihm und Ludwig Krenek, während sie in Indien festsaßen, weitere Fahrten in den Himalaya, immer unter Zeitdruck, immer mit Unsicherheiten – aber es waren Eindrücke, die wie ein Schatz bewahrt wurden, und zehn Jahre später gestützt auf akribisch geführte Notizen zu Papier gebracht wurden, sodass die Leser von »Einzelgänger im Himalaya« daran teilhaben konnten.
Es ist eine traurige Folge des elektronischen Zeitalters, dass vieles verloren geht, das früher gedacht, geschrieben etc. wurde. Leider ist es auch in der Wissenschaft so – nicht digitalisierte Erkenntnisse unserer Vorgänger sind so gut wie nicht vorhanden, denn was nicht im Internet gefunden wird, wird nicht wahrgenommen. So muss das Rad immer wieder neu erfunden werden.
Es freut meine Schwester und mich umso mehr, dass das Buch nun, mehr als 65 Jahre nach seinem Erscheinen, neu aufgelegt wird. Ich bin zuversichtlich, dass es seine Leser und Leserinnen finden wird, denn mein Vater hat spannend und zugleich informativ geschrieben. In Hinblick auf die Notwendigkeit, künftig mit Ressourcen sparsamer umzugehen, erscheint es mir auch wichtig, sich zu vergegenwärtigen, dass Menschen auch ohne Funktionskleidung, Superfood, Mobilfunkverbindung und andere technologische Hilfsmittel in der Lage sind, große Leistungen zu erbringen.
Vielleicht regt die Neuauflage auch den einen oder die andere an, zu den anderen Büchern unseres Vaters zu greifen. Er hat 1974 schon beklemmend treffend die Entwicklung beschrieben, die zur heutigen geopolitischen Situation geführt hat und sich über radikale Rechte, Konservativismus und Populismus und ein autoritäres Amerika und der Auswirkungen auf Europa Gedanken gemacht. Als ich damals, das Manuskript mit ihm diskutierend, meinte, auf einen Hitler würde die Welt doch kein zweites Mal hereinfallen, antwortete er, dass der künftige Faschismus in Amerika anders heißen und aussehen würde, aber wie Hitler damals finanzkräftige Unterstützer mit Eigeninteressen finden würde und reichlich vorhandene, verzagte Menschen verleiten würde, zunächst unbemerkt, Werte wie Menschlichkeit und Freiheit aufzugeben. Wie wahr!
Wir sind Ulrike Schmitzer sehr dankbar, dass sie die Initiative zur Neuauflage der »Einzelgänger im Himalaya« ergriffen hat und im Nachwort auch den Lebenslauf unseres Vaters, vor allem als Bergsteiger, skizziert. Sie hat dabei Zeitungsmeldungen aufgetrieben, die auch wir noch nicht kannten. Der Edition Atelier sei für die Bereitschaft, die »Einzelgänger« neu aufzulegen, herzlich gedankt.
Wien, im Oktober 2024
TRÄUME WERDEN WIRKLICHKEIT
Weite Horizonte, Ketten von schlichtgeformten Bergen, satte und doch pastellweiche, seltsame Farben auf den kahlen Hängen, Gelb, Rot und Violett; irgendwo am lichten Rand des Himmels ein schneebedeckter Berg; kristallklare Luft, singendes Licht in unendlicher Stille, dann wieder steifer, feindseliger Wind; Gebetsfahnen, Tschorten; Häuser aus Stein und Lehm; kümmerliche Gerstenfelder, magere Grasflecken, wenige armselige Weidenbäume; Männer und Frauen mit braunen, verwitterten Gesichtern: Tibet.
Himmelstürmende Eisberge; lange Schneefahnen an sturmumtosten Gipfelzacken; gerillte Eiswände, höher und steiler als irgendwo, behangen mit Lawinenschnee; in zerbrechlichen Zelten winzige Menschlein, die solche Berge besteigen wollen; den einen treibt dies, den anderen jenes; Unglaubliches wird vollbracht im Klettern, Schneewaten, Lastenschleppen, im Ankämpfen gegen Sturm und Kälte, gegen Ermüdung und Benommenheit in dünner Luft; wir sehen Erfolg und Mißerfolg, sehen menschliche Kleinheit, aber auch menschliche Größe bis zum Opfertod um eines Kameraden willen, ohne Unterschied von Sprache, Rasse, Bildung oder Stand: Himalaya.
Breite, heilige Ströme in flachem Land, gütige Bewässerer der Felder; Banyanbäume mit baumelnden Luftwurzeln; Palmkronen an langen, verborgenen Stämmen; Affen, fliegende Hunde, Pfauen, Elefanten; erbarmungslose Sonne am wolkenlosen Himmel; oder wasserfallartiger Regen nach monatelanger Dürre; rote Farbe als heiliges Zeichen an Bäumen und Steinen; kleine, geschnitzte Götterbilder; Lotosblüten, Kokosöl, Reiskörner und Zitronen, den Göttern geopfert; Tempel und Moscheen; braune Menschen mit ansprechenden, verwandt anmutenden Gesichtszügen: Indien.
Wie viele Tausende von uns abendländischen Menschen träumen nicht von diesen fernen Welten! Wie viele junge Männer wären nicht bereit, Jahre der Entbehrung in Kauf zu nehmen, wenn sie sich zum Lohn an jenen Gipfeln der Erde messen oder die unbekannten Weiten Innerasiens durchforschen könnten!
Auf den Seiten dieses Buches werden die Himalaya-Abenteuer solcher Träumer erzählt, oder, anders gesagt, es werden Träume erzählt, die gegen alle Hoffnung zur Wirklichkeit wurden. Denn die großen Himalaya-Expeditionen der dreißiger Jahre arbeiteten mit Geldsummen, die nur Regierungen, Vereine oder Betriebe aufbringen konnten. Um bei solchen Reisen mittun zu können, genügte es nicht, wenn man als Bergsteiger in Betracht kam; man mußte, wenigstens in Deutschland und Österreich, auch sonst in den jeweiligen Rahmen dieser Unternehmungen passen, und, was bei der großen Zahl geeigneter Bewerber vielleicht unvermeidlich war, Beziehungen haben. Manche tatkräftige Männer, die aus irgendeinem Grunde nicht unter die Auserwählten kamen, brachten es allerdings zuwege, durch Verträge mit Zeitungen und Filmunternehmen das nötige Geld aufzubringen. Andere erwählten das Bergsteigen und Reisen zu ihrem Beruf und verfügten so über genügend Zeit, um nicht nur die schönsten und abenteuerlichsten Reisen zu machen, sondern auch gute Bücher darüber zu schreiben. Aber wer fürs Werben und Geldaufbringen keine Gabe oder keine Lust hatte, wer sich nicht dazu entschließen konnte, dem Abenteuer zuliebe seinen Beruf aufzugeben – der mußte verzichten. Auch ich hatte bewußt verzichtet – nur das Träumen konnte ich nicht ganz lassen; wenn ich schon absichtlich keine Fahrtenberichte mehr las, ein Kartenblatt großen Maßstabes, das Berge wie Nanga Parbat, Tiritsch Mir und überdies »weiße Flecken« von unerforschtem Land enthielt, ein solches Kartenblatt versetzte mich nach wie vor in Aufregung.
Einer, der mir von Zeit zu Zeit ein solches Kartenblatt zeigte, war mein Freund Ludwig Krenek. Es ist am besten, wenn ich ihn gleich vorstelle, denn er wird uns vom Anfang bis zum Ende dieses Berichtes begleiten. Etwas kurz ausgefallen war er, der Gute; aber mit sprunggewaltigen, unermüdlichen Beinen begabt. Sein athletischer Körper, seine braungebrannte Haut schienen immer nach Sonnenstrahlen zu dürsten, die ihm übrigens nie etwas anhaben konnten – trotz leichter Neigung zu einer Scheitelglatze. Sein Gesicht war energisch, aber auch gutmütig; mit einem angemessenen Schuß Ehrgeiz darin. Er war ein großer Verehrer von Käse, Früchten und Schokolade, wogegen er das Fleisch, kulinarisch gesprochen, verachtete. Kein Stern am Himmel war ihm unbekannt, vom Kleinen Wagen bis zum Kreuz des Südens, von Sternhaufen, Doppelsternen und Spiralnebeln ganz zu schweigen. Ausschnitt, Vordergrund, Hintergrund, Blende, Belichtungszeit und was sonst noch zur höheren Lichtbildkunst gehört, kam ihm gewissermaßen im Halbschlaf mit unfehlbarer Sicherheit. Philosophisch gesprochen war er ein morgenländischer Mensch, denn er besaß die beneidenswerte Fähigkeit, über Sternen, Landkartenstudium und Blockflötenübungen alles, selbst Abendeinladungen, zu vergessen.
Um aber ernsthaft zu sein: Jeder Schulleiter, der Ludwig unter seinen Lehrern hatte, konnte sich glücklich schätzen. Seine Schüler gingen für ihn durchs Feuer und schwärmten noch zwanzig Jahre später von ihm, wenn ich hie und da einen von ihnen traf. Nach größeren Reisen veröffentlichte er geographische Arbeiten; seine reichen Erfahrungen in Indien hat er durch ein dokumentarisches Buch weiten Kreisen zugänglich gemacht.
Wir kannten uns seit langem, hatten auch gelegentlich miteinander schneidige Bergfahrten unternommen, aber eine engere Freundschaft ergab sich erst aus der beruflichen Zusammenarbeit. Ludwig war nämlich ebenso wie ich in den dreißiger Jahren Fachlehrer an Wiener Vorstadtschulen, und wir unterrichteten oftmals in den gleichen Klassen. Wenn der Sommer ins Land kam, zogen wir gemeinsam mit unseren Schülern in die Berge.
Zu Weihnachten, zu Ostern und in den Sommerferien übernahmen wir mitsammen die Führung von Gruppen englischer Studenten in den Ost- und Westalpen. In Wien gab es seit dem Ende des Ersten Weltkrieges die Akademisch-soziale Arbeitsgemeinschaft, die in aller Stille und ohne internationale Konferenzen an der Völkerverständigung arbeitete. Tausende von englischen Studenten, Lehrern, Ärzten waren im Lauf der Jahre durch die Vermittlung dieser Stelle mit österreichischen Studenten und Akademikern bekannt geworden.
Freundschaftsbande waren geknüpft worden, die englischen Gruppen gingen unter ehrenamtlichen österreichischen Führern in alle Berggebiete Österreichs, später auch in alle Länder Europas und des Nahen Ostens. Von dort hatte Ludwig die verführerischen Landkarten.
Wir hatten verschiedentlich mit dem Gedanken gespielt, im Rahmen dieser Gruppenführungen eine Reise nach Afghanistan zu veranstalten. Das schien nicht unmöglich, denn andere Führer waren bereits bis tief nach Persien vorgestoßen. Aber das waren Autobusreisen gewesen, wo es bei den vielen Teilnehmern keine Rolle spielte, wenn jeder ein wenig mehr zahlte, um dem Führer seine Auslagen zu ersetzen. Unbezahlbar schien jedoch für unseren Gästekreis aus dem englischen Mittelstand eine bergsteigerische Unternehmung in diesen fernen Ländern, denn hierbei konnte man nicht mehr als zwei Gäste auf einen berggewandten österreichischen Führer mitnehmen, abgesehen von den sonstigen Mehrkosten gegenüber einer Autobusreise.
So hatten wir diese Pläne beiseite gelegt, bis ich eines Morgens in der Pause zwischen zwei Unterrichtsstunden Ludwig einen neuen Vorschlag zu überdenken gab. Wir sollten vier junge Engländer suchen, die bereit waren, mit uns im Himalaya so einfach und sparsam zu leben, wie wir es bei unseren eigenen Fahrten zu tun gewohnt waren, besonders in den Westalpen. Kein Hotel, nicht einmal ein Rasthaus, sondern das Zelt; drei Sherpas, statt wie üblich mindestens zwölf; zwanzig bis dreißig Dörfler als Träger bis zum Standlager, statt deren zweihundert; keine Sauerstoffapparate, Zelte und Schlafsäcke von der Arbeitsgemeinschaft, statt Himalaya-Sonderausrüstung; Gesamtdauer nur zweieinhalb bis drei Monate, trotzdem bei unseren Mitteln nur die langsame Schiffsreise und nicht etwa ein Flug in Frage kam; als Reisezeit die Schulferien, da keiner von uns auf einen Sonderurlaub hoffen konnte; die billigste Hin- und Rückfahrkarte nach Bombay, die wir auf irgendeinem italienischen Schiff erhalten konnten; und ein oder zwei Jahre angestrengtesten Sparens, damit auch wir zwei schlechtbezahlten Mitteleuropäer einen möglichst großen Teil der Kosten selbst aufbringen konnten.
Natürlich durften wir mit so wenig Zeit und knappen Mitteln keine »Achttausender« als Ziele wählen, sondern mußten uns mit Bergen zwischen sechstausend und siebentausend Metern begnügen, die noch dazu von Bombay aus rasch erreichbar sein mußten. Die Hin- und Rückreise zur See nahm ja allein schon einen Monat in Anspruch.
Das war im Winter 1937 gewesen, und Ludwig hatte zunächst nur pessimistisch den Kopf geschüttelt. »Du möchtest also im Monsun auf den Himalayabergen herumsteigen? Die Schulferien fallen in die Zeit der Monsunregen.« Viel mehr sagte er damals nicht, aber ich war darüber nicht beunruhigt, denn ich kannte Ludwig. Der Gedanke würde ihn so schnell nicht mehr loslassen. »Im Anfang war das Wort« – der Anfang war also gemacht. Wir zogen uns beide in unsere Schulstuben zurück. Ludwig setzte zustimmende Häkchen unter Schlußrechnungen, Gleichungen und Proportionen oder zerschmetterte bei Bedarf mit zornroten Strichen von links unten nach rechts oben eitle Hoffnungen. Ich erklärte mit gewerbsmäßiger Geduld und ohne Aussicht auf Erfolg, wann man ein rundes, wann ein langes und wann ein scharfes S schreibt, daß man zwar »zugrunde« gehen kann, aber nicht »zuhause« bleiben darf, weil es »zu Hause« heißen muß.
Viermal wöchentlich gab es für jeden von uns Lichtblicke, das heißt Geographiestunden, da wir beide auch dieses Fach unterrichteten. Einige Tage nach der Unterredung hielten wir nach Unterrichtsschluß sogar eine Geographiestunde für uns selber ab. Ludwig hatte nämlich einen Stoß Landkarten in die Schule gebracht, auf denen er mir mit ziemlich selbstverständlicher Miene das Berggebiet im Himalaya zeigte, das in Betracht kam. Es war ein bisher nur wenig erforschter Gebirgsbereich nördlich von Simla, in einem Eingeborenenstaat namens Lahul gelegen, gegen den Monsun durch eine vorgelagerte Fünftausenderkette abgeschirmt, mit einer höchsten Erhebung von 6 500 Metern. Dieser Berg lag ziemlich in der Mitte des Gebietes, war trigonometrisch vermessen, hatte auf der Karte keinen Namen, und seine Besteigung war noch nie versucht worden. Der Anmarsch mochte von Bombay aus acht Tage in Anspruch nehmen, die Schulferien konnten für eine solche Reise ausreichen. Wir schritten zur Tat. Es war nicht einfach, vier englische Kameraden aufzutreiben, die sich die teure Reise leisten konnten. Wir schrieben an viele, ehe wir Erfolg hatten. »Wenn ich von Brot und Käse lebe und dies zwei Jahre lang durchhalte, werde ich das Geld vielleicht aufbringen«, schrieb Johnny, den wir von Schifahrten in Tirol her kannten. Sein richtiger Name war Robey Johnson, und er war Mittelschullehrer in London. Frank S. Hollick, Assistent an der Universität Cambridge, ein Freund Ludwigs, meldete sich als zweiter; die Lehrerin Hilda Richmond aus Leeds war dritte. Wir gewannen sie für die Idee anläßlich einer Besteigung der Meije in den Französischen Alpen. Ein vierter, der viel alpine Erfahrung hatte, fiel im letzten Augenblick aus, und statt ihm trat der damals zwanzigjährige Student Donald Comber aus Windsor ein, dem Papa das Geld vorschoß.
Ehe ich von unserer englisch-österreichischen Fahrt zu erzählen beginne, möchte ich kurz erklären, wie es zu den zwei weiteren Himalayareisen kam, von denen später die Rede sein wird. Obgleich wir schon 1937 zu sparen begannen, hatten wir erst im Sommer 1939 die nötigen Mittel beisammen, und unsere Hauptgruppe reiste erst im August jenes Jahres von Venedig ab. So war es unvermeidlich, daß der Krieg schon wenige Wochen später dem friedlichen Forschen und Bergsteigen in Asien ein vorzeitiges Ende bereitete. Ludwig und ich wurden verhaftet und verbrachten viereinhalb Jahre in verschiedenen Lagern Indiens, größtenteils hinter Stacheldraht. Anfang 1944 kamen Bestimmungen heraus, auf Grund derer wir entlassen werden konnten, falls wir Arbeit fanden. Das Schicksal warf uns siebzehnhundert Kilometer auseinander, Ludwig nach Udaipur im Norden, mich in die Nähe Maduras im äußersten Süden. Wir arbeiteten beide als Lehrer. Schon 1945 fuhren wir wieder in den Himalaya, getrennt, da unsere Schulferien nicht zusammenfielen.
Ein Jahr später war es noch immer unmöglich, in die Heimat zurückzukehren, wie denn überhaupt für uns Wiener aus der für drei Monate geplanten Reise ein neun-, ja dreizehnjähriger Aufenthalt in Indien wurde. So vereinigten wir uns 1946 nochmals zu einer gemeinsamen Fahrt, verstärkt durch Fabian Geduldig, einen Wiener Angestellten, den wir im Lager kennengelernt hatten und der schon vor uns entlassen worden war. Diese Reise übertraf die erste noch bei weitem an spartanischer Einfachheit, unseren noch geringeren Mitteln entsprechend. Doch davon später, und nun zurück zu jenen Sommerwochen 1939, die für sechs junge Menschen in England und in Österreich erfüllt waren von der freudigen Erwartung des großen Abenteuers.
BEI KRIEGSAUSBRUCH IM HIMALAYA
DER VORTRUPP
Ludwig hatte die Gesamtleitung übernommen, ich sollte mit Frank Hollick – den ich noch nicht kannte – um gute zwei Wochen vor den anderen abreisen, um alle Wege zu ebnen. Es war notwendig, dem Haupttrupp jeden Zeitverlust zu ersparen, denn selbst für jene unter uns, die sich drei Monate Urlaub erwirkt hatten, bedeutete das nur knappe vier Wochen in den Bergen – so langsam fahren Bahn und Schiffe, wenn der Weg so weit ist! Am Vormittag des 12. Juli traf ich mich mit Ludwig zu einer letzten Besprechung, am Abend, um 22 Uhr, ging mein Zug. Langsam begann er vom Wiener Südbahnhof abzurollen, Richtung Marseille. Ich stand am Gangfenster und winkte meiner Frau. Die Wagen liefen knirschend in eine Kurve, das letzte Zipfelchen von Marthas Taschentuch entschwand. Wir fuhren schneller und schneller, gleichgültige Vorstadthäuser flogen vorbei, meine Reisegenossen von der dritten Wagenklasse richteten sich für die Nachtfahrt ein. Ich blieb am Fenster, um mit niemand plaudern zu müssen. Wird nicht der Krieg ausbrechen, während ich in Asien bin? Am 1. November 1939 wollte ich wieder zu Hause sein. Martha wird die nächsten drei Monate bei Freunden in England verbringen. Wie gern wäre sie mitgekommen! Sie war auf zahlreichen wagemutigen Fahrten meine Gefährtin gewesen. Aber wir hatten nicht die Mittel, um beide nach Indien zu fahren.
An Geld hatte ich 150 französische Franken und sechs Reichsmark mit mir. Die sechs Reichsmark mußte ich in Arnoldstein, beim Verlassen des Großdeutschen Reiches, hinterlegen. Man belehrte mich, daß ein Reisender, auch wenn er in den Himalaya fährt, nur entweder Devisen im Wert von zehn Mark – das entsprach meinen 150 Franken – oder deutsches Geld bis zu zehn Mark haben darf, aber nicht beides. Nun ja, die Arbeitsgemeinschaft hatte die Schiffskarte auf dem Verrechnungswege besorgt. Was wir Österreicher in Indien an Geld brauchten, zahlten wir unseren englischen Kameraden in Ausrüstungsstücken zurück. So ging es auch mit nur zehn Mark Reisegeld in der Tasche.
Bei der Ankunft in Marseille mußte ich mein Reisegepäck aus dem Zollamt holen. Da aber französischer Nationalfeiertag war – 14. Juli -, gingen 149 Franken und 70 Centimes für Taxifahrten und Trinkgelder auf, ehe ich einen Zollbeamten gefunden hatte, der bereit war, die Amtshandlung zu vollziehen. Mit den mir verbliebenen 30 Centimes konnte ich die Straßenbahn nur bis in Sichtweite des Hafens benützen. Den Rest des Weges mußte ich zu Fuß gehen und die schweren Koffer schleppen. Mit vielen Rasten erreichte ich schließlich den »Strathnaver«, das stattliche Schiff, auf dem ich meinen englischen Kameraden kennenlernen sollte.
Frank war Biologe und arbeitete als Assistent an der Universität Cambridge. Er war damals vielleicht siebenundzwanzig Jahre alt, ich sollte mit siebenunddreißig unser Ältester werden. Ludwig hatte mit Frank lange Fahrten in den Ötztaler Alpen gemacht und ihn auf Grund dieser Bekanntschaft zur Teilnahme an unserer Himalayareise eingeladen. Frank war viel mehr Gelehrter als Bergsteiger. So begann unsere Bekanntschaft wie von selbst mit einem wissenschaftlichen Gespräch. Was war doch die moderne Wissenschaft für ein wunderbares, übernationales Werk! Eine kurze Stunde der Unterhaltung genügte, um Übereinstimmung über die wesentlichsten Punkte wissenschaftlicher Erkenntnis festzustellen. Wir plauderten über die damals gerade am meisten umstrittenen »Ismen«: Empirismus, Apriorismus, Positivismus, über die Forderung nach Falsifizierbarkeit, über Quantenphysik und Kausalität. Man mußte nicht der gleichen Meinung sein über diese Themen, aber man verständigte sich darüber, unter welchen Voraussetzungen eine wissenschaftliche Aussage Gültigkeit haben kann. Nur darauf kam es an, und auf rücksichtslose Wahrheitsliebe. Frank war als frischgebackener Assistent mitten im Getriebe jener wissenschaftlichen Umwälzung, die damals ohne Rücksicht auf Staatengrenzen überall das Atomzeitalter einleitete; – und ich war in die strenge Schule eines seither als Philosoph zu hohem Ansehen gelangten Wiener Freundes gegangen, hatte mitgedacht und mitgelitten, als er sein erkenntniskritisches Erstlingswerk verfaßte. Frank und ich würden uns gut verstehen. Obwohl ich gewiß nichts von den Wassertieren verstand, die er im Himalaya für das Britische Museum fangen wollte, so war ich doch imstande, ihm bei der Erörterung gewisser Schlußfolgerungen über den Insektenflug ein vernünftiger Gesprächspartner zu sein. Er schrieb nämlich auf dem Schiff tagaus, tagein an einer Arbeit über dieses Thema, während zwei starke Schrauben unser weißes Schiff rastlos durch das blaue Mittelmeer nach Südosten schoben. –
Mit Port Said beginnt eine bunte Welt, die jeden mächtig gefangen nimmt, dem sie neu ist. Die Durchfahrt durch den Suezkanal und durch das Rote Meer ist ein fesselndes Erlebnis. In den Häfen gibt es neben Arabern, Türken und Negern bereits auch Inder, nach denen wir natürlich besonders ausschauten. Dabei entdeckten wir den ansprechendsten Sendboten dieses großen Landes auf dem Schiffe selbst, nämlich eine junge Inderin aus Bombay, die mit ihrer Mutter von einem Studienaufenthalt in England zurückkehrte. Sie war klein und zart. Ihr anmutiges Gesichtchen war von glattem, rabenschwarzem Haar umrahmt. Zwischen den Augenbrauen hatte sie ein erbsengroßes rotes Pünktchen aufgemalt. Der zierliche Oberkörper steckte in einer weißen Bluse mit etwas aufgebauschten Schultern. Die linke Schulter trug den Sari, dieses malerische Kleidungsstück der indischen Frauen, das aus einer einzigen langen Stoffbahn besteht und in kunstvollem Faltenwurf den ganzen Körper bedeckt.
Unsere kleine Inderin wechselte ihre Saris häufig: sie trug weiße mit eingewebten Brokaträndern, leuchtendgrüne mit Sternenmustern und andere. Frank und ich hatten uns mit ihr angefreundet und betrieben unter ihrer Mithilfe jeden Tag ein wenig Hindustani.
»Was heißt morgen?«, fragte ich Miß Sita Ananakanda.
»Auch kal«, war die unerwartete Antwort. –
Mit der Ausfahrt aus Aden verließen wir das Rote Meer und fuhren in den Indischen Ozean ein. Nun tanzte unser großes Schiff unruhig über gewaltige Wogen hin. Der Monsun blies in voller Stärke, seine feuchten Luftmassen rollten Tag und Nacht auf Indien zu, das schon sehnsüchtig auf die Regenwinde gewartet hatte. Im Norden, in den hohen Bergen, schneite es jetzt. Wird die erste Himalayakette wirklich alles Wasser aus den Wolken nehmen? Werden wir in den höheren Bergen von Lahul, die weiter hinten stehen, erträgliches Wetter haben?
Vielen Passagieren ging es jetzt schlecht. Sie konnten nichts essen, ihre Plätze an den langen, sauberen Tafeln des Speisesaales blieben leer. Bleich und elend lagen sie in Liegestühlen auf dem Oberdeck. Der Kapitän hatte mitleidsvoll eine Glaswand auf die Windseite stellen lassen, so daß die Kranken in der frischen Luft liegen konnten, ohne dem Sturm und dem Sprühwasser ausgesetzt zu sein. Außerdem befahl er der Schiffskapelle, sich vor die Leute mit den gelben Gesichtern hinzusetzen und ihnen mit lustigen Weisen die Zeit zu vertreiben. Aber Genesung brachte erst der Hafen von Bombay.
ZURECHTFINDEN IM FREMDEN LAND
Uns brachte Bombay eine unangenehme Überraschung. Unser Zollfreibrief vom India Office in London wurde zurückgewiesen, da man noch keine »Weisung« aus Delhi hatte. Was wir auch versuchten, wir mußten zahlen und uns mit dem Versprechen auf spätere Rückerstattung zufriedengeben. Wenn das auch unserem Haupttrupp zustieß, wie würde da unser Geldbeutel aussehen? Also mußte Frank zum damaligen Sommersitz der Regierung nach Simla. Irgendwo in den unendlichen indischen Ebenen, durch die der Schnellzug einen Tag und zwei Nächte lang raste, trennten sich unsere Wege: Frank fuhr nach Simla, ich nach Amritsar und Dharmshala.
Wir hatten bis in die letzten Tage vor meiner Abreise nicht gewußt, ob die Fahrt zustande kommen würde oder nicht. Daher hatten wir erst spät mit den Vorbereitungen begonnen und sie etwas halbherzig betrieben. So war es gekommen, daß wir keine Antworten mehr erhielten auf Briefe, in denen wir uns darum erkundigt hatten, wo wir die Lebensmittel für die Expedition einkaufen sollten. In Bombay wäre das am einfachsten gewesen, aber dann hätten wir auf der Bahn viel Frachtgebühr zahlen müssen, und das spielte bei unseren knappen Mitteln eine Rolle. Daher wollten wir so nahe am Gebirge einkaufen wie nur möglich. Die letzte große Stadt auf dem Weg nach Norden war Amritsar. Dort wollte ich mich gründlich umsehen, denn ob man in den kleineren Orten im Gebirge, in Kangra, Dharmshala und Kulu, alles Nötige erhalten konnte, war zweifelhaft. Der Zug erreichte Amritsar um sechs Uhr früh. Ich war schrecklich müde und unausgeschlafen, da ich in einem von indischen Reisenden überfüllten Abteil gesessen war. Außerdem hatte ich die ganze Nacht mit einem Mohammedaner, einem Professor der Volkswirtschaftslehre aus Delhi, über indische Probleme gesprochen. Zum Einkaufen war es noch zu früh, so wollte ich nur ein paar europäische Geschäfte und die Imperial Bank of India ausfindig machen und dann auf einer Parkbank etwas von dem versäumten Schlaf einbringen.
Ich durchschritt das Stadttor. In den niedrigen Häusern drängte sich Laden an Laden. Ich studierte die Aufschriften, so gut es meine Schlaftrunkenheit zuließ. Sie waren in Urdu- oder in Devanagari-Schriftzeichen geschrieben, wozu meistens die englische Übersetzung in Lateinschrift kam. Was mir die Tafeln nicht sagten, versuchte ich aus den Waren zu ersehen, die in den Fenstern und vor den Türen lagen. Das Leben begann nämlich eben seinen Lauf zu nehmen, ein Geschäft nach dem andern wurde aufgetan. Da gab es Mehl und Getreidekörner, Erbsen und Linsen, Zucker und Salz. Auch Singer-Nähmaschinen und Fahrräder hätte ich kaufen können, nur den europäischen Lebensmittelladen, den ich suchte, fand ich nicht. Nirgends gab es Trockenmilch und Marmeladen, Corned beef und Schinken, Kekse, Schokoladen, Dörrobst, Knäckebrot, Suppenwürfel und was wir damals sonst noch für unentbehrlich hielten.
Die Straße lief in einen kleinen Park vor dem Stadttor am andern Ende aus. Nun versuchte ich mein Glück in den Seitengassen, und zwar dort, wo die meisten Leute gingen. Langsam schob ich mich vorwärts, ohne aber einen Laden zu finden. Der Strom trieb mich zu einem freien Platz: Ein Teich dehnte sich vor mir, und ein wunderhübscher Bau spiegelte sich darin – der Goldene Tempel, das große Heiligtum der Sikhs.
Ich stand eine Weile am Ufer des Teiches, dann begab ich mich wieder auf die Suche nach dem europäischen Geschäft. Basar, Basar. Finstere Winkel, Menschen, immer mehr Menschen. Geplauder, Feilschen, die Wasserpfeife. Hundert unbekannte Waren sahen meine Augen. Nie gesehene Früchte, Holz-, Leder- und Webwaren, Metallschüsseln mit kunstvollen Gravierungen. Schließlich stand ich wieder irgendwo außerhalb der Stadt. Schlecht gepflegte Parks, Kutschen, Lastwagen.
Entmutigt und ärgerlich warf ich mich auf eine Parkbank. Zierliche Baumratten mit buschigen Schwänzen kamen herbeigehopst und beguckten mich. Meine Augen brannten vom langen Wachen. Die Füße schmerzten, der Magen knurrte.
Gegen 10 Uhr rief ich einem Lohnkutscher zu: Hadscham ko tschalao! Fahr mich zum Barbier!
Ob er dies verstand oder die Geste, mit der ich über meine Bartstoppeln hinstrich, ist schließlich gleichgültig. Das Gefährt rumpelte an der Stadtmauer entlang und bog dann in jene Straße ein, durch die ich die Stadt zuerst betreten hatte. Gleich am Tor war der Barbier. Mit den Bartstoppeln fiel ein Teil meiner Verzweiflung ab. Der Barbier erklärte mir in mühsam geführter Unterhaltung, wo die Bank war, und daß es europäische Geschäfte überhaupt nicht gab.
Ich ging also zunächst zur Bank, wo im großen Schaltersaal emsiges Leben pulste. Die Luft summte von vielen halblauten Gesprächen. Hinter den Schalterfenstern sah ich nur indische Gesichter, was mich mit meinen falschen Vorstellungen vom »englischen« Indien noch immer wundernahm. Ein Sikh zahlte mir dreihundert klingende Silberstücke auf die Marmorplatte. Klingend mußten sie





























