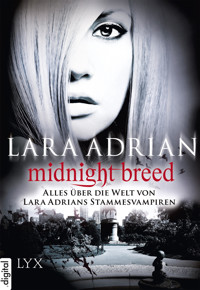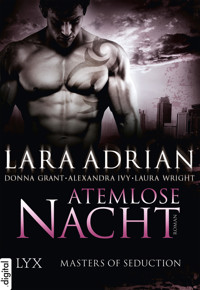3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Midnight-Breed-Novellas
- Sprache: Deutsch
Eine neue Novella aus der Welt von Midnight Breed
Scythe ist ein Jäger — allein dazu geboren, dem einstigen Erzfeind der Vampire als Tötungsmaschine zu dienen. Nun ist er ein gefährlicher Einzelgänger, dessen Herz durch Gewalt und Schmerz verhärtet ist. Einmal hatte er geliebt und einen hohen Preis dafür gezahlt. Doch als der Orden der Vampire ihn als Bodyguard für die schöne Witwe Chiara engagiert, stellt der eiskalte Krieger fest, dass die Stammesgefährtin die Mauern, die er um sein Herz errichtet hat, zum Einsturz zu bringen droht ...
"Wow! Wer hätte gedacht, dass eine so kurze Geschichte so heiß und emotional mitreißend sein kann. Aber es ist schließlich Lara Adrian!" Read Love Blog
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 198
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Inhalt
TitelZu diesem Buch1234567891011121314EpilogDie AutorinDie Romane von Lara Adrian bei LYXImpressumLARA ADRIAN
Entfesselte Dunkelheit
Roman
Ins Deutsche übertragen von Firouzeh Akhavan-Zandjani
Zu diesem Buch
Scythe ist ein Jäger – allein dazu geboren, dem einstigen Erzfeind der Vampire als Tötungsmaschine zu dienen. Nun ist er ein gefährlicher Einzelgänger, dessen Herz durch Gewalt und Schmerz verhärtet ist. Ein Mal hatte er geliebt und einen hohen Preis dafür gezahlt. Doch als der Orden der Vampire ihn als Bodyguard für die schöne Witwe Chiara engagiert, stellt der eiskalte Krieger fest, dass die Stammesgefährtin die Mauern um sein Herz zum Einsturz zu bringen droht …
1
Scythe hielt sich nun schon seit fast einer Stunde in dem Nachtclub auf und hatte sich doch noch nicht entscheiden können, wer aus der Schar berauschter, sich der Musik hingebender Menschen heute Abend seinen Durst stillen sollte. Die lauten Bässe dröhnten rhythmisch und verstärkten die Kopfschmerzen, die seit Tagen in seinen Schläfen pochten.
Auch der Magen tat ihm weh – ein stechender Schmerz, der ihn daran erinnerte, dass er seit fast einer Woche nichts zu sich genommen hatte. Das war zu lang für die meisten seiner Art. Bei einem Stammesvampir wie ihm, der durch sein Gen-Eins-Blut ganz oben in der Nahrungskette stand, war eine Woche ohne Nahrung nicht nur für sein eigenes Wohlergehen gefährlich, sondern auch für alle, die sich in seiner Nähe aufhielten.
Aus dem hinteren, dunklen Bereich der Bar heraus beobachtete er die wogende Menge von jungen Männern und Frauen, die in der immer wieder aufblitzenden Beleuchtung auf der Tanzfläche zuckten, während der DJ nahtlos von einem kitschigen Megahit zum nächsten überging.
Die Touristenabsteige in Bari, einem Ferienort am Meer, der an der Spitze von Italiens Stiefelabsatz lag, gehörte normalerweise nicht zu seinem Jagdrevier. Er zog größere Städte vor, wo man Blutwirte kaufen konnte, damit sie einem zu Diensten waren, und hinterher auch gleich wieder los war. Doch sein Verlangen nach Blut war zu stark, um erst noch die lange Fahrt nach Neapel auf sich zu nehmen. Davon abgesehen würde ihn die Reise an der Weinregion Potenza vorbeiführen. Dieses Gebiet mied er seit einigen Wochen. Die Gründe dafür wollte er sich nicht einmal jetzt vor Augen führen.
Allmächtiger! Vor allem jetzt nicht, wo der Blutdurst seine Innereien zusammenzog und seine Fangzähne vor Verlangen pochten, sich in warmes, zartes Fleisch zu bohren.
Unwillkürlich stieß er ein leises Knurren aus, als er den Blick wieder über die Menge schweifen ließ und er gegen seinen Willen an einer zierlichen Brünetten hängen blieb, die sich am Rand der vollen Tanzfläche zur Musik wiegte. Sie stand mit dem Rücken zu ihm. Das seidige dunkelbraune Haar floss über ihre Schultern, der schlanke Körper steckte in einer hautengen Jeans, und das hochgerutschte Top enthüllte einen schmalen Streifen heller Haut an ihrer Taille. Sie lachte über etwas, was ihre Freundinnen gesagt hatten, und der schrille Laut kreischte förmlich in Scythes überempfindlichen Ohren.
Sofort erlosch sein Interesse, und er wandte den Blick ab. Doch der kurze Moment hatte ihm eine andere, viel zu zierliche Frau in Erinnerung gerufen, die er schon eine ganze Weile versuchte auf Teufel komm raus zu vergessen.
Er wusste, dass er Chiara Genova nie an einem solchem Ort antreffen würde. Doch in einem verkorksten Winkel seines Herzens gab er sich dieser Vorstellung hin, sodass ihn Fantasien verlockten, denen sich hinzugeben er nicht das Recht hatte. Die süße, liebe Chiara nackt in seinen Armen. Ihre leidenschaftlichen Lippen voller Inbrunst an seinem Mund. Ihre zarte Kehle seinem Biss entblößt …
»Verfluchter Mist.«
Voll schroffer Wut brach der Fluch aus ihm heraus. Er erregte damit die Aufmerksamkeit einer großen Blondine, die ihren knochigen Hintern vor einer Viertelstunde auf den neben ihm stehenden Barhocker gehievt und erfolglos versucht hatte, seine Beachtung zu erheischen.
Jetzt rückte sie näher und roch nach zu viel Wein und Parfüm, während sie sich mit der Zunge über die Lippen fuhr und ihn freundlich anlächelte. »Du wirkst nicht gerade so, als hättest du heute Abend Spaß.«
Er gab ein nichtssagendes Brummen von sich, sah sie an und machte sich sofort ein Bild von ihr.
Ein Mensch … wahrscheinlich näher an der vierzig, als der kurze Lederrock und das freizügige Spitzenbustier, das sie trug, vermuten ließen. Außerdem war sie eindeutig nicht von hier. Sie hatte einen deutlich erkennbaren amerikanischen Akzent, und er nahm an, dass sie wohl aus dem Mittleren Westen kam.
»Soll ich dir was gestehen?« Sie wartete seine Antwort nicht ab, und er hatte auch gar nicht vorgehabt, auf ihre Frage zu reagieren. »Ich hab heute Abend auch nicht gerade viel Spaß.« Sie seufzte laut und fuhr mit einem rot lackierten Fingernagel am Rand ihres leeren Glases entlang. »Hast du Durst, Großer? Wie wär’s, wenn ich dir einen Drink spendiere …«
»Ich trinke nicht.«
Ihr Lächeln wurde breiter, und ohne sich von seiner Antwort abschrecken zu lassen, zuckte sie mit den Achseln. »Okay, dann lass uns tanzen.«
Sie rutschte vom Barhocker herunter und wollte nach seiner Hand fassen.
Als sie ins Leere griff – und ihre Finger den Stumpf berührten, wo vor langer Zeit mal eine Hand gewesen war –, zuckte sie zusammen.
»Oh Gott. Ich … äh … shit.« Dann wurde ihr trunkener Blick vor Mitleid ganz weich. »Du Armer! Was ist denn mit dir passiert? Bist du ein Kriegsveteran oder so was Ähnliches?«
»So was Ähnliches.« Vor Wut hatte seine Stimme einen drohenden Unterton bekommen, aber sie war zu betrunken, um es zu bemerken.
Sie trat ganz dicht an ihn heran, sodass er ihre Witterung aufnehmen konnte und seine Nasenflügel sich zusammenzogen, als er den leicht metallischen Geruch menschlicher roter Blutkörperchen wahrnahm, die durch ihre Adern strömten. Die Leere in seinem Magen nahm jetzt sein ganzes Denken gefangen, und das knurrende Pochen wurde vom wachsenden Blutdurst noch verstärkt. Er fühlte sich plötzlich ganz langsam und schwer. Phantomschmerz breitete sich in dem Stumpf am Ende seines Handgelenks aus. Sein normalerweise so scharfer Blick nahm alles nur noch verschwommen wahr und ließ sich nicht mehr fokussieren.
Merkwürdigerweise genoss er für gewöhnlich dieses physische Unbehagen, das seinen niedersten Trieben entsprang; denn so tot er sich innerlich auch fühlen mochte – aufgrund der ihm antrainierten Unnahbarkeit eines sogenannten »Jägers«, eines aus Dragos’ Zuchtlaboren stammenden Killers –, gab es doch noch Momente, die ihn trotz seines betäubten Zustands berührten und in denen er das Gefühl hatte, unter den Lebenden zu weilen.
Dieser spezielle Schmerz ging jedoch jetzt fast bis an die Grenze des Erträglichen, und so musste er all seine Willenskraft aufbieten, um nicht hier mitten im Club über die Frau herzufallen und von ihrem Blut zu trinken.
»Komm. Lass uns von hier verschwinden.«
»Gern!« Sie warf sich ihm fast an den Hals. »Ich dachte schon, du würdest niemals fragen.«
Er führte sie von der Bar weg Richtung Ausgang, ohne noch ein Wort zu sagen. Zwar wussten die Menschen seit mehr als zwanzig Jahren von ihren Mitbewohnern auf der Erde – den Stammesvampiren –, doch es gab nur wenige unter den Vampiren, die in aller Öffentlichkeit Nahrung zu sich nahmen, und nicht einmal jemand wie Scythe, ein kaltblütiger Killer, tat es.
Seine Begleiterin schwankte ein wenig, als sie nach draußen traten, wo es ein bisschen frisch war. »Wo willst du hin? Ich wohne in einem Hotel gleich die Straße rauf. Das Zimmer ist zwar ein richtiges Drecksloch, aber wir können gern hingehen, wenn du ein bisschen abhängen willst.«
»Nein. Mein Wagen reicht.«
Ein verlangender Ausdruck huschte über ihr Gesicht, als sie zu ihm aufschaute. »Bist wohl ungeduldig, hm?« Sie kicherte und klatschte ihm mit der flachen Hand auf die Brust. »Keine Sorge. Das gefällt mir.«
Sie folgte ihm über den kleinen Parkplatz zu seinem schimmernden, schwarzen SUV. Ganz vage regte sich sein Gewissen, und er spürte Mitleid mit einer Frau, die so wenig Wert auf sich legte, dass sie sich auf einen Fremden einließ, der ihr nichts dafür bot, dass er ihren Körper nahm.
Oder in diesem Fall – ihr Blut.
Scythe war nicht mehr als ein Sklave gewesen, als er zur Welt kam … und wäre beinahe auch als einer gestorben. Die Vorstellung, jemandem etwas zu nehmen, nur weil er die körperliche Überlegenheit dazu besaß, erfüllte ihn mit Abscheu vor sich selbst. Das Mindeste, was er tun konnte, war, dass er auch etwas gab, wenn er ihr schon von ihr nahm. Die Frau würde ganz matt sein, auf eine ihr unerklärliche Weise befriedigt, wenn er erst einmal mit ihr fertig war. Aber angesichts des merkwürdigen Anflugs von Mitleid, das er mit ihr hatte, würde ihr Portemonnaie voll genug sein, um sich einen Monat lang ein Zimmer im besten Hotel von Bari leisten zu können, wenn sie auseinandergingen.
»Hier entlang«, brummte er mit rauer Stimme.
Sie nahm den Arm, den er ihr reichte, und grinste. Doch es war nicht das kokette Lächeln, das sein Blut in Wallung brachte. Nein, es war der wild pochende Puls unter der zarten Haut ihres Halses, der dafür sorgte, dass seine Fangzähne hervortraten. Sie schoben sich durch seinen Gaumen, und das Verlangen, Nahrung zu sich zu nehmen, die er sich zu lange verwehrt hatte, machte ihn ganz benommen.
Sie stiegen in seinen Wagen, und er verschwendete keine Zeit. Er drehte sich auf seinem Sitz und streckte den linken Arm nach ihr aus. Seine Finger legten sich um ihren Unterarm. Sie gab einen leisen Laut der Verwunderung von sich, als er ihr Handgelenk an seinen Mund zog.
Ihre Verwunderung schwand sofort, als er seine Fangzähne in ihr zartes Fleisch schlug.
»Oh mein Gott«, keuchte sie. Ihre Wangen röteten sich, und ihr ganzer Körper neigte sich ihm entgegen.
Sie schob die Finger ihrer freien Hand in sein langes schwarzes Haar, und er musste dem Drang widerstehen, nicht plötzlich von ihr abzurücken, während ihr Blut in seinen Mund lief. Er wollte nicht angefasst werden. All sein Sinnen und Trachten war nur darauf gerichtet, die gähnende Leere in seinen Innereien zu füllen, bis er das nächste Mal gezwungen sein würde, Nahrung zu sich zu nehmen.
Sie stöhnte, atmete keuchend und hastig, während er trank. Er saugte das Blut aus ihrem Handgelenk und stillte seinen Hunger, bis er die Energie spürte, die durch seinen Körper zu strömen begann. Seine Kräfte erneuerten sich, ihr Blut stärkte seine Zellen.
Als er fertig war, schloss er die winzigen Bisswunden auf ihrer Haut, indem er leidenschaftslos mit der Zunge darüberfuhr. Atemlos drängte sie sich ihm zuckend entgegen.
»Mein Gott, das war toll! Was muss ich tun, um noch mehr davon zu bekommen?«, murmelte sie immer noch keuchend.
Er ließ sich in die weichen Lederpolster seines Sitzes zurücksinken und spürte, wie Ruhe über ihn kam, als sein Körper begann, die ihm eben zugeführte Nahrung zu verarbeiten. Als die Frau versuchte, sich ihm mit trunkenem Verlangen im Blick zu nähern, hob Scythe die Hand und legte sie an ihre Stirn.
Die Trance erfasste sie sofort. Er löschte die Erinnerung an seinen Biss und an das Verlangen, das dieser in ihr geweckt hatte. Als sie auf ihren Sitz zurücksank, holte er aus der Tasche seiner schwarzen Jeans ein Bündel Geldscheine hervor und entnahm ihm mehrere große Scheine. Er warf sie in ihren Schoß und ließ dann die Tür auf der Beifahrerseite mit einem stummen, mentalen Befehl aufgehen.
»Geh«, befahl er der Frau, die immer noch in Trance war. »Nimm das Geld und geh in dein Hotel zurück. Halte dich von diesem Nachtclub fern. Such dir einen besseren Zeitvertreib.«
Sie gehorchte sofort. Nachdem sie das Geld in ihre Handtasche gestopft hatte, stieg sie aus dem SUV und überquerte den Parkplatz.
Scythe ließ den Kopf nach hinten gegen die Kopfstütze sinken und atmete tief durch, während sich seine Fangzähne wieder zurückzogen. Das menschliche Blut zeigte bereits Wirkung und linderte den Schmerz, der seinen ganzen Körper erfüllte. Das Unwohlsein, das sich im Verlaufe der letzten vierundzwanzig Stunden immer weiter verstärkt hatte, war endlich fort, und wenn er Glück hatte, würde er eine ganze Woche lang von dieser Nahrungsaufnahme zehren können.
Er ließ den Motor an und hatte es plötzlich sehr eilig, in seinen Schlupfwinkel in Matera zurückzukehren. Doch er war noch nicht einmal aus der Parklücke heraus, als sein Handy in der Innentasche seiner Jacke anfing zu klingeln. Er zerrte es heraus und starrte ärgerlich auf das Display. Nur drei Leute kannten seine Nummer, und in diesem Moment wollte er von keinem der drei etwas hören.
Doch das Display leuchtete weiter, und er verzog das Gesicht.
Shit. Er brauchte gar nicht erst zu raten, wer das wohl sein könnte.
Und so gern Scythe sich auch gegen den Rest der Welt abgeschottet hätte, würde er doch nie den Anruf von einem seiner früheren Brüder ignorieren, die genauso »Jäger« gewesen waren wie er.
Mit einem leisen Fluch nahm er den Anruf an. »Ja.«
»Wir müssen miteinander reden.« Tryggs Stimme hatte immer einen knurrenden Unterton, doch jetzt klang er außerdem beunruhigt. In der Stimme von Scythes Halbbruder hatte auch das letzte Mal, als er ihn von der Kommandozentrale des Ordens in Rom angerufen hatte, dieser Unterton mitgeschwungen, und so war ihm gleich klar, dass das nichts Gutes bedeuten konnte.
»Dann rede«, erwiderte er, obwohl er sicher war, den Grund für Tryggs Anruf nicht hören zu wollen. »Was ist los?«
»Der Orden hat ein Problem, bei dem deine speziellen Fähigkeiten von Nutzen sein könnten, Bruder.«
»Verdammt«, ächzte Scythe. »Wann habe ich das schon mal gehört?«
Vor sechs Wochen hatte er sich von Trygg einspannen lassen, als der Orden ein Problem gehabt hatte, und Scythe versuchte immer noch, endlich mit dieser Sache abzuschließen. Als ehemaliger Auftragskiller kam er mit anderen nicht gerade gut zurecht, und er war ganz gewiss nicht darauf erpicht, sich wieder in irgendwelche Ordensangelegenheiten hineinziehen zu lassen.
Doch es gab gerade mal eine Handvoll Leute, die ganz genau wussten, was Scythe im Rahmen von Dragos’ höllischem Zuchtprogramm hatte durchmachen müssen … und einer davon war Trygg. Als Kinder hatten sie beide jahrelang dieselben Qualen durchlitten und später als Erwachsene mit den Folgen fertigwerden müssen.
Selbst wenn zig andere der geflüchteten Jäger nicht zu fünfzig Prozent die gleichen Gene aufgewiesen hätten, so hätten sie doch die schrecklichen Erfahrungen in den Zuchtlaboren zu Brüdern zusammengeschweißt. Wenn also Trygg etwas wollte, würde Scythe für ihn da sein. Mehr noch … er würde sogar seine andere Hand für jeden seiner Brüder hergeben, wenn sie ihn darum baten.
Scythes außergewöhnlich stark ausgeprägte Fähigkeit zu spüren, wenn Ärger in der Luft lag, sagte ihm, dass Trygg ihn um etwas bitten wollte, das noch schmerzhafter sein würde.
»Sag mir, was du willst«, brummte er und wappnete sich innerlich gegen das, was gleich kommen würde.
»Erinnerst du dich noch an Chiara Genova?«
Scythe musste an sich halten, um nicht ein sarkastisches Lachen auszustoßen.
Ob er sich an sie erinnerte? Verdammt, klar erinnerte er sich. Die schöne, verwitwete Stammesgefährtin mit dem seelenvollen, traurigen Blick und dem Gesicht eines gebrochenen Engels war Mittelpunkt zu vieler seiner überhitzten Träume gewesen, seit er sie das erste Mal gesehen hatte. Auch jetzt weckte die bloße Erwähnung ihres Namens eine Sehnsucht in ihm, die zu empfinden er kein Recht hatte.
Er erinnerte sich auch an ihren drei Jahre alten Sohn Pietro. Das Lachen des Kindes hatte dazu geführt, dass Scythes Schläfen anfingen zu pochen, angesichts der Erinnerungen, die er, wie er meinte, vor mehr als zehn Jahren für immer begraben hatte.
»Geht es ihr und dem Jungen gut?« Er spürte die Angst, die seinen Hals enger werden ließ, als er die Frage stellte. Doch sein gleichmütiger Tonfall gab nichts davon preis.
»Ja. Noch.« Trygg holte tief Luft. »Sie ist in Gefahr. Und diesmal ist es verdammt ernst.«
Scythe umklammerte das Handy fester. Die Frau hatte bereits genug durchgemacht. Angefangen hatte alles mit dem mehr als unpassenden Stammesvampir, den Chiara vor mehreren Jahren zum Mann genommen hatte. Dieser Mistkerl, Sal, hatte sich als Spieler und skrupelloses Arschloch erster Güte erwiesen.
Nachdem er nicht in der Lage gewesen war, seine Schulden zu bezahlen, hatte er sich mit einem üblen Verbrecher eingelassen, einer Unterweltsgröße namens Vito Massioni, an den Sal seine eigene Schwester Arabella verschachert hatte, um sein armseliges Leben zu retten. Wäre der Orden in Rom nicht gewesen oder genauer einer seiner Krieger – Ettore »Savage« Selvaggio –, wäre Bella vielleicht immer noch Massioni ausgeliefert.
Und auch Chiara war im Grunde eine Gefangene von Massioni gewesen. Sals Verrat hatte ihm am Ende doch nichts genützt, und nach seinem Tod hatten Chiara und ihr Sohn auf dem Weingut der Familie in ständiger Angst vor Massioni gelebt.
Vor sechs Wochen hatte sich dann alles zugespitzt. Der Orden war gezielt gegen Massioni vorgegangen und hatte ihn und seine gesamte Organisation zur Strecke gebracht … oder zumindest hatten sie das gedacht. Denn Massioni hatte die Explosion überlebt, die seinen Landsitz in Schutt und Asche gelegt und all seine Gefolgsleute getötet hatte, und war danach nur noch auf Blut aus gewesen.
Chiara und ihr Sohn waren zusammen mit Bella und Savage ins Fadenkreuz geraten, sodass sie gemeinsam die Flucht angetreten hatten. Trygg hatte sie zu Scythe geschickt, damit sie dort Unterschlupf fänden, obwohl er sehr wohl wusste, dass Scythe nicht gerade der Beschützertyp war. Vor allem nicht für eine Frau und ein Kind.
Und das würde sich in nächster Zeit auch ganz gewiss nicht ändern.
Trotzdem kam ihm die Bitte ganz leicht über die Lippen. »Erzähl, was passiert ist.«
»Laut Bella hatte Chiara seit einer Woche oder so das Gefühl, beobachtet zu werden. Als würde ihr jemand aus der Ferne nachstellen. Letzte Nacht hat das Ganze dann eine böse Wendung genommen. Ein Stammesvampir brach ins Haus ein. Hätte sie ihn nicht schon vorher bemerkt, sodass sie Zeit hatte, sich auf die Situation einzustellen, wäre sie wahrscheinlich vergewaltigt oder ermordet worden oder gar beides.«
»Verdamm…« Scythe unterdrückte den Fluch, der ihm auf der Zunge lag, und holte tief Luft, um sich zu beruhigen. Er kochte vor Wut, doch er riss sich zusammen und stellte Fragen, um mehr Informationen zu erhalten. »Hat der Mistkerl sie angefasst? Wie ist es ihr gelungen, zu entkommen?«
»Sal hatte einen Degen unter dem Bett versteckt, um vorbereitet zu sein, falls Massioni irgendwelche Schläger schickte, die das Geld eintreiben sollten, welches er ihm schuldete. Chiara hat den Degen nach seinem Tod an sich genommen. Auf wundersame Weise gelang es ihr, ob nun aufgrund eines Adrenalinschubs oder aus wilder Entschlossenheit, den Mistkerl abzuwehren; wenn auch nur knapp.«
Allmächtiger. Als er an das zierliche Persönchen von Frau dachte, die versuchte, sich eines gesunden, kräftigen Stammesvampirs zu erwehren, schüttelte er fassungslos den Kopf. Dass sie den Angriff überlebt hatte, war mehr als eine glückliche Fügung und grenzte schon fast an ein Wunder. Aber Trygg hatte recht: Die Wahrscheinlichkeit, dass ihr das noch einmal gelang, war gering, wenn nicht gar ausgeschlossen.
Und das war offensichtlich der Moment, in dem Scythe und seine speziellen Fähigkeiten ins Spiel kamen. Nicht dass die Bitte von Trygg oder dem Orden nötig gewesen wäre, ihn dazu zu bewegen, Chiaras Angreifer zur Strecke zu bringen und den Stammesvampir für sein Vergehen mit Blut und Schmerz bezahlen zu lassen.
Allein die Vorstellung, dass sie voller Angst vor so einem Tier hatte zurückweichen müssen, das ihr etwas antun wollte, ließ Scythe vor Wut am ganzen Körper zittern.
»Dann braucht mich der Orden also, um diesen Mistkerl aufzuspüren und ihm den Kopf abzureißen?«
»Mit seiner Ermordung dringen wir nicht bis zur Wurzel des Übels vor. Wir halten diesen Angriff nicht für einen Zufall. Der Orden braucht dich, um Chiara und Pietro zu beschützen, während wir versuchen herauszufinden, wer hinter ihr her ist und warum.«
Scythe konnte das Knurren nicht unterdrücken, das unwillkürlich in ihm hochkam. »Du weißt, dass ich für die Aufgaben eines Leibwächters nicht zur Verfügung stehe. Verdammt! Du weißt auch ganz genau warum.«
»Ja«, erwiderte Trygg. »Und trotzdem bitte ich dich darum. Du bist der Einzige, den wir mit dieser Sache betrauen können, Bruder. Alle Ordensmitglieder sind zurzeit im Einsatz und schlagen sich mit Opus Nostrum, dem massenhaften Auftreten von Angriffen durch Rogues und zig anderen Problemen herum. Wir brauchen dich.«
»Dieses Mal bittest du mich um zu viel«, ächzte Scythe.
Die Frau zu beschützen würde an seine Substanz gehen. Das wusste er instinktiv, und auch seine Erfahrung sagte es ihm. Seit fast zwanzig Jahren beschränkte er die Nahrungsaufnahme auf einmal pro Woche. Und seine anderen körperlichen Bedürfnisse behielt er noch stärker unter Kontrolle.
Vor sechs Wochen hatte er nur ein paar Stunden mit Chiara Genova verbracht, doch das hatte gereicht, um ihm klarzumachen, dass sowohl seine Geduld als auch seine Selbstdisziplin auf eine harte Probe gestellt werden würde, wenn er sich wieder unter einem Dach mit ihr befände.
Und das Kind? Das ging gar nicht. Es gab einfach Dinge, die konnte er nicht tun … nicht einmal für seinen Bruder.
Bedrückt schweigend dachte er über Tryggs Bitte nach.
»Wie sieht’s aus, Scythe?«
Die Ablehnung lag ihm auf der Zunge, aber er war nicht in der Lage, sie über die Lippen zu bringen. »Wenn ich es mache, dann auf meine Weise. Ich muss weder dem Orden noch gegenüber jemand anderem Rechenschaft ablegen. Okay?«
»Klar. Das ist ganz dein Ding. Beweg deinen Hintern nur so bald wie möglich nach Rom, damit wir deinen Plan besprechen und alles koordinieren können.«
»Was ist mit ihr?«, wollte Scythe wissen. »Weiß Chiara, dass du dich mit mir in Verbindung gesetzt hast, um ihr zu helfen?«
Als sich das Schweigen am anderen Ende der Leitung in die Länge zog, wusste er, woran er war, und er verzog das Gesicht.
»Savage und Bella bringen Chiara und Pietro gerade her«, erklärte Trygg. »In spätestens einer Stunde sollten alle hier sein.«
Scythe fluchte wieder und noch saftiger dieses Mal. »Ich bin auf dem Weg.«
Er beendete das Gespräch, legte den Gang ein und brauste mit dem SUV los.
2
»Auf gar keinen Fall. Das kommt überhaupt nicht infrage.«
Chiara verschränkte die Arme vor der Brust und funkelte die um sie herum versammelten Krieger wütend an, als hätten die den Verstand verloren. Es konnte gar nicht anders sein, wenn sie tatsächlich dachten, sie würde sich auf das einlassen, was sie gerade gesagt hatten.
»Ich werde Rom nicht ohne meinen Sohn verlassen. Seit Pietros Geburt bin ich nie mehr als ein paar Stunden von ihm getrennt gewesen. Ihr meint doch nicht etwa, dass ich damit jetzt anfange, wenn die Möglichkeit besteht, dass da draußen jemand rumläuft, der mich umbringen will?«
Wütend schüttelte sie den Kopf und marschierte aufgebracht im Konferenzraum auf und ab. Sie hatte sich bereit erklärt, Lösungsvorschlägen gegenüber aufgeschlossen zu sein, als Ettore und Bella sie früher am Abend in die Kommandozentrale des Ordens gebracht hatten, doch das bedeutete nicht, dass sie sich von ihrem kleinen Jungen trennen lassen würde.
Hilfe suchend und verzweifelt bemüht, eine Verbündete zu gewinnen, wandte sie sich an ihre frühere Schwägerin.
»Bella, bitte. Du weißt, dass ich fast alles tun würde, worum du mich bittest. Als du und Ettore Pietro und mich vom Weingut weggeholt habt, um uns vor Vito Massioni und seinen Männern zu beschützen, bin ich widerstandslos mitgekommen. Aber das hier? Nein. Es muss eine andere Lösung geben.«
Keiner antwortete ihr … genau wie schon zuvor keiner auf ihre Fragen und Einwände reagiert hatte. Sie merkte, wie Ettores Blick kurz zum anderen Ende des Konferenzraumes huschte, wo ein Stammesvampir stand, der nicht dem Orden angehörte. Er war kein Fremder für sie, sie konnte allerdings auch nicht gerade behaupten, sich sonderlich wohl in seiner Gegenwart zu fühlen, obwohl sie und Pietro doch vor ein paar Wochen zusammen mit Bella und Ettore Unterschlupf in seinem Haus in Matera gefunden hatten.
Groß und breit – und selbst für einen Gen-Eins-Stammesvampir ein wahrer Koloss – schien Scythe nur aus bedrohlichen Muskeln zu bestehen. Seine völlig schwarze Kleidung verstärkte seine ohnehin unheimliche Erscheinung mit den langen schwarzen Haaren und dem sauber gestutzten Bart. Sogar seine Augen waren schwarz. Der intelligente, durchdringende Blick schien alles zu sehen, alles zu wissen.