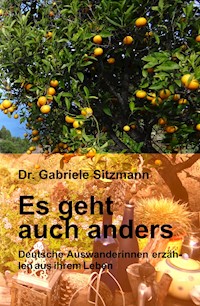
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Ein geradliniger Weg von der Wiege bis zur Bahre im wohlgeordneten Deutschland, abgesichert durch Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung? Ein Leben, das nur im Urlaub so genannt werden kann? Nein! 21 mutige Frauen kehren dieser bundesdeutschen Realität den Rücken und wagen den Sprung ins Ungewisse, in ein anderes Land. Manche folgen der Liebe, andere suchen neue Erfahrungen, mehr Sonne, wollen ihren Horizont erweitern. Viele entdecken neue Seiten in sich, bislang ungelebtes Potenzial. 21 mutige ehrliche Erzählungen, basierend auf Interviews mit der Autorin, einer Nürnberger Ärztin, die selbst vor 25 Jahren nach Australien ausgewandert ist. Haben Sie auch schon einmal an Auswanderung gedacht? Daran, dem kalten Deutschland für eine Zeit lang oder für immer den Rücken zu kehren? Lesen Sie, wie es anderen dabei ergangen ist und was es ist, das deren Leben so lebenswert macht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 286
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Dr. Gabriele Sitzmann
Es geht auch anders
Deutsche Auswanderinnen erzählen ausihrem Leben
Copyright: © 2015 Dr. Gabriele Sitzmann
Lektorat: Dr. Günther Kraus
Fotos: Dr. Gabriele Sitzmann,
Foto von Ines: Dieter Merz
Satz: Erik Kinting / www.buchlektorat.net
Umschlaggestaltung: Sabine Abels / www.e-book-erstellung.de
Verlag: tredition GmbH, Hamburg
ISBN: 978-3-7323-4660-8 (E-Book)
ISBN: 978-3-7323-4622-6 (Paperback)
ISBN: 978-3-7323-4623-3 (Hardcover)
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Inhalt
Einleitung
Die Frauen kommen zu Wort:
Biene
Ich bekomme meine Weisheiten durch die Natur
Kathrin
Bei den Bergstämmen Nord-Thailands
Erika
Kunst im Ziegenstall
Eva
Die Galerie in der Mitternachtssonne
Ursula
Es ist nie zu spät, sich zu verändern
Frohmut
Ein Café zwischen Himmel und Erde
Jennifer
Im Schatten des Vulkans
Beate
Nahrung aus der Natur Australiens
Petra in La Gomera
Ein Restaurant inmitten von Bananenplantagen
Isabel
Grüne Schlangen sind kein Spielzeug
Brigitte
Die Dinge mit neuen Augen betrachten können
Gabi
Meine Hände sind meine Werkzeuge
Ines
Ein Blick hinter die Tourismusfassade Balis
Margarete
Von Kolumbien nach Australien
Kerstin
Mobile Friseurin im Süden Teneriffa
Christiane
Ostdeutsche Küche in San Francisco
Sabine
Vintage Schmuck auf Sydneys Märkten
Jutta
Orangen im Paradies
Ulli
Götter im Reisfeld
Petra auf La Palma
Jetzt nur das Beste für Petra
Gabriele
Leben heißt Erfahrungen machen
Nachwort
Register
Einleitung
An einem schönen Morgen im März 2014 sitze ich auf der Kanareninsel La Palma bei Jutta auf ihrer sonnenbeschienenen Terrasse inmitten eines Orangenhains und atme den Duft dieser cremeweißen Blüten ein. Mein Blick schweift über die baumbestandenen Hänge hinunter zum Meer und ich fühle, wie ich in dieser friedlichen Atmosphäre meine Seele baumeln lassen kann.
Jutta erzählt mir, dass es hier durchaus auch rauere Zeiten gegeben habe: vor einigen Jahren habe sie eine plötzliche Krankheit ereilt und sie habe sich einer schweren Operation unterziehen müssen. Bei der häuslichen Nachbetreuung hätten ihr wunderbarerweise fünf deutsche Frauen aus der Gemeinde im Wechsel geholfen, wieder auf die Beine zu kommen.
Dies zu hören beeindruckt mich sehr. Welches Gemeinschaftsgefühl muss hier herrschen, vermute ich. Und dann bitte ich Jutta, mir diese Frauen vorzustellen. Als ich sie treffe und ihre grundverschiedenen mutigen Geschichten höre, ist meine Idee zu diesem Buch geboren.
Mir wird bewusst, wie viel Tatkraft, Kreativität und Durchhaltevermögen es erfordert, Deutschland und seine Sicherheit zu verlassen und sich an einem anderen Ort ein neues Leben aufzubauen. Ich erlebe, wie viel diese Frauen durch ihren Sprung in eine neue Lebensrealität dazugewonnen haben und was sie auch hinter sich lassen mussten und zum Teil vermissen. Plötzlich werde ich gewahr, dass es wichtig ist, diese Biographien zu bewahren und mit anderen zu teilen. Meine Hoffnung ist es, dass sie anderen den Mut geben, ihrem Herzen und nicht nur ausgetretenen Spuren zu folgen.
Ursprünglich hatte ich mir Fragen überlegt wie: „Woher kamst du und kamst du alleine? Was hat dich veranlasst auszuwandern? Wie unterscheidet sich dein Leben hier von deinem Leben in Deutschland? Welche Höhen und Tiefen hast du erlebt? Was hat dir dein Einwanderungsland gegeben und eventuell auch genommen? Wie verdienst du deinen Lebensunterhalt? Hast du jemals daran gedacht zurückzugehen? Erfährst du Deutschfeindlichkeit, unter Umständen auch subtil? Fühlst du dich als Teil einer Gemeinschaft? Wie erlebst du die Rolle der Frau in deinem Einwanderungsland? Kannst du dir vorstellen, hier alt zu werden? Welche Stärken hast du gebraucht und gewonnen? Begreifst du dich als religiös oder spirituell? Welchen Ratschlag würdest du potentiellen Auswanderinnen geben?“ Die Interviews aber haben oft ihre eigene Dynamik entwickelt und in diesen Fällen ließ ich meine Fragen auch gerne in den Hintergrund treten.
Meine Rolle dabei sah ich als teilnehmende Beobachterin, als Dokumentarin, keinesfalls als Richterin. So schrieb ich auf, was die Frauen mir erzählten, ohne darüber zu urteilen, ob ich mit den mir berichteten Wegen und Werten übereinstimme oder nicht. Gerade die Buntheit und Vielfalt unserer Lebenswege und –entwürfe machten für mich den Reiz dieses Buches aus. Nach den sieben Frauen, die ich auf den kanarischen Inseln interviewt habe, folgten sieben Frauen aus Australien, meinem Einwanderungsland einschließlich meiner eigenen Geschichte, und sieben Frauen „aus dem Rest der Welt“, eine davon aus Norwegen, eine aus Hawaii, zwei aus Thailand, zwei aus Bali und eine Thüringerin aus San Francisco.
Dabei habe ich einiges an langen Reisewegen, Kosten und Beschwerlichkeiten bis hin zu einem schweren Autounfall auf mich genommen, um die Frauen persönlich zu treffen. Internet-oder Telefonbegegnungen können den persönlichen menschlichen Kontakt für mich nicht ersetzen.
Mir ist jede einzelne dieser Frauen ans Herz gewachsen und ich fühle mich sehr privilegiert, ihre Geschichten hören und aufschreiben zu dürfen. Für mich hat sich dadurch meine Lebensrealität geändert: plötzlich fühle ich mich als Teil eines weltweiten Netzwerkes von Auswanderinnen, von Deutschen im Ausland.
Von ganzem Herzen möchte ich allen danken, die mir dabei geholfen haben, dass dieses Buch entstehen konnte. Danke an alle, die daran glauben, dass es nicht nur den einen geradlinigen Weg gibt, sondern dass es eben auch „anders“ geht.
Im März 2015
Dr. Gabriele Sitzmann
Die Frauen kommen zu Wort:
Biene
Ich bekomme meine Weisheiten durch die Natur
Wir schreiben das Jahr 1981 in der Deutschen Demokratischen Republik (DDR). Zwischen 23.00 Uhr und Mitternacht klingelt es in einem Wohnhaus in Hartmannsdorf bei Gera, Thüringen an der Tür. Die sechsjährige Biene steht im Gang, als fünf schwerbewaffnete Männer der geheimen Staatspolizei (Stasi) hereinstürmen und ihren Vater festnehmen. Einer davon ist zum Erstaunen aller der beste Freund ihres Vaters. Bevor auch die Mutter ergriffen wird, bittet sie noch, die Frühstücksbrote für Biene und ihre siebenjährige Schwester für den nächsten Morgen machen zu dürfen. Während die Maschinengewehre bereits auf sie zeigen, umarmt sie Biene ganz fest und sagt: „Ich komme wieder, geht morgen in die Schule und macht alles wie immer.“ Dann wird sie abgeführt.
Ein Stasimann will bei den beiden Mädchen über Nacht bleiben und zeigt ihnen am Abend magische Tricks. Während die Schwestern ins Bett gehen, „verwanzt“ er das Haus mit Abhörgeräten. Am nächsten Morgen ist er verschwunden und am Abend kommt er wieder. Irgendwann sind die Eltern wieder da, dann werden sie erneut abgeführt. So geht das zweieinhalb Jahre lang. Bei jedem Klingeln fängt die Mutter an zu zittern. Am Vortag des ersten nächtlichen Überfalles war die Familie in Ostberlin, der Hauptstadt der DDR gewesen und hatte einen Ausreiseantrag nach Westdeutschland gestellt, da sie dort Verwandte hatten. Bereits beim Verlassen der Dienststelle wurden sie von einem weißen Trabant verfolgt, der ihnen zwei Jahre lang auf den Fersen blieb. Zu dieser Zeit spielen die Mädchen: „Der böse Mann kommt – wo verstecken wir uns.“
Erst als sie selbst Mütter werden, bemerken sie, dass ihre Kinder dieses Spiel nicht spielen.
Die geplante Ausreise nach Westdeutschland spricht sich herum. Eines Tages fragt die Lehrerin: „Nehmt ihr auch euer Auto mit in den Westen?“ Biene, die Vertrauen zur Lehrerin hat, antwortet: „Na klar!“ Am nächsten Tag wird der Familie das Auto weggenommen.
Als nächstes wird die Schwester in der Schule blutig geschlagen. Daraufhin meint der Direktor, dass es zu gefährlich sei für die Kinder, weiterhin die Schule zu besuchen. Deshalb dürfen sie acht Monate lang nicht mehr in die Schule gehen. Plötzlich kommt ein Anruf: „Der Ausreise-Antrag ist genehmigt, packt eure Koffer, ihr müsst in zwei Stunden das Land verlassen.“ Bei allen Familienmitgliedern herrscht große Erleichterung, dass sie als Familie zusammenbleiben dürfen.
Sowohl ihr Vater als auch ihre Mutter waren wiederholt von der Stasi bedrängt worden, alleine in den Westen zu gehen und als Spitzel für die DDR zu arbeiten. Die Kinder hätten in Jena bleiben sollen. Die Eltern hatten dies immer abgelehnt.
In den Ferien durften sie – sowohl während ihrer Zeit in der DDR als auch der in Westdeutschland – nach Siebenbürgen in Rumänien zu den Großeltern reisen. Der Trabant wurde voll gepackt und mit all ihren Schätzen waren sie die Reichsten im Dorf. Der Opa war dort Pfarrer und eine wichtige Bezugsperson für Biene. Siebenbürgen war für sie die heile Welt, es gab einen großen Zusammenhalt in der Gemeinde. Die meisten Leute waren sehr arm und lebten von den Erzeugnissen ihrer Landwirtschaft. Biene erinnert sich gut, wie ihr im Ort eine heiße Kartoffel zugesteckt wird oder jemand ihre zerrissenen Schuhe klebt. Sie fühlt sich sehr geliebt im Dorf. Immer wenn sie nach den Ferien nach Ostdeutschland zurück muss, bekommt sie Heimweh nach Rumänien.
Bis zu ihrem elften Lebensjahr verbringt sie alle Ferien dort. Auch ihr Großvater ist dort als Pfarrer Schikanen durch die Sekuritate, die rumänische Version der Stasi, ausgesetzt. Sein Haus wird ebenfalls „verwanzt“, insbesondere da einer seiner Priesterkollegen ein Informant der Sekuritate ist. Bei einem besonderen Treffen vieler Pfarrer der Umgebung fallen allerdings die Abhörgeräte aus: für Bienes Großvater ein Beweis göttlicher Intervention.
Am 31. März 1984 darf endlich die Ausreise in den Westen stattfinden. Für Bienes Großmutter und den Großvater ist es ein Schock, da sie nichts von den Plänen gewusst hatten. Bienes Eltern hielten es für zu gefährlich, über ihr Vorhaben zu sprechen. Vor allem dadurch, dass der beste Freund des Vaters als Stasimann enttarnt wird, sind die Eltern sehr geschockt und enorm misstrauisch: „Man weiß nie, wer alles in der Stasi drin ist“, sagen sie wiederholt.
Die erste Station ist das Auffanglager in Gießen, dann in Nürnberg. Sie schlafen erst einmal auf Matratzen auf dem Boden, sind aber enorm glücklich, in Westdeutschland zu sein. Biene erinnert sich an ihren neunten Geburtstag im Lager; sie bekommt ein ganzes Glas Nutella für sich alleine geschenkt und darf dieses auslöffeln. Sie ist sehr stolz!
Später wird ihnen eine Wohnung in Roßtal bei Nürnberg zugeteilt. Um sich auf eine Berufstätigkeit vorzubereiten, arbeitet die Mutter unentgeltlich in einem Kleidergeschäft. Sechs Monate später kommt mit Kassel die nächste Station. Biene erinnert sich gerne daran, wie sie und ihre Schwester Würstchen gebraten und die Kinder vom Haus zur „Puddingsuppe“ eingeladen haben.
Es folgt ein Umzug nach dem anderen: von Kassel geht es nach Niedersachsen, dann nach Aalen in Schwaben. Die längste Zeit, die die Familie an einem Ort verbringt, sind zwei Jahre.
Während der Kasseler Zeit macht ihre 30-jährige Mutter eine Ausbildung als Krankenschwester, der Vater arbeitet als Ingenieur. Als sie nach Schwaben kommen, versteht Biene den Dialekt nicht. Zudem ist sie hier die „Ossi“, während sie im Osten die „Wessi“ war. „Man war immer falsch am Platz.“ So wird sie von den anderen Kindern deswegen auch verprügelt und wegen ihrer Second-Hand-Kleidung gehänselt.
„Manchmal habe ich mich sehr einsam gefühlt. Da hat so ein Umzug richtig gut getan, die anderen Kinder kannten mich nicht, es war eine ganz neue Geschichte.“ Natürlich ist es wegen des vielen Wechsels schwer, den schulischen Anforderungen zu genügen. Insbesondere bei den Fremdsprachen hat die neue Klasse bereits ein ganz anderes Pensum als sie bewältigt.
Die Eltern erleiden im Westen einen Nervenzusammenbruch und Biene findet keinen emotionalen Zugang mehr zu ihnen. Mit zehn Jahren befällt Biene nach einem Zeckenbiss beim Sammeln von Heidelbeeren im Wald eine plötzliche Lähmung ihrer rechten Gesichtshälfte, die fast ein Jahr andauert. Mehrere Krankenhausaufenthalte folgen. Bei einem wird sie gefragt, ob sie einen Psychiater sehen möchte. Da bekommt sie einen Schreck: „Hoffentlich sage ich nichts Falsches.“
Dieser Zeckenbiss führt zu einer Schädigung des Sehnervs mit Doppeltsehen auf beiden Augen und einer Gehirnhautentzündung. Mit 14 Jahren verbringt sie deswegen wieder drei Monate im Krankenhaus. Trotz vieler schmerzhafter Untersuchungen findet sie die Zeit im Krankenhaus „toll“. „Ich habe von der Krankenschwester so viel Liebe und Aufmerksamkeit bekommen.“ Während ihrer Ferienzeit in Rumänien in diesem Jahr wird ihr extra ein Kräuterkissen für die Augen genäht.
In der zehnten Klasse will sie auf die Realschule wechseln und organisiert alles selbst. Den Eltern erzählt sie, dass die Lehrer den Wechsel empfehlen und den Lehrern umgekehrt das gleiche. Sie wird – in ihren eigenen Worten – „super gut“ in der Schule, lernt nur noch Englisch und legt die anderen Fremdsprachen ab. „Nach zwei Wochen kam ein Mädchen aus Rumänien, Bettina, in die Klasse, setzte sich neben mich und wir wurden beste Freundinnen. Es stellte sich heraus, dass mein Opa ihre Oma konfirmiert hatte. Auch meine Lieblingspuppe hieß Bettina, ihr Name barg also schöne Erinnerungen für mich.“
„Nach der Realschule gab es Druck seitens meiner Familie, Abitur zu machen. Aber ich konnte nicht zu Hause bei meinen Eltern bleiben. Ich hatte keinen Kontakt mehr zu ihnen und wurde von meiner Mutter bis zur Luftnot festgehalten und geprügelt, während mein Vater dabei zusah. So bin ich mit 16 immer wieder abgehauen. Mit 17 durfte ich dann endlich ausziehen, habe in Stadeln bei Nürnberg ein Zimmer gemietet, das nur drei Minuten von meinem Opa weg war.“ Ihr Großvater war einige Jahre zuvor aus Rumänien ebenfalls in den Westen ausgewandert.
In Nürnberg macht sie dann eine Banklehre. 329 Leute haben sich beworben, nur 24 werden genommen, wovon die Hälfte Kinder von Kunden und Mitarbeitern sind. Biene ist eine der Auserwählten.
„Das Schöne daran war, dass ich Ruhe hatte. Als ich auszog, gingen die Prügeleien auf meine Schwester über, die dann auszog und schließlich auf meinen Vater, bis auch er das Haus verließ.“
Bei der Bank kann sie alle zwei Monate in einen anderen Bereich wechseln, was sie spannend findet. Und jeden Abend hat sie die Möglichkeit, zum Opa gehen, wenn ihr danach ist. In dieser Zeit lernt sie ihn auf eine einzigartige Art und Weise kennen. Seine Frau war gestorben, als Biene zwölf war, so tut es ihm gut, seine Enkelin häufiger bei sich zu haben.
„Ab und zu tranken wir gemeinsam einen Kräuterbitter bis zum Euter herunter und dann hat er mit mir getanzt“, erinnert sich Biene. „Auch liebte mein Opa die Wortspiele und so haben wir uns oft Briefe geschrieben, bei denen jedes Wort mit dem gleichen Buchstaben anfangen musste. Dabei haben wir viel gelacht.“ Sechs Monate lernte sie jeden Abend für ihre Prüfung bei der Bank, aber am Vorabend des Examens geht sie mit dem Großvater auf eine Weinprobe. „Ich habe eine supergutePrüfung gehabt“ ‚sagt sie.
Während ihrer Ausbildung lernt sie ihren Freund kennen, der in Aalen lebt. Sie besuchen einander am Wochenende. Eines Nachts fährt er auf der Autobahn mit ihr und seiner Großmutter als Passagiere hinter einem LKW her. Plötzlich fliegt ein Stück Pappe auf die Windschutzscheibe, so dass er nichts mehr sieht und auf den LKW auffährt.
Das Auto fängt Feuer, die Oma stirbt bei dem Unfall. Biene und ihr Freund überleben. „Mich haben vier Feuerwehrleute festgehalten und ich habe sie alle weggestoßen. Ich lief die Autobahn entlang und wollte mich aus diesem Albtraum aufwecken. Als ich zurückkam, sah ich, dass die Oma mit einer weißen Decke über dem Kopf da lag. Dann haben sie mich ins Krankenhaus gebracht; ich hatte überall Muskelrisse und konnte mich gar nicht mehr alleine ausziehen.
Dieser Unfall war ein Wendepunkt für mich. Danach habe ich jeden Grashalm und jeden Schmetterling bewusst angesehen und habe eine Bewunderung fürs Leben gespürt.“
Nach diesem Ereignis weiß Biene, dass ihr Leben aus mehr bestehen soll als aus der Arbeit in der Bank und Familie. „Ich wusste, es gab etwas anderes.“ Sie will nach England gehen und beginnt verstärkt, Englisch zu lernen, ihr schlimmstes Fach in der Schule. Ihr ist bewusst: „ Wenn ich Englisch lernen kann, dann kann ich alles. Und es hat gestimmt: Ich konnte im Leben alles erreichen.“
Zwei Tage nach dem Ausbildungsende bei der Bank geht sie nach London. Sie wohnt dort zunächst bei Nonnen, die eine Art „Backpackers“ betreiben und Kontakte zu verschiedenen Au-Pair-Familien vermitteln. So kommt sie zu einem sehr netten Paar, beide aus Deutschland geflohene Juden. Auch ihre Schwester, mit der sie sich gut versteht, besucht London und lebt dort mit einer anderen Familie.
In der ersten Zeit arbeitet Biene in einem Restaurant. Wenn die Spätschicht um halb zwei Uhr Nachts zu Ende geht, nimmt sie den Nachtbus und ist um halb drei morgens zu Hause. Angst kennt sie dabei nicht.
Um einen besser bezahlten Job zu finden, durchstreift sie die Nachtclubs in Soho. „Aus dem einen haben sie mich herausgetragen mit den Worten: Du hast hier nichts zu suchen“, erzählt sie. Schließlich möchte sie im Sportsman Casino arbeiten. Ihre gesamte Umwelt bedeutet ihr, dass das zu schwer sei, da Englisch nicht ihre Muttersprache sei. Sie wird zum Vorstellungsgespräch eingeladen und klopft – als es soweit ist – an die Tür. Ihr Chef bedeutet ihr, dass es ihm sehr gefalle, dass sie so höflich hereinkomme, sie sei die erste, die an die Tür geklopft habe.
Das darauffolgende zweite Interview findet vor mehreren Frauen und Männern statt. Biene muss unter Druck schnell etwas vorrechnen. Zwei Tage später bekommt sie den entscheidenden Anruf: sie wird eingearbeitet werden. Das Training im Casino besteht aus vier Wochen unbezahlter und vier Wochen bezahlter Arbeit. Sie fängt um neun Uhr morgens dort an und ist um fünf Uhr nachmittags fertig. Um weiterhin Geld zu verdienen, arbeitet sie zusätzlich im Restaurant, wo sie um 8.00 Uhr abends anfängt und bis halb zwei Uhr morgens durcharbeitet.
In dieser Zeit hat sie nicht viel zu essen, da die Bezahlung erst am Ende des Monats erfolgt. Eine kroatische Freundin erklärt ihr die Überlebensstrategie für diesen Monat: Ein Sack Kartoffeln, ein Sack Äpfel und etwas Vollmilch, die mit Wasser verdünnt wird, damit könne man gut durchkommen. Als die Freundin zurück nach Zagreb muss, schickt sie ihr trotz Krieges ein Päckchen mit Süßigkeiten. Das berührt Biene sehr.
Im Casino wird sie bald zum „Ritz Club“ befördert. Der „high tea“ des Clubs wird zu ihrem Abendessen. Dort lernt sie viele interessante Menschen kennen. Schwerreiche Saudis sind darunter oder ein Mann, dem eine Diamantenmine in Afrika gehört. Sie arbeitet am Roulette-Tisch, der etwas Spielerisches für sie hat. Obwohl sie ein Anrecht auf regelmäßige Pausen hat, wird dies unterbrochen, als ein Scheich aus Saudi-Arabien mit einem Koffer voller Geld hereinkommt und ihre uneingeschränkte Anwesenheit fordert. „Irgendwann konnte ich nicht mehr addieren“, erinnert sie sich.
Nach einiger Zeit hat sie den Wunsch, eine Weltreise zu machen. Sie ist während der Zeit im Casino mit Edmund, einem Mann aus Tansania liiert, der ihr Treue geschworen hat. Eines Tages, als sie gerade seinen Cousin besucht, geht in der Entfernung, in den sog. Docklands eine Bombe hoch, so dass bei ihnen die Wände wackeln. Edmund arbeitet in den Docklands. Deshalb ruft die Frau des Cousins bei ihm an und kommt zurück mit den Worten: „Ich habe gerade mit Edmunds Verlobter gesprochen.“ Biene kann es nicht glauben und fährt einfach hin zu ihrem Freund. Dort öffnet seine Verlobte die Tür und für Biene bricht eine Welt zusammen. Edmund bricht in Tränen aus, dennoch ist für Biene klar: Jetzt ist Schluss mit ihm.
So beschließt sie, die Weltreise alleine zu machen und fliegt am 8. März 1996 los. Die erste Station ist Neuseeland, wo sie mit der Organisation WWOOF (Willing Workers on Organic Farms, freiwillige ArbeiterInnen auf Biofarmen) bei einem Bed & Breakfast in Motueka, Nelson, landet. Dabei ist ihr jede Arbeit recht: vom Schaufeln der Exkremente eines Esels bis zum Goldwaschen. Hier zeigt ihr einer der Arbeiter, wie sie in Neuseeland ihre Cola trinken: sie füllen die Flasche mit salzigen Erdnüssen und schütten den Inhalt dann in sich hinein. Dieser Mann schmilzt später das Gold, das sie gefunden hat, ein und schickt es ihr als Kette.
In Christchurch auf der Südinsel Neuseelands arbeitet sie eine Weile mit Behinderten. Eine deutsche Freundin, die sie dabei kennen lernt, geht zu einem Praktikum ins Gefängnis nach Auckland im Norden der Nordinsel und lädt Biene ein, sie dort zu treffen. Beim gemeinsamen Ausgehen in Auckland bringt der Freund der deutschen Freundin einen Mann mit, Andre. Andre, ein Slowene, ist mit seinen Eltern noch vor dem Balkankrieg mit siebzehn nach Neuseeland ausgewandert. In ihn verliebt sich Biene. Obwohl sie am nächsten Tag weiter nach Australien fliegen wollte, verlängert sie ihr Flugticket um drei Wochen.
Er wohnt noch bei seinen Eltern und lädt sie ein, diese drei Wochen bei ihm zu verbringen. Seine Mutter sagt des Öfteren „Joi“ (Jesus), das erinnert sie an das Dorf ihrer Großeltern in Rumänien und es wird ihr warm ums Herz dabei.
Andre kündigt seine Arbeit und bucht für sich ein Flugticket, um gemeinsam mit Biene weiterreisen zu können. Zusammen besuchen sie Australien, Thailand, England und Deutschland. Dann trennen sich erst einmal ihre Wege. Biene geht nach Deutschland, Andre nach Slowenien. Slowenien ist noch nicht der EU angeschlossen, daher kann Andre nicht in Deutschland wohnen und Biene nicht in Slowenien.
Sie nimmt sich ein Zimmer in Stuttgart, will das Abitur nachmachen und „Internationale Beziehungen“ studieren. Die Trennung von Andre lastet aber schwer auf ihr und sie fragt sich: „Was will ich wirklich?“ Sie will bei Andre sein. So entschließt sie sich, nach Slowenien zu fahren und dort bei einer Bank zu arbeiten. Er macht ihr einen Heiratsantrag und schlägt vor, gemeinsam in England zu leben. Das wird dann ihr drittes Jahr in England. Dort bekommt sie eine Position im Telemarketing des „Motor Racing Worldwide“ und verkauft VIP-Tickets für „Formel 1-Rennen“ an Deutsche. Das macht sie zwei Monate lang. Danach verdient sie ihr Geld für einige Wochen bei der „Banque Paribas“, einer französischen Bank.
Im Oktober 1998 wollen beide nach ihrer Hochzeitreise für sechs Monate in Österreich im Skibetrieb arbeiten und für ein weiteres halbes Jahr bei einer amerikanischen Familie auf einer Yacht anheuern. Ganz unerwarteterweise stellt Biene jedoch fest, dass sie schwanger ist. Somit fallen alle Pläne ins Wasser und beide bleiben länger als geplant in London. Biene spricht bei einer Londoner Bank vor, dabei platzt ihr wegen der Schwangerschaft der oberste Hosenknopf. Sie muss lachen und bemerkt, dass ihr Gegenüber keine Miene verzieht. Sie wird nicht eingestellt.
Ihr ist jetzt fast ständig übel und sie verliert acht Kilo an Gewicht. Im März 1999 kehrt sie nach Deutschland zurück, weil sie ihr Kind nicht in einem englischen Krankenhaus bekommen möchte. Im Juni 1999 kommt ihre Tochter Nikita Tui zur Welt. Biene will eigentlich nur einige Monate in Deutschland bleiben. Als ihre Schwester jedoch vier Monate nach der Geburt von Nikita ihr Kind verliert, entschließt sie sich, länger zu bleiben, um die Schwester zu unterstützen. Andre jedoch fühlt sich in Deutschland nicht wohl.
Seine Eltern sind inzwischen von Neuseeland nach Australien ausgewandert und Andre möchte deshalb auch nach Australien gehen.
Zu Bienes 25. Geburtstag macht die Familie Urlaub bei einer Freundin in Kroatien. Die kleine Nikita ist inzwischen ein Jahr alt. Als Biene eines Morgens in die Küche kommt, spürt sie, wie ihr Mann sich von ihrer kroatischen Freundin angezogen fühlt.
Sie stellt ihn zur Rede, er sagt, es sei nichts zwischen ihm und der Freundin gewesen. Biene überlegt sich, ob sie ihn vernachlässigt hat und was sie an der Beziehung zu ihm ändern muss, damit das nicht wieder vorkommt.
Da Andre in Deutschland nicht heimisch wird, stimmt sie im Oktober 2000 zu, nach Australien überzusiedeln. Sie ziehen nach Mountain Creek, in das Hinterland der Sunshine Coast Queenslands zu ihren Schwiegereltern. Zu ihrer Überraschung ist sie dort als Schwangere nicht willkommen.
Das Problem ist wohl ihre Zugehörigkeit zur evangelischen Kirche, da Andres Eltern überzeugte Atheisten sind. Bereits bei ihrer Heirat bekommt sie das zu spüren. Als sie neben der standesamtlichen Trauung auch kirchlich heiraten will, schickt ihr Schwiegervater ihr einen elfseitigen Brief, in dem er ihr darzulegen versucht, warum es keinen Gott gibt. Daraufhin gibt sie den Gedanken an die kirchliche Heirat auf; sie ist sich jedoch nie sicher, ob sie auch vor Gott verheiratet ist. Zwar ist ihr die kirchliche Trauung sehr wichtig, andererseits will sie, dass Andre ehrlich ist und denkt sich: „Jeder braucht seine Zeit.“
In Australien haben sich die Eltern und die Schwester von Andre gegen sie verbündet und versuchen, sie zu überzeugen, dass es keinen Gott gibt. Auch muss sie mit ihrem dicken Bauch den Boden aufwischen, wenn ihre 16-monatige Tochter beim Essen etwas verschüttet; keiner hilft ihr dabei, sondern alle bleiben am Tisch sitzen und sehen ihr dabei zu, wie sie sich schwer tut, um sich wieder aufzurichten. Das empfindet sie als äußerst demütigend. 2001 kommt dort ihr Sohn Luka zur Welt.
Ihre Kinder möchte sie auf jeden Fall evangelisch erziehen und mit ihnen auch Weihnachten feiern, aber das erlauben die Schwiegereltern nicht. So erlebt Biene dort die erste Weihnacht ohne Christbaum und ohne Sterne, was ihr sehr hart ankommt.
Ihr eigener Glaube an Gott ist sehr stark und war es bereits als Kind. Immer wenn sie als Kind geschlagen wird, ruft sie Gott um Hilfe an und dann „ bricht der Kochlöffel auseinander“.
Nach fünfmonatigem Aufenthalt bei den Schwiegereltern findet ihre kleine Familie eine Zwei-Zimmer-Wohnung in Mooloolaba, direkt an der Küste. Dann bekommt Andre einen Posten bei Aldi und wird zu einem einjährigen Training in die USA, nach Columbus in Ohio, geschickt. Während dieser Zeit muss Biene sich einer Ausschabung unterziehen. Sie bekommt Bluttransfusionen und fühlt sich generell sehr schwach. Sie kann vor Schwäche ihren Sohn nicht halten, ja nicht einmal eine Gabel zum Mund führen. Freunde bringen ihr Essen vorbei, bis sie sich wieder stärker fühlt.
Drei Monate später reist sie mit den Kindern in die USA. Am Anfang fühlt sie sich dort sehr einsam, da Andres Training bei Aldi von sieben Uhr morgens bis Mitternacht dauert. Nach einiger Zeit trifft sie einen Mann, der der Minderheit der Amish angehört und der einen Dialekt spricht, der sich für sie wie schwäbisch anhört.
Die Amish sind eine christliche Gemeinschaft, die nach ihrem Gründer Jakob Amman benannt ist. Sie entstand um 1630 in der Schweiz als eine abgespaltene Gruppe der Mennoniten. Beide Glaubensgemeinschaften gehören den Wiedertäufern an.
Wie auch die Mennoniten wurden die Amish verfolgt und wanderten in die USA aus, insbesondere nach Pennsylvania und Ohio. Sie leben ein einfaches, in der Landwirtschaft verwurzeltes Leben, befolgen die Worte der Bibel und legen großen Wert auf Demut und Bescheidenheit. Viele technische Neuerungen wie Autos lehnen sie ab. So sieht man am Aldi-Parkplatz viele Kutschen und viele Pferdeäpfel.
Ihr Gottesdienst wird in Privaträumen abgehalten. Dazu wird Biene eingeladen, das Gemeinschaftsgefühl spricht sie sehr an, es erinnert sie an Rumänien. In der Kirche lernt sie eine Frau kennen, die 22 Enkel hat. Mit deren Tochter Julia schließt sie eine enge Freundschaft; so gehen die nächsten sieben Monate in Ohio gut vorüber.
Am Ende dieser Zeit zieht sie mit Andre und den Kindern zurück nach Australien; zuerst nach Wollongong und dann nach Jervis Bay im Südosten des Bundesstaates New South Wales.
Dort ist es zwar landschaftlich sehr schön, aber sie empfindet trotzdem Heimweh nach Amerika, da sie niemanden kennt.
Andre möchte, dass sie arbeiten geht, doch sie sagt, dass es sich nicht lohne, da sie dauernd umziehen. Eine Tagesmutter würde mehr kosten, als sie verdienen könne.
Dann verliert Andre seinen Job bei Aldi und sie ziehen zurück nach Mountain Creek. So kann Andre noch zwei Jahre mit seinem Vater verbringen, bevor dieser stirbt. Bei diesem Umzug fällt ihr auf, dass sie schon wieder alleine ist. „Ich bin inzwischen richtig gut darin, Umzüge zu organisieren“, sagt sie heute.
Am ersten Abend bei den Schwiegereltern gibt es Erdbeeren. Biene liebt Erdbeeren. Die Mutter gibt allen am Tisch von den Beeren, nur ihr nicht. Biene ist den Tränen nahe, steht vom Tisch auf und geht weg. Die Eltern lassen Andre gegenüber die Bemerkung fallen: „Ist deine Frau schon wieder schlecht gelaunt?“ Biene macht sehr deutlich, dass sie hier nicht bleiben kann. Sie sucht sich eine Arbeit auf einer Erdbeerfarm, kommt nach Hause und bietet allen Erdbeeren an.
Die Gallenblase macht ihr zunehmend zu schaffen und sie muss sich daran operieren lassen. Im Jahr 2003 übersiedeln sie für drei Jahre nach Nord-Brisbane. Bei einem Besuch bei den Schwiegereltern wollen diese schon wieder über die Kirche diskutieren. Biene hat genug davon und möchte nach Hause nach Brisbane fahren, Andre weigert sich mitzukommen.
Danach verliebt sich Andre immer wieder in andere Frauen. Biene bekommt Ekzeme am Arm und immer wieder Durchfall. Es kommt der Zeitpunkt, da sie bemerkt: „ Wenn das so weitergeht, dann bin ich in zwei Jahren tot.“ Sie sucht einen Heilpraktiker auf, der sie Weizen und Milchprodukte absetzen lässt. Danach hört der Durchfall auf. Er spricht auch ihre Beziehung an, da weiß sie gar nicht, wovon er redet. Er lässt die Bemerkung fallen: „Tiger ändern ihre Streifen nicht; dein Mann ist nicht ehrlich zu dir.“
Als sie an diesem Samstag mit Andre vor dem Fernseher sitzt, sieht sie einen Film vor ihrem inneren Auge: Andre ist in einem Stripper Club. Sie konfrontiert ihn damit, er streitet es ab, lacht aber „komisch“ dabei. Sie sagt zu ihm: „Ich packe meine Sachen.“ Plötzlich gibt er mehrere Affären zu, zum Beispiel eine davon mit einer indigenen Frau, während sie mit Luka schwanger war. „Das hat wie ein Hammer hereingehauen bei mir“, sagt Biene. „Plötzlich waren wir auf einer gleichen Ebene. Vorher hat er auf mich herabgesehen.“ Beide entschließen sich zu einem Vipassana Retreat.
„Danach fing die Ungleichheit wieder an, er wurde gewalttätig und hat mich körperlich bedroht. Ich habe immer gebetet, er möge jemanden kennen lernen und mich verlassen, aber das ist nie passiert.“
Bienes Ekzeme sprechen gut auf eine kinesiologische Behandlung an. Deshalb entschließt sie sich, selbst eine kinesiologische Ausbildung zu machen, zusätzlich studiert sie online therapeutische Beratung. Nebenbei arbeitet sie in einem Geschäft für Swimmingpools.
Andre findet eine neue Arbeit in Brisbane. Martin, ein Kollege von Andre, kommt des Öfteren zu Besuch und Biene verliebt sich in ihn. Er ist das Gegenteil von Andre: ruhig, bedacht und liebevoll. Sie gesteht Andre ihre neue Liebe. Erstaunlicherweise sagt er nur: „Warum probiert ihr beide es nicht einfach. Ich will nicht mehr mit dir zusammen sein, wenn dein Herz woanders ist.“
Einen Monat später reagiert er aber doch sehr aufbrausend.
Biene ist seine Gewalttätigkeit schon von früher her gewohnt.
Sie erinnert sich an eine Gelegenheit, als nach einem von Andres Wutausbrüchen beide Kinder sie nur ansahen und sich ins Auto setzten. „Ich setzte mich hinein und wollte Andre für immer verlassen. Ich hatte nur meine Handtasche dabei. Ich wusste nicht wohin und wollte mit den Kindern im Auto schlafen. Beim Rückwärtsfahren habe ich mit dem Auto gleich einen Unfall gebaut, weil ich so durcheinander war. Andre kam und hat mich am Hemd gepackt und in der Luft hochgehalten und mir leise gesagt, wenn du abhaust, verschwinde ich mit den Kindern für immer, wo du mich nie finden kannst. Die Kinder bleiben bei mir. Ich wusste, er meinte es ernst. Ich habe ihn jedoch immer entschuldigt.“
Ein paar Monate später kommt sie nach Hause. Andre sagt zu ihr, er habe Nikita „angeschrien“ und sie ist verschwunden. Er kann sie seit zwei Stunden nicht mehr finden. „Also begann ich, sie zu suchen. Und ich war so sehr erleichtert, als ich sie gefunden habe. Sie hatte sich unter unserem Haus hinter einem Holzstapel versteckt – über zwei Stunden lang! Ich hatte immer ein schlechtes Gewissen, dass ich sie nicht beschützen konnte, weil ich arbeiten gehen musste. Aber verlassen konnte ich Andre nicht, sonst würde er mit Nikita und Luka in irgendeinem Land verschwinden. Er sagte mir das mehr als einmal.“
Es folgt eine Zeit des großen Dramas des Auseinandergehens. In dieser Zeit kommt Martin, ihr neuer Partner und ist ihr eine große Hilfe.
Zunächst zieht Andre in das Haus seiner Mutter in Slowenien. Als er wiederkommt, explodiert er derartig, dass Biene denkt, er würde sie jetzt umbringen. Ihre Tochter, die alles mitbekommt, zittert in der Schule unkontrollierbar. „Ich dachte, dass ich das alles als Therapeutin niemandem erzählen darf“, sagt Biene. Andre droht jedoch damit, „Hitmen“ (bezahlte Killer) einzuschalten. Daraufhin ruft sie die Polizei und erwirkt eine „Domestic Violence Order“, die besagt, dass Andre per Gesetz nicht näher als 50 Meter an sie oder ihre Tochter herankommen darf. „Ich habe immer gedacht, es ist seine Kultur, das Leidenschaftliche. Im Guten und im Negativen.“ Jetzt aber bricht sie jeden Kontakt zu Andre ab und reicht die Scheidung ein.
Bei diesem Prozess spürt sie die Unterstützung ihrer Eltern, insbesondere ihrer Mutter, die inzwischen eine ihrer engsten Bezugspersonen geworden ist.
Martin besucht sie immer wieder. Im Oktober vor drei Jahren findet Biene mit Martins Hilfe eine neue Wohnung. Martin zieht mit in die Wohnung ein. Jetzt endlich können sie die Ruhe genießen. Andre findet eine neue Freundin. Biene möchte ihn immer noch sehen, erinnert sich auch an die schönen Zeiten mit ihm. Ihr Wunsch ist es, „normal“ miteinander am Tisch zu sitzen und zu essen. Ihre Kinder verstehen sich gut mit Martin. Angst macht ihr allerdings, dass Nikita so viel Schreien erlebt hat, dass es für sie der Normalzustand ist. Therapeutische Hilfe lehnt ihre Tochter ab.
Biene arbeitet im Augenblick als Animateurin in einem Seniorenheim, kümmert sich aber auch um die Palliativpflege.
Gleichzeitig macht sie eine Ausbildung in Gestalt-Therapie und studiert für ein Graduiertenzertifikat in Psychischer Gesundheit, das sie in wenigen Monaten abschließen wird. Sie hofft dann, dass sie eine Stelle annehmen kann, die ihr mehr Geld einbringt, denn das Leben in Australien ist sehr teuer geworden.
Biene wird dieses Jahr 40 Jahre alt. Als Therapeutin kann sie aufgrund der eigenen Lebenserfahrung viel verstehen und sagt von sich selbst: „Ich lerne aus Erfahrung. Wenn ich denke, was die Leute für Schicksale haben, da habe ich es doch eigentlich gut.“ Und wenn sie darüber nachdenkt, warum sie sich in Andre verliebt hat: „Es war das ‚Joi ‘ seiner Mutter, das mich an Opa und Oma erinnert hat, denn die Urlaube in Rumänien zählen zu den schönsten Zeiten meines Lebens.“
Auch mit Edmund, ihrem ehemaligen Freund aus Tansania, kann sie den Kreis schließen. Sie trifft seine Cousine hier in der Nähe ihres Zuhauses. Von ihr erfährt sie, dass er geheiratet hat und immer noch in London lebt. Jetzt hat sie mit Edmund Kontakt über Facebook.
Auch wenn sie darüber nachgedacht hat, nach Deutschland zurückzukehren, dürfte sie die Kinder nicht mitnehmen. Deshalb kommt das jetzt nicht in Frage. Ab und zu besucht sie ihre Eltern in der alten Heimat, will jedoch nach zwei Wochen immer wieder zurück nach Australien. Zu Hause bei ihren Eltern wird sie wieder zur 14-jährigen und das ist ihr nicht angenehm.
Letztlich möchte sie auch dort leben, wo ihre Kinder sind.
Verschiedene Träume möchte sie sich noch erfüllen: mit indigenen Australiern therapeutisch arbeiten, Orang Utans in Malaysia betreuen und Therapeutin mit Tieren werden. Im Moment schreibt sie ihre Masterarbeit für die Gestalt-Therapie über das Thema: „Was passiert in der Attraktion zwischen Mensch und Tier?“
Ihr Großvater ist vor einem Jahr gestorben, was einen großen Verlust für sie bedeutet. „Immer wenn ich spirituelle Fragen hatte, habe ich bis zu zwei Stunden mit meinem Opa telefoniert.“





























