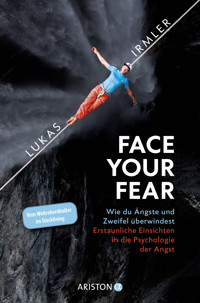
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ariston
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Der Balanceakt zwischen Ängsten und Träumen
Was hält Dich davon ab, Deine Träume wahr werden zu lassen? Die Angst vor dem Unbekannten, vor dem Scheitern oder vor der eigenen Courage?
Bei Extremsportler Lukas Irmler drohte die Höhenangst seinen großen Traum zerplatzen zu lassen, noch ehe seine Reise richtig begonnen hatte. Heute ist der 36-jährige Profi-Slackliner mehrfacher Guinness-Weltrekordhalter. Er läuft über die längsten Slacklines der Welt und liebt heute genau das, was ihn früher in Panik versetzte: extreme Höhe und das Gefühl der Ausgesetztheit.
In diesem Buch erzählt er von seinen ersten Schritten und Stürzen in der Welt der dynamischen Balance. Von der plötzlichen Klarheit, mit der er einen neuen Beruf und eine Berufung für sich findet. Sein Credo: Wer tut, was er liebt, wird zwangsläufig gut darin – auch wenn der erste Schritt furchteinflößend sein mag.
Lass Dich von Lukas Geschichte inspirieren, Deinen eigenen Weg zu gehen und finde heraus, welche Träume jenseits Deiner Ängste auf Dich warten!
- Ängste überwinden und Träume realisieren mit dem mehrfachen Weltrekordhalter im Slacklining
- Lektüre am Limit: reich bebildert für den extra Thrill beim Lesen
- Für Leser*innen von Jan Frodeno, Boris Herrmann und Reinhold Messner
- Wer tut, was er liebt, wird zwangsläufig gut darin
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 292
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
DERBALANCEAKTZWISCHENÄNGSTENUNDTRÄUMEN
Was hält Dich davon ab, Deine Träume wahr werden zu lassen? Die Angst vor dem Unbekannten, vor dem Scheitern oder vor der eigenen Courage?
Bei Extremsportler Lukas Irmler drohte die Höhenangst seinen großen Traum zerplatzen zu lassen, noch ehe seine Reise richtig begonnen hatte. Heute ist der 36-jährige Profi-Slackliner mehrfacher Guinness-Weltrekordhalter. Er läuft über die längsten Slacklines der Welt und liebt heute genau das, was ihn früher in Panik versetzte: extreme Höhe und das Gefühl der Ausgesetztheit.
In diesem Buch erzählt er von seinen ersten Schritten und Stürzen in der Welt der dynamischen Balance. Von der plötzlichen Klarheit, mit der er einen neuen Beruf und eine Berufung für sich findet. Sein Credo: Wer tut, was er liebt, wird zwangsläufig gut darin – auch wenn der erste Schritt furchteinflößend sein mag.
Lass Dich von Lukas Geschichte inspirieren, Deinen eigenen Weg zu gehen und finde heraus, welche Träume jenseits Deiner Ängste auf Dich warten!
Lukas Irmler
Mit Lena Schindler
Face Your Fear
Wie du Ängste und Zweifel überwindest – Erstaunliche Einsichten in die Psychologie der Angst – Vom Weltrekordhalter im Slacklining
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet unter www.dnb.de abrufbar.
© 2024 Ariston Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Alle Rechte vorbehalten
Redaktion: Marie Melzer
Umschlaggestaltung von wilhelm typo grafisch, Zürich unter Verwendung eines Motivs von Valentin Rapp
Satz und E-Book Produktion: Satzwerk Huber, Germering
ISBN 978-3-641-32394-3V001
Inhalt
Prolog
Kapitel 1 Erkenne deine Motivation und Leidenschaft: Jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt
Kapitel 2 Wie ich meine Angst überwand: »Do one thing everyday that scares you«
Kapitel 3 Just Trust: Warum es sich lohnt, dem Leben zu vertrauen
Kapitel 4 Der Weg zum großen Traum: Wer nur das Ziel vor Augen hat, übersieht das Wesentliche
Kapitel 5 Kreative Neuorientierung: Die prägendsten Erfahrungen machen wir fern von aller Sicherheit
Kapitel 6 Die Kunst des Scheiterns: Was Erfolg bedeutet, definierst du für dich selbst
Kapitel 7 Fokus auf das Hier und Jetzt: Weil nichts wichtiger ist als der Augenblick
Kapitel 8 Träum weiter! In jedem neuen Ziel liegt die Chance, zu wachsen
Epilog
Dank
Quellennachweis
Bildnachweis
Prolog
Es ist der 27. Oktober 2016. Ich stehe auf einem Felsen oberhalb des mittelalterlichen Bergdorfs Saint-Jeannet im Süden Frankreichs, blicke auf die geduckten Steinhäuser, die sich am Hang des Berges zusammengedrängt haben, als suchten sie Schutz. Ich ziehe meine Schuhe und Socken aus, klemme beides in eine Felsspalte. Wie schon 100 Mal zuvor greife ich nach meinem Sicherungsseil und binde den Knoten, kontrolliere den Sitz meines Klettergurtes und ziehe ihn nochmal bis zum Anschlag zu. Langsam gehe ich in die Hocke und schwinge ein Bein über die Slackline, die in mehr als 250 Metern Höhe über den Abgrund führt. Meine nackten Füße verlassen den kalten Stein und ich spüre den Wind an meinen Zehen. Seitwärts sitze ich auf der Line, wie auf einem Geländer, rutsche langsam nach vorn. Ich atme ruhig und bewusst, fühle trotzdem meinen Herzschlag bis zum Hals. So wenig wie möglich versuche ich wahrzunehmen, wo ich gerade bin. Fokus! Für diesen Moment habe ich zehn Jahre lang trainiert, schießt es mir durch den Kopf. Die längste Slackline der Welt liegt vor mir. Ich blicke mich noch einmal um zu meinen Freunden am Rand, nicke ihnen kurz zu und wende mich wieder dem schmalen Band zu, das vor mir in den Wolken verschwindet. Es ist Zeit. Ich atme ein und sage zu mir selbst: »Genieß jeden Schritt!« Ich setze den Fuß aufs Band und stehe auf. Sofort mache ich den ersten Schritt und meine Reise beginnt.
So eine Line zu laufen war immer mein Traum. Die Idee, die mich antrieb, mich weiterzuentwickeln, Neues zu lernen und immer wieder aus meiner Komfortzone auszubrechen. Was aber braucht es, um so einen Traum Realität werden zu lassen? Zu Beginn war es für mich unvorstellbar, auf der Slackline überhaupt die Balance zu finden, doch genau das war für mich der Ansporn, es erst recht zu versuchen.
Die Slackline zeigte mir schnell, was alles möglich ist, wenn man nicht aufgibt und seiner Angst ins Gesicht sieht. Die Erfahrungen, die ich auf diesem zweieinhalb Zentimeter dünnen Band machen darf, das in großer Höhe gespannt wird, lassen sich jedoch auch auf ganz andere Lebensbereiche übertragen. Sie stehen sinnbildlich dafür, was man gewinnt, wenn man bereit ist, sich seiner Angst zu stellen und Wege zu finden, gemeinsam mit ihr weiterzugehen. Dann steht uns auf einmal die Welt offen.
Träume werden selten über Nacht real. Nicht aufgeben, Vertrauen haben, beharrlich weiterlaufen, das war immer mein Weg zum Erfolg. Jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt und der ist meist der schwierigste. Sich überhaupt einmal zu überwinden loszugehen. Mit jedem einzelnen Schritt können wir jedoch wachsen und unseren Träumen näherkommen. Nie hätte ich am Anfang zu denken gewagt, dass ich einmal über Hunderte von Metern tiefe Schluchten balancieren und mir wünschen würde, dieser Moment möge nie zu Ende gehen. Es war zu weit weg, im wahrsten Sinne des Wortes undenkbar. Auch konnte ich mir nicht vorstellen, dass ich eines Tages sogar einen Längenrekord im Slacklinen aufstellen würde, wie ich es schließlich tat. Im Jahr 2019 überquerte ich eine 2000 Meter lange Highline über einer stillgelegten Asbestmine im kanadischen Val-des-Sources und holte mir damit den ersehnten Weltrekord. Im Jahr 2021 brach ich zusammen mit drei weiteren Slacklinern in Lappland den Rekord erneut: eine 2130 Meter lange Slackline nahe des Nationalparks Abisko in unvorstellbaren 600 Metern Höhe über der Lappenpforte, auch Lapporten genannt.
Doch allein die Länge oder die Höhe waren es nicht, die den Erfolg ausmachten, nicht nur das Erreichen des Ziels. Es war das Gefühl, ganz im Hier und Jetzt zu sein. Und das Glück, das ich spürte, solche Momente zusammen mit meinen besten Freunden erleben zu dürfen. Ab einem gewissen Zeitpunkt stellte sich dieses Glücksgefühl nicht mehr erst dann ein, wenn die Line geschafft war und hinter mir lag, sondern bereits während ich auf ihr balancierte. In diesem Augenblick, in dem ich genau dort war, wo ich sein wollte. Genau das tat, wovon ich lange geträumt hatte. Irgendwann fing ich an, sogar absichtlich von der Line in die Sicherung zu springen, um mich mit dem Gefühl des Sturzes in die Tiefe gezielt zu konfrontieren – genau dem, was mir am meisten Angst machte. Längst war mein Ziel nicht mehr ein einziger Schritt, ich war ganz schön nah dran am Traum vom Fliegen.
Ein Balanceakt zwischen Ängsten und Träumen
Was wir häufig so liebevoll als »Komfortzone« bezeichnen, kommt mir manchmal eher wie ein selbst erschaffener Käfig vor. Von unserem gemütlichen kleinen Territorium, in dem wir uns wohl und sicher fühlen, schauen wir mit ein bisschen Wehmut in die Ferne, wo so viele Ideen und Träume auf uns zu warten scheinen. Doch wir haben Angst, diesen Fleck zu verlassen. Haben Angst vor dem Unbekannten und sind manchmal auch einfach zu träge, um uns wirklich anstrengen zu wollen. Natürlich ist dieser Rückzugsort für uns Menschen wichtig, um Kraft zu schöpfen und uns entspannen zu können. Einen Großteil des Lebens verbringen wir aber doch damit, von dort hinauszuschauen und uns vorzustellen, was uns Großartiges passieren könnte, wenn wir den Mut finden würden, uns in die weite Welt zu wagen. Viele Dinge sind nur so lange angsteinflößend, bis wir sie wirklich versuchen. Wir haben oft ganz andere Möglichkeiten, den Hindernissen auf dem Weg zu unserem Traum zu begegnen, als wir glauben. Auch wenn es für manche paradox klingen mag: Wer seiner Angst begegnen will, der kann lernen, den Blickwinkel zu verändern – mit Abstand darauf zu schauen, auch wenn er mittendrin steckt.
Wenn wir Neues wagen, sind wir häufig mit unserer Angst konfrontiert, zu scheitern, unsere Gesundheit zu gefährden oder sogar unser Leben. Aber nur wenn wir versuchen, diese Grenze zu verschieben, uns dieser Angst auszusetzen, der Herausforderung nicht den Rücken zuzuwenden, sondern trotzdem weiterzulaufen, kommen wir unseren Träumen ein Stückchen näher. Ich musste mich immer wieder in furchteinflößende Situationen hineinbegeben, um meine Ängste schlussendlich zu überwinden.
Neben der Frage, wie ich mit meiner Höhenangst umgehe, möchten die Menschen am häufigsten von mir wissen, ob ich Man on Wire gesehen habe. Der Dokumentarfilm basiert auf dem Buch Über mir der offene Himmel von Philippe Petit und erzählt von seinem Hochseillauf zwischen den Zwillingstürmen des New Yorker World Trade Centers. Meine Antwort lautet: »Und ob ich den Film gesehen habe, nicht nur einmal!« Und ich war fasziniert von der Geschichte des französischen Hochseilartisten, der jahrelang von dieser Idee träumte und sie am 7. August 1974 schließlich Realität werden ließ. Ohne Sicherheitsnetz und ohne offizielle Genehmigung. Gegen viele Widerstände und jedweder Vernunft zum Trotz. Am Vorabend verschaffte er sich mit seinen Helfern Zugang zum Südturm, der noch im Bau war. Massenhaft Ausrüstung, darunter ein über 200 Kilogramm schweres Drahtseil, schmuggelten sie aufs Dach des Gebäudes. Um nicht entdeckt zu werden, mussten sie stundenlang bewegungslos unter Planen ausharren. Als er das Seil am nächsten Morgen bestieg, blieben Tausende von Menschen auf dem Weg zur Arbeit stehen und starrten ungläubig nach oben. Fast einen halben Kilometer über ihren Köpfen balancierte Philippe im schwarzen Kostüm – bis er schließlich auf der Plattform des World Trade Centers verhaftet wurde.1
Auch wenn das Laufen auf einem Drahtseil für Außenstehende dem Slacklinen sehr ähnlich erscheinen mag, so funktionieren diese beiden Sportarten nach vollkommen unterschiedlichen Prinzipien. Das Drahtseillaufen ist eine statische Form der Balance. Philippe scheint komplett ruhig und ohne jede Anstrengung über das Seil zu spazieren. Auf der Slackline bin ich jedoch permanent in Bewegung und am Kämpfen, um das Gleichgewicht zu halten. Was aber nicht nur daran liegt, dass Philippe das Balancieren schon viel länger betreibt als ich. Die Slackline ist einfach nicht so straff gespannt wie das Drahtseil und dadurch in permanenter Bewegung und Schwingung. Es ist die dynamischste Form der Balance, die ich mir vorstellen kann.
Für mich auch eine tolle Metapher für unser heutiges Leben. Ging es vor 50 Jahren noch darum, auf seinem stringenten Lebensweg bloß nicht danebenzutreten, leben wir jetzt in einer Welt der permanenten Veränderung und Dynamik, sind immer wieder damit konfrontiert, unsere Balance neu finden zu müssen. Mit jedem Schritt kann sie uns verloren gehen, wir müssen sie neu für uns definieren und uns wirklich anstrengen, oben zu bleiben. Früher mag man als unstet gegolten haben, wenn man öfter mal den Kurs gewechselt hat, heute sind Flexibilität, Offenheit und Mut für Veränderung Qualitäten, die Anerkennung finden. So symbolisiert das Drahtseillaufen für mich persönlich auch ein Stück weit die Vergangenheit und das Slacklinen die Zukunft – auch im übertragenen Sinn. Die Slackline bietet dabei viel mehr Möglichkeiten und Chancen als das starre Drahtseil. Wir können uns ausprobieren und ab und an auch über unser Limit hinausgehen, nicht zuletzt, weil wir gesichert sind, was auf dem Drahtseil nicht der Fall ist.
»Life is being on a wire, everything else is just waiting«2, soll eines der Lieblingszitate des deutsch-amerikanischen Zirkusakrobaten und Hochseilartisten Karl Wallenda gewesen sein. Das mag sehr radikal formuliert sein, aber es spricht dennoch etwas in mir an. Denn egal ob Slackline oder Drahtseil, wenn ich dort oben durch die Luft laufe, dann lebe ich wirklich im Moment. Das haben beide Formen der Balance gemeinsam. Auf dem Drahtseil, wo tatsächlich das eigene Leben auf dem Spiel steht, und auf der Slackline, wo es sich so anfühlt, als täte es das. Für mich liegt viel in diesem Zitat, weil es zeigt, wie besessen man sein muss, um große Ideen umzusetzen. Gleichzeitig müssen wir den Satz noch ein bisschen weiterdenken, finde ich. Denn man sollte doch eigentlich danach streben, sein ganzes Leben nach dieser Prämisse auszuschöpfen, nicht nur die besonderen Momente in der Luft. Dann müssten wir nicht so viel auf das Glück warten. Genauso wie diesen besonderen Moment dort oben sollten wir jeden Moment unserer Reise voll und ganz leben, jede neue Begegnung genießen, denn alles hängt miteinander zusammen.
Durch das Überwinden meiner Höhenangst habe ich nicht nur sportliche Erfolge erzielen können. Vor allem durfte ich dadurch vieles lernen, das ich so niemals erwartet hätte, ich durfte mich als Mensch weiterentwickeln und so viel Spannendes über mich und das Leben erfahren. Wenn du gewohntes Terrain verlässt und Neues wagst, ist die Angst dein ständiger Begleiter. Sie ist aber auch ein wertvoller Wegweiser hin zu deinen größten ungenutzten Potenzialen. Ich musste mich ihr stellen, sie an die Hand nehmen und mit ihr den Weg weitergehen. Die dynamische Balance riss mich aus allem heraus, was ich bisher kannte und stieß die Tür zu einer unbekannten Welt auf. Ich durfte lernen, was es bedeutet, das große Wort »unmöglich« zu überwinden. Seither weiß ich, dass Träume immer weiter wachsen, wenn man sie lebt.
Kapitel 1
Erkenne deine Motivation und Leidenschaft: Jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt
Zehn Jahre zuvor, Freising in Bayern
Mein Puls hämmert, der Atem geht flach. Die Handinnenflächen schwitzen. Ich bin neunzehn Jahre alt und stehe mit weichen Knien auf dem extra reißfesten Schlauchband aus Nylon, das ich mit meinem Freund Bernie zwischen zwei alten Kirschbäumen gespannt habe. In fünf Metern Höhe neben einem Fußballplatz, unweit von meinem Elternhaus. Meine Hand umschließt einen Ast, ich fühle die raue Rinde an meinen Fingern, meine letzte Sicherheit. Ich möchte loslassen, aber ich kann nicht. Mein Körper ist wie gelähmt.
Nach endlosen Materialstudien und stark an den Physikunterricht in der Schule erinnernden Experimenten sind wir uns eigentlich sicher, dass die fünfzehn Meter lange Slackline halten muss, die wir mit Bandschlingen und Karabinern vom Klettern befestigt haben. An ein weniger gespanntes Seil, das als Redundanzsystem oder Back-up unter der Line verläuft, haben wir nicht gedacht, zumindest aber an eine mit der Line verbundene Leash vorn am Klettergurt, die uns auffangen wird. Wir mögen ziemlich übermütig sein, komplett wahnsinnig jedoch nicht.
So wirklich vertraue ich unserer Konstruktion in diesem Moment nicht mehr. Wie würden die Kräfte tatsächlich wirken, wenn ich falle? Damit, dass genau das passieren wird, rechne ich fest. Unmöglich zu sagen, wie lange ich hier schon stehe und mich in Absturzszenarien hineinsteigere. Minuten, die nicht enden wollen. Ich kann an nichts anderes denken als an den Aufprall in fünf Metern Tiefe, der mir mit dem ersten Schritt unweigerlich bevorzustehen scheint.
Meine allererste Slackline-Erfahrung lag damals schon über ein Jahr zurück. Es war im Jahr 2005, und ich wohnte bei meinen Eltern, ein Dreispänner-Haus im bayerischen Freising. Eine Sackgasse etwas außerhalb des Zentrums, viele Schrebergärten, nah an der Natur. Wenn ich aus unserer Haustür trat, konnte ich seit ein paar Wochen meinen Nachbarn Markus über ein Band spazieren sehen, das er zwischen Bäumen im Garten gespannt hatte. Es sah leicht, fast spielerisch aus, hatte aber gleichzeitig etwas Unwirkliches. Zu der Zeit hatte ich schon das Klettern für mich entdeckt, war mir sicher, in allen erdenklichen Situationen gut die Balance halten zu können. Doch als ich einmal bei Markus probieren durfte, einen Fuß auf das nur wenig gespannte Band zu stellen und aufzustehen, ging wirklich gar nichts, keine Chance. Er erklärte mir, dass ich meinen Fuß parallel zur Slackline am Boden aufsetzen solle, um mit etwas Schwung das Gewicht vom Standbein am Boden auf das andere Bein auf dem Band zu verlagern. Doch sobald ich es versuchte, fing der Fuß auf der Line massiv zu zittern an, er schwankte mit ihr hin und her, und es war unmöglich, mein gesamtes Gewicht darauf zu bringen. Mit einem Fuß am Boden und dem zweiten unkontrolliert wackelnd, musste ich einsehen, dass ich es einfach nicht schaffte, einen Balancepunkt zu finden. Niemals konnte das funktionieren. Ein ernüchterndes, entmutigendes Gefühl. Wahrscheinlich hätte ich es dabei belassen und nie wieder probiert. Doch knapp ein Jahr später entdeckte ich hinter der Kletterhalle, in der ich fast täglich trainierte, eine festinstallierte Slackline, bei der man von einem Holzstamm aus loslaufen konnte, ohne sich von unten hochdrücken zu müssen. Eine deutlich bessere Startposition. Nach einer Stunde und bestimmt mehr als 60 kläglichen Versuchen hatte ich endlich einen Schritt geschafft. Immerhin, ein erster Schritt! Der Gedanke, die etwa zehn Meter lange Slackline jemals ganz überqueren zu können, schien nach wie vor unendlich weit weg. Dennoch war etwas anders, zumindest schien es jetzt denkbar, dass es überhaupt klappen könnte. Der Idee, sich durch die Luft zu bewegen, haftete etwas Magisches an, das mich reizte. Und für mich stand fest: Du musst das jetzt so lange probieren, bis du einmal rüberkommst!
Am nächsten Tag war ich wieder da. Am darauffolgenden und an dem danach. Anfangs ging ich vor und nach dem Klettern auf die Line, und als es noch immer nicht funktionierte, beschloss ich, mich eine Weile nur noch darauf zu fokussieren. Eine Woche lang habe ich nichts anderes gemacht, als verbissen zu versuchen, bis ans andere Ende zu kommen. Wie ein kleines Kind, das etwas Unbekanntes in die Hand bekommt und es für sich erschließen und begreifen möchte, wollte ich verstehen, wie es funktioniert. Der erste Schritt war gemacht, aber nun stellte ich fest, dass der zweite komplett anders war. Der Beginn der Line ist fest. Je weiter du dich aber der Mitte näherst, desto flexibler und beweglicher wird sie. Jeder Schritt ist neu, alles ist in Bewegung und ändert sich permanent. Unvorhersehbar, unplanbar, unberechenbar – für mich. Genau das machte es so reizvoll. Ich hatte mich mental verbissen in dem Ziel, es einmal schaffen zu wollen. Nach ein paar Tagen gelangen mir mehrere Schritte, ich zählte und feierte jeden Einzelnen. Fünf, zehn, fünfzehn. Bis ich nach einer Woche tatsächlich den zweiten Baumstumpf erreichte, ohne herunterzufallen. Nach unendlich vielen missglückten Versuchen setzte ich meinen Fuß auf den Baumstamm, der das Ende des Bandes bildete. Ich drehte mich um, blickte ungläubig auf die Slackline, die ich gerade zum ersten Mal überquert hatte, warf die Arme in die Luft und stieß einen Freudenschrei aus, den man vermutlich in der halben Stadt hörte. Ich konnte es selbst kaum begreifen.
Dieses erste Hochgefühl werde ich nie vergessen. Die Line, die mir bisher so unendlich lang vorgekommen war, sah vom Ende aus betrachtet auf einmal recht überschaubar aus. Ein Schlüsselmoment, in dem ich verstand, dass Dinge, die initial völlig unmöglich erscheinen, nicht unbedingt unmöglich sein müssen, sondern es nur eine Frage der Zeit und der Übung ist, bis sie Wirklichkeit werden. Wenn ich etwas hart genug verfolge, dann schaffe ich das, was vor einer Woche undenkbar schien. Es waren nur wenige Meter, aber allein diese Erfahrung schien Grenzen zu sprengen. Welche großartigen Möglichkeiten warteten auf mich, wenn ich nur entschlossen genug dranblieb?
Dass ich die Slackline einmal überquert hatte, hieß aber noch lange nicht, dass ich das nun jedes Mal konnte. Ich musste mich perfekt konzentrieren und brauchte ein Quäntchen Glück, damit es gelang. Nach ein paar Wochen konnte ich sie recht sicher laufen. So unglaublich schwierig es zu Beginn auch war, so lernt der Körper doch schnell, sich auf eine neue Bewegungsform einzustellen. Aber anstatt zufrieden zu sein und mich auf meinem Erfolg auszuruhen, war sofort der Gedanke da: Was könnte ich mit der neu gewonnenen Fähigkeit noch alles machen? Wohin könnte die Reise gehen?
Der Garten der alten Frau Berghammer, gleich neben meinem Elternhaus, wurde mein Trainingsplatz. Mein Mikrokosmos. Die fest im Boden verankerten Retro-Wäscheständer, die sie mir bereitwillig zur Verfügung stellte, obwohl sie sich zunächst nur schwer erklären konnte, was ich damit vorhatte, wurden längst nicht mehr genutzt. Aber für mich hatten sie einen enormen Wert, denn sie waren stabil genug, um die Line daran zu befestigen – zumindest am Anfang. Mein Kumpel Bernie war meist dabei. Ziemlich amateurhaft bauten wir das Ganze auf, mussten alle zehn Minuten nach spannen, weil das Band schon wieder halb am Boden schleifte. Wir trainierten so viel, dass der eine Wäscheständer bald völlig verbogen war, sich Richtung Rasen neigte und wir bald die Kirschbäume am Fußballplatz für unsere Sessions ins Visier nahmen. Neben dem Üben auf der Line hatten wir aber auch Spaß daran, an unseren halb wissenschaftlichen Eigenkonstruktionen zu tüfteln, etwa mit unserem Kletterequipment einen Flaschenzug zu bauen, um mehr Spannung zu erzeugen. Damals konnte man nicht einfach in einen Laden gehen und sich das fertige Equipment kaufen, Slacklining steckte noch in den Kinderschuhen und niemand hatte hierzulande fertige Sets dafür im Sortiment. Es gab kaum jemanden, von dem wir uns etwas hätten abschauen können. Wenig später würde sich das ändern, aber in den ersten Jahren war das noch ein luftleerer Raum und wurde nur von ein paar wenigen betrieben. Jedenfalls in unserem Umfeld.
Als wir von einem Slackline-Festival in Österreich erfuhren, war klar, dass wir dabeisein mussten. Erst dort bekam ich eine Ahnung davon, dass es überall auf der Welt Leute gibt, die den Sport betreiben, und das auf einem Level, das ich so niemals erwartet hätte. Ein Amerikaner schaffte einen Vorwärtssalto auf der Line – unbegreiflich! Man konnte das Band offenbar so fest spannen, dass es dynamisch war. Etwas, das Bernie und ich oft versucht, aber nicht ansatzweise hinbekommen hatten. Zu sehen, da sind Leute, die das richtig ernst nehmen und nicht nur als Spielerei betrachten, da gibt es sogar Equipment, damit es besser funktioniert, war ein echter Eye Opener. Dadurch hat sich eine neue, größere Welt aufgemacht, die Grenzen verschoben sich. Auch der Kontakt zur Community war inspirierend, wir trafen auf offene, reisefreudige Leute, Entdeckertypen mit spannenden Lebensgeschichten. Die fünfzehn Meter am Fußballplatz hatten bisher unser Universum gebildet, hier war nun eine 100 Meter lange Slackline aufgebaut. 100 Meter, unglaublich! Keiner der Teilnehmenden konnte sie komplett laufen, aber ein paar haben es recht weit geschafft. Das war beeindruckend. Zumindest in der Theorie schien so etwas möglich zu sein.
Zurück in Freising, motivierte uns dieser veränderte Blickwinkel dazu, Neues zu wagen. Nun übten wir, auf der Line umzudrehen und wieder zurückzugehen, dann kamen die ersten Tricks. Es wurde extravaganter. Irgendwann fingen wir an, im Sitzen Müsli darauf zu essen und Kaffee zu trinken, ohne umzukippen. Am liebsten wären wir wohl gar nicht mehr runtergekommen. Von der Line. Aber auch mental. Jeden Tag neue Räume zu betreten und uns selbst zu testen, war ein beflügelnder Zustand.
Nichts ist unmöglich
Was käme als Nächstes? Wie wäre es, eine längere Line zu laufen, die viel stärker schwingen und noch herausfordernder sein würde? Wie ich loszog, um ein langes Schlauchband zu kaufen, erinnere ich noch genau. Es ging nach München zum Sporthaus Schuster. Wie viel ich denn benötige, wollte der Verkäufer wissen, zwei, drei oder vier Meter? Normalerweise benutzt man das Material für Kletterschlingen und dafür braucht man selten mehr als ein paar Meter. »50 Meter!«, sagte ich entschlossen und man konnte es in seinem Kopf förmlich arbeiten sehen. »Was hast du denn damit vor?«, wollte er wissen. »Slacklinen!«, antwortete ich selbstbewusst. Kopfschüttelnd maß er sie mir ab und übergab sie mir. Die Rolle war danach fast leer. Ich hatte zwar noch nicht die geringste Ahnung, wie ich sie spannen würde, aber dass mir fünfzehn Meter auf Dauer nicht reichen würden, war mir klar. Wer nach Großem strebt, darf manchmal auch naiv sein, muss es vielleicht sogar sein. Ein bisschen Selbstüberschätzung war auf jeden Fall dabei, sicher auch fehlender Realitätssinn. Wir hatten bisher nicht mal eine Methode, um 20 Meter ordentlich aufzubauen. Aber ich wollte mich nicht mit wenig zufriedengeben.
Das Gefühl, meine 50-Meter-Line mit stolzgeschwellter Brust in meinem Rucksack nach Hause zu transportieren, war richtig gut gewesen, aber bald wurden Bernie und ich mit der Wirklichkeit konfrontiert. Bei unseren ersten Versuchen mussten wir feststellen: Das Band war viel zu elastisch! Der Traum, darauf durch die Nachbarschaft zu spazieren und für eine lokale Sensation zu sorgen, zerplatzte. Aber auch wenn es niemals in voller Länge zum Einsatz kommen konnte, habe ich ein Stück davon bis heute aufbewahrt, in einer Kiste mit anderen Slacklines, die eine besondere Bedeutung für mich haben. Wegwerfen würde ich es nie, irgendwann bekommt es einen Ehrenplatz an der Wand. Denn auch wenn ich heute über unseren Übereifer lachen muss, zeigt die Geschichte auch, dass es sich auszahlt, groß zu träumen – oft allerdings erst viel später.
Manchmal frage ich mich, was es genau war, das meine Leidenschaft für ausgerechnet diesen Sport weckte. Woher kam diese Liebe zum Balancieren? Ein Stück weit vielleicht von meiner Mutter. Als Kind konnte sie an keinem Gartenzaun, keiner Mauer, keinem Baum vorbeilaufen, ohne hinaufzusteigen und ihren Gleichgewichtssinn auf die Probe zu stellen. Diesen Bewegungsdrang habe ich von ihr geerbt, den Wunsch, mich auszuprobieren. Sie war dieses Kind, dass mit den Jungs aus der Nachbarschaft Fußball gespielt hat und viel lieber draußen war als im Haus Fenstersterne zu basteln oder Aquarellbilder zu malen. Die Neugierde auf alles Unbekannte haben wir gemeinsam.
Von meinen Eltern weiß ich, dass ich als Baby die Krabbelphase komplett übersprungen habe, gleich versuchte, mich an Dingen hochzuziehen und selbstständig zu stehen. Tatsächlich gilt das Krabbeln aber als eine der wichtigsten Voraussetzungen für die weitere Entwicklung der Koordination von Händen und Augen – sowie für das Gleichgewicht. Oft sage ich im Spaß, dass ich da vielleicht etwas nachzuholen habe, da ich diese Entwicklungsphase einfach ausließ. So stellte ich dann später in meinem Leben fest, dass ich an meiner Balance arbeiten muss, weil sie bei mir nie so ausgeprägt war wie bei anderen. Das ist natürlich nur eine wilde Theorie und nicht wirklich ernst gemeint. Aber dennoch erzählt diese Geschichte etwas über mein Wesen. Wenn ich mir ein Ziel gesetzt habe, bin ich jemand, der dem straight nachgeht und sich nicht aufhält mit Dingen, die ihn davon abhalten könnten. Schon immer habe ich mich wohl mit Zielsetzungen gefühlt, die einem erst mal utopisch vorkommen mögen. Für Babys erscheinen Laufen und die Idee, irgendwo herumzurennen, auch als extrem weit weg, trotzdem bewältigen Kinder diese Hürde spielerisch. Wenn Leute das Slacklinen ausprobieren und nach drei, vier Versuchen sagen »Kann ich nicht«, dann antworte ich: »Wenn du als Kind nach ein paar Mal Hinfallen gesagt hättest, ›Gehen ist nichts für mich‹, wäre dein Leben nie richtig in Gang gekommen, und du hättest buchstäblich nicht deinen Weg gehen können.« Als Kind fällt dir das gar nicht ein. Da ist klar, du probierst es so lange, bis du es kannst. Diese Mentalität habe ich, glaube ich, nie verloren. Wenn es etwas ist, das du unbedingt tun willst, musst du es so lange üben, bis es klappt. Eine andere Option gibt es nicht. Auch der Wunsch, meinen Standpunkt verändern zu wollen, liegt in diesem Bild von einem Baby, das versucht, zu klettern und sich hochzuziehen. Mehr von der Welt sehen wollen als nur den Boden. Die Details, die man vielleicht beim Krabbeln entdeckt, haben mich nie interessiert, ich wollte lieber den Überblick über die Dinge haben. Schnellstmöglich über mich selbst hinauswachsen. In dieser Anekdote aus meinem ersten Lebensjahr kann ich mich gut wiederfinden, denn sie passt zu mir und meinem Selbstbild. Ein bisschen habe ich diese Haltung wohl einfach mitgebracht. Aber vor allem meine Mutter hat mir auch jeden Tag vorgelebt, dass man es nie einfach hinnehmen darf, wenn jemand sagt, etwas sei unmöglich. Für wen? Für alle anderen? Okay, aber ob das auch für mich stimmt, finde ich lieber selbst heraus!
Anderthalb Jahre nach mir kam mein Bruder Matthias zur Welt, viele Wochen zu früh und mit einer schweren körperlichen und geistigen Behinderung. Garantiert ein »Rollstuhl-Kind«, sagte der behandelnde Arzt, über Laufen bräuchte man gar nicht zu reden. Meine Mama hat das nie akzeptiert, von vornherein nicht, es nie auch nur als Möglichkeit in Betracht gezogen. Für sie war klar, der Junge wird laufen und hat ihn früh in die Physiotherapie gesteckt. Weil er verkürzte Sehnen in den Füßen hatte, sodass Laufen mechanisch gar nicht hätte funktionieren können, bekam er Schienen. Das Undenkbare wurde Wirklichkeit. Entgegen den pessimistischen Prognosen hat er tatsächlich Laufen gelernt, und nicht nur das, auch Dreirad fahren und Schwimmen. Im Wasser bewegt er sich heute wie ein Fisch, ganz natürlich, taucht endlos lang. Weil es ihn jede Einschränkung vergessen lässt, die Gravitation dann ausgehebelt ist. Wenn ich früher längst schlotternd und mit blauen Lippen am Beckenrand stand, war er noch im Wasser und machte keine Anstalten herauszukommen. Dass er so viel mehr erreicht hat, als die Experten und Expertinnen prognostiziert haben, ist seiner Kämpfernatur genauso zu verdanken wie der Haltung meiner Eltern, sich nicht abzufinden mit scheinbaren Wahrheiten.
In dieser Hinsicht haben mir meine Eltern einen grenzenlosen Optimismus vorgelebt, der viel dazu beigetragen hat, dass auch ich dieses Mindset entwickelt habe. Mich darauf zu fokussieren: Was kann ich aus dem machen, was da ist? Wie kann ich etwas Gutes daraus gewinnen, auch wenn die Bedingungen vielleicht nicht ideal sind? So haben sie die Situation mit meinem Bruder immer betrachtet: Was entwickelt sich in eine positive Richtung? Wo kann man ansetzen, um mehr herauszuholen? Bei jedem Problem zu gucken, wie man damit umgehen kann, anstatt den Fokus darauf zu richten, wie dramatisch es ist – auch entgegen den Aussagen der Ärzte, dass es sowieso nichts wird und es sich nicht lohnt, es überhaupt zu versuchen. Wenn du selbst davon ausgehst, dass dein Kind nicht gehen lernt, dann tust du auch nichts dafür. Es ist eine selbsterfüllende Prophezeiung, also eine Vorhersage, die durch bewusstes oder unbewusstes Handeln letztlich auch eintritt. Findest du dich zu früh damit ab, wirst du es nie ändern. Aber auch das Bewusstsein ist wichtig, dass jede Diagnose nur statistisch und man als Mensch ein Individuum ist. Dass es im Schnitt so kommt, heißt nicht, dass es das auch für das eigene Leben bedeuten muss.
In Retrospektive war es überlebenswichtig für meinen Bruder, dass er die Bewegung in sein Leben integrieren konnte, weil er in dieser Sache ein ähnlicher Typ ist wie ich, der den Drang hat, sich auszupowern, der diese Freiheit braucht, um mit sich selbst klarzukommen. Für Matthias hat es aber auch deshalb einen so enormen Stellenwert, weil er die Sprache nie vollständig hat entwickeln können. Oft ist er in seiner eigenen Welt versunken. Durch die Bewegung hat er ein Mittel gefunden, sich im Leben zurechtzufinden, eines, das für ihn einen noch größeren Wert hat als die Sprache.
Für mich und meinen Weg war das Aufwachsen mit meinem Bruder prägend. Weil ich gesehen und verinnerlicht habe, wie sich Grenzen durch mentale Stärke verschieben können. Aber sicher auch dadurch, dass ich oft auf mich gestellt war, was ich heute als Qualität begreife. Meine Eltern haben mir viele Freiheiten gegeben, weil sie sich gar nicht in der Form um zwei Kinder hätten kümmern können, wie sie es bei meinem Bruder tun mussten. Jede Person, die außergewöhnliche Leistungen erbringt, hat einen Grund dafür. Der Grund liegt natürlich zum einen darin, dass das, was man tut, einem viel gibt. Meist steckt aber noch etwas anderes dahinter, ein Mangel, den man versucht aufzuholen oder zu überkompensieren. Das geht wahrscheinlich jedem so, der etwas extrem betreibt. Vielleicht ist es bei mir auch ein Stück weit der Wunsch, gesehen zu werden und Anerkennung zu bekommen, der mich antreibt. Als etwas Negatives habe ich das jedoch nie betrachtet. Denn es ist immer die Frage, wie man damit umgeht und wie man es kanalisiert. Ob man darunter leidet oder es einen positiven Effekt hat, weil es einen irgendwo hinbringt, wo man sonst nicht wäre.
So bin ich früh selbstständig geworden. Gleichzeitig haben meine Eltern darauf vertraut, dass ich meine Entscheidungen richtig treffe. Ich machte keine Probleme, kam in der Schule gut klar, fand mich zurecht im Leben. Sie haben mich in all meinen Plänen vollständig unterstützt, mir nichts vorgeschrieben oder eingegriffen in das, was ich für richtig hielt oder mir für mein Leben vorgestellt hatte. Da war nie ein Druck da. Es hat mich enorm gestärkt, sie in jedem Moment hinter mir zu wissen.
Mit dem Gedanken an zu Hause verbinde ich vor allem das warme Gefühl von Gemeinschaft, es war eine extrem fürsorgliche Umgebung. Mein Bruder und ich standen uns sehr nah. Oft war ich wie sein Dolmetscher zum Rest der Welt. Wir haben so viel Zeit miteinander verbracht, und ich wusste meist, was er brauchte oder sagen wollte. Du lernst, Stimmungen zu lesen, Gesichtsausdrücke zu interpretieren. Wenn man damit aufwächst, bekommt man ein sehr gutes Verständnis dafür, was hinter dem steckt, was Menschen vordergründig sagen. Mein Bruder war nicht immer still, aber die Worte, die aus seinem Mund kamen, waren nicht zwingend das, was er sagen wollte. Wenn jemand nur darauf hörte, hat er den Kern des Ganzen verpasst. Die Rolle des Übersetzers habe ich als großer Bruder oft übernommen. Dadurch habe ich viel darüber gelernt, wie man mit Menschen umgeht, sie zu verstehen, empathisch zu sein. Die Klassensprecherrolle übernahm ich gern, weil ich es gewohnt war, die Stimme für jemand anderen zu sein. Für andere mitzudenken habe ich durch meinen Bruder früh gelernt.
Wie ich die Erfahrungen, die ich durch ihn gemacht habe, für mich nutzen kann, und wie viel Positives ich für mein weiteres Leben aus ihnen ziehen kann, ist mir erst heute bewusst. Sie haben viel damit zu tun, warum ich mich speziell in meinem Sport so entwickeln konnte, wie ich es getan habe – auch wenn es Zeit brauchte, das zu erkennen.
Manchmal gab es mit meinem Bruder Situationen, die ich hinnehmen musste. Es brachte mich nicht weiter, einen Schuldigen finden zu wollen, vielmehr musste ich darauf gucken, wie ich damit umgehe oder wie ich meinen Standpunkt dazu verändern kann, sodass es mich weniger belastet. Es steht mir frei, zu entscheiden, ob es mich runterzieht oder nicht. Das hilft mir beim Slacklinen extrem, in dem es sehr viel darum geht, was ich spüre und wie ich mit meinen Emotionen umgehe. Auf der Line bist du einem riesigen Gefühlschaos ausgesetzt. Einerseits liegt darin die Chance, sich genau anzuschauen, was in deinem Inneren los ist, andererseits ist da die Verlustangst, alles wegzuwerfen, wenn du einen einzigen Moment unachtsam bist und einen Schritt danebensetzt. Der Sturm, der in dir tobt, trägt rein gar nichts dazu bei, dass du bedacht und sinnvoll agierst. Die Gefühle zur Seite schieben zu können, sie zu kontrollieren und dich auf das zu konzentrieren, was da ist – eine unglaublich wertvolle Fähigkeit, die ich in der Jugend lernen musste. Weil ich mit vielen Dingen konfrontiert war, die herausfordernd waren. Ich konnte die Situation nicht ändern, aber ich war ihr nicht ohnmächtig ausgeliefert. Denn das, was in mir vor sich ging, konnte ich beeinflussen, was gerade nicht hilfreich war, wegschieben, indem ich mich darauf konzentrierte, was positiv war. Die Gabe, alles andere zu dimmen, begreife ich heute als großes Geschenk, das mich auf der Line wie in anderen Bereichen meines Lebens weiterbringt. Wahrscheinlich habe ich dadurch einen gewissen Vorteil gegenüber Leuten, die in der Zeit ihres Aufwachsens egoistischer sein durften und sich weniger Gedanken machen mussten.
That’s it!





























