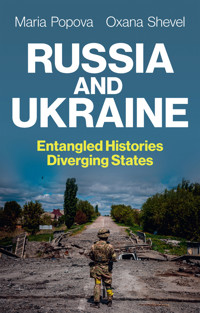14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Maria Popova porträtiert brillante Denkerinnen und Denker aus Wissenschaft, Kunst und Literatur. In poetischer Sprache und mit erfrischend persönlichem Erkenntnishunger verknüpft Popova Lebensentwürfe und Gedanken der letzten vierhundert Jahre. Ein Buch, das Grenzen sprengt, Geschichte neu erzählt und dazu anregt, Gesellschaft anders und gemeinsam zu denken.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1625
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Maria Popova
Findungen
Aus dem Amerikanischen von Stefanie Schäfer, Heike Reissig und Tobias Rothenbücher
Diogenes
Für Bella
Whoever requires the suffrage of others, has at once placed his life in the power of calculation and of chance; to such a degree, that the labours of calculation cannot secure him from the accidents of chance, and the accidents of chance cannot exempt him from the pains of calculation.
Germaine de Staël
A Treatise on the Influence of the Passions Upon the Happiness of Individuals and of Nations (1796)
How should we like it were stars to burn
With a passion for us we could not return?
If equal affection cannot be,
Let the more loving one be me.
W.H. Auden
0
Alles, einfach alles – die Ringe des Saturn und der Ehering meines Vaters, die von der Morgensonne rosa gefärbten Wolken, Einsteins Gehirn in einem Gefäß mit Formaldehyd, jedes Sandkorn, aus dem das Glas des Gefäßes gewonnen wurde, und jede Idee, die Einstein je hatte, die Schäferin, die im Rila-Gebirge meines Heimatlandes Bulgarien sang, und jedes ihrer Schafe, jedes Haar auf den samtigen Ohren meines Hundes Chance, in den geflochtenen roten Zöpfen Marianne Moores und an den Lefzen von Montaignes Katze, jeder durchscheinende Nagel an den Fingern des neugeborenen Sohnes meiner Freundin Amanda, jeder Stein, mit dem Virginia Woolf ihre Manteltaschen füllte, bevor sie sich in der Ouse ertränkte, jedes Kupferatom der Voyager Golden Record, die Arien an Bord des ersten von Menschenhand geschaffenen Objekts in den interstellaren Raum trug, und jeder Eichensplitter der Dielen, auf denen Beethoven in dem Wutanfall zusammenbrach, der ihn sein Gehör kostete, jede Träne, die je über einem Grab vergossen wurde, und das Schnabelgelb jeder Krähe, die die Trauernden dabei beobachtet hat, jede Zelle in Galileis fleischigem Finger und jedes Molekül, das die Monde des Jupiter, auf die er deutete, geformt hat, die Sommersprossen, die das olivfarbene Firmament eines von mir geliebten Unterarms mit Sternbildern überziehen, und jedes Axonzucken der Zärtlichkeit, mit der ich seine Besitzerin liebe, alle Fakten und Fabeln, mit denen wir ständig die Realität darstellen und neu gestalten –, all dies wurde vor 13,8 Milliarden Jahren aus einer Singularität zum Leben erweckt, einer einzigen Quelle, nicht lauter als die Eröffnung von Beethovens Fünfter Sinfonie und nicht größer als der Punkt über dem kleinen i des ICHs, das von seinem Sockel gestoßen wurde.
Wie können wir all das wissen und trotzdem der Illusion des Getrenntseins, des Andersseins erliegen? Diese Verblendung muss der Zusammenfluss von Zufällen und Atomen, bekannt als Dr. Martin Luther King, durchschaut haben, als er von unserem unausweichlichen »Netz wechselseitiger Beziehungen« sprach, und auch Walt Whitman sah sie, da er schrieb, dass »jedes Atom, das zu mir gehört, genauso gut zu dir gehört«.
An einem Herbstmorgen in San Francisco, an dem ich im Garten meiner Freundin Wendy die Briefe eines toten Dichters lese, erblicke ich ein Fragment dieser atomaren Wechselbeziehung. Mitten im Satz schenkt mir mein peripheres Sehen – dieser phantastische, durch Jahrtausende der Evolution geschliffene Instinkt – einen wundersamen Anblick: ein kleines, leuchtend rotes Blatt, das in der Luft herumwirbelt. Für einen Moment scheint es, als würde es seinen endgültigen Fall tanzen. Aber nein – da verweilt es, zwei Meter über dem Boden, und umkreist, von einer unsichtbaren Kraft bewegt, ein unsichtbares Zentrum. In diesem Moment wird mir klar, wie solche nicht wahrnehmbaren Zusammenhänge den menschlichen Geist in den Aberglauben treiben und mittelalterliche Dorfbewohner dazu bringen konnten, Erklärungen in Magie und Hexerei zu suchen. Doch als ich mich dem Blatt nähere, bemerke ich ein zartes Spinnennetz, das über ihm in der Luft glitzert und sich mit der Schwerkraft zu diesem wirbelnden Wunder verschworen hat.
Weder hat die Spinne das Blatt noch das Blatt die Spinne vorhergesehen – und doch sind sie da, ein zufälliges Pendel, angetrieben von denselben Kräften, die die Jupitermonde in ihrer Umlaufbahn halten, zu dieser flüchtigen frühmorgendlichen Pracht erweckt durch ewige kosmische Gesetze, die für Schönheit unempfänglich, der Bedeutung gegenüber gleichgültig und dennoch von beidem erfüllt sind für das verblüffte menschliche Bewusstsein, das sie betrachtet.
Unser Leben lang versuchen wir auszumachen, wo wir enden und der Rest der Welt beginnt. Wir reißen unser Standbild des Lebens aus der Gleichzeitigkeit der Existenz, indem wir an Illusionen von Beständigkeit, Gleichförmigkeit und Linearität festhalten; von statischen Identitäten und Lebensläufen, die sich in sinnvollen Narrativen entfalten. Dabei verwechseln wir Eventualitäten mit Entscheidungen, unsere Etiketten und Modelle für die Phänomene mit den Phänomenen selbst, unsere Aufzeichnungen mit unserer Geschichte. Geschichte ist jedoch nicht das Geschehene, sondern das, was die Schiffbrüche von Urteil und Zufall überlebt.
Einige Wahrheiten, wie die Schönheit, werden am besten durch den Seitenscheinwerfer der Symbolisierung, der Bedeutungsverleihung erhellt. Im Zuge dieser Symbolisierungen überschneiden sich Umlaufbahnen, oft ohne Wissen der Körper, die sie mit sich führen – Überschneidungen, die nur aus der Distanz von Jahrzehnten oder Jahrhunderten kartiert werden können. Wahrheiten überlagern andere Wahrheiten, um in den Nuancen einer größeren Wahrheit aufzugehen – nicht Relativismus, nein, sondern der mächtigste Realismus, den wir haben. Wir durchschneiden die Gleichzeitigkeit, indem wir alles auf einmal sind: unsere Vornamen und unsere Nachnamen, unsere Einsamkeit und unsere Gesellschaft, unser kühner Ehrgeiz und unsere blinde Hoffnung, unsere unerwiderte Liebe und unsere erwiderte. Leben werden parallel und senkrecht gelebt, nicht linear ergründet, nicht in den geraden Graphen der »Biographie«, sondern in vielseitigen, vielschichtigen Diagrammen erfasst. Leben verflechten sich mit anderen Leben, und aus diesem Wandteppich ergeben sich Hinweise zu Antworten auf Fragen, die die Essenz des Lebens betreffen: Was sind die Bausteine des Charakters, der Zufriedenheit, der nachhaltigen Errungenschaften? Wie kann ein Mensch trotz unzähliger Konventionen und blinden Kollektivismus zu Selbstbeherrschung und innerer Eigenständigkeit finden? Reicht Genialität zum Glück? Oder Ruhm? Oder Liebe? Zwei Nobelpreise scheinen die Melancholie, die die Frau im schwarzen Laborkittel auf jedem Photo ausstrahlt, jedenfalls nicht zu kompensieren. Ist Erfolg eine Garantie für Erfüllung oder nur ein Versprechen, das so fragil ist wie ein Ehegelübde? Wie erlangen wir in diesem von der Leere gerahmten Wimpernschlag der Existenz die Vollkommenheit des Seins?
Es gibt unendlich viele Arten von schönem Leben.
So viel von der Schönheit, so viel von dem, was unser Streben nach Wahrheit antreibt, ergibt sich aus den unsichtbaren Verbindungen – zwischen Ideen, zwischen Disziplinen, zwischen den Bewohnern einer bestimmten Zeit und eines bestimmten Ortes, zwischen der Innenwelt aller Pioniere und den Spuren, die sie auf den Höhlenwänden der Kultur hinterlassen, zwischen schemenhaften Gestalten, die sich, bevor das Fackellicht einer Revolution den neuen Tag erhellt, in der Dunkelheit begegnen, mit kaum mehr als einem verschwörerischen Nicken und einem Streichholz, das von einer Hand zur nächsten wandert.
1NUR DER TRÄUMER ERWACHT
So stelle ich es mir vor:
Ein spindeldürrer Mathematiker mittleren Alters mit überragendem Verstand, wundem Herzen und schlechter Haut wird in der beißenden Kälte eines deutschen Januars in einer Kutsche hin- und hergeworfen. Seit seiner Jugend hinterlässt er in Familienbüchern und Freundschaftsalben sein persönliches Motto, das einem Vers des antiken Dichters Persius entlehnt ist: »O die Sorgen der Welt, wie viel ist in allem doch eitel!« Der Mann hat Tragödien überstanden, die die meisten Menschen zerstört hätten. Und nun rollt er in schneller Fahrt durch die eisige, alabasterweiße Landschaft, in der verzweifelten Hoffnung, eine weitere Katastrophe verhindern zu können: Fünf Tage nach Weihnachten und zwei Tage nach seinem vierundvierzigsten Geburtstag im Jahr 1615 schrieb ihm seine Schwester, dass ihre Mutter wegen Hexerei vor Gericht stehe – eine Entwicklung, für die er sich selbst die Schuld gibt.
Er hat das weltweit erste Science-Fiction-Werk geschrieben, eine kluge Allegorie, die das umstrittene kopernikanische Modell des Universums propagiert, die Auswirkungen der Gravitation beschreibt – Jahrzehnte bevor Newton deren Gesetzmäßigkeiten formulierte –, sich die Sprachsynthese Jahrhunderte vor dem ersten Computer vorstellt und die Raumfahrt mehr als dreihundert Jahre vor der ersten Mondlandung voraussagt. Das Buch, das eigentlich dazu dienen sollte, dem Aberglauben mit konkreter Wissenschaft entgegenzutreten, indem es die Leserschaft durch Symbole und Metaphern zum kritischen Denken anregt, hat stattdessen dazu geführt, dass seine alte, ungebildete Mutter dem Tod ins Auge sehen muss.
Wir schreiben das Jahr 1617, und sein Name ist Johannes Kepler – vielleicht der glückloseste Mann der Welt, vielleicht der größte Wissenschaftler aller Zeiten. Er lebt in einer Zeit, in der Gott mächtiger ist als die Natur und der Teufel den Menschen realer und vertrauter als das Konzept der Schwerkraft. Die meisten seiner Zeitgenossen glauben, dass sich die Sonne alle vierundzwanzig Stunden ein Mal um die Erde dreht, von einem allmächtigen Schöpfer auf eine perfekte Kreisbahn geschickt. Die wenigen, die es wagen, die abtrünnige Idee zu vertreten, die Erde drehe sich um ihre eigene Achse und zugleich um die Sonne, glauben, sie bewege sich auf einer idealen kreisförmigen Umlaufbahn. Kepler sollte beide Überzeugungen widerlegen, das Wort Orbit prägen und den Marmor schlagen, aus dem die klassische Physik gemeißelt werden würde. Er würde als erster Astronom eine wissenschaftliche Methode zur Vorhersage von Eklipsen entwickeln und als Erster die mathematische Astronomie mit der materiellen Realität in Einklang bringen, indem er bewies, dass physikalische Kräfte die Himmelskörper in berechenbaren Ellipsen kreisen lassen – wodurch er zum ersten Astrophysiker überhaupt aufsteigen sollte. All das würde er vollbringen, während er zugleich Horoskope erstellte und glaubte, neue Tierarten würden spontan entstehen, indem sie aus Sümpfen emporsteigen und aus Baumrinden sickern. Überdies war er der Meinung, die Erde selbst sei ein beseelter Körper, der eine Verdauung habe, erkranken könne und wie ein lebendiger Organismus ein- und ausatme. Drei Jahrhunderte später würde die Meeresbiologin und Schriftstellerin Rachel Carson ihre ganz eigene Version dieses organischen Weltbildes entwerfen, auf der Basis rein wissenschaftlicher Fakten und frei von Mystizismus, und so das Wort Ökologie zu einem alltäglichen Begriff machen.
Keplers Leben zeigt, dass die Wissenschaft für die materielle Welt das bewirkt, was Plutarchs Gedankenexperiment, das als »Schiff des Theseus« bekannt ist, für das Ich tut. In dieser altgriechischen Allegorie segelt Theseus, der legendäre König von Athen, im Triumph nach Hause zurück, nachdem er den mythischen Minotaurus auf Kreta getötet hat. Tausend Jahre lang wird sein Schiff im Hafen von Athen zum Gedenken an diese Heldentat aufbewahrt und jedes Jahr nach Kreta gesegelt, um die siegreiche Reise nachzustellen. Als der Zahn der Zeit allmählich an dem Schiff nagt, werden nach und nach die maroden Teile ersetzt – neue Planken, neue Ruder, neue Segel –, bis irgendwann kein einziges Originalteil mehr vorhanden ist. Ist es dann, so fragt Plutarch, noch dasselbe Schiff? Es gibt kein statisches, fest umrissenes Ich. Im Laufe unseres Lebens verändern sich unsere Gewohnheiten, Überzeugungen und Ideen bis zur Unkenntlichkeit. Unser physisches und soziales Umfeld wandelt sich. Fast alle unsere Zellen werden ersetzt. Dennoch bleiben wir – für uns selbst –, »wer« »wir« »sind«.
Das Gleiche gilt für das Verhältnis zwischen Wissenschaft und Welt: Nach und nach reformieren neue Entdeckungen unser Verständnis der Realität. Diese Realität offenbart sich uns nur in Fragmenten. Je mehr Fragmente wir wahrnehmen und analysieren, desto lebensechter wird das Mosaik, das wir aus ihnen legen. Dennoch bleibt es ein Mosaik, eine Repräsentation – unvollkommen und unvollständig, so schön sie auch sein mag, und ewiger Wandlung unterworfen. Drei Jahrhunderte nach Kepler würde Lord Kelvin im Jahr 1900 das Podium der British Association for the Advancement of Science erklimmen und erklären: »In der Physik gibt es nichts Neues mehr zu entdecken. Was uns bleibt, ist nur, genauere Messungen vorzunehmen.« Doch zur selben Zeit brütet der junge Albert Einstein in Zürich jene Ideen aus, die in seine revolutionäre Vorstellung der Raumzeit münden und unser elementares Verständnis der Realität irreversibel verändern würden.
Selbst die weisesten Propheten können ihren Blick nicht über den Möglichkeitshorizont ihrer Zeit hinaus richten, jedoch erweitert sich dieser Horizont mit jeder kleinen Veränderung, wenn der menschliche Geist nach außen blickt, um die Natur zu betrachten, und sich dann nach innen wendet, um seine eigenen Gegebenheiten in Frage zu stellen. Durch das Geflecht dieser Gewissheiten, gestrafft von Natur und Kultur, sieben wir die Welt. Doch ab und zu – ob durch Zufall oder bewusste Anstrengung – lockert sich der Draht, und durch die Maschen schlüpft die Keimzelle einer Revolution.
Kepler begeisterte sich erstmals als Student am Evangelischen Stift in Tübingen für das heliozentrische Modell, ein halbes Jahrhundert nachdem Kopernikus seine Theorie veröffentlicht hatte. Der zweiundzwanzigjährige Kepler, der eigentlich Theologie studierte, schrieb eine Dissertation über den Mond und wollte darin die kopernikanische These beweisen, dass sich die Erde gleichzeitig um ihre eigene Achse und um die Sonne bewegt. Ein Kommilitone, ein Jurastudent namens Christoph Besold, war von KeplersMond-Dissertation so angetan, dass er eine öffentliche Debatte anregte. Die Stiftsleitung legte umgehend ihr Veto ein. Einige Jahre später schrieb Galileo Galilei an Kepler, dass er selbst bereits seit »vielen Jahren« an das kopernikanische System glaube – doch bisher habe er nicht gewagt, es öffentlich zu vertreten, und würde dies auch in den kommenden dreißig Jahren nicht tun.
Keplers radikale Ideen machten ihn ungeeignet für die Kanzel. Nach seinem Abschluss wurde er des Landes verwiesen, woraufhin er an der evangelischen Stiftsschule in Graz eine Stelle als Mathematiklehrer annahm. Er war froh darüber, denn er betrachtete sich sowohl geistig als auch körperlich als für die Wissenschaft prädestiniert. Er habe die körperliche Konstitution seiner Mutter geerbt, schrieb er später, die besser für das Studium denn für andere Lebensweisen geeignet sei. Knapp drei Jahrhunderte später würde Walt Whitman feststellen, dass hinter Genius und Moral das Vetorecht des Magens stehe.
Während Kepler seinen Körper als ein Instrument der Wissenschaft betrachtete, mussten andere ihre Körper als Instrumente des Aberglaubens malträtieren lassen. In Graz erlebte Kepler schauerliche Exorzismen an jungen Frauen, die angeblich von Dämonen besessen waren – schreckliche öffentliche Spektakel, veranstaltet von König und Klerus. Er sah grellbunte Dämpfe aus dem Bauch einer Frau wallen und glänzende schwarze Käfer aus dem Mund einer anderen krabbeln. Er sah die Geschicklichkeit, mit der die Puppenspieler das Dogma inszenierten, um das Volk zu kontrollieren – damals war die Kirche das, was heute die Massenmedien sind, und sie schreckte ebenso wenig wie diese davor zurück, sich aller Mittel der Manipulation zu bedienen.
Mit zunehmender Eskalation der religiösen Verfolgung, die bald darauf zum Ausbruch des Dreißigjährigen Kriegs führen sollte, des blutigsten Religionskriegs in der Geschichte Europas, wurde das Leben in Graz unerträglich. Die Protestanten wurden gezwungen, nach katholischem Ritus zu heiraten und ihre Kinder als Katholiken taufen zu lassen. Häuser wurden durchsucht, ketzerische Bücher beschlagnahmt und zerstört. Als Keplers kleine Tochter starb, musste er eine Strafe zahlen, weil er den katholischen Klerus umgangen hatte, und er durfte sein Kind nicht zur letzten Ruhe betten, bis er die Summe beglichen hatte. Es war an der Zeit, den Wohnort zu wechseln – ein kostspieliges und aufwendiges Unterfangen für die Familie, aber Kepler wusste, dass sie einen höheren Preis würden zahlen müssen, wenn sie blieben:
Ich darf auf den Verlust des Vermögens nicht größere Rücksicht nehmen als darauf, wie ich erfülle, wozu mich Natur und Lebensgang bestimmt haben.
Eine Rückkehr nach Tübingen, um eine kirchliche Laufbahn einzuschlagen, kam für ihn allerdings nicht in Frage:
Ich würde mich niemals mit größerer Unruhe und Angst zermartern können, als wenn ich jetzt bei meiner Gewissensverfassung in jenen Tätigkeitsbereich eingeschlossen wäre.
Stattdessen zog Kepler in Erwägung, einer Einladung zu folgen, die er zunächst nur als schmeichelhaftes Kompliment für seinen wachsenden wissenschaftlichen Ruf aufgefasst hatte. Sie stammte von dem prominenten dänischen Astronomen Tycho Brahe, der gerade zum kaiserlichen Mathematiker von Rudolf II. ernannt worden war, dem Kaiser des Heiligen Römischen Reichs und König von Böhmen.
Kepler legte die beschwerliche, fünfhundert Kilometer lange Reise nach Prag zurück, und am 4. Februar 1600 begrüßte ihn der geniale Däne mit dem üppigen karottenroten Schnauzer herzlich in der Burg, wo er sich der Berechnung der Himmelskörper widmete. Zwei Monate verbrachte er dort als Gast und Lehrling, und Brahe war so beeindruckt von den brillanten Ideen und den theoretischen Kenntnissen Keplers, dass er ihm erlaubte, die astronomischen Beobachtungen, die er als einer der ersten Gelehrten mit erstaunlicher Genauigkeit durchgeführt hatte, zu analysieren. Anschließend bot er ihm eine Festanstellung an. Kepler nahm dankbar an und reiste zurück nach Graz, um seine Familie nachzuholen. Dort war die Atmosphäre finsterer denn je und noch stärker von religiösen Verfolgungen geprägt als zuvor. Als die Keplers sich weigerten, zum Katholizismus zu konvertieren, wurden sie aus der Stadt verbannt – die Übersiedelung nach Prag war nicht länger eine Option, sondern eine Notwendigkeit, trotz aller Entbehrungen, die dies mit sich brachte. Kurz nachdem sich Kepler und seine Familie in Böhmen niedergelassen hatten, bot sich dem jungen Wissenschaftler erneut eine unverhoffte Chance: Tycho Brahe starb unerwartet im Alter von vierundfünfzig Jahren. Zwei Tage später wurde Kepler zu seinem Nachfolger als kaiserlicher Mathematiker ernannt und erbte all seine Aufzeichnungen. Auf diese sollte er sich in hohem Maße stützen, als er in den kommenden Jahren seine drei Gesetze der Planetenbewegung entwickelte, die das menschliche Verständnis des Universums revolutionieren würden.
Wie viele Umdrehungen vollführt das Zahnrad der Kultur, ehe sich eine neue Erkenntnis durchsetzt?
Drei Jahrhunderte vor Kepler hatte Dante in seiner Divina Commedia (dt. Die göttliche Komödie) die neuen Uhren bewundert, die in England und Italien tickten: »… wie die Räder zieh’n und treiben«. Aus dieser Verzahnung von Technik und Poesie entstand schließlich die Metapher des Uhrwerkuniversums. Doch bevor NewtonsPhysik diese Metapher schließlich in das ideologische Epizentrum der Aufklärung rückte, verknüpfte bereits Kepler die Poesie mit der Wissenschaft. In seinem ersten Buch, Mysterium), griff Kepler die Metapher auf und befreite sie von ihren göttlichen Dimensionen. Er betrachtete Gott nicht länger als Uhrmacher, sondern ging stattdessen davon aus, dass eine einzige Kraft die Gestirne bewegte. Er fragte sich, ob es möglich war, »nachzuweisen, dass die Himmelsmaschine nicht so sehr ein göttlicher Organismus, sondern vielmehr ein Uhrwerk ist (…) insofern alle die vielfältigen Bewegungen mittels einer recht einfachen magnetischen Kraft des Körpers ausgeführt werden, ganz wie sich bei einer Uhr alle Bewegungen aus einem recht einfachen Gewicht ergeben«. Es war also nicht, wie Dante schrieb, »die Liebe, / Die kreisen macht die Sonne wie die Sterne« – es war die Gravitation, wie Newton die »einfache magnetische Kraft« später definierte. Aber es war Kepler, der auf diese Weise zum ersten Mal überhaupt von einer Kraft sprach, einem Konzept, das Kopernikus noch nicht gekannt hatte. Obwohl dieser zu der bahnbrechenden Erkenntnis gelangt war, dass die Sonne die Planeten bewegt, hatte er diese Bewegung stets eher unter poetischen denn unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten betrachtet. Für Kopernikus waren die Planeten Pferde, deren Zügel die Sonne hielt; für Kepler waren sie Zahnräder, die die Sonne durch eine physische Kraft in Rotation versetzte.
Im sorgenschweren Winter des Jahres 1617 drehen sich unter Johannes Kepler ganz konkrete Räder, als er zum Hexenprozess seiner Mutter eilt. Auf die lange Reise zu Pferd und mit der Kutsche hat Kepler ein ramponiertes Exemplar des Dialogo della musica antica et moderna(»Dialog über die Alte und die Neue Musik«) von Vincenzo Galilei eingepackt, dem Vater seines wissenschaftlichen Mitstreiters Galileo Galilei. Das Buch ist zu jener Zeit eine der Kepler seit jeher ebenso sehr begeistert wie die Mathematik, vielleicht weil er die beiden nicht als getrennt voneinander betrachtet. Zwei Jahre später würde er darauf basierend sein eigenes bahnbrechendes Werk Harmonice mundi (dt. Weltharmonik) veröffentlichen, in dem er sein letztes Gesetz der Planetenbewegung formuliert, welches als drittes Kepler’sches Gesetz bekannt ist und von Kepler selbst als »harmonisches Gesetz« bezeichnet wird. Nachdem er sich zweiundzwanzig Jahre lang intensiv mit seiner Materie beschäftigt hat, entdeckt er die proportionale Verbindung zwischen den Umlaufzeiten der Planeten und den Längen der Achsen ihrer Bahnen. Damit ist es erstmals möglich, die Entfernung der Planeten von der Sonne zu berechnen – man kann also den Himmel vermessen, zu einer Zeit, in der man glaubt, außer unserem Sonnensystem existiere nichts anderes.
Während Kepler durch die deutsche Landschaft galoppiert, um die Hinrichtung seiner Mutter zu verhindern, steht die Inquisition in Rom kurz davor, die Behauptung, dass die Erde sich um die Sonne drehe, als Häresie zu brandmarken – worauf die Todesstrafe steht.
Hinter Kepler liegen die Trümmer seines Lebens: Kaiser Rudolf II. ist tot, wodurch er seinen Posten als kaiserlicher Mathematiker und wissenschaftlicher Chefberater des Kaisers des Heiligen Römischen Reichs verloren hat – ein Posten, der mit dem höchsten wissenschaftlichen Renommee in ganz Europa einherging, obwohl Kepler in erster Linie damit beauftragt war, Horoskope für die Mitglieder des Königshauses zu berechnen. Außerdem ist sein geliebter Sohn im Alter von sechs Jahren gestorben – »eine morgendliche Hyazinthe in den ersten Frühlingstagen«, dahingerafft von den Pocken, an denen Kepler als Kind selbst erkrankt war und die tiefe Narben in seiner Haut hinterlassen und sein Sehvermögen dauerhaft geschädigt hatten. Und auch seine erste Frau, die schwer unter dem Tod des Sohnes gelitten hatte, ist den Pocken erlegen.
Vor ihm liegt eine Zukunft, in der zwei Welten innerhalb zweier unterschiedlicher Weltsysteme aufeinanderprallen und der daraus resultierende Funke die Initialzündung zu den ersten Phantasien von Weltraumreisen auslösen würde.
Im Jahr 1609 vollendete Kepler das erste echte Werk des Science-Fiction-Genres, für das wissenschaftlich-technische Spekulationen charakteristisch sind. Somnium sive astronomia lunaris (dt. Der Traum, oder: Mond-Astronomie) beschreibt die fiktive Reise eines jungen Astronomen zum Mond. Die spektakuläre Handlung und die darin versteckte Symbolik machen das Buch sowohl zu einem Meisterwerk der literarischen Phantasie als auch zu einem unschätzbar wertvollen wissenschaftlichen Dokument – was umso beeindruckender ist, da es entstand, noch bevor Galilei sein Fernrohr gen Himmel richtete und lange bevor Kepler selbst erstmals durch ein Teleskop blickte.
Kepler wusste, was wir für gewöhnlich vergessen – dass sich das Feld der Möglichkeiten ausdehnt, wenn das Unvorstellbare gedacht und anschließend durch systematische Anstrengung verwirklicht wird. Jahrhunderte später brachte der große Science-Fiction-Autor Ray Bradbury diese Art der Entwicklung in einem Gespräch mit Carl Sagan und Arthur C. Clarke über die Zukunft der Weltraumforschung auf den Punkt, indem er bemerkte, es liege in der Natur des Menschen, mit Romantik zu beginnen, um sie dann Wirklichkeit werden zu lassen. Die menschliche Vorstellungskraft gleicht einer Münze mit ihren zwei Seiten. Mittels unserer Phantasie füllen wir die beunruhigenden Lücken des Unbekannten mit den beruhigenden Gewissheiten von Mythos und Aberglaube. Dies kann sich gar in den Glauben an Magie und Zauberei verkehren, wenn der gesunde Menschenverstand und die Vernunft keine Kausalitäten erkennen können. Doch dieselbe Phantasie bringt uns auch dazu, uns über allgemein akzeptierte Tatsachen zu erheben, über die Grenzen des durch Brauch und Konvention als machbar Betrachteten hinauszugehen und nach neuen Gipfeln bisher ungeahnter Wahrheit zu greifen. Wie die Münze fällt, hängt vom Ausmaß des Mutes ab, der seinerseits von einer unberechenbaren Kombination aus Natur, Kultur und Charakter bestimmt wird.
Zum ersten Mal schriftlich erwähnte Kepler den Traum in einem Brief an Galilei vom Frühjahr 1610, knapp über ein Jahrhundert nachdem Kolumbus Amerika entdeckt hatte. Er regte seinen Adressaten dazu an, seine Phantasie in Richtung Weltraumreisen schweifen zu lassen, und rief ihm ins Gedächtnis, wie unvorstellbar den Menschen transatlantische Reisen noch vor nicht allzu langer Zeit erschienen waren:
Wer hätte doch ehedem geglaubt, das Befahren des unendlichen Ozeans werde ruhiger und sicherer sein als das der engen Adria, der Ostsee oder des Ärmelkanals?
Kepler spekulierte: »Gib nur Schiffe oder richte Segel für die Himmelsluft her, und es werden auch die Menschen da sein, die sich vor der entsetzlichen Weite [des interplanetaren Raums] nicht fürchten.« Mit Blick auf diese zukünftigen Entdecker forderte er von seinem Kollegen:
Und so, als ob die wagemutigen Reisenden schon morgen vor der Tür stünden, wollen wir die Astronomie für sie begründen, ich die des Mondes, du, Galilei, die des Jupiter.
Mit Hilfe seines mathematischen Genies und seines tieferen Verständnisses der zugrunde liegenden Kraft würde Newton die drei Kepler’schen Gesetze später zu seinem Gravitationsgesetz verfeinern. Ein Vierteljahrtausend danach würde sich die Mathematikerin Katherine Johnson bei der Berechnung der Flugbahn, die Apollo 11 auf dem Mond landen ließ, auf diese Gesetze stützen, und sie würden auch die Raumsonde Voyager leiten, das erste von Menschen geschaffene Objekt, das den interstellaren Raum erkundete.
Im Traum, jenem Werk, das Kepler in seinem Brief an Galilei als »Mondgeographie« beschrieb, landet der junge Reisende auf dem Erdtrabanten und findet dort Bewohner vor, die glauben, dass sich die Erde um sie dreht – von ihrem kosmischen Aussichtspunkt aus gesehen wandert unsere hellblaue Kugel über ihr Firmament, was sich auch in dem Namen widerspiegelt, den sie der Erde gegeben haben: Volva. Kepler wählte den Namen bewusst, um die Rotation der Erde hervorzuheben – jene Bewegung, die das kopernikanische Prinzip so gefährlich für das Dogma der kosmischen Stabilität machte. Er ging davon aus, dass seine Leser wussten, dass sich der Mond um die Erde drehte – eine altbekannte Tatsache, die zu seiner Zeit unumstritten war. Auf dieser Grundlage stellte er die beunruhigende Frage: Könnte es sein, so impliziert seine Geschichte in einem allegorischen Geniestreich fast drei Jahrhunderte vor Edwin AbbottsFlatland (dt. Flächenland), dem Klassiker der Science-Fiction-Literatur von 1884, dass unsere Gewissheit über die unveränderliche Position der Erde im Weltraum ebenso fehlgeleitet ist wie der Glaube der Mondbewohner, dass Volva ihr Gestirn umkreist? Wäre es möglich, dass auch wir uns um die Sonne drehen, obwohl sich der Boden unter unseren Füßen fest und bewegungslos anfühlt?
Der Traum sollte die Menschen sanft zur Wahrheit von Kopernikus’ heliozentrischem Modell des Universums hinführen und der seit langem geltenden Überzeugung widersprechen, dass die Erde das statische Zentrum eines unveränderlichen Kosmos bilde. Doch der jahrtausendelange Schlummer der Erdlinge war zu tief, um diesen Transfer leisten zu können – eine tödliche Schläfrigkeit, denn sie führte dazu, dass Keplers alte Mutter der Hexerei beschuldigt wurde. Zehntausende Menschen wurden im Zuge der Hexenverfolgung in Europa vor Gericht gestellt. Dagegen nehmen sich die zwanzig Hinrichtungen siebzig Jahre später, die den Ort Salem in den USA zum Synonym für Hexenprozesse machen sollten, fast bedeutungslos aus. Die meisten der Angeklagten waren Frauen, deren Anklage oder Verteidigung ihren Söhnen, Brüdern und Ehemännern oblag – und die meisten Prozesse endeten tödlich. In Deutschland wurden etwa fünfundzwanzigtausend Menschen getötet. Allein in Keplers kleiner Heimatstadt waren wenige Wochen vor der Anklage gegen seine Mutter sechs Frauen als Hexen verbrannt worden.
Eine unheimliche Symmetrie lag über Keplers schwerem Schicksal, denn es war seine Mutter Katharina, der er seine Faszination für die Astronomie verdankte. Als er sechs Jahre alt war, war sie mit ihm auf einen nahe gelegenen Hügel gestiegen und hatte dem staunenden Kind den Großen Kometen gezeigt, der 1577 seinen feurigen Schweif über den Himmel zog.
Als er den Traum schrieb, gehörte Kepler zu den bekanntesten Wissenschaftlern der Welt. Seine rigorose Treue zu Beobachtungsdaten ging mit einer regen Vorstellungkraft einher. Auf der Basis von Tycho Brahes Daten mühte sich Kepler über ein Jahrzehnt lang in mehr als siebzig gescheiterten Versuchen ab, bis er endlich die Umlaufbahn des Mars berechnet hatte, die zum Maßstab für die Vermessung des Himmels wurde. Daraufhin formulierte er das erste seiner Gesetze und zerstörte damit die alte Überzeugung, wonach die Himmelskörper einer einheitlichen Kreisbewegung folgen, denn er konnte nun belegen, dass die Planeten die Sonne mit unterschiedlicher Geschwindigkeit auf Ellipsenbahnen umkreisen. Im Gegensatz zu früheren Modellen, die lediglich auf mathematischen Hypothesen beruhten, hatte Kepler die tatsächliche Umlaufbahn entdeckt, auf der sich der Mars durch den Weltraum bewegt. Anschließend benutzte er die Mars-Daten, um die Umlaufbahn der Erde zu bestimmen. Anhand zahlreicher Beobachtungen der Mars-Position im Verhältnis zur Erde untersuchte er, wie sich der Winkel zwischen den beiden Planeten im Laufe der von ihm bereits berechneten Mars-Umlaufzeit von sechshundertsiebenundachtzig Tagen veränderte. Dazu musste sich Kepler quasi mit einem empathischen Kraftakt der Phantasie auf den Mars versetzen. Das Wort Empathie sollte drei Jahrhunderte später, Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts, durch das Einfallstor der Kunst in den modernen Sprachgebrauch übergehen. Es beschreibt den imaginären Akt der Selbstprojektion, zum Beispiel in ein Gemälde, um zu verstehen, warum uns Kunst bewegt. Auf ganz ähnliche Weise projizierte sich Kepler mittels der Wissenschaft in das größte existierende Kunstwerk, um zu verstehen, wie die Naturgesetze bewirken, dass die Planeten sich bewegen, einschließlich des Himmelskörpers, der uns durch den Weltraum trägt. Mit Hilfe der Trigonometrie berechnete er den Abstand zwischen Erde und Mars, lokalisierte den Mittelpunkt der Erdumlaufbahn und zeigte, dass sich auch alle anderen Planeten auf elliptischen Bahnen bewegten, wodurch das Fundament der griechischen Astronomie – die gleichförmigen Kreisbewegungen – zerstört und dem ptolemäischen Modell ein entscheidender Schlag versetzt wurde.
Kepler veröffentlichte diese bahnbrechenden Ergebnisse, mit der er die Gültigkeit seiner ersten beiden Gesetze bewies, in seinem BuchAstronomia Nova (dt. Astronomia Nova: Neue ursächlich begründete Astronomie). Und genau das war sie – die Gestalt des Kosmos hatte sich für immer verändert und damit auch unser Platz darin. »Lange war ich in Unruhe, denn ich wollte ja Theologe werden. Nun aber seht, wie Gott durch mein Bemühen auch in der Astronomie gefeiert wird«, schrieb Kepler an seinen ehemaligen Professor Michael Mästlin in Tübingen. Er hatte eine Laufbahn in der Theologie gegen die Eroberung einer größeren Wahrheit eingetauscht.
Zu der Zeit, als er die Astronomia Nova verfasste, verfügte Kepler also über umfassende mathematische Beweise, die die Theorie des Kopernikus bestätigten. Doch war er psychologisch geschult genug, um zu wissen, dass die Erklärung zu schwer verständlich war, um seinesgleichen, geschweige denn die wissenschaftlich ungebildete Öffentlichkeit zu überzeugen. Durch harte Fakten allein würde sich ihr Glaube an ein festes Himmelsgefüge nicht erschüttern lassen, dazu brauchte es auch Erzählkunst. Drei Jahrhunderte bevor die Dichterin Muriel Rukeyser schrieb, dass das Universum aus Geschichten bestehe, nicht aus Atomen, wusste Kepler, dass man das Universum, wie immer es auch beschaffen sein mochte, den Leuten nur durch Poesie, nur durch eine neue Rhetorik nahebringen konnte, mit der er auf einfache, aber überzeugende Weise veranschaulichen konnte, dass sich die Erde tatsächlich bewegte. So wurde Der Traumgeboren.
Schon im Mittelalter war die Frankfurter Buchmesse einer der weltweit fruchtbarsten Umschlagplätze für Literatur. Kepler nahm regelmäßig daran teil, um für seine eigenen Bücher zu werben und über andere wichtige wissenschaftliche Publikationen auf dem Laufenden zu bleiben. Also brachte er eine Kopie seines Traumsmit zu dieser bombensicheren Abschussrampe, wo die anderen Teilnehmer nicht nur den Ruf des Autors als kaiserlicher Mathematiker und Astronom gut kannten, sondern auch selbst Wissenschaftler oder zumindest gelehrt genug waren, um das kluge allegorische Spiel seines Werks wertzuschätzen. Aber irgendetwas ging schief: Im Laufe des Jahres 1611 fiel die einzige existierende Abschrift in die Hände eines reichen jungen Adligen und machte sich anschließend auf den Weg durch Europa. Nach Keplers Darstellung erreichte sie sogar John Donne und inspirierte ihn zu seiner wilden Satire über die katholische Kirche, Ignatius His Conclave (»Das Konklave des Ignatius«). Die über Barbiertratsch verbreiteten Versionen der Handlung erreichten bis 1615 auch sehr viel weniger literarisch gebildete Kreise und selbst diejenigen, die des Schreibens und Lesens nicht mächtig waren. Auf diese Weise fanden die verstümmelten Nacherzählungen schließlich ihren Weg bis zurück in Keplers heimisches Herzogtum.
Sobald ein Gedicht der Öffentlichkeit zugänglich gemacht sei, besäßen die Leser das Recht auf dessen Interpretation, schrieb die junge Sylvia Plath drei Jahrhunderte später an ihre Mutter. Aber die Interpretation offenbart stets mehr über den Interpretierenden als über den Autor. Die Kluft zwischen Intention und Interpretation steckt immer voller Fehler, besonders wenn Autor und Leser sich auf sehr unterschiedlichen Ebenen emotionaler Reife und intellektueller Raffinesse bewegen. Die wissenschaftliche Grundlage, die Symbolik und die allegorische Virtuosität des Traums entgingen den Analphabeten, Abergläubischen und rachsüchtigen Bewohnern von Keplers Heimatort. Stattdessen interpretierten sie die Geschichte mit dem einzigen Werkzeug, das ihnen zur Verfügung stand – der stumpfen Waffe der buchstäblichen Eliminierung des Kontextes. Vor allem ein Element der Geschichte zog sie in seinen Bann: Der Erzähler ist ein junger Astronom, der sich selbst als »von Natur begierig, Neues zu lernen« bezeichnet und bei Tycho Brahe in die Lehre gegangen ist. Inzwischen wussten die Menschen überall von Brahes berühmtestem Schüler und Nachfolger am Kaiserhof. Vielleicht waren die Einheimischen stolz darauf, den berühmten Johannes Kepler hervorgebracht zu haben, vielleicht waren sie aber auch neidisch auf ihn. Wie dem auch sei: Sie begriffen die Geschichte nicht etwa als Fiktion, sondern als Autobiographie. Das war die Quelle allen Übels: Eine weitere Hauptfigur ist die Mutter des Erzählers – eine heilkundige Kräuterfrau, die Geister heraufbeschwört, um ihrem Sohn auf seiner Mondreise zu helfen. Und auch KeplersMutter war eine Kräuterfrau.
Ob das, was dann geschah, das Ergebnis vorsätzlicher, böswilliger Manipulationen oder aber verhängnisvoller Unwissenheit war, ist schwer zu sagen. Ich vermute, dass beides zusammenkam, denn diejenigen, die von der Manipulation der Wahrheit profitieren, nutzen häufig diejenigen aus, denen die Fähigkeit zum kritischen Denken fehlt. Jedenfalls, so berichtete Kepler es später, hatte ein einheimischer Barbier die Geschichte gehört und die Gelegenheit beim Schopf ergriffen, KeplersMutter als Hexe zu beschuldigen – aus reinem Opportunismus, da Ursula, die Schwester des Friseurs, mit ihrer ehemaligen Freundin ein Hühnchen zu rupfen hatte. Ursula Reinhold hatte sich von Katharina Kepler Geld geliehen und es nie zurückgezahlt. Sie hatte sich der älteren Witwe auch anvertraut, als sie von einem anderen Mann als ihrem Ehegatten schwanger geworden war. In einem Akt der unbedachten Indiskretion hatte Katharina diese kompromittierende Information mit Johannes’ jüngerem Bruder geteilt, der sie daraufhin ebenso unbedacht in der Kleinstadt verbreitet hatte. Um den Skandal zu mildern, hatte Ursula das Kind abgetrieben, und um die schweren körperlichen Folgen des medizinisch primitiven Eingriffs zu vertuschen, hatte sie ihren schlechten Zustand anschließend einem bösen Zauber Katharina Keplers zugeschrieben. Dann überredete Ursula vierundzwanzig willige Einheimische, Katharina der Hexerei zu bezichtigen. Eine Nachbarin behauptete zum Beispiel, der Arm ihrer Tochter sei taub geworden, nachdem Katharina ihn auf der Straße gestreift habe; die Frau des Metzgers schwor, dass ihrem Mann ein heftiger Schmerz durch den Oberschenkel gefahren sei, als Katharina vorbeigegangen war; und der humpelnde Schulmeister datierte den Beginn seiner Behinderung auf eine Nacht vor zehn Jahren zurück, als er bei Katharina zu Hause aus einem Blechbecher getrunken habe, während er ihr einen von Keplers Briefen vorlas. Katharina wurde vorgeworfen, durch verschlossene Türen zu erscheinen und den Tod von Säuglingen und Tieren verursacht zu haben. Kepler glaubte, dass der Traum den abergläubischen Bürgern der Stadt Beweise für die angebliche Hexerei seiner Mutter geliefert hatte – schließlich hatte ihr eigener Sohn sie in seiner Geschichte als Zauberin dargestellt. Nur hatten die ungebildeten Leute die Allegorie nicht verstanden.
Katharina Kepler selbst trug ebenfalls nicht gerade dazu bei, das Gericht milde zu stimmen. Sie war kratzbürstig und streitsüchtig und versuchte zunächst, Ursula wegen Verleumdung zu verklagen – ein erstaunlich moderner, amerikanischer Ansatz, mit dem sie im Deutschland jener Zeit jedoch nur Öl ins Feuer goss, da Ursulas gut vernetzte Familie Beziehungen zu den lokalen Behörden besaß. Dann versuchte sie, den Richter mit einem Silberkelch zu bestechen, damit er ihren Fall abwies, was dieser prompt als Schuldeingeständnis interpretierte. Erst daraufhin eskalierte der Zivilprozess zu einem Strafverfahren wegen Hexerei.
Inmitten dieses Tumultes starb Keplers nach seiner Mutter benannte Säuglingstochter an Epilepsie, gefolgt von einem weiteren Sohn, der mit vier Jahren den Pocken erlag.
Sobald er von den Anschuldigungen gegen sie erfahren hatte, übernahm der trauernde Kepler die Verteidigung seiner Mutter und widmete dem Prozess sechs Jahre seines Lebens, während er gleichzeitig versuchte, seine wissenschaftliche Arbeit fortzusetzen und die Rudolfinischen Tafeln fertigzustellen, ein Werk auf der Basis von Tycho Brahes Daten, mit Hilfe deren sich die Positionen der Planeten mit bis dahin unerreichter Genauigkeit darstellen ließen. Da Kepler in jenen Jahren als Mathematiker in Linz arbeitete, musste er von dort aus für seine Mutter tätig werden. Zunächst verfasste er mehrere Petitionen, anschließend eine akribische Verteidigungsschrift. Er verlangte eine Dokumentation der Zeugenaussagen und Abschriften der Verhöre seiner Mutter. Dann reiste er quer durchs Land, besuchte Katharina im Gefängnis und redete stundenlang mit ihr, um Informationen über die Menschen und Ereignisse in der Kleinstadt zu sammeln, die er vor langer Zeit verlassen hatte. Entgegen der Behauptung, sie sei dement, verfügte die siebzigjährige Katharina über ein erstaunliches Gedächtnis und erinnerte sich bis in die kleinsten Details an Vorfälle, die sich vor Jahren ereignet hatten.
Kepler machte sich daran, jeden einzelnen der neunundvierzig »Schandpunkte«, die seiner Mutter zur Last gelegt wurden, mit wissenschaftlichen Methoden zu widerlegen und die natürlichen Ursachen für die »übernatürlichen« Übel aufzudecken, die sie den Stadtbewohnern angeblich zugefügt hatte. Er wies nach, dass Ursula abgetrieben hatte, dass das junge Mädchen einen tauben Arm bekommen hatte, weil es zu viele Ziegelsteine getragen hatte, dass das Bein des Schulmeisters gelähmt war, weil er in einen Graben gestolpert war, und dass der Metzger an einem Hexenschuss litt.
Doch keiner seiner schriftlichen Appelle an die Vernunft zeigte Wirkung. Nach fünf Jahren der Tortur wurde Haftbefehl gegen Katharina erlassen. In den frühen Morgenstunden eines Augusttages stürmten bewaffnete Wachen in das Haus ihrer Tochter und fanden Katharina, die den Tumult gehört und sich in einer Wäschetruhe versteckt hatte – nackt, wie sie oft während der heißen Sommermonate schlief. Einer Überlieferung zufolge durfte sie sich noch ankleiden, laut einer anderen wurde sie unbekleidet mitsamt der Truhe zum soundsovielten Verhör geschleppt, um eine Störung der öffentlichen Ordnung zu vermeiden. Die angeblichen Beweise gegen Katharina waren vollkommen an den Haaren herbeigezogen, ja selbst ihre Gelassenheit angesichts der erlittenen Demütigungen legte man als Indiz ihrer Schuld aus. So wurde die Tatsache, dass sie während des Verfahrens nicht geweint hatte, als Beleg für ihre ruchlose Verbindung mit dem Teufel angeführt. Kepler musste dem Gericht erklären, dass er nie gesehen habe, wie seine stoische Mutter auch nur eine einzige Träne vergoss – weder als ihr Mann sie verließ, als Kepler noch klein war, noch während der langen Jahre, in denen sie ihre Kinder allein großzog, noch aufgrund der zahlreichen Einschränkungen, die das Alter mit sich brachte.
Katharina drohte die Streckung auf dem Rad – einem diabolischen Folterinstrument, das häufig dazu benutzt wurde, Geständnisse zu erpressen –, es sei denn, sie gab zu, Hexerei zu praktizieren. Die alte Frau, die die durchschnittliche Lebensspanne ihrer Epoche bereits um Jahrzehnte überschritten hatte, verbrachte die nächsten vierzehn Monate in einer dunklen Zelle, wo sie, an eine schwere Eisenkette gefesselt, auf dem nackten Steinboden sitzen und schlafen musste. Doch sie sah den Drohungen gefasst ins Auge und gestand nichts.
Während im Land der Dreißigjährige Krieg wütete, reiste Kepler zu einem letzten Rettungsversuch in seine alte Heimat. Ob er sich auf dieser deprimierenden Reise wohl fragte, warum er den Traumüberhaupt geschrieben hatte und ob irgendeine Wahrheit, egal welche, es wert war, so schlimmes persönliches Leid erdulden zu müssen?
Vor langer Zeit, kurz nach seinem Studium in Tübingen, hatte KeplerPlutarchsDe facie in orbe lunae (dt. Das Mondgesicht) gelesen – die mythische Geschichte eines Reisenden, der zu einer Inselgruppe nördlich von Großbritannien segelt, wo Menschen leben, die Geheimpassagen zum Mond kennen. Plutarchs Schrift hat zwar nichts mit Wissenschaft zu tun, sondern ist reine Phantasie, doch greift er darin zu dem gleichen einfachen, aber cleveren Trick wie Kepler fünfzehn Jahrhunderte später in seinem Traum, um die anthropozentrische Voreingenommenheit seiner Leserschaft zu erschüttern: Plutarch beschreibt den Mond als potentiellen Lebensraum und weist in diesem Zuge darauf hin, dass die Vorstellung eines Lebens im Salzwasser für luftatmende Kreaturen wie uns unvorstellbar erscheint und dennoch Leben in den Ozeanen existiert. Es sollte achtzehn Jahrhunderte dauern, ehe wir uns nicht nur für das Leben im Meer interessierten, sondern auch für die Komplexität und Pracht dieser kaum ergründbaren Realität. Großen Anteil daran hatte Rachel Carson, indem sie eine neue Ästhetik der poetischen Wissenschaftsliteratur einführte und die Menschen, für die sie schrieb, dazu anregte, die Erde einmal aus der nichtmenschlichen Perspektive von Meeresbewohnern zu betrachten.
1595 hatte KeplerPlutarchsBuch erstmals gelesen, aber erst mit der Sonnenfinsternis von 1605 – durch deren Beobachtung er zu der Erkenntnis gelangte, dass die Umlaufbahnen der Planeten keine Kreise waren, sondern Ellipsen sein mussten – begann er, die Allegorie ernsthaft als Mittel zur Veranschaulichung kopernikanischer Ideen in Erwägung zu ziehen. Während Plutarch interplanetare Reisen als Metaphysik behandelt hatte, machte Kepler sie zu einem Sandkasten für echte Physik, indem er die Gravitation und die Planetenbewegung thematisierte. Beispielsweise verdeutlicht er durch die Beschreibung des Starts seines imaginären Raumschiffs, dass er über ein theoretisches Modell der Gravitation verfügte, welches die Belastungen berücksichtigte, die das Ausbrechen der Raumfahrer aus dem Gravitationsfeld der Erde für sie bedeuten würde. Er ergänzt, dass sich das Raumschiff, nachdem es einmal die Einflusszone der Erde verlassen hatte, im schwerkraftfreien »Aether« mit nur wenig Energie fortbewegen ließe – ein frühes Verständnis von Trägheit im modernen Sinne, Jahrzehnte vor Newtons erstem Gesetz, welches besagt, dass sich ein Körper mit konstanter Geschwindigkeit bewegt, sofern er nicht von äußeren Kräften beeinflusst wird.
In einer so aufschlussreichen wie amüsanten Szene beschreibt Kepler die körperlichen Anforderungen an seine Mondreisenden – eine vorausschauende Darstellung des heutigen Auswahlverfahrens von Astronauten:
Keine Freunde sitzender Lebensweise werden von uns in unsere Gemeinschaft aufgenommen, keine dicken, keine verzärtelten Leute. Vielmehr wählen wir die aus, die ihr Leben lang ständig auf schnellen Pferden reiten oder die häufig nach Indien segeln; sie müssen daran gewöhnt sein, sich von Zwieback, Knoblauch, Dörrfisch und abscheulichen Speisen zu ernähren.
Drei Jahrhunderte später suchte der Polarforscher Ernest Shackleton mit einer ganz ähnlich lautenden Anzeige eine Mannschaft für seine bahnbrechende Antarktisexpedition:
Männer für gefährliche Reise gesucht. Geringer Lohn, bittere Kälte, monatelang völlige Dunkelheit, ständige Gefahr. Sichere Heimkehr zweifelhaft, Ehre und Ruhm im Erfolgsfall.
Als eine Frau namens Peggy Peregrine im Namen eines begeisterten, jedoch weiblichen Trios ihr Interesse bekundete, antwortete Shackleton trocken, es gebe bei der Expedition keine freien Stellen für das andere Geschlecht. Ein halbes Jahrhundert später würde die russische Kosmonautin Walentina Tereschkowa als erste Frau die Erdatmosphäre mit einem Raumschiff verlassen, geleitet von Keplers Gesetzen.
Nachdem er jahrelang mit vernünftigen Argumenten gegen den Aberglauben gekämpft hatte, gelang es Kepler schließlich, einen Freispruch für seine Mutter zu erwirken. Doch die fünfundsiebzigjährige Frau erholte sich nicht mehr von dem Trauma des Prozesses und dem bitterkalten Winter im unbeheizten Gefängnis. Am 13. April 1622, kurz nach ihrer Entlassung, starb Katharina Kepler und fügte damit den Verlusten ihres Sohnes einen weiteren hinzu. Ein Vierteljahrtausend später schrieb Emily Dickinson in einem Gedicht, dessen zentrale Metapher sich auf Keplers Vermächtnis stützt:
Wen wir verlieren, nimmt ein Stück
Von uns; ein halbes Rund
Bleibt stehn, das nächtliche Gezeiten
Anrufen wie den Mond.
Wenige Monate nach dem Tod seiner Mutter erhielt Kepler einen Brief von Christoph Besold, jenem Kommilitonen, der sich dreißig Jahre zuvor für seine Mond-Dissertation eingesetzt hatte und inzwischen ein erfolgreicher Anwalt und Juraprofessor war. Nachdem er von Katharinas schrecklichem Schicksal erfahren hatte, hatte sich Besold dafür eingesetzt, die Unwissenheit und den Machtmissbrauch aufzudecken, die dahintersteckten. Er hatte sich ein Dekret des Herzogs von Keplers Heimatherzogtum beschafft, das alle Hexenprozesse verbot, die nicht vom Oberrat im städtischen und vermutlich weitaus weniger abergläubischen Stuttgart genehmigt wurden. »Während weder dein Name noch der deiner Mutter im Edikt erwähnt wird«, schrieb Besold an seinen alten Freund, »weiß jeder, dass er am Ende daruntersteht. Du hast der ganzen Welt einen unschätzbaren Dienst erwiesen, und eines Tages wird dein Name dafür gesegnet werden.«
Kepler blieb davon unbeeindruckt – vielleicht wusste er, dass politischer und kultureller Wandel kaum dasselbe sind und sich auf verschiedenen Zeitskalen vollziehen. Die restlichen Jahre seines Lebens verbrachte er damit, den Traummit zweihundertdreiundzwanzig Fußnoten zu kommentieren – ein Zusatz, so lang wie der Text selbst –, in denen er seine genauen wissenschaftlichen Gründe für die Verwendung der Symbole und Metaphern erläuterte, um auf diese Weise abergläubischen Interpretationen zuvorzukommen.
In der sechsundneunzigsten Fußnote erklärte Kepler klar und deutlich: »Hier offenbart sich die Hypothese des ganzen Somniums, nämlich die Begründung für die Bewegung der Erde oder eher die Widerlegung der Begründung gegen die Bewegung der Erde, die auf der Sinneswahrnehmung aufgebaut ist.« Fünfzig Fußnoten später betonte er noch einmal, er habe die Allegorie als »eine hübsche Entgegnung« auf die beschränkte ptolemäische Sichtweise ersonnen. In dem revolutionären, systematischen Versuch, die wissenschaftliche Wahrheit von den Illusionen der sinnlichen Wahrnehmung zu trennen, schrieb er:
Alle schreien, die Bewegung der Sterne um die Erde und genauso die Unbewegtheit der Erde lägen offen vor Augen; ich entgegne, vor den Augen der Mondbewohner liege offen die Rotation unserer Erde, ihrer Volva, und ebenso die Unbewegtheit ihres Mondes. Wenn man nun sagt, die Mondsinne meiner Mondvölker würden getäuscht, erwidere ich mit gleichem Recht, die irdischen Sinne der Erdbewohner würden getäuscht, da sie bar der Vernunft seien.
In Fußnote sechsundsechzig definierte Kepler die Gravitation als »eine Kraft wechselseitiger Anziehung, ähnlich der magnetischen«, und erläuterte ihr grundlegendes Gesetz:
Die Kraft dieser Anziehung ist größer bei benachbarten Körpern als bei entfernten. Stärker also widerstehen sie der Trennung des einen vom andern, wenn sie einander noch nahe sind.
In Fußnote zweihundertzwei wies er darauf hin, dass die Gravitation eine universelle Kraft sei, die Körper auch außerhalb der Erde beeinflusse, und dass die Mondgravitation für die irdischen Gezeiten verantwortlich sei: »Doch die Ursache für die Meeresstürme scheinen die Körper von Sonne und Mond zu sein, welche die Meerwasser mit einer magnetischen Kraft anziehen.« Diese Tatsache, die für die Newton’schen Gesetze von zentraler Bedeutung ist und uns heute so alltäglich erscheint, dass Schulkinder sie als eindeutigen Beweis der Schwerkraft benennen, wurde in den wissenschaftlichen Kreisen, in denen sich Kepler bewegte, bei weitem nicht akzeptiert. Galilei, der mit so vielem recht hatte, lag auch mit vielem falsch, was man nicht vergessen sollte, wenn man sich in der kulturellen Akrobatik der nuancierten Wertschätzung ohne Vergötterung übt. Galilei glaubte zum Beispiel, dass Kometen Dämpfe der Erde seien – eine Vorstellung, die Tycho Brahe auf Basis seiner Beobachtung ebenjenes großen Kometen widerlegte, der in dem sechsjährigen Kepler die Liebe zur Astronomie auslöste. Brahe demonstrierte, dass Kometen Himmelsobjekte sind, die sich auf berechenbaren Bahnen durch den Weltraum bewegen. Doch Galilei leugnete nicht nur, dass die Gezeiten durch den Mond verursacht wurden, nein, er ging sogar so weit, Kepler für seine Behauptung zu verspotten: »Dieses Konzept ist für meinen Verstand ganz und gar abstoßend«, schrieb er, und zwar nicht etwa in einem privaten Brief, sondern in seinem Meilenstein Dialogosopra i due massimi sistemi del mondo (dt. Dialog über die beiden hauptsächlichsten Weltsysteme). Und er höhnte weiter: »Wie konnte er, bei seiner freien Gesinnung und seinem durchdringenden Scharfblick, wo er die Lehre von der Erdbewegung in Händen hatte, Dinge anhören und billigen wie die Herrschaft des Mondes über das Wasser, die verborgenen Qualitäten und was der Kindereien mehr sind?«
Kepler widmete sich besonders sorgfältig jenem Teil der Allegorie, den er am unmittelbarsten für den Hexenprozess seiner Mutter verantwortlich machte – die Erscheinung von neun Geistern, die von der Mutter des Protagonisten beschworen wurden. In einer Fußnote erklärte er, dass diese die neun griechischen Musen symbolisieren könnten. In einem eher kryptischen Satz der Erzählung heißt es zu den Geistern weiter: »… und einer davon ist mir besonders bekannt; er ist von allen gerade der sanfteste und unschuldigste und wird durch 21 Zeichen herbeigerufen.« Der dazugehörigen Erklärung in den Fußnoten zufolge beziehen sich die einundzwanzig Zeichen auf die Anzahl der Buchstaben, die man für die Schreibweise von Astronomia Copernicana brauche. Dieser sanfteste Geist sei Urania, die altgriechische Muse der Astronomie, die Kepler als die zuverlässigste der Wissenschaften bezeichnete:
[Die Wissenschaften sind] zwar alle für sich selbst mild und unschuldig (…) (und darum nicht jene abtrünnigen und nichtswürdigen Geister, die mit Magiern und Hexen Verkehr haben …), aber besonders die Astronomie, schon wegen der Eigenart ihres Gegenstandes.
Als der Astronom William Herschel eineinhalb Jahrhunderte später den siebten Planeten von der Sonne aus entdeckte, nannte er ihn Uranus, nach ebenjener Muse. In Deutschland hörte der junge Beethoven von der Entdeckung und fragte sich in den Marginalien zu einer seiner Kompositionen: »Was sie wohl auf dem Stern Urania von meiner Musik halten?« Weitere knapp zwei Jahrhunderte später, als Ann Druyan und Carl Sagan für die Voyager Golden Record ein Porträt der Menschheit in Bild und Ton komponierten, segelte Beethovens Fünfte Sinfonie an Bord der Raumsonde in den Kosmos, neben einem Stück der Komponistin Laurie Spiegel, das auf KeplersWeltharmonik basiert.
Kepler machte keinen Hehl daraus, dass er mit seiner Allegorie durchaus auch politische Ziele verfolgte. Im Jahr nach dem Tod seiner Mutter schrieb er an einen Bekannten:
Wäre es nicht ausgezeichnet, die zyklopischen Sitten unserer Zeit in lebhaften Farben zu schildern, dabei aber der Vorsicht halber die Erde zu verlassen und auf den Mond zu gehen?
Ist es nicht besser, so fragt er sich in einem weiteren psychologischen Geniestreich, die Monstrosität der menschlichen Ignoranz durch die Unwissenheit von anderen, imaginären Wesen zu veranschaulichen? Er hoffte, dass die Bewohner der Erde, wenn sie die Absurdität in den Überzeugungen der Mondbewohner erkannten, dass der Mond das Zentrum des Universums sei, die Einsicht und den Anstand besäßen, ihren eigenen Glauben an die Erde als Mittelpunkt in Frage zu stellen. Dreihundertfünfzig Jahre später, als fünfzehn prominente Dichter gebeten wurden, eine »Erklärung zur Poesie« zu einer einflussreichen Anthologie beizusteuern, würde Denise Levertov – die einzige Frau unter den fünfzehn – erklären: Sofern Poesie eine soziale Funktion habe, sei es jene, Schlafende mit anderen Mitteln als einem Schock zu wecken. Das Gleiche muss auch Kepler mit seinem Traum bezweckt haben – es war seine Serenade zur Poesie der Wissenschaft, die die Schlafenden wecken sollte.
Im Dezember 1629 finanzierte Kepler den Druck seines Traum-Manuskripts aus seinem eigenen, ohnehin schon schmalen Geldbeutel und setzte es selbst von Hand. Für die ersten sechs Seiten brauchte er vier Monate; dann ging ihm das Geld aus. Er ließ seine Familie in ihrem vorübergehenden Heim in Sagan zurück und reiste, bereits gesundheitlich angeschlagen, nach Leipzig, wo er sich fünfzig Gulden lieh – eine beträchtliche Summe, in etwa so viel wie ein guter Handwerker in einem Jahr verdiente. Dann zog er seine wärmsten braunen Strümpfe an, steckte eine Pistole und eine Pulverflasche in seinen abgetragenen schwarzen Wollmantel und machte sich auf den Weg nach Nürnberg, wo er eine alte Mähre kaufte, die genauso mager war wie er selbst. Die beiden klapprigen Gestalten reisten hundert Kilometer durch den Herbstregen an den bayerischen Hof in Regensburg, wo Kepler die Erlaubnis erbat, einige österreichische Anleihen zu verkaufen, um seine Schulden zu begleichen und den Traum zu vollenden. Wenige Tage nachdem er angekommen und sich im Haus eines Bekannten einquartiert hatte, das heute nach ihm benannt ist, wurde Kepler schwer krank. Doch er war an häufige Fieberanfälle und körperliche Beschwerden gewöhnt und schenkte ihnen nur wenig Beachtung. Man ließ ihn zur Ader, um seine Symptome zu lindern, aber er verlor zwischendurch immer wieder das Bewusstsein. Geistliche wurden an sein Bett gerufen.
Am 15. November 1630 um zwölf Uhr mittags starb Johannes Kepler, sechs Wochen vor seinem neunundfünfzigsten Geburtstag. Drei Tage später, als seine Leiche auf dem evangelischen Petersfriedhof zur Ruhe gebettet wurde, predigte ein Pastor: »Selig sind, die das Wort Gottes hören und bewahren.« Bald darauf würde der Dreißigjährige Krieg, in dem unselig um das angebliche Wort Gottes gekämpft wurde, den Friedhof verschlingen und jede Spur von Keplers Knochen beseitigen.
In der Nacht nach der Beerdigung wanderte der Vollmond durch den Erdschatten; eine Mondfinsternis, regiert von ewigen Kräften, die für menschliche Worte taub sind – grundlegenden Wahrheiten der Natur, die Kepler in der Muttersprache des Universums ausgedrückt hatte: der Mathematik. Dreihundertneununddreißig Jahre später würde sein Traum wahr werden, als der erste Mensch seinen Fuß auf die Mondoberfläche setzte – der Menschheit großer Schritt, der durch eine Flugbahn möglich geworden war, die KeplersGesetzen folgte.
Das kopernikanische Modell war die erste Theorie, die unserer anthropozentrischen Selbstherrlichkeit einen gehörigen Dämpfer versetzte. Seitdem wurden unsere Gewissheiten immer wieder in ihren Grundfesten erschüttert, sei es durch die Evolutionslehre, die Bürgerrechte oder die Ehe für alle, wobei große Teile der Gesellschaft auf Letztere mit einer ähnlichen Ablehnung reagierten wie die Einwohner von Keplers Heimatstadt auf das kopernikanische Weltbild. Was im Zentrum steht – sei es des Universums oder unserer Machtstrukturen –, muss im Zentrum bleiben, selbst wenn es auf Kosten der Wahrheit geht. »Die nämlichen, genau die nämlichen Widerstände wie heute hat es mit einem leichten Wechsel der Szene & des Kostüms zu allen Zeiten gegeben«, würde Ralph Waldo Emerson Mitte des neunzehnten Jahrhunderts in sein Tagebuch schreiben.
Knapp zweihundertfünfzig Jahre nach der Sonnenfinsternis, die Kepler auf die Idee zu seinem Traum brachte, erschien im New York Herald ein Bericht über die Frauenrechtskonvention von 1852. Der Verfasser – ein Mann, der sich vehement gegen die Vorstellung wandte, dass Frauen den Männern gleich seien – schrieb, die Konvention habe aus »alten Jungfern bestanden, deren persönlicher Charme nie besonders einnehmend war«, und Frauen, die »zu so viel Streitlust disponiert sind, dass die Natur sie scheinbar mit dem falschen Geschlecht ausgestattet hat – Mannsweiber wie Hühner, die krähen«. Sein Kommentar enthielt unter anderem folgende Passage, die den Gipfel der Unlogik darstellt und von regelrechter Hysterie zeugt:
Wenn es wahr wäre, dass das weibliche Geschlecht dem männlichen in Bezug auf körperliche Stärke und geistige Kraft gleichwertig ist, wie kommt es dann, dass vom Anbeginn der Welt bis zur Gegenwart, in allen Altersgruppen, in allen Ländern und Klimazonen, in jeder Varietät der menschlichen Spezies, das männliche Geschlecht vorherrschend war und das weibliche ihm politisch, sozial und im Familienkreis unterworfen? (…) Wie ist die Frau überhaupt dem Manne untertan geworden, so wie sie es heute auf der ganzen Welt ist? Durch ihre Natur – ihr Geschlecht –, genauso wie der Neger es ist und immer sein wird, bis zum Ende der Zeit, der weißen Rasse unterlegen und daher zur Unterwerfung verdammt; aber glücklicher, als sie es in jedem anderen Zustand wäre, da es nun einmal das Gesetz ihrer Natur ist.
Im Zuge des Hexenprozesses seiner Mutter machte Kepler eine weitere Bemerkung, die seiner Zeit Jahrhunderte voraus war, noch bevor der französische Philosoph François Poullain de la Barre Ende des siebzehnten Jahrhunderts aussagen sollte, der Geist habe kein Geschlecht. Zu Keplers Zeiten, lange vor der Entdeckung der Genetik, glaubte man, dass Kinder in Physiognomie und Charakter Ähnlichkeit mit ihren Müttern hätten. Kepler war sich jedoch sehr deutlich bewusst, wie unterschiedlich er und seine Mutter als Menschen waren, wie verschieden ihre Weltanschauungen und ihre Schicksale – er ein sanftmütiger führender Wissenschaftler, der dabei war, die Welt grundlegend zu verändern; sie eine launenhafte, ungebildete Frau, die wegen Hexerei vor Gericht stand. Für Kepler war es unausweichlich, sich zu fragen, was das Schicksal eines Menschen bestimmte – die Horoskope, die er erstellt hatte, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen, konnten es ja nicht sein. Was aber dann? Als Wissenschaftler auf der Suche nach Kausalität argumentierte er, ein Vierteljahrtausend bevor die Sozialpsychologie zum offiziellen Studienfach wurde, dass alles, was seine Mutter in so große Schwierigkeiten gebracht hatte – ihre auf Unwissenheit beruhenden Überzeugungen und Verhaltensweisen, die als Zeichen der Besessenheit interpretiert wurden, ihre soziale Ausgrenzung als alleinstehende Frau –, auf der Tatsache beruhte, dass sie nie von der Erziehung profitiert hatte, die ihrem Sohn qua Geschlecht vorbehalten war. Im vierten Abschnitt seinerWeltharmonik – seinem gewagtesten und spekulativsten Streifzug durch die Naturphilosophie – schreibt Kepler in einem Kapitel, das sich mit »metaphysischen, psychologischen und astrologischen« Fragen beschäftigt:
Ich kenne eine Frau, die fast unter den gleichen Aspekten geboren ist. Sie ist von sehr unruhigem Geist, erreicht damit aber nicht nur nichts auf wissenschaftlichem Gebiet (was bei einer Frau nicht verwunderlich ist), sondern bringt auch ihre ganze Gemeinde in Aufregung und ist sich selber Urheberin beklagenswerten Elendes.
Im nächsten Satz identifiziert Kepler die fragliche Frau als seine eigene Mutter und stellt fest, dass sie nie dieselben Privilegien besessen habe wie er. »Zweitens kommt hinzu, dass ich als Mann geboren bin, nicht als Frau«, schreibt er, »den Geschlechtsunterschied suchen die Astrologen vergebens am Himmel.« Die unterschiedlichen Schicksale der Geschlechter, deutet Kepler an, werden nicht vom Himmel bestimmt, sondern von der irdischen Konstruktion des Geschlechts als kultureller Funktion. Nicht die Natur seiner Mutter mache sie unwissend, sondern die Folgen ihres sozialen Status in einer Gesellschaft, die in der Ermöglichung intellektueller Erleuchtung und Selbstverwirklichung so unflexibel sei wie die Fixsterne.
2UM MONDLOS IM STERNENSTAUB ZU FINDEN
Maria Mitchell steht im Wohnzimmer ihres bescheidenen Elternhauses in der Vestal Street Nummer 1 auf der Insel Nantucket. Es ist zwar »schmucklos, unansehnlich«, wie sie später in einem Gedicht schreiben würde, aber dennoch ein von allen geliebtes Heim. Neben ihr steht ein glänzendes Messingteleskop, das durch das Fenster, aus dem die Scheiben herausgenommen sind, hinauf in den Himmel gerichtet ist. Sie ist so aufgeregt, dass sie die eisigen Böen des Februarwindes gar nicht spürt, die von draußen hereinwehen. Über ihr an der Zimmerdecke hängt eine mit Wasser gefüllte Glaskugel und sprenkelt den Raum mit schillernden Regenbögen. Mit ihren großen braunen Augen blickt Maria durch eine rußgeschwärzte Scherbe in den allmählich dunkler werdenden Mittagshimmel, während sie auf die Sonnenfinsternis wartet und sich bereit macht, zu zählen, wie viele Sekunden sie dauert.
Im oberen Stockwerk hat ihr Vater einen Einbauschrank zu einem Arbeitszimmer umgebaut. Eigentlich sollten seine zehn Kinder es abwechselnd benutzen, aber in Wirklichkeit wird es allein von Maria beansprucht. An der Tür hängt ein Zettel, auf dem in ihrer ordentlichen Handschrift steht: »Miss Mitchell ist beschäftigt. Bitte nicht anklopfen.«
Einundzwanzig Minuten nach zwölf an diesem außergewöhnlich kalten Wintersamstag im Jahr 1831 legt sich ein metallisches Licht auf die Häuser, die Hügel und den Hafen und verwandelt alles in eine lebendige Daguerreotypie. Ich stelle mir eine Person vor, die die schmale, gepflasterte Straße entlanggeht, Beethoven pfeift und plötzlich mitten in der Melodie innehält. Ich stelle mir einen jungen Walfänger unten in der Bucht vor, der sich auf seine Harpune stützt, um nach oben zu blicken.
Hundert Meilen weiter nördlich, unter dem unheimlichen Himmel des teilweise verdunkelten Concord, hat Ralph Waldo Emerson gerade seine geliebte junge Braut begraben, die mit zwanzig Jahren an Tuberkulose gestorben ist.
Vor dem sich vertiefenden Kobaltblau des Firmaments gleitet der Mond vor die Sonne und bildet eine immer schmaler werdende Sichel. Als das Gestirn schließlich von einem leuchtenden Ring umgeben ist, beginnt Maria zu zählen, mit einem einhundertsiebzehn Sekunden währenden Gefühl, als blicke sie durch den Gewehrlauf der Zeit, goldumrahmt und unheimlich.
Sie ist damals zwölf Jahre alt und zutiefst fasziniert von den Wundern des Kosmos und der klar umrissenen Wahrheit der Mathematik. Ihr überragender Intellekt lässt sich nicht aufhalten, weder von den Beschränkungen ihrer Zeit noch von jenen ihrer Herkunft. Damals besitzen Frauen kein Wahlrecht, und nirgendwo auf der Welt bietet sich ihnen die Möglichkeit einer schulischen oder gar universitären Ausbildung in Mathematik oder Astronomie. Noch nie hat die Regierung der USA eine Stelle im Technikbereich mit einer Frau besetzt. Das Frauenwahlrecht sollte Maria Mitchell nicht mehr erleben, aber sie würde auf vielen Gebieten die Erste sein: Amerikas erste professionelle Astronomin, die erste Frau, die in die American Academy of Arts and Sciences aufgenommen wird, die erste Frau, die von der Regierung für eine »spezielle, nichthäusliche Tätigkeit« als »computer of Venus« eingestellt wird, um komplexe Berechnungen durchzuführen, die Seefahrern bei der Navigation helfen sollen.
Im selben Jahr, in dem sie die Sonnenfinsternis protokollierte, lobte der König von Dänemark – Europas größter Förderer der Wissenschaften – einen Preis aus: eine Medaille aus Gold im Wert von zwanzig Dukaten für die erste Person, die einen neuen teleskopischen Kometen entdeckte, also einen, der mit bloßem Auge nicht zu sehen war. Eine solche Entdeckung war keine Kleinigkeit – die geduldigen Beobachter mussten ein verschwommenes, schwanzloses Lichtpünktchen inmitten des kosmischen Durcheinanders existierender Objekte ausmachen, mit denen sie genauestens vertraut sein mussten, um die sich bewegende Erscheinung dazwischen überhaupt zu erkennen.
Über Jahre hinweg richtete Maria Mitchell ihr auf einem Stativ befestigtes Instrument Nacht für Nacht gen Himmel und durchforstete ihn mit stiller, systematischer Leidenschaft, auf der Suche nach einem neuen Objekt vor dem Hintergrund vertrauter Körper. An einem Herbstabend in ihrem neunundzwanzigsten Lebensjahr verließ sie heimlich eine Dinnerparty ihrer Eltern, um hinauf aufs Dach zu klettern und ihren Platz hinter dem Teleskop einzunehmen, eingehüllt in eine, von ihr selbst so genannte, »Regimentsuniform« – die schlichte Kleidung, die sie als Quäkerin trug. Ich stelle mir vor, wie diese sonst so beherrschte junge Frau zu ihrer eigenen Überraschung ein spontanes Keuchen ausstieß, als sie um 22.30Uhr am 1.Oktober des Jahres 1847 ihre Entdeckung machte. Eilig rief sie ihren Vater zu sich aufs Dach, um ihm den kleinen und doch so bedeutsamen Fleck zu zeigen, den sie in den immensen kosmischen Weiten isoliert hatte: einen neuen teleskopischen Kometen.
Was Maria Mitchell an diesem Abend mit Begeisterung erfüllte und sie ihr ganzes Leben lang antreiben würde, war weder die Medaille des dänischen Königs noch der Glanz weltweiter Anerkennung, sondern der schiere Nervenkitzel der Entdeckung – die Ekstase, ein kleines Wissensfragment aus dem riesigen Monolithen des Unbekannten gemeißelt zu haben, die elementare Antriebskraft eines jeden aufrichtigen Wissenschaftlers.
Trotz Marias Widerwillen, die Entdeckung öffentlich zu machen, bestand ihr Vater darauf, dass sie das Harvard