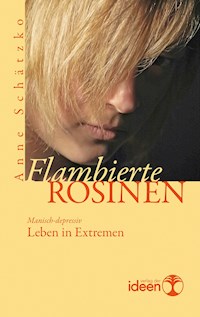
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag der Ideen
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
'Mich packte das Reisefieber, und ich düste mit dem Zug nach Zürich. Als ich dort spät abends ankam, verspürte ich erst einmal das dringende Bedürfnis zu duschen. Aber nicht etwa, dass ich warten wollte, bis ich im Hotel war. Nein, auf der Stelle musste es sein – in der Bahnhofsdusche! Ich erinnere mich noch, dass das ein recht abenteuerliches Unternehmen war: Irgendwie musste ich über meinen Gehwagen klettern, um überhaupt in die Duschkabine zu passen. 'Blitzblank' suchte ich als nächstes in einer Telefonzelle die Nummer eines mir bekannten Anwalts, um ihn mit einem Spontanbesuch zu überraschen. Dumm nur, dass ich in Zürich gar keinen Anwalt kenne! Und auch sonst niemanden.' Mit schonungsloser Ehrlichkeit und einer reichlichen Portion Selbstironie erzählt Anne Schätzko die skurrilen Geschichten, seltsamen Begegnungen und haarsträubenden Abenteuer, die sie während ihrer manischen Phasen erlebte. Auch oder gerade weil sie die schweren und dunklen depressiven Phasen und ihre vielen Suizidversuche, die sie schwer behindert überlebte, nicht verschweigt, ist ihre Lebensgeschichte das Zeugnis einer mutigen Frau und deren Liebe zum Leben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 139
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Anne Schätzko,
Münchnerin, Jahrgang 1957, ledig, kinderlos, ist promovierte Chemikerin. Nach kurzer Berufstätigkeit erkrankte sie infolge ihrer massiven psychischen Instabilität schwer. In »Flambierte Rosinen«, ihrem Erstlingswerk, schildert sie die Höhen und Tiefen ihres Lebens mit der Diagnose »manisch-depressive Störung«.
Anne Schätzko
Flambierte Rosinen
Manisch-depressivLeben in Extremen
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© 2010 Verlag der Ideen, Volkachwww.verlag-der-ideen.de
eISBN 978-3-942006-02-6
Covergestaltung, Titelfoto und Layout: Jonas Dinkhoff
In Dankbarkeit für meine verstorbene Mutter
Inhalt
Vorwort und Dank
Prolog
Weiße Trauben: Sommer 1982
Donnergrollen: Winter 1982
Blaue Trauben: Frühjahr 1983
Feuer(chen) 1: Sommer 1983
1984 bis 1986: Alkohol und Hochs und Tiefs
Kernlose Trauben: Frühjahr 1987
Intermezzo: Frühjahr/Frühsommer 1988
Feuer 2: Herbst 1988
Reflexion
Intermezzo: Sommer 1989 bis Herbst 1992
Feuer 3: Herbst 1992
Sultaninen: Frühjahr 1993
Korinthen: Frühjahr 1994
Feuer 4: Spätherbst 1994
Studentenfutter : Frühjahr 1995
Rum-Rosinen: Frühjahr 1996
Feuer 5: Herbst 1996
Moussierende Trauben: Frühsommer 1999
Muskatellertrauben: Frühjahr 2000
Feuer 6: Herbst 2000
Feuer 7: Herbst 2001
Über die Zeit nach dem Feuer 7
Feuer 8: Sommer 2004
Über die Zeit nach dem Feuer 8
Reflexion
Der blühende Rebstock (ab 2005)
Ehrenrunde (Sommer/Herbst 2006)
Die Zeit danach
Ursachenforschung
Krisenintervention (ab Herbst 2008)
Epilog
Nachwort
Weitere E-Books von Verlag der Ideen
Alles geben die Götter, die Unendlichen,
Ihren Lieblingen ganz.
Alle Freuden, die Unendlichen,
Alle Leiden, die Unendlichen, ganz.
J. W. v. Goethe
Vorwort und Dank
In Deutschland sind allein 4 Millionen Menschen an Depressionen erkrankt. Rechnet man die von anderen psychischen Krankheiten Betroffenen dazu, kommt man zu einer Zahl, die Erkrankungen der Seele kein vernachlässigbares Randphänomen mehr sein lassen. Trotzdem wurde dieses Thema tabuisiert. Erst durch das Schicksal von Robert Enke wurde eine Diskussion angeregt.
Dieses Buch schildert mein Leben, in dem sich Depressionen (in meinem Fall mit gravierenden Folgen) mit euphorischen Stimmungsbildern abwechseln.
Die an dieser Stelle üblichen Danksagungen fallen vergleichsweise gering aus. Dafür danke ich zwei Menschen umso mehr: meiner Mutter und meinem Vater. Sie schenkten mir die Gabe, mein Leben voll auszukosten. Meinem Freund Joe danke ich, dass er meine Eskapaden geduldig ertragen hat. Auch waren die Kommentare meiner Schwester für dieses Manuskript sehr hilfreich. Meine Psychotherapeutin und Freundin Constanze brachte mich auf den Titel – vielen Dank!
Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind rein zufällig. Auch die Namen, insbesondere die der psychiatrischen Kliniken, sind verfremdet worden. Nur der Name Joe ist authentisch.
Die psychiatrischen Krankenhäuser kommen in meiner Schilderung vielleicht zu schlecht weg. Das ist aber eine rein persönliche Meinung.
München, im Januar 2010
Prolog
Zuerst einmal möchte ich mich vorstellen: Ich bin 52 Jahre alt, ledig, kinderlos – und im Frühjahr 1984 wurde die Diagnose gestellt: Zyklothymie (manisch-depressive Erkrankung).
Jahrelang war es mein Wunsch, über diese »Krankheit« ein Buch zu schreiben; aber ich wusste nicht so recht, wie. Mir war klar, dass es unterhaltsam sein müsste, da es sonst niemanden interessieren würde – zugleich sollte es sich aber auch ernsthaft mit psychischer Instabilität auseinandersetzen. Ich hoffe, diese Mischung ist mir gelungen. Ich hoffe auch, der Leser kann über meine Erlebnisse genauso lachen wie ich – wenn ich sie mit der nötigen Distanz betrachte. Auf die dunklen Seiten bin ich nur dann ausführlicher eingegangen, wenn unbedingt nötig – eigentlich sind sie nämlich langweilig, weil immer dasselbe passiert. Da wäre es angebracht, depressive Phasen einfach über sich ergehen zu lassen, ohne sich viel dabei zu denken – aber so easy ist das eben nicht!
Was bedeutete die Diagnose »Manisch-depressiv« für mich? In Zukunft sollte ich also zu den »psychisch Kranken« gehören. Ein vernichtendes Urteil! In meinem Kopf ließ ich Revue passieren, was ich mit diesem Begriff assoziierte:
Positiv war nicht, was mir da so einfiel! Vor allem Worte wie »verrückt« und »Klapsmühle«. Doch ich wollte, genauso wie die Erfahrung, was Psychopharmaka so alles mit einem anstellen, dieses Problem erst einmal auf mich zukommen lassen. Ich würde mich, sollten Schwierigkeiten auftauchen, immer noch damit beruhigen können, dass es sich ja eigentlich um eine Stoffwechselerkrankung handelt. Aber weit gefehlt! In den folgenden Jahren tat es mir am meisten weh, intelligent aber gleichzeitig »verrückt« zu sein. Erst als ich in meinem Sprachgebrauch das Wort »Psychische Krankheit« durch den Begriff »Psychische Instabilität« ersetzte, fühlte ich mich wieder besser. Heute habe ich kein Problem mehr damit dazu zu stehen, psychisch instabil zu sein, und dass es mir dabei eben besser geht, wenn ich Medikamente nehme. Krank fühle ich mich aber gewiss nicht: Stimmungsschwankungen hat jeder. Der eine stärker, der andere in schwächerer Ausprägung. Wer will sich da schon anmaßen, eine Grenze zu ziehen zwischen »normal« und »krankhaft«? Die Medizin tut das, da gibt es ein »Diagnostisches Manual«. Sind bestimmte Symptome vorhanden, wird das Problem zur Krankheit erhoben.
Womit wir gleich dabei wären, was Manie und Depression eigentlich bedeuten:
Manisch zu sein heißt, zu gut drauf zu sein. Eigentlich hört sich das nach einem angenehmen Zustand an. Wenn man einmal davon absieht, dass z.B. ein gesteigertes Selbstwertgefühl (das sich aber leider plötzlich in Größenwahn umkehren kann), Bewusstseinserweiterung (wie schnell jedoch wirken z.B. die raschen Gedankenverknüpfungen und –sprünge leider nur noch läppisch), generell gesteigerter Antrieb (der aber irgendwann völlig unproduktiv wird) und Kontaktfreudigkeit (oftmals können andere Menschen deine Späße allerdings nicht nachvollziehen) etwas eigentlich Wünschenswertes sind, fallen bei näherer Betrachtung die negativen Dinge auf: Kaufrausch (der in Verschwendungssucht ausufert), gesteigerte Libido (und hinterher ist man dann über seine sexuelle Freizügigkeit schwer schockiert), Reiselust (wäre an sich ja nichts Schlechtes; nur dass man meistens ganz ohne Gepäck und immer ohne einen Pfennig Geld losfährt), innere Unruhe, extremer Bewegungsdrang, schwere Schlafstörungen und das totale Unvermögen, sich zu konzentrieren. Auch die körperlichen Empfindungen sind nicht gerade spaßig: Trotz Durchfalls hat man überhaupt keinen Hunger und Durst; jede noch so kleine Bewegung fällt ungeheuer schwer; es ist einem in geschlossenen Räumen so kalt wie im Winter draußen; oder Hände und Füße empfinden das Gegenteil – sie »kochen«; die Augen sind sehr lichtempfindlich (ich muss dann auch in geschlossenen Räumen eine Sonnenbrille aufsetzen). Früher hatte ich auch einen ausgeprägten Bewegungsdrang. Da musste ich des Öfteren im Quasi-Laufschritt, möglichst noch den voll aufgedrehten Walkman auf den Ohren, »Spazieren-Laufen«. Doch das hat sich Gott sei Dank gegeben – vielleicht auch, weil ich jetzt andere Medikamente nehme.
Auch auf das gesteigerte Bedürfnis, Geld auszugeben, möchte ich noch einmal zurückkommen: Während es sich meist in Grenzen hält, wieviel Geld man für Klamotten oder Bücher oder CD’s »verpulvert«, kann es auch schon zu größeren, meist sinnlosen und unüberlegten Anschaffungen kommen. Gundi (eine Bekannte aus der Psychiatrie) hat sich beispielsweise in einer Manie Grundstücke gekauft. In der nächsten fing sie an, eines davon zu bebauen. (Es versteht sich eigentlich fast von selbst, dass sie dafür gar nicht das Geld hatte.) Überhaupt nicht nachzuvollziehen ist jedoch, dass ihre Entscheidungen immer während eines Klinikaufenthalts fielen. Man sollte vom Personal dort erwarten können, dass es die Patienten vor dererlei vorschnellen Entschlüssen bewahrt! Ein solch unverantwortliches Verhalten ist mir aber leider auch schon begegnet. – Davon aber mehr an anderer Stelle. Meine größte Anschaffung: Ich habe mir einmal ein Auto gekauft. Das klingt an sich ganz harmlos – die Sinnlosigkeit wird erst beim näheren Betrachten deutlich: Da ich keinen Führerschein habe und zudem fahruntauglich bin, brauche ich ja gar kein Auto. Und damit der Kauf auch so richtig unökonomisch war, schaffte ich mir eines mit großem Motor und hohem Benzinverbrauch an, für das Ersatzteile schön teuer sind! Einen Wiederverkauf konnte ich vergessen, da ich es einem Bekannten geliehen hatte, der es so geschunden hat, dass das Automatikgetriebe Schaden nahm.
So manch einer hat sich in der Manie schon ganz in den finanziellen Ruin getrieben!
In der Manie ist der gesamte Stoffwechsel beschleunigt. Doch der Körper kann nicht immer auf Hochtouren laufen. Irgendwann ist ein völliger körperlicher und psychischer Erschöpfungszustand erreicht. Da es nur selten vorkommt, dass nur Manien auftreten, wird das später wohl in einer Depression wieder ausgeglichen, in der die körperliche und geistige Aktivität ganz schön heruntergefahren werden.
Der Übergang zwischen Manie und Schizophrenie ist fließend. So werde ich beispielsweise regelmäßig auch ein bisschen schizophren: totaler Realitätsverlust (z.B. bin ich mir in Manien immer absolut sicher, dass meine Eltern nicht meine leiblichen sind – Blödsinn!), Persönlichkeitsspaltung, Verfolgungswahn, Panikattacken, sehr selten auch optische oder akustische Halluzinationen.
In einer Psychose schadet einem jeder noch so kleine Reiz; denn man kann nie wissen, was er wieder für eine Gedankenkaskade auslöst! Ergo wäre es am besten, sich ins Bett zu legen und die Decke über den Kopf zu ziehen: Bloß nichts hören und sehen! Aber gerade dieses Sich-Abschotten ist in der Psychose unerträglich langweilig!
Bevor allerdings die Manie ihren »Schabernack« mit einem treibt, durchlebt man kurz auch eine angenehme Phase – die Hypomanie: Man fühlt sich pudelwohl in seiner Haut und der Antrieb ist gesteigert, aber gerade nur soweit, dass dieses Stimmungsbild produktiv ist.
Tja und so wie es rauf geht, muss es auch wieder runter gehen – womit wir bei der Depression angelangt wären: Jeder weiß, wie es ist, schlecht drauf zu sein. Minderwertigkeitsgefühle, Versagens- und Verlustängste, eine oft grundlose, tiefe Traurigkeit, Perspektivlosigkeit und Schlafstörungen quälen einen, auch Zukunftsängste sind an der Tagesordnung. Wenn man diese Missempfindungen über längere Zeit hat, man das Gefühl hat, sie erdrücken einen, überhaupt nicht mehr glaubt, dass sie wieder vergehen, vielleicht auch furchtbar Angst hat, zu verarmen oder sogar seinem Leben ein Ende setzen will, sprengen sie wohl den Rahmen einer üblichen Verstimmung – ab hier wird es irgendwo »krankhaft«.
Man bildet sich auch ein, alle redeten hinter vorgehaltener Hand über einen. Niemanden erträgt man um sich herum, weil man sich beobachtet fühlt und dem Gegenüber auch fast nichts zu sagen hat. Redet man überhaupt, kommt man sich wegen Wortfindungsstörungen wie ein Idiot vor. Dieser Eindruck seiner selbst wird dadurch verstärkt, dass das allgemeine Sprachniveau sinkt und man sich nichts merken kann. Selbst die einfachsten Verrichtungen hat man »verlernt« – so weiß ich beispielsweise in Depressionen regelmäßig nicht mehr, wie Waschen und Anziehen funktionieren.
Überhaupt lässt sich in diesen Zeiten das Leben noch am besten im Bett ertragen. Zutrauen tut man sich nicht einmal mehr die einfachsten Dinge! (Undenkbar, sich einen Tee zu machen oder ein Brot zu schmieren und wenn, nur unter allergrößter Anstrengung! Geschweige denn, etwas zu kochen, die kleinste Kleinigkeit im Haushalt zuwege zu bringen, oder auch nur bis vier zu zählen!) Der gesamte Organismus fällt in eine Art Winterstarre (das Wort Winterschlaf wäre wohl nicht zutreffend, denn Schlafen tut man ja doch nicht ganz; auch soll die Bezeichnung nicht implizieren, dieser Zustand sei auf den Winter beschränkt. Depressionen können einen auch mitten im Hochsommer überfallen). Dazu gehört auch, dass sich Mimik und Gestik auf ein minimales Maß reduzieren; beispielsweise »versteinert« das Gesicht.
Zu nichts kann man sich aufraffen. So ist zum Beispiel daran, Termine wahrzunehmen, überhaupt nicht zu denken. Manchmal schafft man es nicht einmal, sie wenigstens rechtzeitig abzusagen. Dass das eigentlich keine Art ist, checkt man schon noch. Aber das zu ändern, schafft man nicht. Da bleibt einem dann nur ein schrecklich quälendes schlechtes Gewissen wegen dieses »Versagens«, das die bereits vorhandenen Minderwertigkeitsgefühle noch verstärkt. Der Wille ist eben einfach sehr krank – ich glaube, intuitiv merkt man das sogar. Und die Selbstwahrnehmung ist schwer gestört:
Denn muss man aus irgendeinem Zwang heraus eine Sache doch machen, gelingt es einem schon, seine Aufgabe zu erledigen – und das genauso gut, wie wenn man »gesund« ist. Da man aber die dazu nötige enorme Anstrengung niemals freiwillig aufbringen würde, kommt man sich faul und dumm vor. Wegen des fehlenden Antriebs muss ein Depressiver ja auch für jeden Außenstehenden extrem faul wirken.
Ein typisches Beispiel dafür ist, wie ich mich damals verhalten habe, als mein Freund und ich in unsere gemeinsame Wohnung eingezogen waren: Während er sich mit der Renovierung abrackerte, saß ich meistens untätig in der Ecke und starrte vor mich hin. Und ich hatte ein schlechtes Gewissen, nicht mehr tun zu können. (Ich erinnere mich noch genau, Joe nannte mich damals »nixig«, was der Volksmund wohl mit »faul« übersetzen würde; aber das trifft nicht zu – mir fehlte eben jeglicher Antrieb.)
Mit den Suizidversuchen ist es auch so eine Sache: Man ist vor ihnen nie sicher! Man sollte meinen, wenn man einmal einen verübt hat, lernt man daraus und lässt so einen Blödsinn in Zukunft bleiben. Aber das stimmt leider nicht! Das Gefühl, allem ein Ende setzen zu wollen, überkommt einen förmlich von einer Sekunde auf die andere. Da denkt man auch nicht mehr daran, dass man sich schaden könnte.
Komischerweise wäre die Depression fast schon ausgestanden, wenn sich Suizidgedanken einstellen: Die Fähigkeit zur Aktion ist nämlich erst dann wieder vorhanden, wenn die Depressionen bereits abflauen. Aber auch daraus kann man nichts lernen! Depressionen und Ratio haben eben so gar nichts miteinander zu tun!
Und wenn ich nicht gerade an Suizid gedacht habe, dann habe ich versucht, mich mit massenhaft Alkohol zu betäuben! Wohl nicht zuletzt, damit mir nicht bewusst wurde, wie viel freie Zeit ich in solchen Wochen hatte, mit der ich aber nichts anfangen konnte: Z.B. ein Buch zu lesen funktioniert nicht. Man kann sich nicht ausreichend konzentrieren. Außerdem versteht man kein Wort (die Pseudo-Verdummung habe ich ja bereits angeschnitten). Musik nervt einen nur. Also schaut man vor lauter Langeweile stundenlang fern. Der Allgemeinverfassung entsprechend lauter niveauloses Zeug. Bis einem das unheimlich auf den Geist geht. Also ist man irgendwann an dem Punkt angelangt, an dem gar nichts mehr geblieben ist.
Und was passiert körperlich? Wenn ich nicht gerade einen von einem meiner Alkohol-Exzesse dicken Kopf hatte (oder sonst irgendein Unwohlsein; aber das ist jetzt Gott sei Dank vorbei), quält mich Verstopfung, ich schwitze sehr stark (was natürlich besonders gut dazu passt, dass ich mich in diesen Zeiten nicht so regelmäßig wasche), habe entweder gar keinen Appetit oder könnte mich vor lauter Frust, vor allem mit Süßigkeiten, vollstopfen. Ergo wiegt man nach einer Depression meist auch erheblich mehr. Ich habe es einmal auf 15 Kilo über meinem normalen Gewicht gebracht! Tröstlich, dass es auch »Normalen« bisweilen so geht: Essen ist ja generell als Ersatzbefriedigung bekannt. Außerdem kann ich mich, kaum bewegen. Und das nicht erst, seit ich mir einen Kummerspeck zugelegt habe.
Um Depressionen entgegen zu wirken, müsste man eigentlich beispielsweise unter Leute gehen – aber wer setzt sich schon gerne ins Glashaus? Womöglich ist unter diesen Leuten ja auch noch jemand, der es gut mit einem meint und einem gut zuredet. Da das aus krankheitsbedingten Gründen nichts bewirkt, darf man dann auch noch mit einem schlechten Gewissen kämpfen. Überhaupt führt das bereits mehrfach erwähnte schlechte Gewissen (manchmal bildet man sich die Gründe dafür ja aber lediglich nur ein), zusammen mit den vielen anderen Symptomen, dazu, dass man sich förmlich vor der Umwelt verkriecht.
Immerhin, ein Gutes hat so eine Depression: Man spart eine Menge Geld! Reich wird man deswegen natürlich nicht, aber in puncto Finanzen gleichen sich Manie und Depression wenigstens ein bisschen aus.
In dieser Ausprägung »psychisch krank« zu sein, bedeutete für mich auch die schon frühe Entscheidung gegen eigene Kinder: Sie bekämen ein »schlechtes Erbe« mit auf den Weg! Und wer würde schon ein Wutzerl absichtlich in dem Chaos leben lassen, in dem man selbst zu leben gezwungen ist?
Die meisten, die mit der Psyche zu tun haben, haben auch ein Alkoholproblem, wofür ich ein gutes Beispiel war. Anfangs ist es nur der sogenannte sekundäre Alkoholismus, der einen beherrscht, da man den Alkohol als zusätzliches Medikament benutzt; aber irgendwann verselbständigt sich der Missbrauch – und schon hätten wir ein weiteres hübsches Problem!
Wenn der Leser nun Betroffene fragt, welchen Zustand sie als bedrohlicher empfinden, wird er sicher über die Antwort erstaunt sein: Die Manie! Okay, die Depression ist zwar sozusagen lebensbedrohlich: Aber wenn der Suizid gelingt, hat man eben Pech gehabt. (Was übrigens nicht etwa sagen soll, »uns« bedeute unser Leben nichts! Ich z.B. lebe sehr gerne, habe aber trotzdem schon mehrere Male versucht, mich umzubringen.) Bei einer Manie hingegen weiß man ja nie, was man wieder anstellen wird oder wie hoch der Schuldenberg nachher ist oder wofür man sich danach wieder in Grund und Boden schämen muss!
1984 wurde die Diagnose gestellt, die mein Leben ganz schön beeinflussen sollte – neben den vielen Erlebnissen, die dieses Buch schildern soll, fand im Spätherbst 1988 die wohl einschneidendste Veränderung statt: Ich hatte mein Studium der Chemie gerade mit der mündlichen Doktorprüfung abgeschlossen und einen guten Job bei einer Münchner Großforschungseinrichtung angefangen, da holte mich eine schwere Depression ein und kehrte mein allgemeines Glücksgefühl ins Gegenteil um.





























