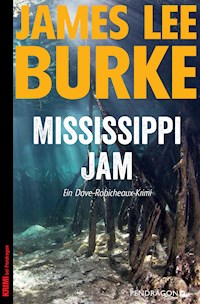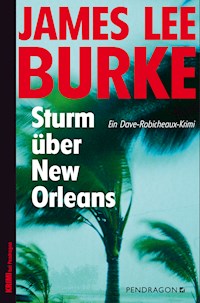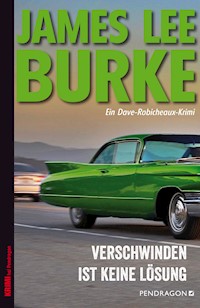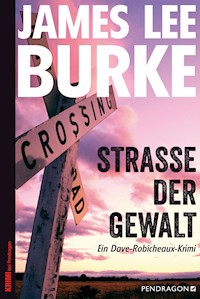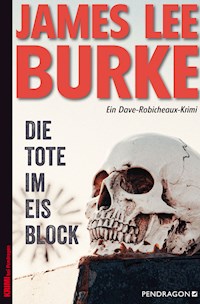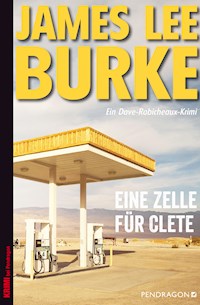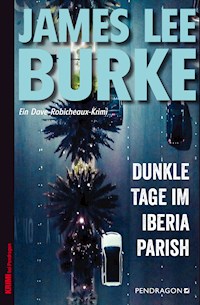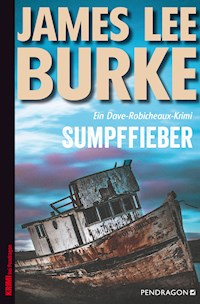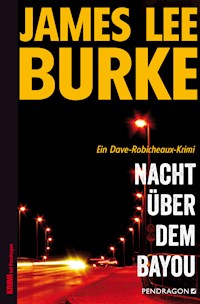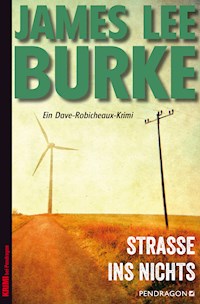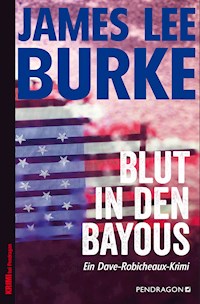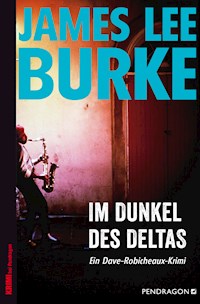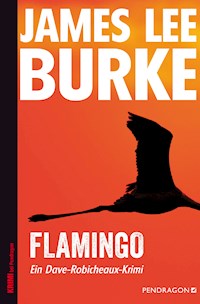
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Pendragon
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Dave Robicheaux-Krimi
- Sprache: Deutsch
Der Albtraum eines jeden Polizisten: Als Dave Robicheaux zwei Mörder in den Todestrakt eines Staatsgefängnisses von Louisiana überführen soll, gelingt den beiden die Flucht. Dave wird dabei schwer verwundet und sein Partner erschossen. Das Verlangen nach Vergeltung und der unbändige Wille, sich zu rehabilitieren, treiben Dave aus der Idylle der Bayous in die Schattenwelt von New Orleans und mitten in das Zentrum des organisierten Verbrechens.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 517
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
James Lee Burke • Flamingo
Für Martin und Jennie Bush
JAMES LEE BURKE
FLAMINGO
Ein Dave-Robicheaux-Krimi Band 4
Aus dem Amerikanischen von Oliver Huzly
1
Wir parkten den Wagen vor dem Bezirksgefängnis und lauschten dem Regen, der auf unser Dach trommelte. Der Himmel war schwarz, und die hohe Luftfeuchtigkeit hatte die Wagenfenster beschlagen lassen. Blitze pulsierten wie weiße Adern in den Gewitterwolken über dem Golf.
„Tante Lemon wartet sicher schon auf dich“, sagte Lester Benoit, der Fahrer. Er war, genau wie ich, ein Kriminalbeamter im Dienste des örtlichen Sheriffs. Er trug lange Koteletten und einen Schnauzbart und ließ sich regelmäßig in Lafayette eine modische Lockenfrisur machen. Seine gleichmäßige Sonnenbräune das ganze Jahr über verdankte er seinen Winterurlauben in Miami Beach, wo er sich jedes Mal neu einkleidete. Obwohl er, abgesehen von seiner Zeit beim Militär, sein ganzes Leben in New Iberia verbracht hatte, sah er immer aus wie ein Neuankömmling, der hier eben aus dem Flugzeug gestiegen war.
„Du bist nicht besonders scharf drauf, ihr über den Weg zu laufen, stimmt’s?“, fragte er mit einem Grinsen.
„Nein.“
„Wir können den Seiteneingang nehmen und sie mit dem Lastenaufzug runterbringen. Da merkt sie nicht mal, dass wir da waren.“
„Ist schon okay“, sagte ich.
„Hey, mein Problem ist es nicht. Wenn dir bei der Sache nicht wohl zumute ist, hättest du nur verlangen müssen, dass sie’s eben einen andern machen lassen. Warum stellst du dich überhaupt so an?“
„Ich stelle mich nicht an.“
„Dann sag ihr, dass sie sich zum Teufel scheren soll. Ist doch bloß ’n altes Niggerweib.“
„Sie sagt, Tee Beau hat es nicht getan. Sie sagt, er war am Abend des Mordes bei ihr und hat Krebse geschält.“
„Ach komm, Dave. Meinst du etwa, sie würde nicht lügen, um ihren Enkel zu retten?“
„Vielleicht.“
„Du bist gut, vielleicht.“ Er wandte sich ab und blickte in Richtung des Parks am Bayou Teche. „Schöne Scheiße, das mit dem Regen beim Feuerwerk. Meine Ex war mit den Kindern da. Es ist jedes Jahr dasselbe. Ich muss hier weg.“ Durch die regenverschmierte Scheibe fiel das Licht einer Straßenlaterne und ließ sein Gesicht fahl erscheinen. Das Fenster auf seiner Seite war einen Spalt geöffnet, damit der Zigarettenrauch abziehen konnte.
„Bringen wir’s hinter uns“, sagte ich.
„Nicht so schnell. Ich hab keine Lust, die ganze Strecke in nassen Klamotten zu fahren.“
„Das hört nicht auf zu regnen.“
„Jetzt lass mich mal meine Zigarette zu Ende rauchen, und dann sehen wir weiter. Ich werd nicht gerne nass. Hey, mal ganz ehrlich, Dave, macht es dir so zu schaffen, dass du Tee Beau da abliefern musst, oder geht’s in Wirklichkeit um was ganz anderes?“ Das Licht der Laterne warf Schatten auf sein Gesicht, die sich wie kleine Regenrinnsale kräuselten.
„Bist du schon mal dabei gewesen?“, fragte ich.
„Bis jetzt war’s noch nie nötig.“
„Und würdest du es tun?“
„So wie ich es sehe, weiß der Typ, der auf den Stuhl kommt, was ihn erwartet.“
„Würdest du hingehen?“
„Yeah, das würde ich.“ Er drehte den Kopf und sah mir scharf ins Gesicht.
„Diese Erfahrung kann dich teuer zu stehen kommen“, sagte ich.
„Aber alle wussten sie, was sie erwartet. Stimmt’s, oder hab ich recht? Wenn du in Louisiana einen umlegst, bekommst du eine echte Elektroschock-Therapie verpasst.“
„Dann sag mir mal den Namen von einem einzigen reichen Mann, den sie hier in diesem Staat gegrillt haben. Oder auch in irgendeinem anderen Staat.“
„Tut mir leid. Diesen Typen weine ich keine Träne nach. Oder meinst du etwa, sie hätten Jimmie Lee Boggs mit lebenslänglich davonkommen lassen sollen? Willst du, dass er in zehneinhalb Jahren wieder frei hier rumläuft?“
„Nein, das will ich nicht.“
„Das hab ich mir gedacht. Und ich sag dir noch was. Wenn dieser Typ bei mir irgendwas versucht, verpass ich ihm eine direkt ins Maul. Und dann geh ich zu seiner Mutter und beschreib es ihr auf ihrem Totenbett bis ins kleinste Detail. Wie gefällt dir das?“
„Ich geh jetzt rein. Willst du mit?“
„Sie wartet sicher schon“, sagte er, wieder mit einem Grinsen.
Sie wartete tatsächlich. Ihr gemustertes Baumwollkleid, von der Sonne und vom vielen Waschen völlig ausgebleicht, klebte ihr wie triefend nasses Küchenpapier am knochigen Körper. Ihr Mulattenhaar sah aus wie ein graugoldenes Drahtknäuel, und ihre hellgelbe Haut wirkte, als sei sie mit braunen Zehncentstücken gemustert. Sie saß allein auf einer Holzbank vor einer Arrestzelle, gleich neben dem Fahrstuhl, aus dem in wenigen Minuten ihr Enkel, Tee Beau Latiolais, den sie alleine großgezogen hatte, und Jimmie Lee Boggs treten würden, beide mit Ketten um Hüfte und Beine. Ihre blaugrünen Augen waren vom Grauen Star gezeichnet, aber sie wichen nicht von meinem Gesicht.
In den Vierzigerjahren hatte sie in einem von Hattie Fontenots Läden an der Railroad Avenue gearbeitet; dann hatte sie ein Jahr im Frauengefängnis zugebracht, weil sie einen weißen Mann, der sie verprügelt hatte, in die Schulter gestochen hatte. Später arbeitete sie in einer Wäscherei und machte Hausarbeit für zwanzig Dollar die Woche, was bis weit in die Sechziger der Standardverdienst eines Schwarzen in Südlouisiana war, welche Stellung er oder sie auch immer bekleidete. Tante Lemons Tochter hatte eine Frühgeburt; das Baby war so klein, dass es in der Schuhschachtel Platz hatte, in der sie es versteckte, bevor sie es tief unten in eine Mülltonne stellte. Als Tante Lemon am nächsten Morgen zum Plumpsklo ging, hörte sie das Kind schreien. Sie zog Tee Beau auf, als sei er ihr Sohn, fütterte ihn löffelweise mit cush cush, damit er ein kräftiger Junge wurde, und band ihm eine Münze an einem Faden um den Hals, um Krankheit von ihm fernzuhalten. Sie lebten in einem ungestrichenen, primitiven Holzhaus, dessen Veranda sich in ihre Einzelteile aufgelöst hatte, sodass die Treppen aussahen, als führten sie in einen sperrangelweit aufgesperrten, zerstörten Mund, in einem Teil der Stadt, den die Leute „Niggertown“ nannten. Mein Vater, der mit Fallenstellen und Angeln sein Geld verdiente, stellte Tante Lemon jedes Frühjahr dazu an, Krebse für ihn zu putzen, obwohl er sich ihr mageres Gehalt vom Munde absparen musste. Immer, wenn er in seinen Netzen Seebarben oder Hornhechte fing, nahm er sie aus und brachte sie ihr.
„Die ess ich doch eh nicht“, sagte er dann immer zu mir.
Ich hörte, wie der Aufzug kam. Ein Wärter in Uniform saß an einem kleinen Tisch und machte die nötigen Papiere für den Transfer zweier Gefangener vom Bezirks- ins Staatsgefängnis Angola fertig.
„Mr. Dave“, sagte Tante Lemon.
„Ihr könnt den Jungs da oben sagen, dass die beiden heut schon gegessen haben“, sagte der Wärter. „Sie sind auch sonst gut in Schuss. Der Arzt hat beide durchgecheckt.“
„Mr. Dave“, sagte sie erneut. Sie sprach mit gesenkter Stimme, als befände sie sich in der Kirche.
„Ich kann nichts tun, Tante Lemon“, sagte ich.
„Er war in meinem kleinen Haus. Er hat den Redbone nich umgebracht“, sagte sie.
„Irgendjemand wird sie nachher heimbringen“, sagte der Wärter.
„Ich hab’s ihnen allen gesagt, Mr. Dave. Aber die hören nich auf mich. Warum sollen sie auch ’ner alten Nigger frau glauben, die früher für Miss Hattie angeschafft hat? Das haben sie gesagt. Eine alte Nigger-putain, die für ihren Tee Beau lügt.“
„Sein Anwalt wird Berufung einlegen. Da ist noch viel drin“, sagte ich. Ich wartete darauf, dass die Lifttüren endlich aufgingen.
„Sie werden den Jungen auf’n elektrischen Stuhl setzen“, sagte sie.
„Tante Lemon, ich kann nichts dagegen tun“, sagte ich.
Ihre Augen wichen nicht von meinem Gesicht. Sie waren klein und feucht und blickten starr wie die eines Vogels.
Ich sah Lester vor sich hinlächeln.
„Ein Wagen wird Sie heimbringen“, sagte der Gefängnisbeamte zu ihr.
„Weshalb soll ich denn heimgehen? Damit ich allein in meinem kleinen Haus rumsitze?“, antwortete sie.
„Machen Sie sich was Heißes zu trinken und ziehen Sie die nassen Klamotten aus“, sagte der Wärter. „Und morgen reden Sie dann mit Tee Beaus Anwalt, genau wie Mr. Dave gesagt hat.“
„Mr. Dave weiß es besser“, sagte sie. „Sie werden meinen Jungen hinrichten, dabei hat er doch gar nix getan. Dieser Redbone hat immer auf ihm rumgehackt, ihn vor anderen Leuten lächerlich gemacht, ihn so hart rangenommen, dass er nich mal mehr essen kann, wenn er heimkommt. Ich mach ihm Hühnchen und Reis, ganz lecker, genau wie er’s mag. Er setzt sich ungewaschen an den Tisch und starrt es an, stopft es in den Mund, als wären es nur trockene Bohnen. Ich sag ihm, er soll doch gehn und sich Gesicht und Hände waschen, damit er dann in Ruhe essen kann. Aber er sagt immer nur: ‚Ich bin so müde, Gran’maman. Ich kann nich essen, wenn ich so müde bin.‘ Ich sag ihm: ‚Morgen ist doch Sonntag, da kannst du ausschlafen, du kannst ja dann morgen essen.‘ Er sagt: ‚Er holt mich morgen früh ab. Wir müssen wieder auf die Felder.‘ – Wo waren denn alle, als mein kleiner Junge Hilfe gebraucht hat? Als dieser Redbone-Mischling ihn mit ’ner zusammengerollten Zeitung geschlagen hat wie ’ne streunende Katze? Wo waren sie denn da, die Polizisten, die Anwälte?“
„Ich komme morgen bei dir vorbei, Tante Lemon“, versprach ich ihr.
Lester zündete sich eine Zigarette an und lächelte versonnen in den aufsteigenden Rauch. Ich hörte, wie der Liftmotor stoppte; dann glitten die Türen auf, und zwei Dep utys in Uniform führten Tee Beau Latiolais und Jimmie Lee Boggs in Ketten heraus. Beide trugen Straßenkleidung für die Fahrt zum Angola. Tee Beau hatte eine glänzende Sportjacke an, deren Farbe an Weißblech erinnerte, weite purpurne Hosen und ein schwarzes Hemd, dessen Kragen flach über dem Jackenrevers lag. Er war fünfundzwanzig, aber er sah aus wie ein Kind in Erwachsenenkleidung, als könne man ihn mit einem Griff um die Taille hochheben wie einen Kissenbezug voller Stöcke. Im Gegensatz zu seiner Großmutter war seine Haut schwarz, die Augen braun, zu groß für sein kleines Gesicht, sodass er verängstigt wirkte, selbst wenn er es nicht war. Jemand im Gefängnis hatte ihm das Haar geschnitten, aber den Nacken nicht ausrasiert. Unterhalb des Genicks war eine drahtige schwarze Linie übriggeblieben, die aus der Entfernung wie Schmutz aussah.
Aber es war Jimmie Lee Boggs, der die Blicke auf sich zog. Sein Haar war lang und dünn und silbergrau. Es war nach hinten gekämmt und hing gerade und schlaff herunter wie an die Kopfhaut genähte Fäden. Er hatte die typische Gefängnisblässe, und seine minzgrünen Augen waren längliche Schlitze. Seine Lippen wirkten unnatürlich rot, als hätte er Rouge aufgelegt. Der geschwungene Hals, das Profil seines Schädels, die rosaweiße Kopfhaut, die durch das faserige Haar hindurchschimmerte, all das erinnerte mich an eine Schaufensterpuppe. Er trug ein frisch gewaschenes T-Shirt, Jeans und knöchelhohe schwarze Tennisschuhe ohne Socken. Aus einer seiner Hosentaschen ragte kokett eine Packung Lucky Strikes hervor. Obwohl seine Hände an die Kette um seine Hüfte geschlossen waren und er wegen der knappen Beinfesseln nur kleine, trippelnde Schlurfschritte machen konnte, sah man, wie sich straffe Muskeln in seinem Bauch und seinen Armen bewegten und an den Schultern über dem Schlüsselbein pulsierten, als er den Hals verdrehte, um alle im Raum Anwesenden in Augenschein zu nehmen. In seinen Augen lag ein eigenartiger Glanz, dem man sich lieber nicht aussetzte.
Der Gefängnisbeamte öffnete die Lade eines Aktenschranks und entnahm ihr zwei große braune Papiertüten, die oben fein säuberlich zugefaltet und zugeheftet waren. „Boggs“ stand auf der einen, „Latiolais“ auf der anderen.
„Das ist ihr Zeug“, sagte er und übergab mir die Tüten. „Wenn ihr die Nacht über im Angola bleiben wollt, könnt ihr euch das mit einer Tagespauschale vergüten lassen.“
„Seht euch doch an, was ihr da hinschickt“, sagte Tante Lemon. „Schämt ihr euch denn nicht? Ihr habt diesem kleinen Jungen Ketten angelegt und tut so, als wär er so wie der andere, weil euch sonst euer Gewissen die ganze Nacht keine Ruhe lässt.“
„Dieser Bursche war acht Monate in meinem Gefängnis, Tante Lemon, lange bevor er in diesen Schlamassel geraten ist“, sagte der Wärter. „Also tu jetzt nicht so, als hätte Tee Beau noch nie was Unrechtes getan.“
„Das war, weil er sich was von Mr. Dores Schrottplatz geholt hat. Weil er seiner Gran’maman einen alten Ventilator gebracht hat, den keiner mehr haben wollte. Das ist der Grund, weshalb er hier im Gefängnis war.“
„Er hat Mr. Dores Wagen gestohlen“, sagte der Wärter.
„Das sagt der“, sagte Tante Lemon.
„Ich hoffe doch nicht, dass wir jetzt hier noch übernachten“, sagte Lester und klopfte mit den Fingernägeln gegen seine Hose, um die Zigarettenasche zu entfernen.
Da weinte Tante Lemon. Sie schloss die Augen, und unter den Lidern quollen Tränen hervor, als wäre sie blind; ihr Mund bebte und zuckte unkontrolliert.
„Ach du liebe Güte“, sagte Lester.
„Gran’maman, ich schreib dir“, sagte Tee Beau. „Ich schick dir Briefe, wie wenn ich nur ein paar Häuser weiter wär.“
„Ich muss mal“, sagte Jimmie Lee Boggs.
„Halt’s Maul“, sagte der Wärter zu ihm.
„Der Junge ist unschuldig, Mr. Dave“, sagte sie. „Du weißt, was sie mit ihm anstellen werden. T’connait, du. Er kommt ins Red-Hat-Haus.“
„Jetzt macht mal, dass ihr loskommt. Ich kümmere mich um sie“, sagte der Wärter.
„Scheiße, ja“, sagte Lester.
Wir traten hinaus in die Dunkelheit, in den Regen und die Blitze, die über den südlichen Himmel zuckten, und sperrten Jimmie Lee Boggs und Tee Beau in den Fond des Wagens, der durch Maschendraht von den Vordersitzen getrennt war. Dann schloss ich den Kofferraum auf und warf die zwei Papiertüten mit ihren Habseligkeiten hinein. Hinten im Kofferraum, mit elastischen Bändern am Boden befestigt, lagen ein Gewehr vom Kaliber 30-06 mit Zielfernrohr in einem Etui mit Reißverschluss und eine Repetierflinte Kaliber 12 mit Pistolengriff. Ich nahm auf dem Beifahrersitz Platz, und wir verließen die Stadt auf der Landstraße, die durch St. Martinville auf die Interstate 10, nach Baton Rouge und schließlich zum Staatsgefängnis Angola führte.
Die breiten Eichen entlang der zweispurigen Straße waren schwarz und voller Wasser. Der Regen hatte nachgelassen, und als ich das Fenster auf meiner Seite ein kleines Stück öffnete, konnte ich das Zuckerrohr und die nasse Erde auf den Feldern riechen. Regenwasser stand hoch in den Gräben zu beiden Seiten der Straße.
„Ich muss aufs Klo“, sagte Jimmie Lee Boggs.
Weder Lester noch ich antworteten.
„Ohne Scheiß, ich muss wirklich“, wiederholte er.
„Du hättest vorher noch mal gehen sollen“, sagte ich.
„Ich hab ja gefragt. Und er hat nur gesagt, ich soll’s Maul halten.“
„Jetzt musst du’s dir halt verkneifen“, sagte ich.
„Warum machst du den Job jetzt wieder?“, fragte Lester mich.
„Ich hab hohe Schulden“, sagte ich.
„Wie hoch?“
„So hoch, dass es mich mein Haus und meinen Bootsverleih kosten kann.“
„Irgendwann dieser Tage werd ich mich absetzen. Dann kauf ich mir ein Haus in Key Largo. Dann kann sich jemand anders mit so was rumschlagen. Hey, Boggs, hatte die Mafia nicht genug Arbeit für dich in Florida?“
„Was?“, sagte Boggs. Er saß nach vorne gebeugt und blickte aus dem Seitenfenster.
„Hat dir Florida nicht gefallen? Musstest du unbedingt den ganzen weiten Weg hierher machen, um jemanden umzubringen?“, fragte Lester. Wenn er lächelte, wirkten seine Mundwinkel wie Knetmasse.
„Was geht’s dich an?“, fragte Boggs zurück.
„Reine Neugier.“
Boggs schwieg. Sein Gesicht wirkte angestrengt, und er rutschte mit dem Hintern unruhig auf dem Sitz hin und her.
„Wie viel haben sie dir dafür bezahlt, dass du diesen Barbesitzer umnietest?“, fragte Lester.
„Nichts“, sagte Boggs.
„Eine reine Gefälligkeit?“, fuhr Lester fort.
„Ich hab gesagt ‚nichts‘, weil ich diesen Typ nicht umgebracht hab. Hör zu, ich will nicht unhöflich sein, wir haben noch ’ne lange Fahrt vor uns, aber mir geht es gar nicht gut.“
„Wenn wir erst mal auf der Interstate sind, besorgen wir dir ’n paar Magentropfen oder so was“, sagte Lester.
„Dafür wär ich dankbar, Mann“, sagte Boggs.
Wir fuhren in weitem Bogen durch das offene, weite Land. Tee Beau schlief, den Kopf auf die Brust gelegt. Ich hörte das Quaken von Fröschen in den Gräben.
„Schöner Nationalfeiertag“, sagte Lester.
Ich stierte aus dem Fenster auf die regendurchtränkten Felder. Ich verspürte keinerlei Lust, mir noch mehr von Lesters negativen Kommentaren anzuhören, und ich wollte ihm auch nicht sagen, was ich wirklich dachte: dass er nämlich der deprimierendste Mensch war, mit dem ich je zusammengearbeitet hatte.
„Ich sag dir was, Dave. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass ich mal mit ’nem Cop zusammenarbeite, der selber schon mal unter Mordanklage gestanden hat.“ Er gähnte und sperrte dabei angestrengt die Augen auf.
„Ach ja?“
„Du redest wohl nicht gerne drüber?“
„Ist mir eigentlich egal.“
„Wenn’s dein wunder Punkt ist, tut’s mir leid, dass ich’s angesprochen hab.“
„Ist kein wunder Punkt.“
„Manchmal bist du schon verflucht empfindlich.“
Der Regen schlug mir ins Gesicht, und ich kurbelte das Fenster wieder hoch. Zwischen den Bäumen konnte ich Kühe sehen, die dicht gedrängt beieinander standen, und weit hinten in einem Zuckerrohrfeld ein einsames, dunkles Bauernhaus. Weiter vorne eine alte Tankstelle, die dort schon in den Dreißigerjahren gestanden hatte. Der Vorbau mit den Zapfsäulen war erleuchtet, und vom Dachvorsprung sprühte der Regen ins Licht.
„Bei mir stimmt irgendwas nicht“, sagte Boggs. „Wie wenn Glas kleingemahlen wird.“
Gefesselt wie er war, saß er vornübergebeugt auf dem Sitz, biss sich auf die Lippen und atmete schnell durch die Nase. Lester warf einen Blick in den Rückspiegel, um ihn sich hinter dem Maschendraht anzuschauen. „Wir besorgen dir was für den Magen. Da geht’s dir gleich besser.“
„Ich kann’s nicht mehr aushalten. Ich mach gleich in die Hose.“
Lester warf mir einen Blick zu.
„Ich mein’s ernst, ich kann’s nicht mehr halten. Ich kann doch nix dafür“, sagte Boggs.
Lester drehte den Kopf nach hinten, nahm dabei den Fuß vom Gas. Dann sah er wieder zu mir. Ich schüttelte verneinend den Kopf.
„Ich will nicht, dass der Bursche die ganze Fahrt zum Angola nach Scheiße stinkt“, sagte Lester.
„Ein Gefangenentransport ist ein Gefangenentransport“, sagte ich.
„Man hat mir ja gesagt, dass du ein sturer Bock bist.“
„Lester.“
„Wir machen halt“, sagte er. „Ich wisch doch nicht den Dünnschiss von so ’nem Typ auf. Wenn dir das nicht passt, tut’s mir leid.“
Er fuhr in die Ausbuchtung der Tankstelle. Drinnen saß ein junger Mann hinter einem alten Schreibtisch und las ein Comicheft. Er legte das Heft beiseite und kam nach draußen. Lester stieg aus dem Wagen und zeigte ihm seine Polizeimarke.
„Wir sind vom Büro des Sheriffs“, sagte er. „Wir haben einen Gefangenen, der Ihre Toilette benutzen muss.“
„Wie bitte?“
„Können wir Ihre Toilette benutzen?“
„Ja, klar. Wollen Sie tanken?“
„Nein.“ Lester stieg wieder ein und ließ den Jungen einfach stehen. Er fuhr rückwärts neben die Tankstelle, aus dem Licht, bis zur Tür der Herrentoilette.
Tee Beau war aufgewacht und starrte hinaus in die Dunkelheit. Im Licht der Scheinwerfer sah ich hinter der Tankstelle ein nahezu ausgetrocknetes Flussbett, von Bäumen gesäumt, mit dichtem Unterholz entlang der Böschung. Lester drehte den Motor ab, stieg erneut aus und öffnete die Passagiertür. Er fasste Boggs am Arm und half ihm hinaus in den leichten Regen. Boggs schnaufte durch die Nase und schüttelte sich, wenn er ausatmete.
„Ich mach dir eine Hand frei und geb dir fünf Minuten“, sagte Lester. „Wenn du sonst noch irgendwelche Schwierigkeiten machst, liegst du den Rest der Fahrt im Kofferraum.“
„Ich mach keine Schwierigkeiten. Ich hab denen den ganzen Tag lang gesagt, dass es mir nicht gut geht.“
Lester nahm den Schlüssel für die Handschellen aus der Tasche.
„Schau erst in der Toilette nach“, sagte ich.
„Ich war hier schon mal. Sie hat keine Fenster. Lass gut sein, Robicheaux.“
Ich atmete aus, öffnete die Tür auf meiner Seite und wollte aussteigen.
„Okay, okay“, sagte Lester. Er ging mit Boggs bis zur Toilettentür, öffnete sie, schaltete das Licht an und sah hinein. „Ohne Fenster, wie ich gesagt hab. Willst du’s selber sehen?“
„Check sie.“
„Schwachsinn“, sagte er. Er löste die Handschelle, die mit der Kette um Boggs’ Leib verbunden war, von dessen rechter Hand. Sobald Boggs die Hand frei hatte, strich er sich mit den Fingern das Haar nach hinten, blickte zurück zum Wagen und trat dann mit den kurzen, schlurfenden Schritten, die die Beinfesseln zuließen, in die Toilette. Er verriegelte die Tür hinter sich.
Diesmal stieg ich aus dem Wagen.
„Was hast du denn jetzt wieder?“, fragte Lester.
„Du machst zu viele Sachen falsch.“ Ich ging vorne um den Wagen herum auf ihn zu. Die Scheinwerfer waren immer noch an.
„Hör zu, ich hab hier das Sagen. Wenn’s dir nicht gefällt, wie ich vorgehe, kannst du ja ’ne schriftliche Beschwerde einreichen, wenn wir wieder zurück sind.“
„Boggs hat drei Menschen umgebracht. Er hat den Besitzer dieser Bar mit einem Baseballschläger getötet. Was sagt dir das?“
„Dass du vielleicht ein bisschen besessen bist. Liegt das Problem vielleicht da?“
Ich knöpfte das Holster meiner .45er auf und schlug mit der Faust gegen die Tür der Toilette.
„Mach auf, Boggs“, rief ich.
„Ich sitz auf’m Klo“, erwiderte er.
„Mach die Tür auf !“
„Ich komm nicht ran. Ich hab schweren Dünnpfiff, Mann. Was ist denn los?“, fragte Boggs.
„Scheiße. Ich glaub’s nicht“, sagte Lester.
Ich schlug erneut gegen die Tür.
„Los, Boggs, mach schon“, sagte ich.
„Also, ich hol mir jetzt Zigaretten. Mach doch, was du willst“, sagte Lester und ging zur Vorderseite der Tankstelle.
Ich trat einen Schritt von der Tür zurück, legte die Hand fest auf den Kolben der .45er, gab der Tür einen harten Tritt direkt unter den Türknauf. Sie gab nicht nach. Ich sah, wie sich Lester umdrehte und mich anstarrte. Ich versetzte der Tür noch einen Tritt, und diesmal splitterte das Schloss aus dem Türpfosten. Die Tür flog krachend auf.
Meine Augen registrierten den auseinandergerissenen Handtuchbehälter an der Wand und die über den ganzen Boden verstreuten Papiertücher, noch bevor ich Boggs erblickte. Er stand schussbereit da, die Knie leicht gebeugt, die einzelnen Glieder der Kette dicht an den Körper geschmiegt. Die Hand, die noch festgekettet war, hing starr an seiner Seite wie eine Vogelklaue, und in seiner ausgestreckten rechten Hand hielt er einen vernickelten Revolver. Seine minzgrünen Augen funkelten, und auf seinem Mund lag ein Lächeln, als wären wir alle Teil eines Scherzes.
Ich brachte die .45er halb aus dem Holster, bevor er feuerte. Der Schuss war nicht lauter als ein Silvesterknaller, und ich sah Funken aus dem Lauf hinaus in die Dunkelheit fliegen. Im Geiste drehte ich mich zur Seite, hob den linken Arm vors Gesicht und zog meine Waffe ganz aus dem Holster, aber ich glaube nicht, dass ich irgendetwas davon wirklich tat. Ich bin vielmehr sicher, dass sich mein Mund in ungläubigem Staunen und vor lauter Angst weit öffnete, als mich die Kugel hoch oben in der Brust traf wie eine stahlbewehrte Faust. Die Luft wich explosionsartig aus meinen Lungen, meine Knie gaben nach, und meine Brust brannte, als ob jemand mit einem Bohrer Sehnen und Knochen durchstoßen hätte. Die .45er glitt mir nutzlos aus der Hand und fiel ins Unkraut am Boden. Ich spürte, wie mein linker Arm schlaff wurde, wie die Muskeln in meinem Hals und in der Schulter in sich zusammenfielen, als gäbe es nichts mehr, was sie zusammenhielte. Dann stolperte ich rückwärts durch den Regen auf das Flussbett zu, eine Hand auf das nasse Loch in meinem Hemd gepresst. Mein Mund öffnete und schloss sich wie der eines Fisches.
Lester trug eine .38er an den Knöchel geschnallt. Er hatte mir einmal erzählt, dass ein Cop in Miami Beach, den er kannte, seine Waffe genauso trug. Sein Knie schoss hoch, seine Hand fuhr nach unten in Richtung seines Schuhs, und im Licht des Vorderfensters der Tankstelle war sein Gesicht einen Augenblick lang kalkweiß, zu Eis erstarrt, von Regentropfen gerahmt. Dann krümmte er sich nach vorne, von Jimmie Lee Boggs in den Bauch geschossen.
Aber ich dachte nicht an Lester, und ich kann auch nicht ernsthaft behaupten, dass mich sein Schicksal in diesem Augenblick kümmerte. Durch die Pistolenschüsse und das Zucken der Blitze am Horizont hindurch hörte ich die Worte eines schwarzen Sanitäters meiner Kompanie: Scheiße. Lungenschuss. Pneumothorax. Drück zu, drück zu, drück zu. Chuck muss durch den Mund atmen. Dann brach ich rückwärts durchs Gehölz und taumelte durch Schilf und dichtes Gestrüpp die Böschung des Flussbetts hinunter. Ich rollte mich auf den Rücken, und in meinen Ohren dröhnten Feldhörner und Trommeln. Mein Atem entwich mit einem langen Seufzer. Über dem Abhang des Flussufers wölbten sich Eichenäste, und durch die Blätter hindurch konnte ich Blitze am Himmel sehen.
Meine Beine lagen im flachen Wasser, mein Rücken war schlammverschmiert, an der Seite meines Gesichts klebten lauter schwarze Blätter. Ich fühlte, wie sich die Wärme aus der Wunde unter meiner Hand im Hemd ausbreitete.
„Los, rein mit dir, du Mistkerl“, sagte Boggs oben in der Dunkelheit.
„Mr. Boggs“, hörte ich Tee Beau sagen.
„Hol die Autoschlüssel und mach den Kofferraum auf “, sagte Boggs.
„Mr. Boggs, es gibt kein’ Grund, das zu tun. Der Junge hat viel zu viel Angst, der tut uns doch nix.“
„Halt’s Maul und hol die Gewehre aus dem Kofferraum.“
„Mr. Boggs …“
Ich hörte ein Geräusch, als würde jemand hart gegen eine Wand geschubst, dann noch einmal einen Schuss, wie das schwache, trockene Ploppen eines Feuerwerkskörpers.
Ich schluckte und versuchte mich auf die Seite zu rollen, um weiter das Flussbett hinunterzukriechen. Knochen zermahlender, rotschwarzer Schmerz fuhr mir vom Hals bis in die Genitalien hinunter, und ich rollte mich wieder zurück in die Farnkräuter und die dicke Schicht aus schwarzen Blättern und den Schlamm, der so scharf wie Abwässer roch.
Dann hörte ich das unverkennbare Dröhnen eines Schrotgewehrs.
„Jetzt versuch’s mal selber mit Magentropfen“, sagte Boggs und lachte, wie ich nie zuvor einen Menschen hatte lachen hören.
Ich nahm die glitschige Hand von der Brust, fasste mit beiden Händen hinter mir in den Schlamm, grub die Absätze meiner Schuhe in den Schlick am Grund des seichten Gewässers und begann mich stoßweise auf einen verrotteten Baumstamm zuzubewegen, spinnennetzartig überzogen von festgetrocknetem Treibgut und Schlingpflanzen. Inzwischen konnte ich wieder richtig atmen; meine Befürchtung einer offenen Brustwunde hatte sich als grundlos erwiesen, aber es hatte den Anschein, als hätte man mir alle Lebensenergie abgezapft. Am Rande des Flussbetts sah ich die Silhouetten von Tee Beau und Boggs. Boggs hielt die halb automatische Schrotflinte mit dem Pistolengriff, die im Kofferraum gewesen war, wie ein Soldat quer vor der Brust.
„Mach du’s“, sagte er. Er zog den vernickelten Revolver aus der Tasche seiner Jeans und reichte ihn Tee Beau.
„Mr. Boggs, machen wir lieber, dass wir hier wegkommen.“
„Du bringst das jetzt zu Ende.“
„Der stirbt doch da unten. Da müssen wir gar nix mehr machen.“
„So billig kommst du nicht davon, Junge. Wenn wir hier wegfahren, wirst du genauso viel Dreck am Stecken haben wie ich.“
„Mr. Boggs, ich kann das nich.“
„Hör zu, du dämlicher Nigger, du machst jetzt, was ich dir gesagt hab, oder dir blüht das Gleiche wie dem Typ da im Klo.“
In seinen zu großen Kleidern sah Tee Beau neben Boggs wie ein Strichmännchen aus. Boggs gab ihm mit einer Hand einen Schubs, und Tee Beau schlitterte den Abhang hinunter durch das nasse Gebüsch. Die zurückschwingenden Äste peitschten ihm gegen Jacke und Hose. Die Waffe flach an den Oberschenkel gedrückt, platschte er durch das Wasser hindurch auf mich zu.
Ich fuhr mir mit der Zunge über die Lippen und versuchte etwas zu sagen, aber die Worte verfingen sich in meiner Kehle zu einem Gewirr von rostigen Nägeln.
Er kniete vor mir nieder, das Gesicht schlammbespritzt, die Augen in dem kleinen Gesicht groß und rund und angsterfüllt.
„Tu es nicht, Tee Beau“, wisperte ich.
„Er hat den weißen Jungen da im Klo gekillt“, sagte er. „Hat Mr. Benoit das Gewehr gegen’s Gesicht gehalten und es weggeschossen.“
„Tu es nicht. Bitte“, sagte ich.
„Machen Sie die Augen zu, Mr. Dave. Und nich bewegen.“
„Was?“, sagte ich, so schwach wie ein Mann, der gerade für immer unter die Oberfläche eines tiefen, warmen Sees gleitet.
Er spannte den Abzugshahn, und seine hervorquellenden Augen starrten wirr in meine.
Manche Leute sagen, dass man in diesem letzten Moment sein ganzes Leben vor sich Revue passieren sieht. Ich für meinen Teil glaube nicht, dass das stimmt. Man sieht die Adern in einem schlammschwarzen Blatt, Pilze, die dicht an dicht zwischen den feuchten Wurzeln einer Eiche wachsen, einen Ochsenfrosch, der auf einem Baumstamm sitzt und im Dunkeln glänzt; man hört Wasser, das über Steine plätschert, das von den Bäumen herabtropft, und man riecht es in der dunstigen Luft. Süß und feucht wie Zuckerwatte kann einem der Nebel auf der Zunge liegen, und im Schein eines einzigen Blitzschlags oben am Himmel bekommen die Weidenkätzchen und Schilfgräser eine silbergrüne Schattierung, die schöner ist als jedes Gemälde. Man denkt an die Beschaffenheit der Haut, die körnigen Poren, die vielen Adern, die denen eines Blatts entsprechen. Man denkt an die gepuderte Brust der Mutter, den Milchgeruch in ihren Kleidern, ihre Körperwärme, wenn sie dich an sich drückte; dann schließen sich die Augen, und der Mund öffnet sich zu einem letzten, erstickten Protestschrei gegen den kleinen Zwischenfall im Lauf der Welt, der dein Leben so plötzlich und so ungerecht beenden wird.
Er hatte sich auf ein Knie gekauert, als er den Abzug drückte. Der Revolver ging wenige Zentimeter von meinem Gesicht entfernt los, und ich spürte die Schießpulverreste auf meiner Haut brennen und die Erde direkt neben meinem Ohr explodieren. Mir drehte sich das Herz in der Brust.
Ich hörte Tee Beau aufstehen. Er klopfte sich die Knie ab.
„Erledigt, Mr. Boggs“, sagte er.
„Dann mach, dass du hier hochkommst.“
„Jawohl, Sir. Ich beeil mich.“
Ich blieb regungslos liegen, die Hände mit den Handflächen nach oben im plätschernden Wasser. Die Nacht war voller Geräusche: die Grillen im Gras, das entfernte Donnergrollen draußen über dem Golf, der Ruf eines Sumpf bibers etwas weiter weg im Flussbett, und Tee Beau, der sich mühsam einen Weg durch das nasse Unterholz bahnte.
Dann hörte ich die Wagentüren zuschlagen, den Motor starten und die Reifen über den Kiesweg auf die zweispurige Straße knirschen.
Im Verlauf der Nacht regnete es noch einmal heftig. Unmittelbar vor Sonnenaufgang hellte sich der Himmel auf, und durch die Eichenzweige über meinem Kopf leuchteten die Sterne. Die Sonne ging rot und heiß über dem Baumhorizont im Osten auf, und der Nebel, der am Grund des Flussbetts festhing, war so rosa wie mit Wasser verdünntes Blut. Mein Mund war trocken, mein Atem stank mir selbst in der Nase. Ich fühlte mich innerlich tot, losgelöst von all den gewöhnlichen Dingen in meinem Leben, und krampfartig überkamen mich Wellen von Schock und Ekel, die meinen Körper erzittern ließen, als läge ich noch einmal am Rand eines Pfades in Vietnam, nachdem eine tückische Sprengmine dafür gesorgt hatte, dass Güterzüge durch meinen Kopf dröhnten und ich fassungslos und meiner Stimme beraubt im verbrannten Gras lag. Ich hörte den frühmorgendlichen Verkehr auf der Straße und Autoreifen, die sich durch den Kies pflügten; dann wurde eine Wagentür geöffnet und jemand ging langsam seitlich an der Tankstelle entlang.
„Oh Herrgott im Himmel, was hat da jemand angerichtet“, sagte ein schwarzer Mann.
Ich versuchte zu sprechen, aber meine Stimmbänder brachten keinen Ton hervor.
Ein kleiner schwarzer Junge in einem zerlumpten Overall, dessen Träger lose herunterbaumelten, stand am oberen Rand des Flussbetts und starrte mich an. Ich hob die Finger von meiner Brust und versuchte schwächlich, ihm zuzuwinken. Ich fühlte, wie eine Seite meines Mundes zu lächeln versuchte und dabei das Netz aus getrocknetem Schlamm aufsprang, das sich quer über meine Wange zog. Der Junge wich zurück und rannte mit viel Getöse durch das Unterholz. Seine Stimme gellte durch die heiße Morgenluft.
2
Drei Monate später verbrachte ich einen Großteil meiner Zeit zu Hause, auf der Veranda. Die Tage waren kühl und warm zugleich, so wie jeden Herbst im Süden von Louisiana, und ich saß gerne in Khakihosen, einem weichen Flanellhemd und bequemen Schuhen einfach nur so da, betrachtete das goldene Licht in den Pecanbäumen, die harten Blautöne über dem Sumpf, ein Himmel wie gekachelt, das rote Laub, das wie die Blütenblätter einer Rose auf dem Bayou schwamm, die Fischer am Landungssteg, die säckeweise kleingestoßenes Eis auf ihren Fang, sac-à-lait und Breitmaulbarsch, schütteten.
Manchmal machte ich nach einigen Stunden dann einen kleinen Spaziergang durch den Pecanhain den Feldweg hinunter zum Landungssteg und meinem Laden für Köder und Angelzubehör, wo ich Batist, dem Schwarzen, der für mich arbeitete, dabei half, die Einnahmen zu zählen, tote Köderfische aus dem Aluminiumbecken zu fischen oder die Hühnchenteile und Würstchen mit sauce piquante zu bestreichen, die auf meinem Grill lagen, einem alten Ölfass, das ich mit dem Acetylenbrenner längs halbiert und dann eiserne Scharniere und Beine drangeschweißt hatte. Dieses Jahr hatten wir eine gute Saison, und ich verdiente viel Geld mit dem Verleih von Booten und dem Verkauf von Ködern und Bier und Essen vom Grill. Meine Abnehmer dafür waren die Fischer, sie kamen mittags rein und versammelten sich um die runden Gartentische, auf die Seite gelegte hölzerne Telefonkabeltrommeln mit Sonnenschirmen in der Mitte. Aber ich hatte immer schnell genug von meinem eigenen Laden und ging dann wieder zurück auf die Veranda, wo ich die runden Lichtkegel in den Bäumen und die grauen Eichhörnchen beobachtete, die durch die Laubhaufen am Fuß der Bäume huschten.
Linke Schulter, Arm und oberer Brustbereich taten nicht mehr weh, nicht einmal, wenn ich mich im Schlaf auf die linke Seite drehte. Nur wenn ich mit meiner linken Hand etwas Schweres schnell hochzuheben versuchte, hatte ich Probleme. Manchmal knöpfte ich mein Hemd auf und betastete die runde Narbe, wenige Zentimeter unterhalb meines Schlüsselbeins. Sie war so groß wie ein Zehncentstück, rot, eine Einbuchtung, die sich anfühlte wie Gummi. Nahezu narzisstisch fasziniert von meiner eigenen Sterblichkeit fasste ich dann oben über meine Schulter und berührte die wulstige Narbe, die sich über der Austrittswunde gebildet hatte. Die Kugel war so sauber und gerade wie ein Pfeil durch mich hindurchgegangen.
An manchen Nachmittagen klappte ich einen Kartentisch auf der Veranda auf und nahm meine Schusswaffen auseinander – eine doppelläufige Schrotflinte Kaliber 12, eine kleine Beretta Kaliber .25 für Notfälle und die .45er Automatik, die ich aus Vietnam mitgebracht hatte – und ölte und putzte und polierte alle Federn und Schräubchen und kleinen mechanischen Teile. Dann ölte ich sie noch einmal und fuhr mit einer Rundbürste durch die Läufe, bevor ich die Waffen wieder zusammensetzte. Es gefiel mir, wie die .45er schwer in meiner Hand lag, wie präzise das Magazin in den Griff passte, wie sich meine Fingerabdrücke in feinen Linien auf dem frisch geölten Metall abzeichneten.
Eines Tages lud ich das Magazin mit Hohlspitzgeschossen, ging hinunter zum Ententeich an der Rückseite meines Grundstücks, ließ eine Patrone in die Kammer gleiten und nahm ein breites grünes Hyazinthenblatt ins Visier. Aber ich drückte nicht ab. Ich senkte die Automatik, hob sie dann wieder und zielte erneut. Der Nachmittag war sonnig und warm, und das Gras glänzte mattgrün im Sonnenlicht. Ein zweites Mal nahm ich die .45er runter, nahm das Magazin wieder raus und steckte es in die Hüfttasche meiner Hose. Ich zog den Schlitten zurück und warf die Patrone aus der Kammer. Ich sagte mir, dass ein Pistolenschuss sicher ohrenbetäubend wäre und nur die Nachbarn aufschrecken würde.
Ich ging wieder ins Haus, steckte die .45er unter einige Hemden in meiner Ankleidekommode und kümmerte mich nicht weiter drum.
Mit den Nächten kam ich weniger gut zurecht. Manchmal ging ich nach dem Abendessen noch mit Alafair, meiner Adoptivtochter, auf ein Eis zu Vezey’s in New Iberia. Danach, auf der Fahrt zurück über die unbefestigte Straße entlang des Bayous, im nachlassenden Licht der Abenddämmerung, Leuchtkäfer wie stiebende Funken am Nachthimmel, fühlte ich auf einmal einen namenlosen Druck, für den es keinen ersichtlichen Grund gab. Ich versuchte vor ihr zu verbergen, wie sehr ich mit mir zu kämpfen hatte, aber obwohl sie erst in der zweiten Klasse war, erkannte sie meine Stimmungen immer treffsicher und ließ sich von mir nicht täuschen. Sie war ein schönes Kind, mit einem runden braunen Gesicht, einem breiten indianischen Gebiss und glänzendem schwarzen Haar im Ponyschnitt. Wenn sie lächelte, konnte sie kaum mehr aus den Augen sehen, und niemand wäre darauf gekommen, dass sie in ihrem Dorf in El Salvador Zeugin eines Massakers geworden war, oder dass ich sie aus einer Luftblase im Wrack eines Flugzeugs gezerrt hatte, das mit illegalen Flüchtlingen an Bord über dem Meer abgestürzt war.
Eines Abends merkte ich auf dem Heimweg von der Eisdiele, dass ihre Augen mein Gesicht beobachteten. Ich blickte zu ihr und blinzelte sie an. Wir hatten ein paar neue Kinderbücher mit Curious George und Baby Squanto gekauft, und die hatte sie die Fahrt über auf ihren Knien.
„Warum denkst du dauernd nach, Dave?“, fragte sie. Sie trug Jeans mit Stretchverschluss, pinkfarbene Tennisschuhe, ein T-Shirt mit dem Aufdruck „Ragin’ Cajuns“ und eine Baseballmütze der Houston Astros, die ihr mehrere Nummern zu groß war.
„Ich bin heute nur müde, Kleines.“
„Bei Vezey’s hat ein Mann ‚Hallo‘ zu uns gesagt, und du hast gar nicht reagiert.“
„Vielleicht hab ich ihn einfach nicht gehört.“
„Du lächelst oder spielst gar nicht mehr, Dave. Wie wenn dauernd was nicht in Ordnung wäre.“
„Ist es so schlimm?“
Sie blickte starr nach vorne, und ihre Kappe wippte mit den Unebenheiten in der Straße.
„Alf ?“, fragte ich.
Aber sie wollte weder den Kopf drehen noch antworten.
„Hey, Baby Squanto, komm schon.“
Dann fragte sie ganz leise: „Hab ich was getan, dass du traurig bist?“
„Nein, natürlich nicht. So was darfst du nie denken, Kleines. Wir sind doch Partner, oder?“
Aber ihr Gesicht wirkte verdüstert im tiefroten Abendlicht, ihre dunklen Augen umwölkt von Fragen, auf die sie keine Antwort hatte.
Nachdem ich mit ihr gebetet und ihr einen Gutenachtkuss gegeben hatte, las ich bis spät in die Nacht, bis meine Augen brannten und ich die Worte auf der Seite nicht mehr aufnehmen konnte und die Dunkelheit draußen von den Schreien und Rufen der Nachtvögel und Sumpfbiber mit Leben erfüllt wurde. Ich sah mir noch die Spätnachrichten im Fernsehen an, trank ein Glas Milch und schlief schließlich mit dem Kopf auf dem Küchentisch ein. Mitten in der Nacht weckte mich das Geräusch von Alafairs Füßen, die in Hausschuhen über den Linoleumboden tappten. Ich blickte auf und sah mit verquollenen Augen in ihr Gesicht. Auf ihrem Schlafanzug waren lauter lächelnde Uhren. Sie tätschelte mir den Kopf wie einer Katze.
In meinen Träumen wartete er auf mich. Nicht Tee Beau Latiolais oder Jimmie Lee Boggs, sondern eine sich ewig verändernde Gestalt, die jede Nacht anders war, aber immer dasselbe zuwege brachte. Manchmal war es ein Vietcong, der schwarze Pyjama schweißnass an den Körper geklatscht, das Gesicht mit menschlichen Fäkalien aus einem Reisfeld beschmiert, mit einem Stielauge über Kimme und Korn eines altmodischen französischen Gewehrs zielend. Als er abdrückte, zerriss die Kugel mit dem Stahlmantel meine Kehle so mühelos, wie sie eine Melone durchbohrt hätte.
Manchmal sah ich mich auch in einer schmalen, unbeleuchteten Ziegelpassage, die von der Dauphine Street im French Quarter abging. Ich roch den feuchten Stein, die Minze und die Rosen, die im Innenhof wuchsen, und ich sah die Schatten der Bananenstauden auf den Steinplatten jenseits des Eisentors flattern, das am Ende der Passage offen stand. Meine Hand umklammerte den Griff der .45er; ich spürte den Mörtel zwischen den Mauerziegeln, als würden mir Krallen in den Rücken fahren. Langsam arbeitete ich mich zum Eingang des Innenhofs vor, und der Atem schwoll mir in der Brust; plötzlich flog mir das verzierte Eisentor ins Gesicht, brach zwei meiner Finger wie dürre Zweige, wischte mir die .45er aus der Hand und warf mich rückwärts in eine Regenpfütze. Ein riesiger schwarzer Mann in einem Kinder-T-Shirt und in lavendelfarbenen Hosen, die mindestens drei Nummern zu klein waren, sodass sich seine Hoden wie ein Sack voller Unterlegscheiben darin abzeichneten, ging in die Knie, eine .410er Schrotpistole auf den Oberschenkel gelegt, und sah mich durch das Gitter des Tors hindurch an. Er war zahnlos, seine Lippen dunkelrot und schorfig, die Augen hatten rote Ränder, und sein Atem stank wie die Hölle.
„Jetzt darfst du betteln, Arschloch“, sagte er. „Ja, richtig, bettel um dein wertloses Scheißleben.“
Er lächelte, hob mit dem Lauf der Schrotpistole meine Kinnspitze und spannte den Hahn.
Dann erwachte ich auf der Couch, T-Shirt und Unterhose durchgeschwitzt, und saß in einem Mondlichtkegel am Couchrand, den Kopf vornübergebeugt, die Zähne krampfhaft zusammengebissen, damit sie nicht klapperten.
Während der drei Monate, die ich beurlaubt war, erhielt ich meinen vollen Lohn, und als ich wieder zum Dienst antrat, war mein Aufgabenbereich eingeschränkt. Die meiste Zeit blieb ich im Büro; ich befragte Zeugen für andere Detectives; manchmal untersuchte ich auch Verkehrsunfälle, die sich irgendwo im Bezirk ereignet hatten. Ich erledigte viel Papierkram. Man behandelte mich mit der Ehrerbietung, die oft verwundeten Soldaten auf dem Weg der Besserung entgegengebracht wird. Das ist nett von den Leuten, aber vielleicht schwingt auch eine gewisse Furcht mit, so als wäre Sterblichkeit eine ansteckende Krankheit, die durch Quarantäne gebannt werden kann.
Im gleichen Maße wie die Jahreszeit mild und warm wurde, eine Übergangszeit, wurde mein Leben konturenund belanglos.
An einem stürmischen Nachmittag, an dem der Wind die Blätter durch die Luft wirbelte, fuhr ich schließlich mit meinem Lieferwagen nach Lafayette, um Minos P. Dautrieve aufzusuchen, einen alten Freund und Drogenfahnder der DEA, der jetzt bei der vom Präsidenten eingesetzten Sondereinheit zur Drogenbekämpfung war.
Er angelte sehr gerne, und weil ich mit ihm nicht in seinem Haus reden wollte, wo seine Frau oder seine Kinder immer irgendwo in der Nähe waren, bat ich ihn, sein Angelzeug mitzunehmen und mit mir zum Damm am Henderson Swamp zu fahren.
Ich hielt an einem der Läden unterhalb des Damms, die Köder verkauften und Boote vermieteten, und kaufte zwei Poorboy-Sandwiches mit Shrimps und eine Flasche Jax-Bier für ihn und ein Dr Pepper für mich.
Wir gingen hinunter auf eine Grasfläche am Ufer, gegenüber einer Reihe von Bauminseln, die als Barriere zwischen dem Kanal entlang des Damms und dem eigentlichen Sumpf dienten, tatsächlich ein riesiges Marschlandgebiet, mit Buchten, Kanälen, Bayous, Ölbohrinseln und im Wasser stehenden Grüppchen von Zypressen und Weiden. Er warf seine Angel bis zu der Stelle aus, wo die Wasserpflanzen aufhörten, die auf der anderen Seite des Kanals wuchsen.
Minos hatte es zu hohen Ehren gebracht, als er in der Basketballmannschaft der Louisiana State University spielte, und er trug sein Haar immer noch militärisch kurz geschnitten wie ein Collegejunge, sodass man die Kopfhaut durchschimmern sah. Er war genauso schlank und hatte einen genauso flachen Bauch und schmale Hüften wie zu der Zeit, als Sportjournalisten ihn Dr. Dunkenstein getauft hatten. In Vietnam war er Oberleutnant beim Nachrichtendienst der Army gewesen, und obwohl er sich oft abschätzig und zynisch und defensiv äußerte, was seine Rolle als Agent der Regierungsbehörde betraf, hatte er das Herz auf dem rechten Fleck und einen klaren Sinn für Recht und Unrecht, der ihn bisweilen in Schwierigkeiten mit seiner eigenen Bürokratie brachte.
Ich setzte mich auf die abschüssige Grasfläche und rupfte an einem langen Grashalm herum. Erzählte ihm von der seltsamen Abgestumpftheit, die meine Tage kennzeichnete. „Als würde ich mich mitten in irgendeinem Niemandsland befinden. Als gäbe es auf einen Schlag keine Geräusche mehr, keine Bewegung mehr.“
„Das gibt sich“, sagte er.
„Den Eindruck hab ich aber nicht.“
„Sie haben in Vietnam zwei Verwundetenabzeichen bekommen. Und das haben Sie doch ganz gut überstanden, oder irre ich mich da?“
„Das war was anderes. Die erste Wunde war nur oberflächlich. Beim zweiten Mal hab ich’s nicht kommen sehen. Das macht einen ziemlichen Unterschied, ob man’s kommen sieht.“
„Ich selbst bin nie verletzt worden, also reden Sie vielleicht mit dem Falschen. Aber ich habe das Gefühl, dass da noch was anderes ist, was Ihnen auf der Leber liegt.“
Ich ließ den zerrupften Grashalm zwischen meine Knie fallen und wischte mir die Finger an den Hosen ab.
„Ich werde das Gefühl nicht los, ich hab um mein Leben gebettelt“, sagte ich.
„Versteh ich nicht. Sie haben Boggs gegenüber um Ihr Leben gebettelt, bevor er Sie niedergeschossen hat?“
„Nein, als Tee Beau in das Flussbett runtergeklettert kam und vor meinem Gesicht den Hahn der Waffe gespannt hat.“ Ich musste schlucken, als ich es sagte.
„Also, meiner Meinung nach haben Sie sich blendend gehalten. Was hätten Sie denn tun sollen? Sie hatten einen Schuss in die Brust abbekommen, mussten im Dunkeln daliegen, während zwei Kerle davon reden, Sie umzubringen, und dann waren Sie noch von der Gnade eines jungen Schwarzen abhängig, den man bereits zum Tod verurteilt hatte. Ich glaube nicht, dass ich das unversehrt überstanden hätte. Nein, ich weiß genau, dass ich das nicht unversehrt überstanden hätte.“
Er warf Haken und Köder wieder aus und holte sie in einer Zickzackbewegung knapp unterhalb der Wasseroberfläche wieder ein. Dann legte er die Rute am Ufer ab, holte unsere Sandwiches und Getränke aus der Papiertüte und setzte sich neben mich.
„Hören Sie mal zu, Kumpel“, sagte er. „Sie haben Mut. Das haben Sie schon vor langer Zeit bewiesen. Hören Sie also auf, sich das Gegenteil einzureden. Ich glaube, wir sollten hier eigentlich drüber reden, wie wir Boggs zur Strecke bringen. Und zwar endgültig, sodass er nicht mehr vom Haken kommt. Wie ist er überhaupt an den Revolver aufm Scheißhaus gekommen?“
„Er hatte eine Freundin in Lafayette, eine Tänzerin. Sie ist am Tag seiner Flucht aus der Stadt abgehauen, aber ihre Fingerabdrücke waren überall auf dem Handtuchbehälter.“
„Was nimmt man an, wo er jetzt ist?“
„Keine Ahnung. Er hat den Wagen in Algier stehen lassen. Vielleicht ist er wieder nach Florida.“
„Was ist mit dem jungen Schwarzen?“
„Verschwunden. Ich hätte eigentlich gedacht, dass er mittlerweile auftauchen würde. Er ist noch nie irgendwo anders gewesen, hat immer bei seiner Großmutter gelebt.“ „Fangen Sie ihn, und er führt Sie vielleicht zu Boggs.“
„Vielleicht ist er auch tot.“
Minos öffnete die Bierflasche mit seinem Taschenmesser, warf den Kronkorken in die Papiertüte und trank aus der Flasche. Er starrte hinaus auf die weite, dahingestreckte Fläche aus grauem Wasser und toten Zypressen. Im Westen stand die Sonne tief und rot am Horizont.
„Ich finde, es wird Zeit, dass Sie in die Gänge kommen und die Jagd auf diese Kerle eröffnen“, sagte er. „Das Spiel läuft nämlich so: Wir machen die fertig und ziehen sie aus dem Verkehr.“
Ich sagte gar nichts.
„Ist doch verflucht langweilig, in seinem eigenen Leben zum Zuschauen verdammt zu sein. Was meinen Sie?“, fragte er.
„Gar nichts.“
„Quatsch. Was meinen Sie?“ Er versetzte mir mit dem Ellbogen einen Stoß gegen den Arm.
Ich stieß meinen Atem aus.
„Ich denke drüber nach“, sagte ich.
„Wenn Sie irgendwelche Hilfe von unserer Behörde brauchen, kriegen Sie die.“
„In Ordnung, Minos.“
„Wenn der Schwarze noch lebt, möchte ich wetten, dass Sie ihn innerhalb von einer Woche schnappen.“
„Okay.“
„Und Sie wissen, dass sich auch Boggs finden wird. Ein Bursche wie der verbringt keinen Tag, ohne irgendwo Scheiße auf die Möbel zu schmieren.“
„Ich versteh schon, worauf Sie hinauswollen.“
„Okay, vielleicht trag ich jetzt ein bisschen dick auf. Aber ich will nicht, dass Sie noch länger so untätig rumsitzen. Die Verbrecher sind die Verlierer. Jeden Morgen, wenn sie aufstehen, ist ihnen das klar. Und wir wollen doch nicht, dass die nur einen Augenblick lang daran zweifeln, Kollege.“
Er lächelte und reichte mir ein Poorboy-Sandwich. Dick und weich lag es in meiner Hand. Auf der anderen Seite des Kanals sah ich zwischen den Wasserlilien den zerfurchten und knubbeligen Kopf eines Alligators. Er sah aus wie ein nasser brauner Stein zwischen den Lilienkissen.
Am nächsten Tag las ich alle Unterlagen, die es über Tee Beau Latiolais gab, und sprach mit dem Büro des Staatsanwalts und dem Detective, der die Untersuchung geführt und Tee Beau verhaftet hatte. Niemand schien einen Zweifel an seiner Schuld zu haben. Er hatte für einen Redbone namens Hipolyte Broussard gearbeitet, der Wanderarbeiter in klapprigen Bussen vom Norden Arizonas nach Dade County in Florida beförderte. Ich erinnerte mich an ihn. Ein seltsam aussehender Mann, der sich in jener Halbwelt bewegt hatte, die in Südlouisiana allen Farbigen vorbehalten blieb: Schwarzen, Quadroones – zu einem Viertel schwarz, Octoroones – zu einem Achtel schwarz, und Redbones – Mischlinge von schwarzer, weißer und indianischer Abstammung. Zur Zeit der Zuckerrohrernte sah man ihn beim Morgengrauen auf den Feldern, wo er seine Arbeiter ablud, und abends hielt er sich in den Schwarzenbars und Billardhallen im Südteil der Stadt oder draußen auf dem Land auf, wo er die Arbeiter auszahlte oder ihnen von einem Tisch im Hinterzimmer aus zu Wucherzinsen Geld lieh. Wie bei allen Redbones hatte seine Haut die Farbe verbrannter Ziegel, und seine Augen waren türkis. Seine Arme und langen Beine waren so dünn wie Pfeifenreiniger, und er trug lange Koteletten, einen rostfarbenen, strichdünnen Schnurrbart und keck und schief auf dem Kopf einen gelackten Strohhut. Er nahm seine Arbeiter hart ran, und er bekam so viele Aufträge von landwirtschaftlichen Betrieben, wie er nur wollte. Ich hatte Geschichten gehört, nach denen er Arbeiter, sogar ganze Familien, die ihm Ärger gemacht hatten, zu mitternächtlicher Stunde auf einer abgelegenen Landstraße einfach aus dem Bus geworfen hatte. Es gab auch niemanden, der an Tee Beaus Motiv zweifelte. In der Tat brachten die Leute sogar Verständnis dafür auf. Aus unerfindlichem Grund hatte Hipolyte Broussard Tee Beau das Leben nach Kräften schwergemacht. Es war die Art und Weise, wie Tee Beau ihn umgebracht hatte, die den Richter dazu veranlasst hatte, Tee Beau zum Tode zu verurteilen.
Es herrschte leichter Nebel, als ich auf der unbefestigten Straße zu den Schwarzensiedlungen draußen auf dem Land fuhr, wo Tante Lemon jetzt lebte. Einfache Holzhäuser, grau und ohne Anstrich, die Verandas und Vorbauten morsch, die Außentoiletten behelfsmäßig aus Dachpappe, Bauholzresten und Wellblech zusammengezimmert. Auf dem lehmigen Boden pickten Hühner, die Straßengräben waren voller Müll, und in der Luft hing der tränentreibende Geruch von Grieben, die jemand draußen in einem eisernen Topf kochte. An einer Straßenecke befand sich eine schindelgedeckte Kneipe, deren gesprungene Fenster mit Klebeband notdürftig geflickt waren. Da Freitagnachmittag war, stand der mit Muschelschalen gekieste Parkplatz bereits voller Autos, und die Jukebox im Inneren des Lokals dröhnte so laut, dass das Vorderfenster vibrierte.
Das Haus von Tante Lemon stand leicht erhöht auf niedrigen Ziegelsäulen, und ein gelber Hund an einem Seil hatte sich unter dem Haus eine Kuhle gegraben, von der aus er mich beäugte. Sein wedelnder Schwanz klopfte gegen den Lehmboden. Im feuchten Schatten unter dem erhöhten Holzboden surrten Fliegen. Ich klopfte an die Gazetür, dann sah ich sie in einer Ecke ihres kleinen Wohnzimmers an einem Bügelbrett stehen. Sie hörte auf zu bügeln, nahm eine Blechdose, hielt sie an die Lippen und spuckte Kautabak hinein.
„Die meinen wohl, wenn sie dich schicken, werd ich dir verraten, wo mein kleiner Junge ist“, sagte sie. „Hab ihn nich gesehen, hab nich mit ihm gesprochen, weiß nich mal, ob er noch am Leben ist. Daran bist du schuld, Mr. Dave. Also komm jetzt nich her und tu so, als bist du unser Freund.“
„Darf ich reinkommen, Tante Lemon?“
„Ich hab’s den andern Polizisten gesagt, und ich sag’s dir noch mal: Ich hab ihn nich gesehen, und ich hab nich vor, dir zu helfen.“
„Hör zu, Tante Lemon, ich will Tee Beau nichts Böses. Er hat mir das Leben gerettet. Ich bin hinter dem Weißen her. Aber früher oder später wird Tee Beau ja doch gefasst werden. Wär’s dir da nicht lieber, wenn ich ihn zuerst finde, bevor ihm am Ende noch einer was antut?“
Sie trat zur Fliegentür und öffnete sie. Ihr Kleid war vom vielen Waschen nahezu farblos, und es hing formlos wie ein Sack an ihrem Körper mit den welken Brüsten.
„Meinst du, weil ich ein altes Niggerweib bin, kannst du mir die Hucke volllügen?“, fragte sie. „Wenn du meinen Jungen fängst, bringen sie ihn ins Red-Hat-Haus, schnallen ihn dort an den Stuhl und machen eine Metallkappe auf seinem kleinen Kopf fest. Dann verhüllen sie sein Gesicht, damit sie seine Augen nich sehn müssen. Und dann dürfen all die Leute zusehn, wie mein kleiner Junge stirbt, wie der Strom seinen Körper verbrennt. Ich war in Camp One, Mr. Dave, als da noch Frauen hingeschickt worden sind. Ich hab gesehn, wie sie einen weißen Mann zum Red-Hat-Haus gebracht haben. Sie haben ihn den ganzen Weg vom Auto am Boden langgeschleift, wie einen Hund in Ketten. Dann haben sich die ganzen Leute hingesetzt wie im Baseballstadion und haben zugesehn, wie dieser Mann gestorben ist.“
Sie hob die Blechdose an die Lippen und spuckte erneut hinein. Dann griff sie nach ihrem Bügeleisen und nahm sich ein gestärktes weißes Hemd vor. Sie roch nach getrocknetem Schweiß, Copenhagen-Tabak und der Hitze, die vom Bügelbrett aufstieg. Papier von Zeitungen und Illustrierten war schichtweise auf die Wände ihres Hauses geklebt worden, darüber dann einzelne, nicht zueinander passende Streifen von Tapete mit Wasserflecken. Den Boden bedeckte ein Teppich, dessen Fasern sich wie welliges Stroh in ihre Einzelteile aufgelöst hatten, und die wenigen Möbel, die sie besaß, sahen aus, als seien sie Stück für Stück von dem Müllabladeplatz angeschleppt worden, wo Tee Beau früher gearbeitet hatte.
Ich setzte mich auf einen einfachen Stuhl mit gerader Lehne, der neben ihrem Bügelbrett stand.
„Ich kann dir zwar nichts versprechen“, sagte ich, „aber wenn ich Tee Beau finde, will ich versuchen, ihm zu helfen. Vielleicht können wir den Gouverneur dazu bringen, sein Urteil umzuwandeln. Tee Beau hat einem Polizisten das Leben gerettet. Das könnte eine große Rolle spielen, Tante Lemon.“
„Das Leben von diesem Zuhälter hat eine große Rolle gespielt.“
„Was?“
„Hipolyte Broussard war ein Zuhälter, und er wollte Tee Beau auch zu einem machen.“
„Ich hab nie gehört, dass Broussard etwas mit Prostitution zu tun hatte.“
„Die Weißen hören das, was sie hören wollen.“
„In der Akte stand auch nichts davon. Wem hast du davon erzählt?“
„Niemandem hab ich’s erzählt. Niemand hat mich gefragt.“
„Wo war sein Revier, Tante Lemon?“
„In der Kneipe da an der Ecke“, sagte sie und nickte mit dem Kopf in die Richtung. „Und draußen in den Lagern, wo die Farmarbeiter untergebracht sind.“
„Und er wollte, dass Tee Beau da mitmacht?“
„Tee Beau hat immer die Mädchen aus der Kneipe ins Lager fahren müssen. Tee Beau hat gesagt: ‚Ich kann das nich länger tun, Hipolyte.‘ Darauf hat Hipolyte gesagt: ‚Du wirst es tun, weil ich sonst nämlich deinem Bewährungshelfer stecke, dass du mich bestohlen hast, und dann kommst du wieder in den Knast.‘ Und es hat keine Rolle gespielt, ob Tee Beau jetzt gehorcht hat oder nich. Hipolyte hat ihm das Leben zur Hölle gemacht, ihn gepiesackt bis zum Gehtnichmehr, vor allen Leuten, bis er nur noch heulend heimkam. Wenn der Mann nich schon tot wär, würd ich ihn selber umbringen.“
„Tante Lemon, warum hast du das niemandem gesagt?“
„Ich sag’s dir doch, sie haben mich nich gefragt. Meinst du etwa, die Leute im Gericht gäben einen feuchten Dreck drauf, was ’n altes Niggerweib sagt?“
„Du hast es keinem gesagt, weil du dachtest, dass es Tee Beau nur schadet, dass die Leute dann nur noch überzeugter von seiner Schuld gewesen wären.“
Draußen begann es zu regnen. Der behelfsmäßige Windschutz am Seitenfenster wurde von einem Stock hochgehalten, und in dem grauen Licht bekam ihre Haut die Farbe einer abgegriffenen Kupfermünze. Sie fuhr mit dem Eisen ruckartig über das Hemd, das sie bügelte.
„Über diese Kneipe an der Kreuzung könnt ich dir ’ne Menge erzählen, über die Voodoohexe, die den Laden mit Hipolyte zusammen führt, und was für einen Laden die da am Laufen haben. Aber das interessiert keinen, Mr. Dave. Erzähl mir nich, dass es nich so ist. Als ich im Angola im Straflager war, war’s genauso. Die Männer mussten am Damm schuften und wurden hin- und hergekarrt wie Vieh. Jeden Tag sind sie mit Knüppeln geprügelt oder abgeknallt und an Ort und Stelle verscharrt worden. Jeder hat das gewusst, niemand hat sich drum gekümmert. Und es kümmert sich auch niemand um Tee Beau oder was ich zu sagen hab.“
„Du hättest mit jemandem reden sollen. Sie haben Tee Beau nicht auf den Stuhl setzen wollen, weil er Hipolyte getötet hat, sondern deshalb, wie er es getan hat.“
„Tee Beau war hier in diesem Haus und hat Krebse geputzt. Genau hier“, sagte sie und pochte mit dem Finger auf das Bügelbrett.
„Okay. Aber jemand hat sich in den aufgebockten Bus gesetzt und ist losgefahren, und der Wagen ist auf Hipolyte gelandet. Tee Beaus Fingerabdrücke waren überall auf dem Lenkrad. Schlammabdrücke von seinen Schuhen waren überall auf den Pedalen. Und zwar nur seine. Und als Hipolyte mit gebrochenem Rückgrat unter der Bremstrommel lag, hat ihm jemand einen Öllappen in den Mund gestopft. Er hat zwei Stunden gebraucht, bis er daran erstickt ist.“
„Das war nich lang genug.“
„Wo ist Tee Beau?“
„Dir sag ich gar nix mehr. Reine Zeitverschwendung“, sagte sie. Sie nahm eine Zigarette aus einer Packung, die auf dem Bügelbrett lag, zündete sie an und blies den Rauch in die schwüle Luft. „Du bist ein weißer Mann. Du hast mit den Farbigen nix am Hut. Jetzt kommst du her, weil du Tee Beau brauchst, um diesen weißen Abschaum zu kriegen, der dich niedergeschossen hat. Du siehst nur einen schwarzen Jungen, der dir dabei helfen kann. Aber du weißt überhaupt nich, wie er wirklich ist, wie’s in ihm drin aussieht, wie sehr er seine Gran’maman lieb gehabt hat, wie viel er sich aus Dorothea macht und was er alles für das Mädchen tun würde. Von all diesen Dingen hast du keine Ahnung, Mr. Dave.“
„Wer ist Dorothea?“
„Geh in die Kneipe, frag sie selber, wer sie ist. Und frag sie nach Hipolyte, und was Tee Beau für sie getan hat. Wo du doch der bist, der ihn auf den Stuhl bringen will.“
Ich verabschiedete mich von ihr, aber sie machte sich nicht die Mühe, mir zu antworten. Als ich von der Veranda trat, regnete es heftig, und Schlammtropfen tanzten auf dem Lehmboden. Unten an der Kreuzung schimmerte die klapprige Fassade der Kneipe im grauen Licht, und die Neonbuchstaben über der Tür, Big Mama Goula’s, wirkten im Regen, der von den Dachschindeln abprallte, wie purpurner Rauch.
Das Innere des Lokals war dicht gefüllt mit Schwarzen; Zigarettenrauch und diverse andere intensive Gerüche – getrockneter Schweiß, Muskat, Talkumpuder, Kutteln, Gumbo, abgestandenes Bier und Toiletten-Desinfektionsmittel – sorgten für dicke Luft. Die Jukebox dröhnte ohrenbetäubend, und die Billardspieler rammten die Kugeln rabiat in die Löcher, johlten und schlugen den Rahmen mit Wucht auf die dunkle Tischoberfläche. Hinter der Tanzfläche machte sich eine Zydeco-Kapelle mit Akkordeon, Waschbrett, den dazugehörigen Fingerhüten und einem elektrischen Bass auf einer kleinen Bühne bereit, die von orangenen Scheinwerfern und Hühnerdraht umsäumt war. Hinter den Musikern rotierte in einem Fenster ein riesiger Ventilator, der den Zigarettenrauch aufsaugte und hinaus in den Regen blies, und in der Zugluft flatterte ihre Kleidung wie Vogelfedern. Dicht gedrängt standen Kunden an der Theke, aßen boudin und eingelegte Schweinsfüße von Papptellern, tranken Jax-Bier aus langhalsigen Flaschen und spotioti-Wein, ein Mischgetränk aus Whiskey und Muskat, das einem eine Woche lang den Schädel brummen ließ. Ich stellte mich ans Ende der Theke, sah, wie sich die Blicke für einen kurzen Moment mir zuwendeten, hörte dann, wie die Gespräche wieder aufgenommen wurden, als wäre ich gar nicht da. Ich wartete darauf, dass der Barkeeper mich zur Kenntnis nehmen würde. Er kam bis auf einen Meter in meine Nähe und machte sich daran, Bierflaschen aus einem Pappkarton zu pflücken, die Flaschenhälse zwischen den Fingern beider Hände, und sie in die Eistruhe zu stecken. In seinem Mund hing eine dünne erloschene Zigarre.
„Was wollen Sie, Mann?“, fragte er, ohne den Blick zu heben.
„Ich bin Detective Dave Robicheaux vom Büro des Sheriffs“, sagte ich und klappte das Mäppchen mit der Marke in meiner Hand auf.
„Was wollen Sie?“ Seine Augen sahen mich zum ersten Mal direkt an. Sie wirkten mürrisch und waren von winzigen roten Äderchen durchzogen.
„Ich möchte mit Dorothea reden.“
„Sie bedient an den Tischen. Hat grad viel zu tun.“
„Es dauert nicht lang. Rufen Sie sie bitte her.“
„Hören Sie, Mann, Sie sind hier fehl am Platz. Verstehen Sie, was ich meine?“
„Nicht ganz.“
Er stand von seiner Arbeit auf und legte die Hände flach auf die Theke.
„Da drüben bei der Band, das ist sie“, sagte er. „Wollen Sie zu ihr rüber gehen und sie herholen? Wollen Sie das wirklich?“
„Sagen Sie ihr, sie soll herkommen, bitte.“
„Hören Sie, ich hab Ihnen nix getan. Warum machen Sie mir hier Schwierigkeiten?“
Die Männer neben mir hatten ihr Gespräch unterbrochen und rauchten jetzt übertrieben beiläufig ihre Zigaretten und betrachteten ihre eigenen Spiegelbilder im Spiegel hinter der Theke. Ein Mann trug einen lavendelfarbenen Filzhut mit einer Feder in der Krempe. Seine Jacke hing an einer Seite schwer durch.
„Hören Sie, Mann, sind Sie mit dem Wagen da?“, fragte der Barkeeper.
„Ja.“