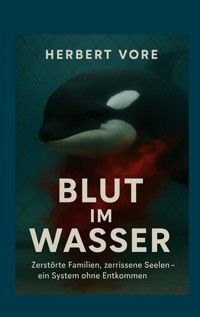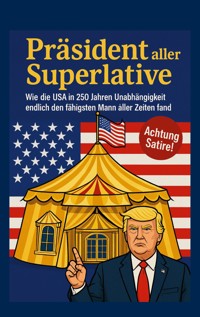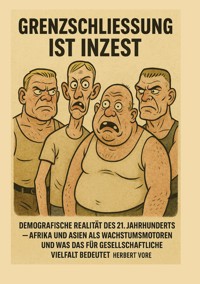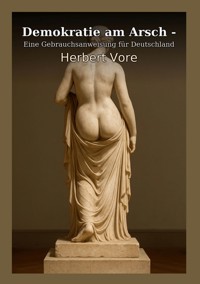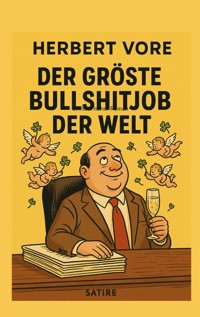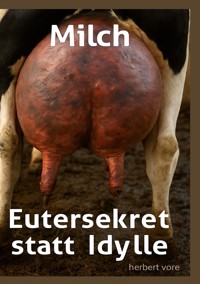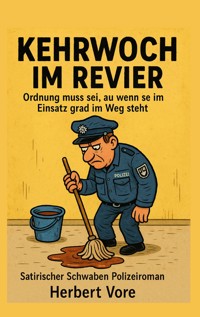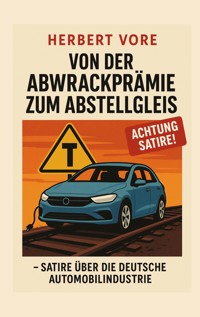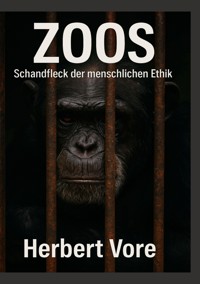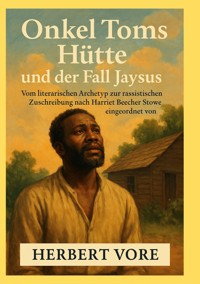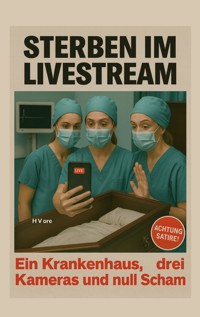Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Jedes Stück Fleisch trägt eine unsichtbare Bilanz aus Blut, Angst und Zerstörung. In Fleisch: Die blutige Bilanz unserer Esskultur nimmt Herbert Vore den Leser mit hinter die geschlossenen Türen der Schlachthäuser, in Mastanlagen, auf Transportwege und in Verarbeitungsbetriebe. Das Buch folgt den Spuren des Tieres von der Geburt bis zur letzten Sekunde; und erzählt von dem, was danach mit seinem Körper geschieht. Es geht um das stille Leid, das nicht auf Verpackungen steht, um den politischen Willen, dieses System am Leben zu erhalten, und um den ökonomischen Motor, der es antreibt. Die Kapitel führen von EU Verordnungen bis zu nationalen Gesetzen, von den Arbeitsbedingungen der Werksvertragsarbeiter bis zu den Milliarden an Subventionen, die jeden Tag in den Markt gepumpt werden. Ein zentrales Thema ist dabei die carnivore Haustierhaltung; ein Aspekt, der selten öffentlich diskutiert wird, aber Millionen Tonnen Fleisch zusätzlich verbraucht. Das Buch fragt: Wie gerecht ist ein System, das den Tod so vieler rechtfertigt, nur um den Napf zu füllen? Herbert Vore verbindet persönliche Beobachtungen mit Recherchen aus Berichten, Studien und Zeugenaussagen. Die Sprache ist klar, kompromisslos und nah an den Realitäten der Betroffenen; menschlich wie nichtmenschlich. Am Ende steht ein Ausblick auf mögliche Wege aus der Gewaltspirale: von einer Landwirtschaft ohne Massentierhaltung über politische Instrumente wie Steuerkorrekturen und Subventionsumschichtungen bis hin zu einer Kultur, in der Mitgefühl selbstverständlich ist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 127
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Rechtlicher Hinweis
Dieses Werk ist reine Fiktion. Alle Personen, Orte, Organisationen und Handlungen sind frei erfunden. Jede Ähnlichkeit mit real existierenden oder verstorbenen Personen, tatsächlichen Orten, Ereignissen oder Strukturen ist zufällig und nicht beabsichtigt.
Es handelt sich weder um Rechtsberatung noch um medizinische, psychologische oder sonstige professionelle Beratung. Die dargestellten Technologien, wissenschaftlichen Ideen und gesellschaftlichen Entwicklungen sind spekulativ und dienen ausschließlich der erzählerischen Darstellung.
Die Lektüre dieses Buches entbindet niemanden von der eigenen Verantwortung. Der Autor übernimmt keinerlei Haftung für Handlungen, Unterlassungen, Schäden oder Verluste, die direkt oder indirekt aus dem Inhalt dieses Werkes entstehen könnten.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Prolog
Kapitel 1 Angst hat eine Temperatur
Kapitel 2 Stimmen der Linie
Kapitel 3 Die Sekunden zwischen Betäubung und Blut
Kapitel 4 Elektrische Betäubung
Kapitel 5 Kohlendioxid im Schweinestall
Kapitel 6 Bolzenschuss beim Rind
Kapitel 7 Geflügel im Wasserbad
Kapitel 8 Kriterien des Bewusstseins
Kapitel 9 Geburten unter Plan
Kapitel 10 Die Straße als Produktionsfaktor
Kapitel 11 Die verbotenen Küken
Kapitel 12 Fließbandseele
Kapitel 13 Geschwindigkeit als System
Kapitel 14 Kontrolle und Vollzug
Kapitel 15 Europäischer Rechtsrahmen und Deutschland
Kapitel 16 Kontrolle und Vollzug
Kapitel 17 – Subventionslandschaft
Kapitel 18 – Steuerlogik an der Kasse
Kapitel 19 – Externe Kosten von Klima bis Gesundheit
Kapitel 20 Exporte und Handelsströme
Kapitel 21 Der zweite Markt Petfood
Kapitel 22 Kategorie Drei und Rendering
Kapitel 23 Hunde und Katzen als Fleischverbraucher
Kapitel 24 Exoten, Wild, Beifang
Kapitel 25 Transformation der Haustierhaltung
Kapitel 26 Fische und Aquakultur
Kapitel 27 Insekten für Futter und Teller
Kapitel 28 Etiketten, Kantinen, Handel
Kapitel 29 Küche, Kultur und Umschichtung
Epilog – Ein anderes Morgen in der Morgendämmerung
Vorwort
Die Bilder, die wir von Fleisch haben, sind sorgfältig ausgewählt.
Einladende Verpackungen, Werbeslogans, die von „Tradition“ und „Qualität“ sprechen, grüne Wiesen und lächelnde Gesichter. Diese Inszenierung ist kein Zufall – sie ist ein Schutzschild. Nicht für die Tiere, sondern für unser Gewissen.
Hinter dieser Fassade liegt eine andere Realität: das routinierte Töten, die Enge, das Warten, die Fehlbetäubungen, die Panik vor dem letzten Schritt. Ein System, das Gewalt in Produktionspläne einrechnet, Subventionen in die Aufrechterhaltung von Leid investiert und selbst den Napf unserer Haustiere aus den Resten des Schlachtbetriebs füllt.
Dieses Buch ist keine neutrale Bestandsaufnahme. Es ist eine Anklage gegen Strukturen, die Schmerz zu einer wirtschaftlichen Größe machen, und ein Werkzeug, um sie zu durchschauen. Kapitel für Kapitel beleuchtet es nicht nur, wie und warum Tiere leiden, sondern auch, welche politischen, ökonomischen und kulturellen Mechanismen dieses Leid am Leben halten – und wie es enden könnte.
Es wird nicht leicht zu lesen sein. Aber Veränderung beginnt nicht mit Bequemlichkeit, sondern mit der Bereitschaft, hinzusehen. Wenn wir verstehen, wie tief das Problem in unserem Alltag verwurzelt ist, können wir beginnen, es zu lösen – Schritt für Schritt, Entscheidung für Entscheidung.
Herbert Vore Leipzig, 2025
Prolog
Der Morgen riecht nach Metall und Kälte, nach feuchtem Staub, nach Desinfektionsmittel, das die Luft nicht reinigt, sondern nur überdeckt, was hier täglich geschieht. Vor der Rampe steht ein Lastwagen, groß wie ein Haus, mit Wänden, die den Atem speichern. Das Brummen des Motors ist verstummt, doch die Wände sprechen weiter. Sie knacken, sie knarren, sie zittern noch, als würden sie eine Erinnerung loswerden wollen. Drinnen stehen Körper an Körper. Sie sind warm, sie sind schwer, sie sind stiller, als man es vermuten würde, nur die kurzen Stöße ihrer Atemzüge verraten den Rhythmus der Anspannung. In der Dunkelheit glänzen Augen, die sich an die wenigen Schlitze im Blech klammern, wo ein blasses Licht hereinsickert. Die Tiere lesen dieses Licht wie eine Nachricht. Licht bedeutet Bewegung, Bewegung bedeutet Enge, Enge bedeutet, dass etwas kommt.
Wenn die Tür der Ladefläche aufschwingt, fällt das Tageslicht über den nassen Boden. Es ist ein Licht ohne Trost. Es zeigt jede Rille im Beton, jeden alten Abdruck einer Klaue, jeden Schlierenzug von Wasser, Blut und Reinigungsmittel, die zu einer eigenen Landkarte verschmiert sind. Ein Mann ruft. Seine Stimme ist nicht laut, aber sie hat diese Schärfe, die allen klar macht, dass die Richtung eindeutig ist. Die Schiebestange klirrt gegen das Gitter, ein metallisches Signal, das die Reihen ordnet. Keine Drohung braucht Worte, wenn der Raum selbst droht.
Das erste Tier setzt einen Huf auf den Rand der Rampe. Der Beton ist feucht und kalt, der Huf rutscht eine Fingerbreite, fängt sich, setzt nach. Dahinter drängen Körper. Nicht aus Ungeduld, sondern weil in einem gedrängten Körperverbund jede Bewegung zur Kettenreaktion wird. Die Tiere wissen nichts von Regeln und Arbeitsanweisungen. Sie kennen nur die unmittelbare Logik der Dinge. Ein Schlag auf Metall bedeutet Platz machen. Ein Schatten an der Wand bedeutet aufpassen. Ein Luftzug bedeutet, dass es gleich enger wird. Die Luft trägt den Geruch derer, die schon hier waren, und die Anspannung derer, die gleich hier sein werden. Die Sinne dieser Tiere sind nicht abstrakt. Sie sind konkret, so konkret wie die Kälte im Beton. Sie verknüpfen Geräusch mit Gefahr, Geruch mit Richtung, Vibration mit Erwartung.
Die Laufgänge sind schmal. Über den Köpfen der Tiere ziehen sich Rohre, Kabel, Schläuche. Sie singen ihr eigenes Lied aus Summen, Zischen, Klacken. Für Menschen klingt es nach Technik. Für ein Wesen, das nicht weiß, was die nächste Minute bringt, klingt es nach Schicksal. Die Tiere betrachten einander, sie riechen einander, sie drücken die Flanken an harte Ecken, um Halt zu finden. Ein Blick verfängt sich im Blick eines anderen. In diesem Augenblick entsteht etwas, das man mit Worten nicht kleinreden kann. Es ist nicht Vernunft, nicht Sprache. Es ist eine stille Frage, die das ganze Tier ausfüllt. Der Mensch, der den Takt hält, spürt diese Augen nur am Rand seiner Arbeit. Er spürt sie und drückt sie weg, so wie er alles wegdrückt, was nicht in den Ablauf passt. Er hat gelernt, den Blick zu teilen in das, was zur Aufgabe gehört, und das, was man sonst nicht aushalten würde.
Die Betäubungsvorrichtung ist nahe. In der Halle steht eine Maschine, die nichts Böses will. Sie will nur funktionieren. Sie will, dass jeder Schritt sitzt, dass jede Bewegung greift, dass jede Sekunde kalkulierbar bleibt. Zwischen dieser Maschine und den Tieren liegt ein Abstand, der sich nicht messen lässt. Es ist der Abstand zwischen Plan und Wirklichkeit. Der Plan sagt, dass Bewusstsein abgeschaltet wird, bevor Schmerz entsteht. Die Wirklichkeit sagt, dass Sekunden zu lang sein können, dass Kontaktflächen ungenau sein können, dass ein Körper ausweichen kann, dass kein System so perfekt ist, wie es der Plan verlangt.
Ein Tier stolpert. Es fängt sich, dreht den Kopf, stößt die Schnauze gegen eine Stange, drückt sie an die Stange, als suche es dort eine Antwort. Dann geht es weiter, denn die Wand aus Körpern hinter ihm nimmt ihm die Entscheidung ab. Es wird fixiert. Der Moment zwischen Entschluss und Ausführung ist kürzer als ein Atemzug. In diesem Augenblick liegt eine ganze Welt. Ein Mensch, der für die Betäubung zuständig ist, hebt die Hand. Sein Arm kennt diese Bewegung in allen Varianten. Aus der Tiefe steigen Erinnerungen auf, die er in das tiefe Wasser der Routine getaucht hat. Die Maschine spricht, und für den Bruchteil eines Augenblicks steht alles still, als hielte die Halle selbst den Atem an.
Manchmal gelingt alles so, wie es auf dem Papier steht. Manchmal nicht. Wenn es nicht gelingt, sagt niemand etwas. Es gibt Anzeichen, die geschulte Augen lesen können, es gibt Zeichen, auf die Ohren reagieren, noch bevor sie zu Bewusstsein werden. Ein Laut, der nicht in den Lärm passt, kann wie eine Nadel sein, die mitten in einem großen Tuch steckenbleibt. Wer ihn hört, hört mehr als ein Geräusch. Er hört, was er nicht hören will. Dann muss er schneller werden, dann muss er nachsetzen, dann muss er eine Lücke schließen, die sich nie ganz schließen lässt. Der Takt ist eine Uhr, die niemand gebaut hat, die aber doch alles misst. Der Takt misst Menschen und Tiere zugleich. Er misst, wie viele Sekunden ein Gewissen erträgt.
Draußen zieht die Sonne höher. Auf dem Hof fährt ein Hubwagen. Ein Container leert sich, ein anderer füllt sich. Ein Lieferant unterschreibt mit einem Stift, der schon so oft über Papier gefahren ist, dass er selbst wie ein Gerät wirkt. Ein Vogel setzt sich auf die Laterne. Er sieht hinunter. Er sieht nichts von Bedeutung, denn er kennt keine Bedeutung in menschlichen Dingen. Er sieht nur Bewegung, und Bewegung bedeutet ihm Hunger, und Hunger bedeutet ihm Futter, und irgendwo wird etwas in einem Container liegen, das für ihn Futter ist. Die Welt bleibt nicht stehen. Sie ordnet sich neu, Sekunde für Sekunde, und wenn in einer Halle etwas geschieht, geschieht zugleich in einer Küche etwas anderes, in einer Kantine etwas Drittes, in einem Napf auf dem Boden einer Wohnung etwas Viertes. Alles ist verbunden, ohne dass jemand die Fäden sieht.
Wenn die Halle am Abend gereinigt wird, fließt Wasser durch Rinnen, die schon viele Abende gesehen haben. Es fließt über Flächen, die das Gedächtnis der Dinge in sich tragen. Die Schicht um drei Uhr morgens wird die Flächen wieder so aussehen lassen, als gäbe es hier keine Geschichten, nur Arbeit. Doch Geschichten lassen sich nicht wegwischen. Sie kleben an der Luft, sie haften an der Haut, sie sitzen in den Köpfen derer, die es wagen, sie anzusehen. Dieses Buch entsteht, weil Hinsehen eine Pflicht ist. Es entsteht, weil die Praxis der Betäubung nicht nur Technik ist, sondern Ethik und Verantwortung. Es entsteht, weil die Straße vom Stall zur Halle nicht nur eine Logistik ist, sondern eine Geschichte von Angst und Kontrolle. Es entsteht, weil die Kultur, die am Ende dieser Kette isst, sich erinnern muss, dass sie die Kette zu einem großen Teil selbst geschmiedet hat.
Dies ist kein Ort für Erlösung. Es ist ein Ort für Klarheit. Klarheit ist das, was bleibt, wenn alle Bilder leiser werden und nur die Fragen übrig sind, die man nicht mehr überhören kann. Was ist ein Leben wert. Was ist eine Sekunde wert. Was ist Bequemlichkeit wert. Wer darf entscheiden, und wessen Körper bezahlt den Preis. Wenn diese Fragen zu Anfang stehen, kann vielleicht am Ende etwas anderes stehen als das, was jeden Morgen an der Rampe beginnt.
Kapitel 1 Angst hat eine Temperatur
Angst ist kein Gedanke. Angst ist ein Zustand. Sie steigt aus dem Boden, sie sitzt im Nacken, sie kriecht in den Bauch, sie macht die Luft eng. Wer sagt, Angst sei nur eine Vorstellung, hat niemals eine Halle betreten, in der Tiere dicht an dicht stehen und doch jedes für sich allein ist. Angst hat eine Temperatur, und sie wechselt mit dem Raum.
Am frühen Morgen ist die Luft knapp über dem Boden kälter als auf Schulterhöhe. Tiere, die flach atmen, ziehen diese Kälte direkt in den Körper. Ihre Schnauzen dampfen, die Feuchtigkeit sammelt sich an den Wänden, rinnt in stillen Tropfen zurück. Später, wenn die Geräte warmgelaufen sind, wenn Motoren, Kompressoren und Menschenkörper die Halle aufheizen, liegt ein Schleier von Wärme in der Luft. Er ist träge, er hängt, er mischt sich mit dem stechenden Geruch der Reinigungsmittel und dem süßlichen Geruch der Körper. Diese Wärme ist nicht harmlos. Sie ist das Medium, in dem Angst sich hält.
Ein Schwein liest die Welt anders als ein Mensch. Es nimmt Vibrationen wahr, die ein Mensch überhört. Es registriert Veränderungen im Luftzug, noch bevor eine Tür sich sichtbar bewegt. Es sieht Kontraste, es erkennt Helligkeiten, es ordnet Bewegungsvektoren ein, die schneller sind als jeder Plan. Was für uns ein Hintergrundrauschen ist, ist für ein Schwein ein dichtes Netz von Signalen. Der Hallraum verstärkt dieses Netz. Jeder Schlag mit einer Stange gegen Metall wird zum Rufzeichen, jede schnelle Bewegung eines Arms wird zu einer drohenden Linie, die Raum für Raum voranschiebt. Die Tiere verknüpfen diese Zeichen mit Schmerz, auch wenn der Schmerz noch nicht da ist. Erwartung ist ein Teil von Angst.
In den engen Laufgängen entscheidet die Temperatur über Bewegung. Ist der Beton kalt und feucht, sucht der Körper Halt, wird vorsichtig, setzt die Klauen flacher auf, rutscht leichter aus, vermeidet jeden Schritt, der zu weit erscheint. Ist der Beton warm und schmierig, klebt er an der Sohle, lässt sich nicht gut lesen, macht schnell und ungenau. Beides ist gefährlich, denn beides stört den Takt. Der Takt ist das ungeschriebene Gesetz jeder Produktionshalle, und er ist das natürliche Gegenteil von Sicherheit. Sicherheit will Zeit. Takt will Geschwindigkeit. Zwischen beiden liegt der Raum, den Angst füllt.
Es gibt eine Physik der Angst. Sie hat mit Dichte zu tun, mit Druck, mit Schall, mit Beschleunigung. Wenn Körper auf engem Raum stehen, erhöht sich der Grunddruck auf Muskeln und Gelenke. Wenn dann ein Impuls von hinten kommt, verstärkt er sich auf dem Weg nach vorn. Diese Welle drückt die ersten über ihre eigene Grenze, sie lässt sie stolpern, sie lässt sie das Gleichgewicht verlieren. In diesem Moment steigt die Stimme eines Tieres oft in die Höhe, schneidet durch den Lärm wie ein Draht. Es ist kein Ruf nach Hilfe, denn Hilfe ist kein Begriff in dieser Welt. Es ist ein Ausdruck purer Überforderung. Ein solcher Laut bleibt in Köpfen haften, die sich dagegen wehren. Er frisst sich durch Schutzschichten. Wer ihn einmal bewusst gehört hat, hört ihn in der Stille wieder.
Angst hat auch eine Farbe. Nicht die Farbe, die das Auge sieht, sondern die Farbe, die der Geist benennt, wenn er keine Worte findet. Es ist das matte Grau eines Gangs, der nie ganz trocken wird. Es ist das gebrochene Weiß eines Neonlichts, das jede Pore sichtbar macht. Es ist das stumpfe Rot von Anzeigen, die blinken, als ob sie etwas sehr Wichtiges mitteilen würden, während sie nur den Takt sichern. Wer lange in dieser Farbe arbeitet, verändert sein Verhältnis zu Wahrnehmung. Er filtert anders, er sortiert anders, er nennt Dinge bei anderen Namen, um sie ertragen zu können. Die Tiere haben dafür keine Wörter. Sie haben die unmittelbare Reaktion. Ein Kopf fährt hoch, ein Körper friert, ein Fuß setzt einen halben Schritt zurück. Diese Mikrobewegungen sind die Sprache der Angst.
In Transportern ist Angst lauter. Der Wagen schaukelt, er bremst, er beschleunigt, er nimmt Kurven. Die Wände sind nah, die Decke ist niedrig, der Boden ist uneben. Selbst wenn die Luft durch Schlitze strömt, bleibt sie alt, weil sie den Atem vieler Körper enthält. In dieser Luft hängen Nachrichten, die kein Mensch abschaltet. Sie sagen, dass hier eine Gruppe gefangen ist, die sich aneinander wärmt, ohne sich wärmen zu wollen. Ist es warm, entzieht die Luft dem Körper die Kraft. Ist es kalt, sticht sie in Nase und Lunge. Der Wechsel zwischen beidem kann innerhalb einer Stunde geschehen, je nach Jahreszeit, je nach Strecke, je nach Wartezeit an der Rampe. Die Tiere kennen die Uhren der Menschen nicht. Sie kennen den Wechsel der Zustände.
Wenn die Tiere in die Halle treten, stehen sie nicht mehr in der Unsicherheit des Transporters, sondern in der Gewissheit einer Struktur, die sie nicht kennen. Die Halle spricht eine Sprache aus Linien, Geländern, Gittern, Stufen, Türen. Diese Sprache ist klar für alle, die sie erfunden haben. Für die Tiere ist sie ein Labyrinth ohne Ausweg. Jeder Gang führt in einen