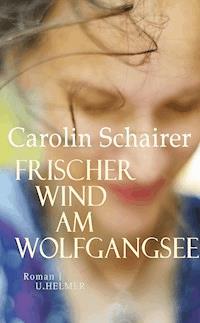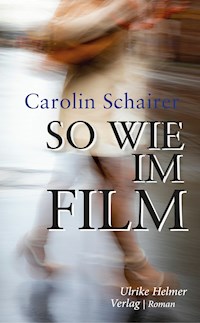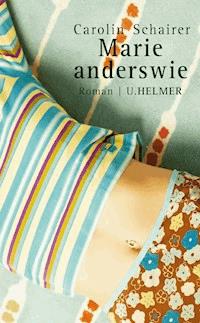16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ulrike Helmer Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Lucia ist Mitte zwanzig, saß aber für längere Zeit im Gefängnis. Kaum entlassen, begegnet sie ausgerechnet ihrem früheren Opfer … Lucia findet einen neuen Job – und trifft ausgerechnet auf Romy. Die beiden Frauen verband einmal eine tiefe Zuneigung – doch dann entspann sich ein Drama um ein Gemälde, das Romys Vater, einen Galeristen, in den Ruin und Lucias Mutter sogar zu noch weit Schlimmerem trieb. Zögernd beginnen die beiden Frauen ihre gemeinsame Geschichte zu ergründen. Dabei müssen beide über ihren Schatten springen und nehmen sich vor, unbedingt sachlich zu bleiben. Dies ist jedoch ein Vorsatz, der zunehmend schwerer fällt, weil (zumindest hier) zusammenfindet, was zusammengehört …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 407
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Carolin Schairer
FLUSS MITZWEI BRÜCKEN
Roman
ISBN (eBook) 978-3-89741-963-6
ISBN (Print) 978-3-89741-411-2
© 2018 eBook nach der Originalausgabe
© 2018 Copyright Ulrike Helmer Verlag, Roßdorf
Alle Rechte vorbehalten
Covergestaltung: Atelier KatarinaS / NL
unter Verwendung des Fotos »Wet«
© Tinvo / photocase.de
Ulrike Helmer Verlag
Blütenweg 29, 64380 Roßdorf
E-Mail: [email protected]
www.ulrike-helmer-verlag.de
Inhalt
Ein neuer Anfang
Offene Fragen
Schicksalshafte Begegnung
Rückkehr nach Wien
Zeugen der Vergangenheit
Scharfsinnige Entdeckungen
Nuancen im Gold
Erhärteter Verdacht
Stärker als Verdrängung
Eine florentinische Nacht
Villa La Palla
Was zusammenfindet, immer wieder
Neue Wendungen
Zeit für Entscheidungen
Im Alleingang
Blutiges Finale
Fluss mit zwei Brücken
Über den Autor
Ein neuer Anfang
Der schwarze Wollmantel war zu warm, viel zu warm. Lucia fühlte, wie es unter ihren Achseln feucht wurde, und begann um ihre Bluse zu fürchten. Sie hatte nicht damit gerechnet, dass das Thermometer schon morgens über fünfzehn Grad klettern würde, immerhin war es erst Ende März und auf den Bergen lag noch Schnee.
Mit schnellen Schritten hastete sie die schmale Goldgasse entlang. Die wenigen Touristen, die so früh bereits unterwegs waren und die Auslagen der noch geschlossenen Geschäfte betrachteten, nahm sie kaum zur Kenntnis. Sie war knapp dran. Der Zug war mit Verspätung am Salzburger Hauptbahnhof angekommen; danach hatte sie nicht gleich den richtigen Bus in die Innenstadt gefunden. Zwar hätte sie den Weg wohl in derselben Zeit auch zu Fuß bewältigen können, doch selbst der Stadtplan, den sie bei sich führte, hatte ihre Ortskenntnisse nicht in Sicherheit gewogen. Ihr letzter Salzburg-Aufenthalt lag mehr als ein Jahrzehnt zurück.
Eine Welle der Erleichterung flutete nun durch Lucias Körper, als sie das kunstvoll geschmiedete Schild des Hotels entdeckte. Die wenigen Sonnenstrahlen, die in die ansonsten dunkle Gasse fielen, tauchten den gusseisernen Vogel in ein warmes Licht und brachten ihn zum Leuchten. Goldener Fasan.
Sie erinnerte sich an die Anweisungen, die man ihr vorab erteilt hatte, und ging am Haupteingang zum Restaurant vorbei, durch den kleinen Torbogen. Links gab es eine schlichte Tür mit Klingelknöpfen. Hotel Goldener Fasan, Lieferanten, Privat. Lucias Hand zitterte leicht, als sie auf Lieferanten drückte.
Sie hasste Situationen wie diese. Sich vorstellen und unbequeme Fragen beantworten zu müssen. Aber sie wollte diesen Job, wollte endlich weg aus Niederösterreich, irgendwohin, wo es wenig Erinnerungen an die Vergangenheit gab. Kurz hatte sie mit dem Gedanken gespielt, nach Deutschland zu gehen, doch das war zu weit weg, um Dani regelmäßig zu treffen, und so war die Wahl auf Salzburg gefallen. Die Stelle als Chef de Rang im Hauben-Restaurant eines Traditionshauses wie dem Goldenen Fasan klang zudem nach einer weiteren Stufe auf der Karriereleiter.
Ein stattlicher Herr in weinroter Weste und dunkler Hose öffnete ihr die Tür.
»Lucia Starl? – Pünktlich auf die Minute. Das wird der Chefin gefallen.«
Der Grauhaarige schickte seinen Worten ein freundliches Lächeln hinterher. Lucia reichte ihm die Hand. Sein Händedruck war angenehm fest und beruhigend. Sie fühlte sich gleich besser und folgte dem Mann durch den Gang. Als sie an der Küche vorbeikamen, streifte sie der verlockende Duft von gebratenem Fleisch und Gewürzen.
Die Gaststube befand sich in einem Gewölbekeller. Lucia ließ ihre Augen durch den Raum wandern. Schätzungsweise bis zu sechzig Gäste hatten hier Platz; das Mobiliar war aus Zirbenholz, schlicht und modern. Die weißen Tischtücher und weinroten Polster auf den Stühlen verliehen dem Ambiente eine edle Note. Die Tische waren bereits eingedeckt; es gab Besteck, jeweils ein Wein- und ein Wasserglas sowie weinrote Stoffservietten mit einem goldenen Fasan. Links neben der perfekt ins Ambiente eingepassten Schanktheke standen auf einer Erhöhung zwei größere Bartische.
Ihr grauhaariger Begleiter steuerte direkt darauf zu. Lucia erkannte die Dame, die sich nun erhob und ihr freundlich die Hand entgegenstreckte, sofort als die Chefin des Hauses. Sie sah genauso aus wie auf dem Foto auf der Website: eine elegante Frau um die fünfzig mit mittelblondem Haar, zu einem Dutt am Hinterkopf frisiert, das feine Gesicht dezent geschminkt. Sie trug einen Raulederrock und dazu ein Leinensakko im Trachtenstil.
»Guten Morgen. Yvette Bruckner. Meinen Restaurantleiter Hans Obermoser haben Sie ja bereits kennengelernt. – Bitte, setzen Sie sich doch.«
Ihre Stimme klang herzlich und angenehm. Dennoch, als Lucia nun Platz nahm, kehrte die innere Anspannung zurück. Vor der Chefin des Hauses lagen immerhin ihre Bewerbungsunterlagen.
»Darf ich Ihnen einen Kaffee anbieten?«
Lucia, die inzwischen ihren Mantel abgelegt hatte, überkam eine jähe Sorge. Was, wenn auf dem roséfarbenen Blazer, den sie über der verschwitzten Bluse trug, Flecken sichtbar wären? Dass ihr Yvette Bruckner eine Frage gestellt hatte, begriff sie daher erst, als sie deren wartenden Blick auf sich ruhen fühlte.
»Wasser«, sagte sie hastig, korrigierte sich dann aber: »Ein Glas Wasser wäre mir lieber, wenn das möglich ist.«
»Selbstverständlich.«
Der Restaurantleiter schnippte mit den Fingern, und wie aus dem Nichts tauchte ein junger Bursche auf.
»Max, für die junge Dame bitte ein Mineralwasser.«
»Sehr wohl.«
»Hatten Sie eine angenehme Anreise?«
Yvette Bruckner sandte ihr erneut ein freundliches Lächeln, blätterte aber gleich schon im Lebenslauf.
Lucia setzte an, um etwas auf die Höflichkeitsfrage zu antworten, doch ihre Stimme versagte. Erst nachdem sie sich geräuspert hatte, brachte sie ein »Ja, danke« über die Lippen.
Lucia, du wirst das schaffen! Denk einfach an alles, was wir besprochen haben …
Im Geiste hörte sie die Stimme von Frau Schneider – nein:
Nenn mich Ilse. Jetzt stehen wir ja in keinem beruflichen Verhältnis mehr miteinander.
Berufliches Verhältnis. Ilse konnte gut mit Worten umgehen. In Wahrheit war sie die Sozialarbeiterin und Lucia ihr Schützling gewesen, und das über drei Jahre. Als es keine Auflage mehr gab, sich regelmäßig mit der Sozialpädagogin zu treffen, war Lucia frei, zu gehen, wohin auch immer sie wollte. Und so hatte sie sich nach einem Job umgesehen, weit weg von Niederösterreich. Wo niemand etwas über ihre Vergangenheit wusste.
Genau das machte sie nervös: Den Spagat zwischen Wahrheit und Notlüge zu schaffen, ohne sich dabei zu verzetteln.
»Es haben sich einige auf diese Stelle beworben«, eröffnete Yvette Bruckner nun ohne Umschweife das Bewerbungsgespräch. »Der vielkolportierte Personalmangel in der Gastronomie ist keine Sache, die uns im größeren Ausmaße betrifft. Unser Haus gehört, wie Sie wissen, zu den renommiertesten Adressen in Salzburg und blickt auf eine lange Tradition zurück. Wir haben erlesene Gäste. Internationales Publikum. Darunter Adelige, Großindustrielle, Prominente aus allen Bereichen. Wir zahlen gut, erwarten aber auch überdurchschnittlichen Einsatz.«
Sie machte eine Pause, als der Bursche mit dem Wasser kam, und fuhr erst fort, als er sich außer Hörweite begeben hatte.
»Wir wollten Sie kennenlernen, weil Ihr Lebenslauf … nun ja … für unsere Branche eher ungewöhnlich ist. Und natürlich auch deshalb, weil Ihr letzter Arbeitgeber Ihnen ein phänomenales Arbeitszeugnis ausgestellt hat. Der Retthof in Puchberg muss ja ausgesprochen enttäuscht gewesen sein, eine so fleißige und qualifizierte Kraft wie Sie zu verlieren!«
Im ersten Moment suchte Lucia eine Spur von Ironie in den Worten der Frau. Vergebens. Sollte sie etwas darauf erwidern? »Ja, es wurde allgemein bedauert«, sagte sie schließlich wahrheitsgemäß. »Aber auch verstanden.«
»Weshalb verstanden?«
»Weil es keine Entwicklungsmöglichkeiten für mich gab. Ich war dort als Commis de Rang, und alle höheren Positionen lagen fest in Familienhand. Ich konnte nicht aufsteigen.«
»Also, ich würde auch gerne weiterhin Restaurantleiter bleiben«, schaltete sich Obermoser ein, der das Gespräch bisher nur schweigend verfolgt hatte. Er schmunzelte bei seinen Worten. Lucia stieg dennoch die Röte ins Gesicht. Jetzt meinte er womöglich, sie wolle künftig an seinem Stuhl sägen!
Sie suchte bereits nach klärenden Worten, als Yvette Bruckner auch schon weitersprach: »Auch der Goldene Fasan ist ein Familienbetrieb. Sämtliche Entscheidungsbefugnisse und das gesamte Finanzmanagement liegen in meiner Hand. Ich bin die Inhaberin. Und ich bin Geschäftsfrau.«
Lucia schwieg zunehmend verwirrt. Sie hatte nicht vor, der Bruckner in irgendeiner Weise ihre Eigentümerrechte streitig zu machen.
»Aber jetzt zurück zu Ihnen.« Der äußerst bestimmte Gesichtsausdruck der eleganten Dame wurde wieder weicher. »Ichrem Lebenslauf nach waren Sie auf dem Juneum, einem privaten Musikgymnasium in Wien. Bis zur fünften Klasse Oberstufe. Danach sind Sie nach Niederösterreich umgezogen, haben den Hauptschulabschluss gemacht und dann eine Ausbildung zur Restaurantfachfrau. – Sie verstehen sicher, dass das Fragen aufwirft. Ich bin seit mehr als dreißig Jahren in der Gastronomie, und in all diesen Jahren ist mir noch keine einzige Servicekraft untergekommen, die auf einer renommierten Privatschule war.«
Denk an das, was wir besprochen haben!
Ilse Schneiders Worte hallten in Lucia wider. Sie fuhr sich mit der Zunge über die trockenen Lippen.
»Meine Mutter ist damals unerwartet verstorben. Ich war gerade mal siebzehn. Das hat mich ziemlich aus der Bahn geworfen. Ich konnte mich nicht mehr auf die Schule konzentrieren. Darum bin ich zu Verwandten nach Niederösterreich gezogen, und der Hauptschulabschluss war das am schnellsten erreichbare Ziel. Die Laufbahn in der Gastronomie hat sich dann beinahe von selbst ergeben.«
»Was ist mit Ihrem Vater? – Sie haben zu Ihren Eltern ja leider keine Angaben gemacht.«
Lucia rang sich ein Lächeln ab.
»Meine Mutter war ab meinem neunten Lebensjahr alleinerziehend; ich hatte zu meinem Vater nie ein enges Verhältnis. Er war daher keine Option.«
»Das alles muss einen ziemlichen Einschnitt in Ihr Leben bedeutet haben.«
Mehr, als sich ein Mensch vorstellen kann, ging es Lucia durch den Kopf. Laut sagte sie: »Ja, natürlich. Aber es kommt im Leben eben manchmal anders, als man denkt, und man muss wohl das Beste daraus machen.«
»Und die Gastronomie ist eindeutig das Beste für Sie, Ihrer Meinung nach?« Ein fragender Blick, der auf ihr ruhte.
Lucias Kehle wurde immer trockener. Sie sehnte sich nach einem Schluck Wasser, wollte aber nicht nach dem Glas greifen. Das Zittern hätte ihre Nervosität verraten.
»Ja, ich …«, begann sie schließlich, doch Yvette Bruckner fiel ihr ins Wort.
»Was ist mit Ihrem Instrument? Spielen Sie das noch?«
Lucia wurde es erst heiß, dann kalt. Die Eiseskälte fraß sich durch ihren Unterleib bis zum Herzen und drückte es schmerzhaft zusammen. Sie rang nach Luft, während sie sich gleichzeitig zur Ruhe zwang.
Eine naheliegende Frage angesichts der Angabe des Juneums in ihrem Lebenslauf. Wer dieses Gymnasium besuchte, spielte schließlich ein Instrument, und das auf höherem Niveau. Das Konservatorium und ihr dort bereits in jungen Jahren aufgenommenes Studium hatte sie in Abstimmung mit Ilse Schneider vorsorglich ganz aus dem Lebenslauf herausgelassen, um die Erklärungen nicht noch komplexer zu machen.
»Klavier«, sagte sie und bemühte sich um eine feste Stimme. »Es ist Klavier gewesen. Aber ich spiele nicht mehr.«
»Wie schade.« Yvette Bruckner legte das Blatt Papier mit ihren Angaben zur Seite. »Als Hobby wäre es ja auch noch nett, oder nicht?«
Lucia hatte nicht den Eindruck, dass die Gastronomin eine Antwort erwartete, daher schwieg sie. Zumindest hatte sie ihren Körper nun so weit unter Kontrolle, um zum Wasserglas greifen zu können. Vorsichtig führte sie es an die Lippen.
»Wie sieht es mit Fremdsprachenkenntnissen aus? Englisch ist hier ein absolutes Muss!«
»Das ist kein Problem.«
»Französisch?«
»Ausreichend für den Gastronomiebereich.«
»Italienisch?«
»Perfekt.«
Yvette Bruckner hob die Augenbrauen, sichtlich überrascht. Dann schien ihr ein Licht aufzugehen.
»Richtig, in den ersten Schuljahren waren Sie in Italien. Und Ihr Name, Ihr dunkles Haar. Sie haben italienische Wurzeln.«
»Mein Vater ist Italiener.«
Kaum war es ausgesprochen, biss sie sich auf die Lippen.
Zu viel Information. Oder doch nicht?
Die Chefin des Hauses lächelte.
»Da haben wir fast etwas gemeinsam – auch ich habe ja einen für österreichische Verhältnisse eher außergewöhnlichen Vornamen. Yvette. Meine Mutter war Französin.«
Quasi übergangslos legte sie Lucia dann ihren Aufgabenbereich in einer Ausführlichkeit dar, die keinen Zweifel offenließ, dass sie in ihr den zukünftigen Chef de Rang des Goldenen Fasan sah. Da der Lebenslauf offensichtlich kein Thema mehr war, fand Lucia allmählich zu ihrem Selbstvertrauen zurück. Sie stellte Fragen, brachte sich ein.
Das Gehalt lag tatsächlich weit über der tariflichen Vorgabe. Überstunden würden abgegolten, finanziell oder in freien Tagen; letzteres käme jedoch nur in der Nebensaison infrage. Lucia war das egal, sie legte auf Freizeit ohnehin wenig Wert.
Am Ende war klar: Sie hatte den Job.
Noch immer nicht ganz entspannt, setzte sie schließlich ihre Unterschrift unter den von Yvette Bruckner bereits unterschriebenen Vertrag.
»Wenn Sie Hilfe brauchen, eine günstige Bleibe zu ergattern, lassen Sie es mich wissen«, sagte die künftige Chefin abschließend. »Ich könnte da sicher etwas möglich machen.«
Lucia bedankte sich höflich. Ihr Privatleben wollte sie strikt von der Arbeit getrennt wissen. Dennoch empfand sie die angebotene Unterstützung als sehr entgegenkommend.
Sie reichte ihren neuen Vorgesetzten zum Abschied die Hand.
»Ein bildhübsches Mädchen«, hörte sie Hans Obermoser im Restaurantbereich zu Yvette Bruckner sagen, als sie schon fast beim Ausgang war.
»Kein Mädchen. Mit fünfundzwanzig ist man eine Frau«, erwiderte diese darauf, und Lucia war ihr noch im selben Augenblick dankbar für diese Klarstellung. Ein Mädchen war sie lang genug gewesen. Eines von vielen in der Justizvollzugsanstalt Schwarzau, in der sie schneller erwachsen hatte werden müssen, als ihr lieb war.
Den Mantel im Arm, verließ sie um kurz vor halb elf den Goldenen Fasan. Inzwischen hatte die Sonne ihren Weg in die Gasse gefunden. Die Geschäfte waren geöffnet. Touristen schlenderten umher, machten Fotos von den barocken Gebäuden, lachten, unterhielten sich in allen möglichen Sprachen. Einheimische hasteten mit prall gefüllten Einkaufstüten vom Grünmarkt an ihr vorbei.
Lucia atmete tief durch.
Sie war jetzt nicht nur erwachsen, sondern auch in Freiheit. Ohne Gitter, ohne soziale Wohngruppe, in der sie die Jahre nach der Entlassung verbracht hatte, während sie im Retthof ihrer Arbeit nachging. Es war höchste Zeit, einen endgültigen Strich unter die Vergangenheit zu ziehen.
Ann-Kathrin saß mit einer Freundin am Tisch, als Lucia die Küche betrat, Dani mit ihrem dicken Rucksack im Schlepptau. An ihnen vorbeizugehen war unvermeidlich – Lucias Zimmer war nur von der Küche aus begehbar.
Die beiden, nur geringfügig jünger als Lucia selbst, unterbrachen ihr Gespräch mitten im Satz und starrten Dani an wie ein Wesen von einem anderen Stern. Zu Lucias Unverständnis blieb diese auch noch stehen und starrte zurück. Lucia stand dazwischen, sah von einer zur anderen und musste beinahe lachen, so gegensätzlich waren die Welten, die hier aufeinanderprallten: Dani in zerrissener Jeans, mit raspelkurzen Haaren, Nasenpiercing und den Tätowierungen auf ihren nackten Oberarmen, die zwei Studentinnen der Rechtswissenschaften mit Perlohrringen, Hermès-Tüchlein um den Hals und in taillierten Blazern.
Als dem staunenden Schweigen allmählich Schwere anhaftete, sah sich Lucia bemüßigt, etwas zu sagen.
»Ann-Kathrin, das ist meine Freundin Dani aus Wien; sie bleibt bis morgen zu Besuch.«
Ann-Kathrin, aus gutem Hause, erhob sich doch tatsächlich und reichte Dani wohlerzogen die Hand. Lucia erkannte an dem verräterischen Zucken ihrer Mundwinkel, dass sie dieser Akt der Höflichkeit eine gewisse Überwindung kostete.
»Nett, dich kennenzulernen. – Das ist Sophie, sie studiert mit mir.« Die Worte klangen in Lucias Ohren schal.
Sophie machte aus ihrer Abneigung keinen Hehl. Sie blieb sitzen und verzog lediglich den Mund zu einer Art Lächeln.
Lucia, die keinen Grund sah, die Begegnung noch länger auszudehnen, öffnete ihre Zimmertüre und gab Dani mit einer Kopfbewegung zu verstehen, dass sie ihr rasch folgen sollte.
Augenblicke später waren sie allein und die Türe zur Küche geschlossen.
»Hej, echt, die studieren? Wohnen die beide hier?«
Dani stellte die Fragen, während sie sich neugierig in Lucias neuer Bleibe umsah. In dem sechzehn Quadratmeter großen Raum gab es nicht viel zu entdecken: Schrank, Schreibtisch mit Stuhl, ein fast leeres Regal und ein Bett, alles aus Sperrholz, weiß lackiert. Das war es. Lucia hatte in den zwei Wochen, in denen sie hier wohnte, weder Zeit noch Muße gefunden, sich mit der wohnlichen Ausgestaltung eines Zimmers zu beschäftigen, in dem sie sich fast nur zum Schlafen aufhielt.
Dani ging zum Fenster.
»Die Aussicht ist ja nicht so cool«, stellte sie fest. »Ein Schrottplatz?«
»Eigentlich eine Werkstatt.«
»Ist das nicht recht laut, wenn die da arbeiten?«
Lucia hob die Schultern.
»Bisher habe ich noch nichts mitbekommen von dem, was da gemacht wird.«
Dani nahm neben ihr auf dem Bett Platz.
»Das sind schon zwei ziemliche Tussen, oder?«
Reflexartig legte Lucia den Finger auf ihre Lippen. »Nicht so laut«, flüsterte sie. »Durch die Tür hört man jedes Wort.«
»Also, ich höre die beiden im Augenblick gar nicht«, wisperte Dani zurück.
»Entweder sie flüstern auch oder sie lauschen.«
»Oh Gott.« In gespielter Erschöpfung ließ Dani sich nach hinten auf das Bettzeug kippen. »Wie hältst du das aus? Warum wohnst du nicht alleine? Das wolltest du doch immer.«
»Die Mieten sind hier extrem teuer, es herrscht Wohnungsnot in Salzburg.«
»Du hättest eben doch mit mir nach Wien kommen sollen. Da ist es mit der Wohnungssuche recht einfach.«
Lucia straffte die Schultern. »Die Diskussion hatten wir bereits.«
Dani setzte sich auf und legte ihr die Hand auf den Oberarm.
»Du musst ja nicht in den Ersten Bezirk fahren und dorthin gehen, wo es passiert ist. Wien ist groß.«
»Dani, bitte …« Lucia schüttelte gequält den Kopf. »Ich werde nie wieder in Wien wohnen. Ich werde nicht einmal mehr hinfahren. Und ich will auch nicht darüber reden.«
Einen Moment lang herrschte Schweigen.
»Schau mal, das habe ich neu stechen lassen.« Stolz deutete Dani auf ein schwarzgrünes Gebilde auf ihrem rechten Oberarm. Lucia brauchte ein paar Sekunden, um zu erkennen, was es sein sollte: offenbar eine Meerjungfrau. »Cool, oder?«
»Wird es allmählich nicht zu viel? – Deine ganzen Arme sind inzwischen voll davon!«
»Nein, da ist schon noch Platz. Und wenn, mache ich am Oberkörper weiter … Dir gefällt es nicht, oder?«
»Nein«, gab Lucia ohne Umschweife zu. Wenn sie ehrlich war, gefiel ihr Danis Veränderung insgesamt nicht. Seit ihre Freundin vor einem Jahr nach Wien gezogen war, hatte sie nach und nach ihr nettes Aussehen ab-, dafür an Gewicht zugelegt und sich in eine Frau verwandelt, die ihren Körper immer mehr verunstaltete. Einem Tattoo folgte das nächste. Die neueste Leidenschaft waren Piercings. Auch wenn es im Gesicht bisher nur bei einem Nasenring geblieben war – Danis Ohrläppchen zierten Stanzlöcher, und statt dezenter Stecker trug sie Ohrschmuck, der Lucia an Zubehör aus dem Baumarkt erinnerte. Als sie vor rund einem Monat miteinander geschlafen hatten, war sie zudem mit den Haaren in der kleinen Doppelaxt hängen geblieben, die in Danis Bauchnabel steckte.
»Dein kleines Tattoo auf der Schulter fand ich nett und ein Nasenstecker kann auch gut aussehen. Aber ich finde, das, was du da machst, ist echt zu viel.«
Lucia ahnte bereits, was die Freundin darauf erwidern würde.
»In Wien in der Szene laufen alle so herum! Ich will da endlich dazugehören. Da sind so coole, sexy Mädels!« Sie brach mitten im Satz ab, als ihr bewusst wurde, was ihr da über die Lippen gekommen war. »Sorry, ich wollte nicht …«
»Schon gut.« Lucia strich sich eine Haarsträhne aus dem Gesicht. »Das ist ja genau der Grund, weshalb ich sagte, wir sollen es miteinander lieber locker nehmen.«
»Ich will einfach nur ein paar Sachen ausprobieren. Aber ich liebe dich!«
Dani nahm ihre Hand. Die Berührung fühlte sich warm und vertraut an. Lucia unterdrückte ein Seufzen.
»Ich weiß.«
»Später will ich mit dir zusammenwohnen, eine echte Beziehung. So wie in Schwarzau. Das hat doch gut geklappt mit uns.«
Eine Zwangsgemeinschaft auf zehn Quadratmetern, aus der erst Freundschaft und schließlich so etwas wie Liebe wurde. Knapp zweieinhalb Jahre hatten sie auf diese Weise miteinander verbracht. Dann war Dani entlassen und in St. Pölten in einer sozialen Wohngemeinschaft untergebracht worden. Sie hatte Lucia besucht, aber Intimitäten waren nun nicht mehr möglich, und Lucia fühlte von Besuch zu Besuch mehr, wie eine Kluft zwischen ihnen entstand.
Als auch sie schließlich das Gefängnis verließ und in Puchberg am Schneeberg eine Stelle bekam, lebte das Verhältnis mit Dani noch einmal für kurze Zeit auf. Regelmäßige Treffen scheiterten jedoch nicht nur an der geographischen Distanz, sondern vor allem an ihren Arbeitszeiten, die sich schwer abstimmen ließen. Dani, die in der Justizvollzugsanstalt ebenfalls eine Lehre als Restaurantfachfrau abgeschlossen hatte, war in St. Pölten in einem Stadtbeisl untergekommen, während Lucia in der Vier-Sterne-Gastronomie arbeitete und entsprechend eingespannt war.
Als Dani schließlich entschied, nach Wien zu ziehen, sah Lucia der Realität ins Auge: Künftig würden sie sich noch weniger sehen. Sie selbst ginge keinesfalls nach Wien, nicht einmal zu Besuch. Aus diesem Grund hatte sie Dani vorgeschlagen, sich zu trennen, ehe es Tränen gäbe. Die Tränen waren dennoch geflossen, weil Dani an ihr festhielt. Eine Familie, die für sie da war, besaßen beide nicht; doch Lucia hatte erkennen müssen, dass die zwei Jahre jüngere Dani in ihr nicht nur die Geliebte, sondern auch eine Art Ersatzmutter sah. Der Altersunterschied gewann plötzlich an Gewicht – ein Gewicht, dass Lucia nicht tragen wollte. Weshalb sie schließlich eine Art offene Beziehung ohne Verpflichtungen vorschlug. Seither lief ihr Verhältnis auf Sparflamme.
Und so war es auch an diesem Montag, den sie miteinander verbrachten. Lucia zeigte Dani die Stadt, wobei sie bewusst einen weiten Bogen um die Goldgasse machte. Auf Danis Wunsch hin besuchten sie abends schließlich die einzige Bar, die als Homosexuellentreffpunkt galt – um zu erkennen, dass sich dort nur zwei, drei Schwule am Tresen tummelten und ansonsten tote Hose herrschte. Für Dani stand danach fest, dass Salzburg die größte Fehlentscheidung war, die Lucia hatte treffen können.
Nachts schliefen sie miteinander. Lucia wollte es so, trotz der Piercings, trotz der Tattoos, trotz Danis aufgesetztem Männlichkeitsgehabe, dass sie an diesem Abend mit einem Mal zur Schau gestellt hatte. Das Neunzig-Zentimeter-Bett machte es ohnehin unmöglich, sich nicht zu berühren, und die nackte Haut weckte Lucias Lust aus dem Winterschlaf. Zudem war sie überzeugt, dass sich hier für lange Zeit die letzte Gelegenheit bot, Sex zu haben. So bald würde Dani nicht wieder nach Salzburg kommen.
»Können wir mal kurz miteinander reden?«
Ann-Kathrin saß mit ernstem Gesicht am Tisch, als Lucia ihr Zimmer verließ. Der dampfende Kaffee in der großen Tasse vor ihr füllte das Zimmer mit seinem aromatischen Duft. Im Hintergrund spielte das Radio einen Hit, der seit Monaten in den Charts stand und den Lucia kaum mehr hören konnte.
Vor rund zwei Stunden hatte sie Dani zum Bahnhof gebracht. Beim Abschied hatte die Freundin geweint, der Grund war nicht aus ihr herauszubekommen gewesen. Sie wisse es selbst nicht genau, hatte Dani immer wieder gesagt.
Der Abschied hinterließ Lucia ziemlich aufgewühlt.
Zurück in der Wohnung, war sie gleich in den schwarzen Rock geschlüpft und hatte die weinrote Weste über die weiße Bluse gezogen. Die Dienstkleidung wurde vom Goldenen Fasan zur Verfügung gestellt. Ihr Dienst begann erst in einer Stunde, doch sie hatte sich angewöhnt, früher da zu sein.
Ann-Kathrins Frage, die nach mehr klang als nach einer einfachen Antwort, durchkreuzte ihren Plan. Der Ton verriet, dass es sich nur um eine unangenehme Angelegenheit handeln konnte. Besser, sie brachte das gleich hinter sich.
Im Geiste ging sie kurz die Liste möglicher Konfliktpunkte durch. Der Putzplan war es nicht. Sie hatte ihn in der vergangenen Woche penibel eingehalten, jetzt war Ann-Kathrin an der Reihe. Schmutziges Geschirr im Spülbecken gab es von ihr aus nie, sie aß grundsätzlich nur im Goldenen Fasan, wo man eine warme Mahlzeit während der Dienstzeit stellte. An freien Tagen, deren Anzahl sie bewusst gering hielt, besorgte sie sich eine Pizzaschnitte. Also blieb nur noch ein Punkt. –
Während ihrer Zeit in Schwarzau hatte sie sich angewöhnt, keine voreiligen Schlüsse zu ziehen, sondern abzuwarten.
Mit undurchdringlicher Miene ließ sie sich Ann-Kathrin gegenüber am Tisch nieder.
»Im Großen und Ganzen klappt unser Zusammenleben ja ziemlich gut«, begann die Mitbewohnerin, während sie gleichzeitig eifrig in ihrer Kaffeetasse rührte. Der Löffel schlug gegen das Porzellan und brachte es zum Klingen. In Lucias Kopf hörte sich das fast an wie das Schrillen von Alarmglocken. »Ich meine, du … bist sauber, leise, gewissenhaft … Ich hatte echt anfangs Bedenken, tja, weil … du bist nur Kellnerin und ich studiere, da besteht schon ein gewisser Unterschied. Aber du bemühst dich wirklich, die Regeln unserer WG zu befolgen.«
Lucia verschränkte die Arme vor der Brust. Sie verzog keine Miene. Ann-Kathrin schien darauf zu warten, dass sie etwas erwiderte. Den Gefallen tat sie ihr nicht. In den vergangenen Jahren hatte sie gelernt, ihre Emotionen zu kontrollieren und darauf zu warten, dass andere das Wort ergriffen, ehe sie sich unbedacht äußerte.
»Es ist nur … wegen deiner Freundin«, nahm die Studentin den Faden wieder auf, als sie realisierte, dass von Lucias Seite nichts kommen würde. Sie atmete tief durch. »Also, ich habe euch gestern Nacht gehört. Die Wohnung ist ziemlich, hmm, hellhörig.«
Lucia blinzelte.
Aha, daher wehte der Wind.
»Es ist nicht so, dass ich etwas gegen Lesben hätte.«
Nein, nein. Natürlich nicht.
Lucia sah ihr Gegenüber abwartend an.
»Es ist wegen … dieser Dani.« Ann-Kathrin atmete nochmals tief durch. »Sie sieht jetzt zwar anders aus, aber Sophie hat sie eindeutig erkannt. Als Schülerin nahm ihre Klasse mal bei einem Prozess teil, als Zuschauer. Es ging um Raubüberfälle. Diese Dani war eine der Angeklagten, sie wurde zu Jugendarrest verurteilt. In anderen Worten: Deine Freundin ist eine vorbestrafte Kriminelle. Wusstest du das?«
Lucia fühlte, dass ihre Handflächen nass wurden.
»Dani bereut, was sie getan hat«, sagte sie mit fester Stimme. »Und sie hat für ihre Taten gebüßt. Sie ist nicht mehr die, die sie mit sechzehn war.«
»Du wusstest es also.« Ann-Kathrin nickte bedächtig, schien nachzudenken. Nach einer Weile hob sie den Kopf. »Jedenfalls, es tut mir leid, aber ich möchte sie nicht mehr in der Wohnung haben. Ich finde es wirklich süß, dass du zu ihr hältst, aber ehrlich gesagt, ist es auch reichlich naiv von dir. Die Tatsache, dass sie für ihre Vergehen bestraft wurde, macht sie doch nicht zu einem besseren Menschen. Einmal Täter, immer Täter. Wer andere Leute angreift, ihnen bewusst körperlichen und seelischen Schaden zufügt, kann keinen guten Kern haben.«
Lucia betrachtete das makellose, perfekt zurechtgemachte Gesicht der Jus-Studentin. Die wasserblauen Augen spiegelten eine unerbittliche Härte wider, die im klaren Kontrast zu der zart rosafarbenen Bluse stand. Sie konnte sich Ann-Kathrin sehr gut als künftige Staatsanwältin vorstellen.
»Ich muss zur Arbeit.« Lucia erhob sich. »Mein Dienst beginnt bald.«
»Wir sind uns also einig, richtig? Du wirst sie nicht mehr mit hierher bringen?«
»Sie wird so oder so nicht mehr kommen.«
Lucia angelte ihren dünnen Mantel vom Garderobenhaken.
»Ich meine es wirklich nicht böse.« Ann-Kathrin war ihr gefolgt, die Kaffeetasse in beiden Händen. »Aber ich möchte mit solchen Kreisen einfach nichts zu tun haben. Schon gar nicht in meiner Wohnung.« Als Lucia schweigend ihren Mantel überzog, schob sie hinterher: »Außerdem habe ich echten Schmuck. Und mein neues iPhone. Ich will nicht, dass davon etwas wegkommt, weil du solche Leute anschleppst!«
Lucia rang sich ein flüchtiges Lächeln ab. »Mach dir keine Sorgen«, sagte sie mit unbewegter Stimme. »Niemand nimmt dir etwas weg, niemand tut dir etwas an. – Ich muss jetzt wirklich … Bis dann.«
Eilig rannte sie die Treppe hinunter. In ihr brodelte eine Mischung aus Verzweiflung, Wut und Scham.
Ja, im Befolgen von Regeln war sie tatsächlich gut. Erfolgreich war sie darauf trainiert worden, vier bittere Jahre lang. Frau Schneider … Ilse … wäre in dieser Minute stolz auf sie.
Trotzdem. Diese Person war an Arroganz nicht zu überbieten. Ich, die tolle reiche Studentin. Du, die dumme arme Kellnerin. Wunderbar.
Und das Schlimmste war: Ann-Kathrin hatte auch noch recht! Mit allem. Darum hatte sie ihr nicht einmal widersprechen können.
Einmal Täter, immer Täter. Wer andere Leute angreift, ihnen bewusst körperlichen und seelischen Schaden zufügt, kann keinen guten Kern haben.
Lucia, die die Straße entlanggehastet war, hielt inne. Sie war inzwischen im Mirabellgarten angelangt, das Kongressgebäude zur Rechten, die Parkbänke links. Über ihr zwitscherten die Vögel in den Bäumen, obwohl der Himmel grau war.
Bleib ruhig, Lucia.
In Gedanken hörte sie Ilse Schneiders Stimme.
Sie atmete tief durch und ließ sich auf einer freien Bank nieder. Sie musste sich wirklich beruhigen. In derart aufgewühltem Zustand konnte sie nicht den Goldenen Fasan betreten.
Ein schlechter Mensch. Das war auch sie, würde sie immer bleiben. Nichts ließ sich wiedergutmachen, in ihrem Fall.
Ann-Kathrin war eine blöde, arrogante Zicke, zweifelsohne. Aber wer konnte ihr das verübeln? – Die Eltern zahlten die Wohnung, überwiesen großzügig Geld, damit es an nichts fehlte. Und weil Ann-Kathrin noch mehr shoppen wollte, vermietete sie eines der beiden Zimmer ohne Wissen der Eltern unter.
Je länger Lucia darüber nachdachte, desto mehr konnte sie es verstehen. In einem anderen Leben, da wäre sie eine Ann-Kathrin gewesen. Eine Ann-Kathrin hoch drei. Mit Eigentumswohnung, eigenem Auto und einer über alle Maßen guten Gage.
Alles hatte auf eine glanzvolle Karriere hingedeutet.
Aber sie hatte die Aussicht auf dieses phantastische Leben in den Sand gesetzt. Damit musste sie sich abfinden.
Mit der bitteren Erkenntnis im Hinterkopf setzte sie ihren Weg in die Goldgasse fort.
Antoni hatte erst vor vier Tagen seinen ersten Arbeitstag im Goldenen Fasan gehabt, aber Lucia erkannte jetzt schon, dass er womöglich nicht lange bleiben würde. Der junge Pole, dessen Herkunft nur ein leichter Akzent verriet, zeichnete sich vor allem darin aus, dass er andere herumdirigierte.
Das Lokal war für einen Abend an einem Werktag gut gefüllt, bis auf zwei Tische war alles besetzt. Lucia, die am Eingang neue Gäste willkommen hieß, zu den Tischen begleitete und Speise- und Weinempfehlungen gab, beobachtete Antoni aus den Augenwinkeln eine ganze Weile, ehe sie beschloss, dass es reichte.
Als die meisten Essen serviert waren, winkte sie ihn abseits der Gäste zu sich.
»Antoni, du bist hier angestellt, um zu arbeiten, nicht um herumzustehen«, kam sie ohne Umschweife zur Sache. »Du bist für die Tische links verantwortlich, das hatten wir geklärt. Aber ich sehe den ganzen Abend dort nur deine Kolleginnen herumrennen.«
»Ich bin auch schon gelaufen. Das kann die Küche bestätigen. Frag doch den Koch. Andrej hat mich gesehen. Aber die Mädchen kennen sich ja gut aus und sie wissen, was zu tun ist.«
»Und du weißt das nicht?« Lucia runzelte die Stirn. »Immerhin hast du eine umfassende Einweisung bekommen!«
Antoni machte ein finsteres Gesicht. »Du musst dich nicht so aufspielen. Ich bin älter als du, ich bin ein Mann und ich war auch schon Chef de Rang, mehrere Jahre.«
»Nun, hier bist du es jedenfalls nicht. Dass du älter bist und ein Mann, ist mir herzlich egal. Ich bin deine Vorgesetzte, ich erteile hier die Anweisungen, und wenn ich dir etwas sage, hast du dieser Aufforderung Folge zu leisten. Ohne Diskussion, verstanden?«
Antonis Hände waren zu Fäusten geballt. Sein blasses Gesicht lief rot an vor unterdrückter Wut. Das bemerkte Lucia trotz der nur schummrigen Beleuchtung. Der kräftige, hochgewachsene Bursche machte einen Schritt auf sie zu.
Sie musste sich zwingen, nicht zurückzuweichen. Wenn sie es tat, hätte sie verloren, das stand fest. Es war nicht das erste Mal, dass sie körperlich von jemandem bedroht wurde, der ihr kräftemäßig überlegen war.
»Bitch«, zischte Antoni und bedachte sie mit einem verächtlichen Blick. »Euch Weiber müsste nur einer richtig …« Er brach mitten im Satz ab. Seine Augen wurden groß, seine Gesichtsfarbe wandelte sich von rot zu weiß.
Lucia begriff erst, dass jemand hinter ihr stand, als sie die sonore Stimme von Hans Obermoser vernahm.
»Bitte, fahr doch fort, mein Freund. Und wiederhol das dann am besten vor der Chefin. Ich bin gespannt, was sie dazu sagt.«
Antoni trat verlegen von einem Fuß auf den anderen. Er wirkte plötzlich wie ein getadelter Schulbub.
»Das war nicht so gemeint«, presste er hervor. »Tschuldigung … ich gehe an die Arbeit.«
Er wollte sich an Lucia vorbeidrängen, doch der Restaurantleiter versperrte ihm den Weg. »Andere Richtung.« Er deutete auf den Hinterausgang. »Deine Dienstkleidung bringst du spätestens in drei Tagen gewaschen und gebügelt vorbei, sonst erstatten wir umgehend Anzeige wegen Diebstahls.«
»Aber …« Der Pole wirkte plötzlich sehr verzweifelt. »Es tut mir wirklich leid! Ich habe es ja nicht so gemeint! Es war nur ein kleiner Spaß, weiter nichts! Das sagt man halt so … Ich habe eine Frau und ein kleines Baby, bitte, ich brauche den Job!«
»Dein Problem«, erwiderte Obermoser ungerührt. »Fehler wie diese dulden wir hier nicht. Da gibt es keine zweite Chance. Und jetzt hau ab!«
Antoni sagte etwas auf Polnisch. Es klang wie ein Fluch. Dann machte er auf dem Absatz kehrt und verschwand.
Lucia wusste nicht recht, was sie sagen sollte. Der Zwischenfall hatte sie aufgewühlt – weniger wegen Antoni, denn sexistische Bemerkungen waren in der Branche keineswegs selten, sondern hauptsächlich wegen Obermosers Auftritt. Es war neu für sie, dass jemand hinter ihr stand. Und es bestürzte sie, mit welcher Härte hier auf Entgleisungen reagiert wurde.
Hans Obermoser klopfte ihr nun auf die Schulter.
»Alles gut«, sagte er. »Jetzt musst du heute Abend etwas mehr zupacken, nachdem ihr nur noch zu dritt seid. Aber gut gemacht. Du lässt dich nicht kleinkriegen, das gefällt mir. Und wenn dir hier wieder einer auf diese Weise blöd kommt, kannst du ihm dasselbe sagen wie ich.«
»Ich hoffe nur, dass Frau Bruckner das genauso sieht.«
»Natürlich sieht sie das so. Zerbrich dir darüber nicht den Kopf. Sie will, dass der Laden läuft, aber sie will ganz sicher keine Idioten in ihrem Restaurant. Und jetzt lach mal. Das tust du nämlich viel zu selten. Immerhin arbeiten wir im Service.«
Mit Mühe brachte Lucia ein Lächeln zustande. Eine zweite Chance gab es nicht. Sie hatte begriffen.
»Das könnte noch ein bisschen überzeugender werden«, schmunzelte der Restaurantleiter. »Oder brauchst du einen Schnaps, damit es besser klappt?«
»O nein, danke. Ich hasse Schnaps!«
Diesmal gelang ihr ein Lächeln, das ihren Vorgesetzten anscheinend zufriedenstellte.
Als Lucia am nächsten Nachmittag zum Dienst erschien, hatte sie den Vorfall mit Antoni bereits hinter sich gelassen. Ann-Kathrin hatte ihr zuvor in der Küche einen Kaffee angeboten und mit ihr über Belanglosigkeiten geplaudert, fast so, als wären sie Freundinnen. Es war nur eine kleine Geste, aber Lucia war darüber erleichtert. Sie wollte mit ihr auskommen. Schließlich war sie im Moment auf diese Wohngemeinschaft angewiesen.
Vor ihrem Umzug nach Salzburg hatte sie sich freilich noch ein paar andere Optionen angeschaut. Doch Einzelwohnungen waren rar und viel zu teuer, und viele WGs nahmen ausschließlich Studenten auf. Außerhalb der Stadt konnte sie aufgrund ihrer Dienstzeiten bis spät in die Nacht hinein nicht wohnen, da sie als Nicht-Autofahrerin auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen war. Die Wohnung hinter dem Bahnhof war somit wirklich die beste Lösung.
Sie wollte gerade ihre Arbeit aufnehmen, als Mara, eine der Kellnerinnen, fast beiläufig sagte: »Ach, du bist schon da … Die Chefin will dich sprechen, im Büro.«
Beklommenheit breitete sich in Lucia aus. Prompt wurden ihre Handflächen wieder feucht, ihr Puls raste. Antoni. Vermutlich hatte sie ihre Kompetenz überschritten. Nun, eigentlich war es ja Obermoser gewesen, der ihn weggeschickt hatte. Aber der Restaurantleiter war jetzt nicht hier, und es wäre nicht das erste Mal in ihrem Leben gewesen, dass sie für etwas einstehen sollte, was nicht sie zu verantworten hatte.
Yvette Bruckner saß hinter einem Computer-Monitor an einem ausladenden, alten Schreibtisch, links von sich ein Regal mit Büchern. In einer Ecke gab es ein dunkelgraues Sofa im Biedermeierstil, einen passenden Sessel und einen kleinen Tisch.
Die Chefin sah auf, als Lucia eintrat, und erhob sich.
»Lucia, wie schön. Bitte, setzen Sie sich doch.«
Sie wies auf das Sofa, und Lucia leistete der Geste Folge.
Trotz der Freundlichkeit, mit der die Frau ihr begegnete, blieb sie skeptisch. Sie stufte die Besitzerin des Goldenen Fasan nicht als eine Person ein, die Kritik laut und unbeherrscht auf ihr Gegenüber einprasseln ließ. Yvette Bruckner war eher der Typ, der sich mit süßem Lächeln nach dem Wohlbefinden erkundigte, während er hinterrücks schon den Dolch in der Hand bereithielt.
Wie ungerecht von mir, ging es Lucia durch den Kopf. Bisher hatte sich die Chefin doch nur liebenswürdig gezeigt.
»Es ist kurz nach drei, und Sie sind schon da. Und das, wo doch Ihre Schicht erst um halb fünf beginnt.«
Aha, das war es also.
»Ich schreibe die Überstunden nicht auf«, stellte sie sofort klar. »Ich bin nur hier, weil …« Egal, letztendlich reichte wohl der erste Satz. Natürlich wollte die Chefin ihr nicht unzählige Überstunden auszahlen oder in Freizeit abgelten.
»Sie sind hier, weil …?«
Yvette Bruckner sah sie abwartend an.
»Weil … es immer etwas zu tun gibt.« Lucia war froh, dass ihr schnell noch eine plausible Begründung eingefallen war.
»Da haben Sie natürlich recht, hier gibt es immer etwas zu tun.« Die Chefin bedachte sie mit einem prüfenden Blick. »Aber das heißt ja nicht, dass Sie das alles tun müssen, oder?«
»Ich arbeite gerne.«
»Das glaube ich Ihnen! Und Sie arbeiten gut. Ich bin sehr zufrieden mit Ihnen. Vom ganzen Team hört man nur Positives. – Allerdings möchte ich, dass es auch so bleibt. Ich will nicht, dass Sie sich jetzt verausgaben und dann wegen Burnout ausfallen, verstehen Sie?«
Lucia verstand nicht. Seit sie in der Gastronomie tätig war, geschah es das allererste Mal, dass sich ein Chef um ihr Wohlergehen sorgte. Dieser Umstand schmeichelte ihr nicht, sondern stürzte sie in Verwirrung. Sie legte die Hände ineinander und wartete schweigend. Einfach nur sitzen und abwarten. Erfahrungsgemäß hielt das kein Gegenüber lange aus und kam zur Sache.
Yvette Bruckner war jedoch anscheinend die Ausnahme von der Regel. Sie saß in ihrem Sessel, ein leichtes Lächeln auf den Lippen, die Hände auf den Stuhllehnen. Die Zeit verstrich. Lucia ließ ihren Blick durch das Zimmer schweifen, vorbei an den Buchrücken im Regal, dem Ficus neben dem Fenster, der alten Stehlampe in der Ecke, zur Decke hinauf. Über ihnen prangte ein großer, vergoldeter Reifenluster mit Stabkerzen.
Dann entdeckte sie das Bild an der Wand gegenüber. In Pastelltönen gehalten, zeigte es zwei Häuser und einen See. Am Bootssteg lag ein Segelschiff, der Mast blank, das Segel zusammengefaltet.
Sergej Anastov Poisson.
Ihr Herz zog sich zusammen, als sie den bekannten Expressionisten als Urheber erkannte. Einen Moment lang hatte sie das Gefühl, keine Luft mehr zu bekommen.
Dann wurde sie sich bewusst, dass Yvette Bruckner sie noch immer beobachtete. Schnell wandte sie den Blick ab. Sie wollte hier raus – so schnell wie möglich.
»Ich bin sicher nicht burnoutgefährdet«, beeilte sie sich zu sagen. »Aber wenn Sie meinen, werde ich meine Anwesenheit hier …«
»Was ich meine, ist: Achten Sie bei einem solch stressigen Job wie dem unseren auf Ausgleich. Tun Sie etwas für sich.« Yvette Bruckner griff in ihre Schreibtischschublade und zog ein längliches Kuvert heraus. »Hier. Ein Geschenk des Hauses, als Dankeschön und Anerkennung für Ihren Einsatz.«
Zögernd ergriff sie den Umschlag. Die Chefin erwartete wohl, dass sie den Inhalt gleich begutachtete.
Schließlich hielt sie zwei Theaterkarten in der Hand. Hochzeit auf Korsisch. Eine Komödie in den Salzburger Kammerspielen, am kommenden Freitagabend.
»Danke, aber das kann ich nicht annehmen.«
Lucia wollte die Karten zurückgeben, doch Yvette Bruckner machte eine abwehrende Handbewegung.
»Nein, ausgeschlossen. Sie gehen da hin und machen sich einen schönen Abend. Basta. Und wenn Sie niemanden kennen, der mitkommen will, dann fragen Sie doch Veronika von der Hotelrezeption. Die hat sich auch eine kleine Belohnung verdient, und obendrein habe ich das Gefühl, Sie beide würden sich gut verstehen. Und nun können Sie die Flucht ergreifen – das wollten Sie ja schon tun, noch ehe Sie hier Platz genommen hatten.«
Yvette Bruckner zwinkerte ihr belustigt zu.
Lucia biss sich auf die Unterlippe. So leicht durchschaut zu werden war genauso neu für sie wie eine Belohnung.
Sie bedankte sich höflich. Auf dem Weg nach draußen versuchte sie, einen detaillierteren Blick auf das kunstvoll gerahmte Bild zu erhaschen. Sie wollte die Signatur sehen, um sicherzugehen, dass sie sich nicht irrte. Doch Yvette Bruckner geleitete sie geschäftig in Richtung Türe.
Je weiter der Tag voranschritt, desto mehr kam Lucia schließlich zu der Überzeugung, dass sie sich geirrt haben musste. Das Bild stammte sicher aus der Feder eines unbekannten Künstlers, der den Stil Poissons imitierte. Yvette Bruckner mochte als Eigentümerin eines gut gehenden Restaurants zwar durchaus wohlhabend sein, aber den Besitz eines echten Poisson traute sie ihr nun doch nicht zu.
Veronika – Vroni – entpuppte sich als eine angenehme Bekanntschaft. Die zierliche junge Frau mit den hellbraunen Locken, die an der Hotelrezeption des Goldenen Fasan arbeitete, wirkte sympathisch und hatte in Lucias Augen trotz ihrer einundzwanzig Jahre etwas Kindliches, Unbeschwertes an sich, ohne dabei dümmlich oder naiv zu wirken.
Vroni wohnte noch bei ihren Eltern in Maria Plein, einem Dorf nördlich von Salzburg. Sie hatte einen älteren Bruder und eine jüngere Schwester. Ihr Vater arbeitete für eine Salzburger Brauerei als Ausfahrer, ihre Mutter in einer Konditorei. Vroni selbst hatte die Tourismusschule besucht; abgesehen von einigen Saisonpraktika im Skigebiet und an den Seen des Salzkammerguts konnte sie an Arbeitserfahrung noch nicht allzu viel aufweisen. Beim Goldenen Fasan arbeiten zu dürfen, empfand sie als große Auszeichnung – ihr erster richtiger Job, und dann gleich in einem so renommierten Betrieb.
Das alles erfuhr Lucia im Laufe des Abends, den sie im Anschluss an die Komödie in den Kammerspielen bei einem Drink in der Steingasse fortsetzten. Je länger sie dort saß und an ihrem Cocktail nippte, desto besser konnte sie sich auf die neue Erfahrung einlassen, in einer Bar zu sein, ohne dort selbst auszuschenken. In Puchberg hatte sie nie den Drang verspürt, sich unter die Landjugend zu mischen, und sich stattdessen in die Arbeit gestürzt. Der Wirt vom dortigen Retthof hatte keinerlei Probleme damit gehabt, dass sie von früh bis spät bediente.
Vroni erzählte gern von sich, und das, ohne dabei zu nerven. Von ihrer Familie, von ihrer Katze Mimi, von ihrem Ex-Freund Franz, der nie Zeit für sie gehabt hatte, weil er lieber Fußball spielte. Lucia entspannte sich zunehmend. Es gefiel ihr, von diesem Leben zu hören, einem normalen Leben, das es so für sie nie wieder geben würde. Aber noch mehr gefiel ihr, dass Vroni sie nicht mit Fragen löcherte, sondern die Häppchen akzeptierte, die Lucia wohlüberlegt servierte.
Irgendwann kamen sie dann doch wieder auf die Arbeit zu sprechen.
»Die Kollegen im Goldenen Fasan sind die nettesten, die ich bisher hatte«, erzählte Vroni. »Irgendwie ist kein Psychopath darunter, findest du nicht?«
»Ich kenne die Leute noch nicht so gut, aber wahrscheinlich hast du recht«, erwiderte Lucia. »Bisher waren alle okay.«
Bis auf Antoni, aber der war kein Psychopath, sondern schlichtweg ein Trottel.
»Im Praktikum am Wolfgangsee hatte ich einen Chef, vor dem haben alle gezittert. Der war jähzornig und unbeherrscht. Ein echter Choleriker. Sehr unangenehm. Der ist immer gleich explodiert, wenn etwas nicht so lief, wie er sich’s vorstellte.«
Lucia nickte. Mangelnde Affektkontrolle. Sie behielt den Fachausdruck, der in ihren zahlreichen Therapiestunden immer wieder einmal gefallen war, aber für sich. Er würde nur Fragen aufwerfen, auf die sie keinesfalls Antworten geben wollte.
»Ich bin froh, dass Frau Bruckner nicht so ist«, fuhr Vroni fort. »Sie ist meistens sehr freundlich.«
»Meistens?«
»Na ja, wenn jemand richtig Mist baut, kann sie schon böse werden. Das habe ich erlebt, als Moritz vor ein paar Monaten so ruppig zu den russischen Gästen war … Tja, und mit dem Hans Obermoser, da ist sie manchmal auch ziemlich zickig. So richtig, richtig zickig.« Vroni fletschte die Zähne, formte ihre Hände zu Tigerkrallen und stieß ein helles Fauchen aus.
Die Darbietung brachte Lucia unwillkürlich zum Schmunzeln und legte gleichzeitig eine Annahme nahe.
»Haben die beiden was am Laufen?«
»Nein, sicher nicht.« Vroni schüttelte heftig den Kopf und senkte die Stimme, obgleich Lucia überzeugt davon war, dass sich ohnehin keiner der anderen sich eifrig unterhaltenden Gäste an den Tischen um sie herum für ihr Gespräch interessierte. »Es heißt ja, die Bruckner ist mit dieser Galeristin zusammen.«
Lucia wurde hellhörig. Yvette Bruckner eine Lesbe? – »Du meinst, zusammen im Sinne von … einer Partnerschaft?«, erkundigte sie sich überrascht.
»Ja, klar, was denn sonst?« Vroni saugte mit ihrem Strohhalm den letzten Rest Mai Tai aus dem Glas, und Lucia fühlte sich durch die Selbstverständlichkeit, mit der ihre Kollegin über eine Frauenbeziehung sprach, auf seltsame Weise beruhigt. Vielleicht würde sie Vroni ja einmal von Dani erzählen … oder sie ihr gar vorstellen? »Jedenfalls ist sie oft im Goldenen Fasan, diese Galeristin. Kommt auf einen Kaffee vorbei oder bringt Gäste zum Abendessen. Hast du sie noch nie gesehen? Romy heißt sie.«
Lucia schüttelte den Kopf.
»Nicht, dass ich wüsste.«
»Sie ist mindestens zehn Jahre jünger und blond. Aber nicht so wie die Bruckner, sondern eher dunkelblond.«
Wieder schüttelte Lucia den Kopf.
»Definitiv nein.«
»Egal!« Vroni unterstrich ihren Ausruf mit einer gleichgültigen Handbewegung. »Jedenfalls, die Bruckner ist mit der zusammen. Heißt es. Sie nennt sie Liebes, das ist schon ziemlich eindeutig. Und sie wohnt auch in Aigen.«
»In derselben Wohnung?«
Ohne dass sie es wirklich wollte, war Lucias Interesse nun doch geweckt. Sie tat sich immer noch schwer, in Yvette Bruckner eine Lesbe zu sehen. Allerdings kannte sie auch bisher kaum andere Lesben außer Dani – und, nun ja – sich selbst. Wie sollte sie also eine Lesbe erkennen, wenn sich ihr nicht gerade ein optisches Klischeebild aufdrängte?
»Nein, die Bruckner wohnt in einer von diesen modernen Neubauwohnungen und ihre Freundin in einer Villa, einem Haus eben, keine Ahnung. Jedenfalls nicht zusammen. Vermutlich, weil die Gesellschaft das nicht akzeptieren würde. Heißt es.«
»Heißt es.« Lucia schüttelte den Kopf. Unglaublich, was sich manche antaten … »Ich dachte eigentlich, die Chefin wohnt in der Dachgeschosswohnung über dem Hotel?«
»Nein. Da wohnt der Obermoser.« Vroni war anscheinend wirklich gut informiert.
»Aber der Goldene Fasan und das Gebäude gehören doch ihr, oder nicht?«
»Ja. Aber Hans Obermoser wohnt trotzdem dort. Das weiß ich genau, weil die Erna, eines der Zimmermädchen, auch bei ihm in der Wohnung putzt. Sein Schlüssel ist deshalb sogar bei uns an der Rezeption hinterlegt – Zimmer 001. Die Nummer gibt es im Hotel selbst gar nicht.«
Lucia beließ es dabei und wechselte das Thema. Was gingen sie schon die privaten Verhältnisse ihrer Vorgesetzten an? – Es war sicher besser, sich aus Klatsch und Tratsch herauszuhalten.
Als sie sich später verabschiedeten, sagte Vroni: »Das war lustig heute. Wir sollten das wieder machen. All meine Freundinnen sind derzeit in festen Beziehungen; ich finde es super, jemanden zu kennen, der Single ist wie ich! Ich habe auch ein paar echte Geheimtipps zum Ausgehen. Stadlfeste und so. Kostet weniger als die angesagten Clubs in der Stadt und es gibt da nicht nur Schickimickis, sondern auch normale Menschen!«
Lucia war sich nicht sicher, ob sie Stadlfesten – was auch immer sich dahinter verbarg – etwas abgewinnen konnte, griff aber bereitwillig nach der Hand, die sich ihr entgegenstreckte.
»Klar, gerne wieder. Es war ein netter Abend.«
Auf dem Weg zurück in die Wohnung fühlte sie einen Hauch von Euphorie. Vroni war sympathisch, unkompliziert und vor allem so … normal. Sie wusste nichts von Schwarzau und hatte offenbar nichts dagegen, ihre Freundin zu sein.
Möglicherweise gab es ja doch noch eine kleine Chance, in ein ganz gewöhnliches Leben einzutauchen, zumindest in den Stunden, in denen die Erinnerungen sie nicht heimsuchten …
Offene Fragen
»Wolltest du heute nicht eigentlich ins Theater?«
Vom Beifahrersitz aus warf Romy der Frau, die sie vom Flughafen abgeholt hatte, einen fragenden Blick zu. Im selben Augenblick sprang die Ampel von rot auf grün. Die Strecke, die tagsüber aufgrund der Verkehrsdichte beinahe einer Weltreise glich, war um diese Zeit – die Uhr am Autodisplay zeigte 21:35 – relativ schnell zurückzulegen.
»Ich habe die Karten zwei meiner Mädchen gegeben«, erwiderte Yvette. »Kleine Freuden erhalten die Arbeitsmotivation. Außerdem hat mich diese flache Komödie, die da zurzeit auf die Bühne gebracht wird, ohnehin nicht interessiert.«
Romy schmunzelte.
»Das hast du bei der letzten Aufführung auch schon gesagt. Vielleicht solltest du die Sache mit dem Abo überdenken.«
»Du weißt, dieses Abo ist eine Art Politikum: Ich unterstütze so das Landestheater und die Kammerspiele, dafür liegen meine Hotelprospekte dort aus und ich bekomme gute Werbekonditionen im Programmheft. Eine Hand wäscht die andere. Und, wie schon gesagt, mit den Karten kann ich ab und zu die großzügige Chefin spielen.«
»Wenn ich mir nur vorstelle, dass ich Clara mit Theaterkarten belohne …«
Yvette machte eine wegwerfende Handbewegung.
»Das kannst du ja wohl nicht vergleichen. Clara ist in unserem Alter und eine promovierte Kunsthistorikerin. – Außerdem, wenn man einmal damit anfängt, finanzielle Prämien auszuzahlen, geben sie sich mit nichts anderem mehr zufrieden. Ich hatte dich damals gewarnt.«
»Jaja, hast du. Aber glaube mir, Clara hat jeden zusätzlichen Cent verdient, so oft, wie sie derzeit die Galerie alleine schupft«, versicherte Romy. »Weißt du, dass ich seit Beginn dieses Jahres kaum mehr als drei Wochen am Stück im Geschäft stand? – Erst die Grippe, danach die Bronchitis, dann der Tod meines Vaters. Von den Geschäftsreisen ganz zu schweigen.«
»Das Jahr hat wirklich heftig für dich begonnen«, stimmte Yvette zu. »Es kann nur besser werden. Wenigstens entfallen die ständigen Besuche im Pflegeheim, jetzt, da dein Vater endlich erlöst wurde.«
»Ja.« Romy stieß einen resignierten Seufzer aus. »Zumindest das. Seit dem letzten Schlaganfall vor Weihnachten war er kaum mehr ansprechbar. Im Pflegeheim kursieren außerdem laufend irgendwelche Krankheiten, und kränkelnde Menschen tun meinem schwachen Immunsystem definitiv nicht gut, so grausam das auch klingen mag.«
»In deinem Fall ist das einfach eine Tatsache. Als Transplantationspatientin bist du eben anfälliger.« Yvette fuhr rechts heran und stellte den Motor ab. »So, wir sind da. – Soll ich noch mit hochkommen, oder bist du müde von der Reise?«
»Beides.« Romy holte ihren Trolley aus dem Kofferraum des Wagens. »Natürlich kommst du mit hoch.«