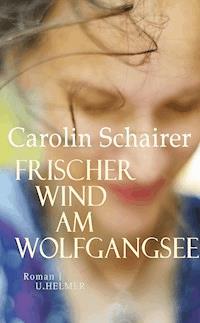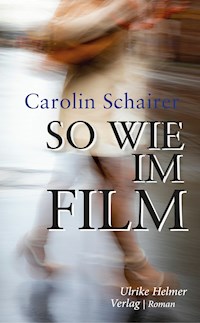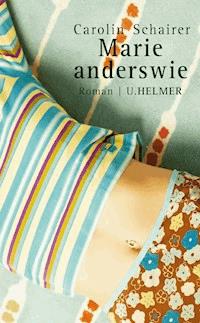16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ulrike Helmer Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Mia träumt von einer Theaterkarriere als Schauspielerin, doch im realen Leben jobbt sie als Kellnerin. Da bietet ihr ein mysteriöser Fremder ›die Rolle ihres Lebens‹ an: Sie soll ihre angebliche Zwillingsschwester vertreten … Und sie tut es. Doch je länger Mia als Nadine lebt, desto mehr zweifelt sie, wem sie trauen soll. Da ist beispielsweise die seltsame Rechtsanwältin Mariella, zu der sie sich stark hingezogen fühlt. Doch wie stand Mariella zu Nadine? – "Riskantes Spiel" ist eine aufregende Liebesgeschichte mit Tendenz zum Krimi …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 427
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Carolin Schairer
Riskantes Spiel
Roman
ISBN eBook 978-3-89741-952-0
© 2018 eBook nach der Originalausgabe© 2012 Copyright Ulrike Helmer Verlag, Sulzbach/TaunusAlle Rechte vorbehaltenCovergestaltung: Atelier KatarinaS / NLunter Verwendung des Fotos »Young woman with blond hair on grungy redbackground« © Lvnel – Fotolia.com
Ulrike Helmer VerlagNeugartenstraße 36c, D-65843 Sulzbach/TaunusE-Mail: [email protected]
www.ulrike-helmer-verlag.de
Inhalt
Prolog
Kein Glück in Holland
Ein Urlaub in Brasilien
Aufregende Begegnungen
Die Dinge wenden sich
Wahre Mutterliebe
Entdeckungen
Totgesagte leben länger
Ein seltsamer Besucher
Kehrtwende
Abschiede
Entscheidungen
Prolog
Der Tag in der Kanzlei war lang und anstrengend gewesen. Immerhin, er hatte ihr zwei neue Klienten beschert, und zumindest einer der beiden garantierte Erfolg und gute Entlohnung. Das Einverständnis des Klienten vorausgesetzt, würde sie nach Abschluss des Verfahrens einen Artikel in einer juristischen Zeitschrift publizieren. Die Aussicht, ihre Reputation in Fachkreisen damit weiter zu stärken, brachte ein flüchtiges Lächeln auf Mariella Simonis Lippen, während sie mit dem Aufzug von der Tiefgarage in den dritten Stock fuhr.
Bisher war sie heute nur im Büro gesessen und hatte sich anschließend mit dem Auto durch die Rushhour Münchens gequält. Zumindest war ihr unterwegs aufgefallen, dass draußen angenehm warme Temperaturen herrschten. Ein lauer Sommerabend, den andere im Biergarten verbrachten. Ihr fehlte dazu sowohl die Muße als auch die passende Gesellschaft. Obendrein – sie musste noch Nonna anrufen. Wie jeden Abend.
Der Lift war oben angekommen. In Gedanken schon beim Telefonat mit ihrer Großmutter, steuerte die Anwältin mit gezücktem Hausschlüssel auf ihre Wohnungstür zu. Abrupt blieb sie stehen, als sie der zierlichen Gestalt gewahr wurde, die an die Mauer gelehnt offensichtlich auf sie gewartet hatte.
»Du? – Was …«
Die unerwartete Besucherin ließ sie nicht zu Wort kommen.
»Mariella, hör zu! Ich weiß, du hast nicht mit mir gerechnet. Wahrscheinlich willst du überhaupt nicht mit mir reden. Aber du musst! Bitte, hör mich an. Ich habe in letzter Zeit viel nachgedacht, und ich …«
»Bitte! Nicht hier.« Mariella hatte ihre Fassung wiedergewonnen und sperrte hastig die Wohnungstüre auf. Es war ihr ein Gräuel, ihre Privatsphäre mit den Nachbarn zu teilen.
Während sie ihre Aktentasche unter dem Schreibtisch verstaute und sich ihrer Pumps entledigte, hatte sich die Besucherin bereits auf dem Sofa niedergelassen. Seit ihrem letzten Besuch waren mehrere Jahre vergangen. Dennoch schien es Mariella so, als wäre sie erst am Vortag hier gewesen. Die Erinnerung an Gespräche, die sie so oft in der Vergangenheit geführt hatten und die sich immer nur um ein und dasselbe Thema drehten, war frisch.
»Ich weiß, was du denkst. Ich sehe in deinen Augen, dass du mich am liebsten rauswerfen würdest, weil du keine Lust hast, mit mir zu sprechen. Aber ich bitte dich, Mariella – gib mir eine Chance und hör mich an.«
Mariella unterdrückte ein Seufzen. Zu oft hatte sie ihr schon zugehört, zu oft war nach diesen Gesprächen nichts geblieben außer Resignation und Enttäuschung.
Sie ließ sich im Sessel gegenüber nieder, schlug die Beine übereinander und zwang sich innerlich zurück in das Korsett jener Nüchternheit, die sie als Juristin auszeichnete.
»Ich will dich nicht rauswerfen«, stellte sie klar. »Ich weiß nur nicht, was das Ganze bringen soll. Ich weiß jetzt schon, was du sagen wirst, und ich weiß auch, wohin das alles führt – nämlich zu keinem Ergebnis, das für uns beide zufriedenstellend ist.«
»Doch!« Mit zwei schnellen Schritten überwand die Frau die räumliche Distanz zwischen ihnen und kniete vor ihr nieder. Ihre dunklen Locken kitzelten an Mariellas Oberschenkeln.
»Es wird alles anders! Ich verspreche es dir!«
Angesichts der unerwarteten körperlichen Nähe fiel Mariellas distanzierte Fassade in sich zusammen. Sie fuhr der Frau, die ihr Herz noch immer zum Flattern brachte, zärtlich durch das lange Haar und verdammte sich dafür im selben Moment selbst. Wieso konnte sie nicht hart bleiben?
»Du hast mir schon oft etwas versprochen«, erwiderte sie leise. »Mach es nicht schlimmer und gib mir noch ein Versprechen, von dem wir beide wissen, dass du es nicht halten wirst. Ich denke, wir haben inzwischen geklärt, wie wir zueinander stehen, und sollten es dabei belassen.«
»Nein!« Die junge Frau hob abrupt den Kopf. »Diesmal ist mein Entschluss endgültig. Ich will endlich so leben, wie ich es mir wünsche! Mit dir. – Ich liebe dich, Mariella!«
Mariella schloss einen Moment lang die Augen.
Auch diesen Satz hörte sie nicht das erste Mal aus dem Mund der anderen.
Ich liebe dich, aber …
Das »Aber« blieb aus.
Die junge Frau wartete kurz ab, schien auf eine positive Reaktion zu hoffen, die Mariella vielleicht zeigen würde. Als nichts kam, richtete sie sich auf.
»Ich werde mich scheiden lassen.«
Mariella hörte den Satz und sah bereits die Konsequenzen. Sie schüttelte den Kopf.
»Das wirst du nicht tun. Es steht für dich zu viel auf dem Spiel.«
»Das ist mir egal. Ich möchte endlich frei sein«, entgegnete die Dunkelhaarige mit fester Stimme. »Ich habe diese Lügen satt. Es wird ab sofort alles anders. Ich verspreche es dir.«
»Ich sagte dir schon, was ich von deinen Versprechen halte.«
»Ich verstehe, dass du skeptisch bist. Aber … diesmal ist es anders! Mariella … es ist so viel passiert in meinem Leben! Ich habe Dinge herausgefunden … über meine Familie, meine Herkunft … ich bin nicht mehr allein! Und ich habe in den vergangenen Wochen immer nur daran gedacht, dass ich dir davon erzählen will. Dass ich bei dir sein will. Dass ich mein Leben mit dir teilen will. Ich hatte erst heute den Mut, hierher zu kommen.«
Sie begann zu erzählen. Wie Backsteine schichteten sich die Erkenntnisse, zu denen sie gekommen war, und die Entscheidungen, die sie getroffen hatte, aufeinander und ließen in Mariellas Kopf ein Bauwerk an Hoffnungen und Erwartungen entstehen. Die Hoffnung auf das, was sie sich immer gewünscht hatte, ließ sie ihre Abwehr schwinden.
Als ihre Besucherin sie küsste, ließ sie sich ganz darauf ein, erwiderte den Kuss, spürte dieselbe Leidenschaft, die sie viele Jahre zuvor mit dieser Frau verbunden hatte. Erst als sich eine zarte Hand unter ihre Bluse schob, gewann ihr Verstand wieder die Oberhand.
»Nein«, stellte sie klar und stoppte die Berührung, obwohl ihr ganzer Körper danach verlangte. »Nein! – Ich möchte nicht wieder glauben, auf dem Gipfel zu stehen, um dann in ein tiefes Tal zu fallen – wenn du versteht, was ich meine. Woher soll ich wissen, dass du es diesmal ernst meinst? Wieso um alles in der Welt soll ich glauben, dass du deine Versprechen jetzt plötzlich hältst?«
Die Besucherin sah sie lange und eindringlich an.
»Weil ich es dir beweisen werde«, erklärte sie dann entschlossen. »In spätestens einem Monat ist alles geregelt – und ich bin frei. Für dich.«
Kein Glück in Holland
Der blaue Porsche folgte mir, seit ich den Parkplatz vor dem Theater verlassen hatte. Ich hatte ihn im Rückspiegel bemerkt, obwohl meine Gedanken noch immer bei dem misslungenen Casting waren, das hinter mir lag. Gemeinsam mit knapp neunzig anderen jungen Frauen hatte ich um die Statisten-Rolle einer Elfe im »Sommernachtstraum« gekämpft. Ich hatte den Kampf verloren.
In Ihrem Alter ist eine Frau keine Elfe mehr, hatte der Regisseur gesagt.
Zart genug war ich immerhin, dachte ich mit einem gewissen Trotz. Ich besaß eine zierliche Statur und lief schon immer Gefahr, eher zu dünn als zu dick zu werden. Mein Leben lang hatte ich mich fraglos für schlank gehalten, aber seit vorhin fühlte ich mich zum ersten Mal mickrig und alt.
Und jetzt folgte mir also ein blauer Porsche mit getönten Scheiben. Vielleicht bildete ich mir das aber auch nur ein. Es war ja nicht unwahrscheinlich, dass der Fahrer einfach nur dasselbe Ziel hatte wie ich: die Innenstadt von Kleve.
Das Schicksal meinte es ausnahmsweise einmal gut mit mir. Ich ergatterte den letzten freien Parkplatz am Rathaus und ließ mich durch die Innenstadt treiben. Manchmal blieb ich vor einem Schaufenster stehen, obwohl mein derzeitiges Einkommen als Aushilfskellnerin absolut nicht darauf zugeschnitten war, meine Garderobe zu erneuern.
Mit vierunddreißig Jahren war ich also weder eine Elfe noch in der Lage, mir hin und wieder ein neues Kleid zu gönnen.
Resigniert ließ ich mich in einem Straßencafé nieder. Die Herbstsonne tauchte die Fußgängerzone in goldenes, warmes Licht. Für mich machte die milde Stimmung das Nest, in das es mich vor Monaten verschlagen hatte, kein bisschen schöner.
Kleve. Stadt am Niederrhein, rund 50.000 Einwohner inklusive Eingemeindungen. Der nächste größere Flughafen in Düsseldorf – über eine Stunde Fahrzeit entfernt. Seit ich dem Saarland, wo ich aufgewachsen war, den Rücken gekehrt hatte, stand für mich fest, dass ich niemals wieder an einem Ort mit weniger als einer halben Million Einwohner wohnen wollte.
Dann aber hatte ich Henrik kennengelernt. Er spielte eines Abends Saxophon in dieser Kölner Bar, in der ich eine Weile kellnerte. Er sah süß und sexy aus mit seinem blonden schulterlangen Haar und dem Drei-Tage-Bart. Der Abend war lang, die Nacht noch länger. Seither waren wir ein Paar.
Henrik, der Holländer war, wohnte in Nijmegen in einem Zwei-Zimmer-Appartement. Es befand sich in einem vierzehnstöckigen Betonbunker in einem Viertel der Universitätsstadt, in dem die sprichwörtlichen Bürgersteige schon gegen acht Uhr abends hoch geklappt wurden.
Dennoch zog ich bereits knapp zwei Wochen nach unserer ersten Begegnung bei ihm ein.
Ich bestellte bei der Kellnerin einen Espresso. Eigentlich war mir nach Wein zu Mute, oder sogar nach einem Whiskey. Doch mit Alkohol im Blut setzte ich mich nicht hinter das Steuer.
Mein Holländisch machte allerdings noch keine großen Fortschritte. Nach drei Monaten reichten meine Sprachkenntnisse gerade einmal aus, um die Bestellungen der Gäste im Café entgegenzunehmen, nicht aber für eine Bewerbung am Theater in Nijmegen. Kleve war die erste deutsche Stadt hinter der Grenze und meine einzige Chance, meine Karriere als Schauspielerin fortzusetzen. Diese Chance hatte ich heute wohl vergeigt.
Ich trank den Espresso mit hastigen kleinen Schlucken, legte das Geld abgezählt auf den Tisch und machte mich auf den Rückweg zum Parkplatz.
An der Windschutzscheibe von Henriks Auto klebte ein kleiner Zettel. Ich erkannte schon von Weitem, um was es sich handelte, und stieß einen leisen Fluch aus. Dass dieser Parkplatz gebührenpflichtig war, hatte ich völlig übersehen.
Wütend auf mich selbst, zerknüllte ich den Strafzettel.
»Shit happens.«
Ich fuhr herum. Im ersten Augenblick nahm ich nur das Auto wahr, das jetzt direkt neben dem Fiat parkte. Der blaue Porsche. Der Mann, der in betont lässiger Manier an der halb geöffneten Beifahrertür lehnte, grinste mich an.
Ich konnte seine Augen nicht erkennen, denn er hielt sie hinter einer dunklen Sonnenbrille verborgen. Lächelnd stand er da, mit der Körperhaltung eines Mannes, der glaubte, dass ihm keine widerstehen konnte. Zumindest nicht seinem Geld.
Er hatte etwas an sich, was bei mir die Alarmglocken schrillen ließ. Er wirkte so jung. Viel zu jung für mich. Warum hatte ein Mann, der aussah wie zwanzig und einen Porsche fuhr, Interesse an einer Frau, die zu alt war, um eine Elfe darzustellen?
»Darf ich Sie auf einen Kaffee einladen?«
Ich warf ihm einen raschen Blick zu. »Danke«, sagte ich kurz angebunden.
»Vielleicht auf einen Cocktail?«
»Kein Interesse.«
Ich wollte mich ins Auto zwängen, doch sein Arm, der nun über der halb offenen Türe des Fiats lag, machte es mir unmöglich.
»Ich denke schon, dass Sie Interesse an meinem Angebot haben werden.«
Ich funkelte ihn an. Was bildete er sich ein?
»Hören Sie sich zumindest einmal an, was ich Ihnen zu sagen habe.«
Er gab meiner Autotür einen Schubs, sodass sie vor meiner Nase zufiel.
»Sie sind Schauspielerin. Und ich biete Ihnen die Rolle Ihres Lebens.«
»Tatsächlich? – Wer sind Sie? Steven Spielberg?«
»Es ist eine Rolle, die Ihnen leicht fällt und die Sie ganz gewiss interessieren wird. Denn Sie müssen im Grunde nur Sie selbst sein. Ich biete Ihnen sechs bis zwölf Monate freie Kost und Logis und eine Rolle, für die Sie wenig Text auswendig lernen müssen. Und dafür bekommen Sie am Ende 50.000 Euro.«
Es dauerte etwas, bis mein Verstand den Inhalt seiner Worte verarbeitet hatte. Als es soweit war, musste ich unwillkürlich lachen. Sein Angebot war zu aberwitzig, um es ernst zu nehmen.
»Gut. Sagen wir: 60.000.«
Mein Lachen erstarb. Sekundenlang starrte ich ihn an. Und plötzlich glaubte ich zu begreifen, was er mir da anbot. Wut stieg ihn mir auf.
»Ich bin kein Callgirl.« Ich riss die Autotüre so schwungvoll auf, dass er fast das Gleichgewicht verlor. Er taumelte und wich ein paar Schritte zurück.
»Sie verstehen mich falsch!« Plötzlich hatte seine Stimme einen verzweifelten Unterton. »Es geht überhaupt nicht um Sex! Sie müssen nur ein paar Leute davon überzeugen, dass Sie eine Andere sind! Es kommt niemand dabei zu Schaden, Sie tun niemandem weh … ganz im Gegenteil! Sie würden vielen Leuten sogar eine Freude machen.«
Jetzt, da er so viel redete, fielen mir seine Sprachmelodie auf und die Art und Weise, wie er die Endsilben verschluckte. Kein Zweifel, er stammte aus dem Süden Deutschlands.
»Ich will niemandem Freude machen. Suchen Sie sich eine Andere.«
Er lachte. Es klang künstlich.
»Das würde ich, wenn ich es könnte. – Hören Sie sich mein Angebot doch wenigstens an. Ich bin sicher, Sie werden interessiert sein.« Seine Stimme senkte sich und bekam einen beschwörenden Klang. »Es geht um Ihre Familie.«
Ich schüttelte den Kopf. Meine Geduld war erschöpft.
»Jetzt hören Sie mir mal zu: Ich habe keine Familie. Folglich interessiert mich nichts, was im Zusammenhang mit meiner nicht vorhandenen Familie stehen könnte. Was Sie hier von sich geben, ist einfach nur Unsinn. Lassen Sie mich jetzt einsteigen, sonst werde ich um Hilfe schreien und sagen, dass Sie mich sexuell belästigt haben. Und da Sie ja so sehr an meine schauspielerischen Fähigkeiten glauben, brauche ich Ihnen wohl nicht zu erklären, wie überzeugend ich als Opfer sein kann.«
Ich stieg ein. Diesmal hielt er mich nicht davon ab.
Sobald ich auf dem Fahrersitz saß, verriegelte ich die Türen von innen.
Sein Gesicht tauchte vor dem Fenster auf, als ich es schließlich hinter das Steuer geschafft hatte. Er drückte seine Hände an das Glas.
»80.000 Euro!«, hörte ich ihn durch die Scheibe gedämpft sagen. »Mein letztes Angebot!«
Ich startete den Wagen und ließ den Motor aufheulen. Er sprang zur Seite.
Ehe ich auf die Straße abbog, warf ich einen kurzen Blick durch den Rückspiegel und sah, dass er wütend gegen den Parkscheinautomaten trat.
In diesem Moment fühlte ich nichts anderes in mir außer der Gewissheit, richtig gehandelt zu haben. Mit jemandem, der mir so viel Geld für etwas zahlen wollte, dessen bloße Beschreibung schon mysteriös genug klang, um mir Magendrücken zu verursachen, wollte ich nichts zu tun haben.
Ich schlug den Weg nach Nijmegen ein und beruhigte mich bei dem Gedanken, dass zumindest der Rest des Tages keine unangenehmen Überraschungen mehr für mich bieten würde.
Ich sollte mich täuschen.
»Warum, verdammt, hast du mir nie gesagt, dass du keinen Führerschein hast?« Henrik sah mich über den kleinen Esstisch hinweg wütend an. »Ich hätte dir niemals mein Auto geliehen, wenn ich das gewusst hätte!«
Genau deshalb hatte ich ihm nichts gesagt. Vor allem fuhr ich seit über zehn Jahren Auto. Unfallfrei.
»Wie bescheuert bist du eigentlich, Mia?« Sein Blick durchbohrte mich.
Die Polizeikontrolle, in die ich auf der Landstraße zwischen Kleve und Kranenburg geraten war, war nicht meine erste gewesen. Bisher hatte ich es immer geschafft, mich irgendwie herauszuwinden. Es wäre mir gewiss auch diesmal gelungen, wenn mir nicht diese andere Sache zum Verhängnis geworden wäre.
»Nicht nur, dass du ohne Führerschein fährst. Nein, du vergisst auch noch, das Marihuana aus dem Handschuhfach zu nehmen, ehe du über die Grenze fährst!« Henrik raufte sich sein blondes Haar. »Ich fasse das einfach nicht! – Und das alles mit einem Auto, das auf mich zugelassen ist! Die Bullen haben jetzt auch meinen Namen auf ihrer Liste, verdammt!«
»Es war nicht mein Marihuana«, stellte ich klar.
»Ich weiß nicht, wie das mit uns weitergehen soll.« Henrik legte Zigarettenpapier und Tabak auf den Tisch und begann sich eine Zigarette zu drehen. »Ich weiß nicht, wie lange ich das noch aushalte. Und du bist immer da, immer um mich herum! Das nervt!«
An Liebe und Treue hatte ich das letzte Mal mit einundzwanzig geglaubt. Schon damals hatte sich das als fataler Fehler erwiesen. Mit vierunddreißig Jahren war eine Frau vielleicht keine Elfe mehr, aber auch keine Illusionistin.
Was Henrik betraf, so hatte ich nie angenommen, dass er in mich verliebt war. Ich hatte damals im Grunde keine andere Wahl gehabt, als zu ihm zu ziehen. Ich schuldete meiner damaligen Kölner Mitbewohnerin Tanja knapp zwei Monatsmieten. Dann war ihre Geduld erschöpft gewesen. Sie hatte mir ein Ultimatum gestellt: entweder zahlen oder ausziehen.
Henrik und ich verbrachten damals nicht viel Zeit miteinander. Ich arbeitete tagsüber in einem Studentencafé in der Innenstadt. Abends war Henrik oft mit seinen Kumpanen von der Band unterwegs. Wenn er in Amsterdam oder im Norden des Landes spielte, blieb er auch über Nacht weg.
Für mich war unsere Beziehung ein Arrangement: Ich hatte ein Dach über dem Kopf und Henrik jemanden, der sich um seine Wäsche kümmerte, den Müll entleerte, ausgetrunkene Weinflaschen entsorgte und den Kühlschrank mit dem Nötigsten füllte.
Henrik zündete seine Zigarette an der Flamme der Kerze an, die zwischen uns auf dem Tisch stand, neben einer leeren Flasche Wein, zwei Gläsern und einer Packung Chips.
»Du zahlst hier nicht einmal Miete«, sagte er. »Ich darf alle Kosten tragen. Und jetzt noch die Sache mit dem Auto! Das ist mir echt zu viel.«
Der Rauch, den er ausstieß, bildete kleine Wölkchen, die zur Decke stiegen. Ich sah ihnen nach und fühlte nichts.
Bei Fahren ohne Fahrerlaubnis droht eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten. Das hatte mir der Polizist gesagt. Dazu kam der in Deutschland illegale Besitz von Marihuana. Möglicherweise musste ich mir um mein zukünftiges Quartier sowieso keine Sorgen mehr machen.
Henrik stand auf.
»Ich geh jetzt ins Bett. Für heute habe ich wirklich keine Lust mehr, noch über irgendetwas zu diskutieren. Aber morgen werden wir uns ernsthaft über die Zukunft unterhalten müssen.«
Ich warf einen Blick auf meine Armbanduhr. Es war halb zwei. Auch ich fühlte mich müde, doch ich musste noch einige Minuten mit mir alleine sein, um einen klaren Gedanken zu fassen.
»Und blas nachher die Kerze aus«, meinte Henrik knapp. Dann verschwand er im Nebenzimmer.
Ich starrte in das flackernde Kerzenlicht.
In meinem bisherigen Leben hatte ich gelogen, war nie um Ausreden verlegen gewesen, hatte Leute aus persönlicher Not heraus hin und wieder wohl auch ausgenutzt – aber niemals, wirklich niemals, war ich mit dem Gesetz in Konflikt geraten.
Nun sah ich mich bereits hinter Gittern, gekleidet in einen farblosen Anzug mit Nummer, in ein Leben ohne Rückzugsmöglichkeit und persönliche Freiheit gezwungen.
Die Angst, die mich plötzlich überkam, ließ mich zittern.
Doch noch war nicht aller Tage Abend. Es würde eine Gerichtsverhandlung geben, wegen des Marihuanas. Wenn Henrik mich jetzt hängen ließ und vor die Tür setzte, gab es keinen Grund, ihn in Schutz zu nehmen. Immerhin war er derjenige, der es in einem der Coffee Shops gekauft hatte.
Als ich wenig später zu ihm ins Bett schlüpfte, schlief er bereits tief und fest.
Ich bekam keine Luft. Ich konnte nicht sehen. Der ganze Raum schien in rauchigen Nebel gehüllt. Ich hörte Henrik neben mir husten.
Im nächsten Moment packte er mich am Arm und warf das Bettzeug über uns. Gemeinsam stolperten wir zur Tür, hinaus auf den schmalen Flur. Ich riss die Wohnungstüre auf.
Im Treppenhaus war Rauch, aber immerhin konnte ich hier atmen. Der Feueralarm füllte das gesamte Gebäude mit ohrenbetäubendem Lärm.
»Was …?«, stammelte ich, doch Henrik zog mich grob nach unten.
»Es brennt!«, herrschte er mich an. »Wir müssen hier raus!«
Wir waren nicht die Einzigen, die dieser Meinung waren: Plötzlich schien das Treppenhaus voller aufgeregter Menschen, die wild auf Niederländisch durcheinander schrien und Richtung Ausgang drängten. Aus der Ferne hörte ich eine sich nähernde Feuerwehrsirene.
Irgendwann standen wir unten auf der Straße – Henrik in einer Pyjamahose und mit bloßem Oberkörper, ich in einem übergroßen T-Shirt mit dem Werbeslogan einer niederländischen Supermarktkette. Es hatte höchstens acht Grad, und es nieselte. Ich fror erbärmlich.
Den Menschen um uns herum ging es nicht besser. Sie alle waren durch das Alarmsignal des Brandmelders aus dem Schlaf gerissen worden und drängten sich nun auf dem Parkplatz vor dem Wohnblock. Einige hatten es geschafft, ein paar Habseligkeiten an sich zu raffen, ehe sie aus dem Haus geflüchtet waren.
Die Feuerwehr fuhr bereits ihre Leiter und den Löschschlauch aus. Meine Augen glitten die Hausmauer entlang.
Ich sah die Wohnung, aus der der Rauch quoll. Es war unsere.
Die Leute von der Cordaid, der niederländischen Caritas, waren sehr hilfsbereit gewesen. Sie hatten mich mit Kleidung ausgestattet und mich für den Rest der Nacht in einem Heim für obdachlose Frauen untergebracht. Nachdem ich einen kurzen Blick in die Schlafzelle geworfen hatte, die mir zugewiesen worden war, zog ich die Gemeinschaftsküche vor. Auf einer durchgelegenen Matratze, umgeben von schnarchenden Mitbewohnerinnen, würde ich ohnehin kein Auge zutun können.
Henrik war bei einem seiner Freunde untergekommen. Mich hatte er eiskalt stehen lassen.
Wenn die Polizei die Wohnung wieder freigibt, kannst du den Rest deiner Sachen holen, hatte er mir noch an den Kopf geworfen, ehe er sich in sein Auto gesetzt hatte.
Ich nippte an dem Kaffee, den ich mir in der Heimküche gebraut hatte, und wartete darauf, dass es draußen hell wurde.
Den Rest meiner Sachen. Was sollte das sein? Ein paar halb verbrannte, rauchige Kleidungsstücke?
Zumindest hatte ich meinen Reisepass. Ein Feuerwehrmann hatte ihn mir gegeben, nachdem der Brand in Henriks Wohnung gelöscht gewesen war. Der Beschreibung des Mannes nach war die ganze Wohnküche völlig ausgebrannt. Im Schlafzimmer hatte lediglich das Löschwasser Schaden angerichtet. Über die Brandursache wollte er nicht spekulieren.
Ich dachte an die Kerze. Sollte ich tatsächlich vergessen haben, sie zu löschen? – Bei dem Gedanken, dass sie möglicherweise den Brand ausgelöst hatte, wurde mir übel.
Später machte ich mich auf den Weg zum Polizeirevier. Ich war bestellt worden, um eine Aussage zu machen. Auf dem Weg zur Bushaltestelle hatte ich ein mulmiges Gefühl. Was würde mich dort erwarten?
Ein Auto fuhr langsam die Straße entlang. Als es auf einer Höhe mit mir war, hielt der Fahrer an und kurbelte das Autofenster herunter. Es war der Mann mit dem Porsche.
Diesmal trug er keine Sonnenbrille. Er wirkte noch jünger als am Vortag.
»Guten Morgen. Lust auf eine kleine Spritztour?«
»Hören Sie«, erwiderte ich unwirsch. »Heute Nacht ist meine Wohnung abgefackelt. Ich habe jetzt wirklich anderes im Sinn, als ausgerechnet mit Ihnen durch die Gegend zu fahren. Im Übrigen habe ich Ihnen gestern schon klipp und klar gesagt, dass ich kein Interesse an Ihrem dubiosen Angebot habe. Ich habe auch so schon genug Probleme.«
»Bitte! Geben Sie mir zumindest eine Viertelstunde.«
Der flehende Unterton in seiner Stimme ließ mich zu meinem eigenen Erstaunen einwilligen. Was hatte ich schon zu verlieren? Wenn er sich als der Spinner bestätigte, für den ich ihn hielt, konnte ich immer noch flüchten.
Ich bestand darauf, das Gespräch in einem belebten Café zu führen. Er bestellte einen Milchshake, ich einen Kaffee. Während wir auf die Getränke warteten, glitt sein Blick prüfend an mir entlang. Er grinste.
»Genug gesehen?«, wies ich ihn scharf zurecht. »Kommen Sie zur Sache, ich habe noch einen Termin.«
Er lehnte sich zurück.
»Wissen Sie, dass die Polizei inzwischen von Brandstiftung ausgeht?«
Ich stutzte, fing mich aber schnell wieder. »Und woher bitte wollen Sie das wissen?«
Achselzuckend fuhr er fort: »Ihr Freund … oder sagen wir wohl besser Ex-Freund … Henrik hat gestern Nacht noch ausgesagt, dass Sie möglicherweise die Verursacherin dieses Brandes sind.«
Ich stellte die Kaffeetasse, die ich eben zum Mund führen wollte, zurück auf den Unterteller. Er sollte nicht sehen, dass meine Hände leicht zitterten.
»Das ist absurd. – Selbst wenn er das gesagt hätte: Warum sollte ich das tun? Eine Wohnung anzünden, in der ich selbst zu Hause bin?«
»Vielleicht, weil Ihr Freund … pardon, Ex-Freund … ohnehin vorhatte, Sie vor die Tür zu setzen. Die Aktion könnte eine Art Racheakt sein.«
»Das ist einfach lächerlich.« Ich erhob mich. »Ich höre mir das nicht länger an!«
»Warten Sie!« Er sprang auf und zog mich mit sanfter Gewalt auf den Stuhl zurück. Das Zittern, das inzwischen meinen gesamten Körper erfasst hatte, raubte mir die Kraft zur Gegenwehr.
»Mia Hagedorn, ob Sie es hören wollen oder nicht: Sie stecken tief im Schlamassel. Die Polizei hält Sie für eine Brandstifterin, Sie haben keine Bleibe mehr, Sie haben kein Geld …«
»Woher wissen Sie das alles? Woher wissen Sie meinen Namen? Wer sind Sie?«
»So viele Fragen auf einmal.« Er kräuselte belustigt die schmalen Lippen. »Aber nun gut, ich will versuchen, sie zu beantworten. Ich habe mich über Sie informiert. Wie ich schon sagte, ich brauche eine Schauspielerin. Und zwar nicht irgendeine. Ich brauche Sie.«
»Wer sind Sie?«, wiederholte ich mit Nachdruck, mühsam die Unruhe, die mich erfasst hatte, überspielend.
»Oh, Verzeihung. Natürlich. Wie unhöflich.« Er streckte mir die Hand entgegen. Ich nahm sie nicht. »Mein Name ist Adrian Schattengruber.«
»Schön.« Ich hatte meinen Körper wieder so weit unter Kontrolle, dass ich einen Schluck Kaffee nehmen konnte. »Herr Schattengruber. Aus München?«
»Sie sind gut darin, Dialekte herauszuhören.« Er ließ sich seine Ruhe nicht nehmen. »Ich bin tatsächlich aus der Nähe von München: aus einem netten, idyllischen Ort im Altmühltal. Und in diese schöne Landschaft würde ich Sie gerne mitnehmen. Und zwar als meine Schwester. Klingt gut, nicht wahr?«
Erneut erhob ich mich und griff nach der Jacke, mit der ich von Cordaid ausgestattet worden war. Der Kerl war verrückt. Lieber riskierte ich eine Anzeige als mutmaßliche Brandstifterin, als mich in die Hände eines Irren zu begeben.
»Warten Sie!« Er legte ein Foto vor mich auf den Tisch.
Ich erstarrte. Denn die Frau auf dem Foto war ich selbst: eine zierliche Person, etwas größer als einen Meter sechzig, mit hellbraunem, lockigem Haar. Der breite Mund, die Stupsnase, die braunen Augen, die schwungvollen Augenbrauen, die langen Wimpern, die Sommersprossen, die sich über das ganze Gesicht verteilten – das alles sah ich, wenn ich morgens in den Spiegel blickte. Die Frau auf dem Foto stand auf einem Segelschiff, an den Mast gelehnt, und lachte in die Kamera.
Ich hatte noch nie in meinem Leben auf einem Segelschiff gestanden.
Zum zweiten Mal ließ ich mich wieder auf den Stuhl sinken.
»Das ist meine Schwester Nadine.« Zum ersten Mal war Adrian Schattengrubers Stimme frei von Spott. »Ich möchte, dass Sie eine Weile in ihre Rolle schlüpfen.«
Ich griff nach dem Foto.
Sie trug ihr Haar kürzer als ich. Der dunkelblaue Pulli, der hellblaue Blusenkragen, die elegant geschnittene beige Bluse – das war nicht mein Kleidungsstil. Zu konservativ, zu gewöhnlich.
Ich versuchte, einen klaren Gedanken zu fassen. Das konnte einfach nicht sein!
Jeder Mensch hat einen Doppelgänger. Das hatte ich einmal in einer Illustrierten gelesen. Doch diese Frau glich mir wie mein Spiegelbild. Es gab dafür nur eine Erklärung. Aber sie war so abwegig, dass ich sie nicht einmal aussprechen konnte.
Mein Gegenüber hatte damit keine Probleme.
»Nadine ist Ihre Zwillingsschwester. – Sie sind nach der Geburt getrennt zur Adoption freigegeben worden.«
Mein Gesicht sprach sicher Bände, denn nach einer Weile, in der er verdutzt meine Miene studiert hatte, schob er nach: »Sagen Sie bloß, Sie wussten nicht, dass Sie adoptiert sind?«
Stumm schüttelte ich den Kopf. Zu mehr war ich in diesem Augenblick wahrhaftig nicht in der Lage. Ich sah die Leute vor mir, die ich bis eben für meine Eltern gehalten hatte. Ich wusste in diesem Augenblick nicht, was ich denken sollte.
Adrians Stimme erreichte mich inmitten meines inneren Chaos.
»Ich möchte schlicht und einfach, dass Sie für maximal sechs Monate das Leben meiner Schwester übernehmen. Dafür biete ich Ihnen, wie schon erwähnt, 80.000 Euro in bar. Ich verspreche Ihnen, dass es Ihnen in den sechs Monaten an nichts fehlen wird. Und sehen Sie die Vorteile: Mia Hagedorn, die potenzielle Brandstifterin, wird für einige Zeit verschwinden. Bis Sie wieder auftauchen, ist Gras über die Sache gewachsen.«
Es war nach wie vor nicht das Geld, das mein Interesse weckte. Es war auch nicht die Aussicht, meinen derzeitigen Problemen mit der Polizei zu entkommen – auch wenn ich nichts gegen einen guten Anlass hatte, meinen Gang zum Nijmegener Polizeirevier bis auf Weiteres zu verschieben. Viel entscheidender war, dass ich offensichtlich nicht so alleine auf dieser Welt stand, wie ich immer gedacht hatte.
»Und was ist mit meiner Schwester? Werde ich Sie kennenlernen?«
»Natürlich.« Er trank seelenruhig den Rest seines Milchshakes. »Wenn alles vorüber ist. Aber zunächst müssen Sie alle glauben lassen, dass Sie Nadine sind.«
»Aber wo ist Nadine?«
»Im Ausland. Details müssen Sie nicht wissen.« Als er meine Skepsis bemerkte, schob er nach: »Nadine hatte eine schwierige Phase. Sie ist derzeit auf Selbstfindungstrip, irgendwo in Südamerika. Leider brauchen wir sie jetzt zu Hause. Und das ist der Grund, weshalb Sie einspringen müssen.«
Er redete noch zwei Stunden auf mich ein, erzählte mir von Nadines Leben, ihrem Umfeld, ihren Vorlieben und auch von den Gründen, aufgrund derer ich vorübergehend in ihre Rolle schlüpfen sollte. Es klang wie ein Bühnenstück.
Ich würde eine Rolle spielen. Ich würde meine Schwester kennenlernen. Meine Zwillingsschwester. Ich würde in einem hübschen Haus wohnen und mir keine Gedanken über ein Nachtquartier machen müssen. Sechs verlockende Monate lang.
Ich verdrängte den letzten Rest Skepsis und willigte ein.
Mein ganzes Leben lang war ich das Gefühl nicht losgeworden, etwas Wichtiges verloren zu haben. Nie hatte mich der Eindruck verlassen, am verkehrten Ort in der falschen Familie zu leben. Als Teenager hatte ich mir sogar zusammengereimt, dass ich im Krankenhaus versehentlich vertauscht worden war und meine Mutter eigentlich ein ganz anderes Baby zur Welt gebracht hatte: ihr Baby, das jetzt auch bei einer falschen Familie lebte, nämlich meiner Familie.
Auch als Erwachsene fühlte ich mich niemals ganz und vollkommen.
Jetzt bekam ich plötzlich und unerwartet die Antwort auf all die Fragen, die ich mir stets gestellt hatte: Wieso meine Eltern groß und blond waren, ich dagegen zierlich und braunhaarig. Weshalb ich so ganz und gar anders fühlte und dachte über die Welt. Warum ich mich mit zunehmendem Alter immer unwohler bei ihnen gefühlt hatte – so unwohl, dass ich mit sechzehn einen Rucksack zusammenpackte und mich nach Berlin absetzte. Ich wurde nach einer Woche von der Polizei aufgegriffen und zurück ins Saarland gebracht, in ein Zuhause, das für mich nie eines war. Mit siebzehn tauchte ich erneut unter. Diesmal holte mich niemand zurück.
Seit diesem Zeitpunkt verlor ich jeden Kontakt zu den Leuten, die mir immer fremd geblieben waren, auch wenn ich sie »Mama« und »Papa« nannte. Ich hatte sie und die Enge dieses frömmelnden, katholischen Elternhauses, das sie mir geboten hatten, seither nicht eine Minute vermisst. Im Gegenteil, wenn ich an die Vergangenheit zurückdachte, sah ich mich nur auf hölzernen Kirchbänken knien, Sünden beichten, die keine waren, und mich schämen für Dinge, die nur natürlich sind. Zum Beispiel für meinen Körper, der trotz meiner Zierlichkeit schon früh weibliche Formen angenommen hatte. Oder auch für die Tatsache, dass ich ausgerechnet im Religionsunterricht mit einem Jungen namens Tobias Zettelchen ausgetauscht hatte, in denen in krakeliger Kinderschrift der Satz »Willst du mit mir gehen?« gekritzelt stand. Die harmlose Frage, deren Antwort ich damals übrigens schuldig geblieben war, hatte mir sieben Tage Hausarrest und eine Ohrfeige eingebracht.
Das Einzige, was ich an meiner katholischen Kindheit und dem Kirchenleben geliebt hatte, war das Singen im Kirchenchor. Gewiss hätte ich lieber Lieder von den Beatles nachgesungen, doch mangels Alternativen war ich auch mit »Christ ist erstanden« zufrieden gewesen. Es hatte sich für mich ausgesungen, als mich der Pfarrer eines Tages im Beichtstuhl erwischte – mit meiner Zunge im Mund des Sohnes vom Chorleiter. Meine Eltern waren damals außer sich geraten und zeterten heftig mit mir. Ihre größte Sorge war stets, dass ich eines Tages unehelich schwanger werden würde, und nach diesem Kuss glaubten sie mich auf direktem Wege dorthin. Dass ich sie in dieser Diskussion über die Möglichkeiten hormoneller Verhütung aufklärte, brachte mir wiederum eine Ohrfeige und Hausarrest ein.
Das war der Moment, an dem ich meinen Entschluss fasste, diese Familie zu verlassen.
So unterschiedlich Nadine und ich auch lebten, gab es dennoch einige Parallelen. Auch Nadine war katholisch erzogen worden, auch sie war im konservativen Klima einer Kleinstadt aufgewachsen.
Mit einundzwanzig hatte sie geheiratet. Nun lebte sie bereits wieder seit acht Jahren von ihrem Mann getrennt, aber immer noch in Lindach, wo sie einen Großteil ihrer Kindheit verbracht hatte. Wie man sein Leben in einem Ort mit gerade einmal 13.000 Seelen vertun konnte, war mir schleierhaft.
Dabei hatte ihr Leben vielversprechend begonnen. Ich war von einem Religionslehrer und einer Hausfrau adoptiert worden, deren Familien seit Generationen in der Provinz wohnten. Nadines Adoptivvater dagegen war ein französischer Diplomat, der mit einer Deutschen verheiratet war. Zwei Jahre lang wohnte Nadine in Paris, besuchte dort auch die Schule. Dann ging die Ehe ihrer Eltern in die Brüche und die Mutter zog zurück in ihre Heimatstadt, um dort schließlich einen wohlhabenden Brauereibesitzer zu heiraten: Magnus Schattengruber, mittlerweile knapp siebzig und in den letzten Zügen seines Lebens, sofern ich Adrian, seinem Sohn, wirklich Glauben schenken konnte. Schattengruber war an Leberkrebs erkrankt. Der Arzt gab ihm nur noch wenige Monate. Und in diesen wenigen Monaten sollte ich die Rolle seiner Stieftochter Nadine übernehmen.
Adrian rückte inzwischen damit heraus, dass es ums Erbe ging. Sein Vater werde Nadine kurzfristig enterben, wenn sie ihm jetzt, in seinen letzten Lebensmonaten, nicht beistand. Für ihren Selbstfindungstrip hätte er, der eingesessene, bodenständige Braumeister und Geschäftsmann, kein Verständnis. Adrian hielt es für seine brüderliche Pflicht, ihr die Chance auf ihr Erbe zu erhalten.
Ich fragte mich in Gedanken, wie hoch dieses Erbe sein musste, dass es ihm Wert war, 80.000 Euro an Nadines Doppelgängerin zu zahlen. Mein Misstrauen wuchs. Warum war ihm als Stiefbruder so sehr daran gelegen, dass Nadine nicht leer ausging? Adrian schmetterte sämtliche Nachfragen ab, was nicht gerade dazu beitrug, dass ich Vertrauen zu ihm entwickelte. Ihn schien das nicht weiter zu stören. Er war und blieb für mich eine dubiose Gestalt. Doch die Aussicht, irgendwann meiner Schwester zu begegnen, ließ mich alle Zweifel über sein Vorhaben verdrängen.
Ein Urlaub in Brasilien
Der Ort hieß Praia do Forte und befand sich rund 50 Kilometer nördlich des Flughafens von Salvador. Einst ein gewiss malerisches Fischerdorf, hatte es sich zu einem beliebten Touristenort entwickelt. An der Hauptstraße reihten sich Souvenirläden, kleine Supermärkte und Restaurants aneinander. Dazwischen gab es vereinzelt einige kleinere Ateliers, in denen unbekannte Künstler ihre Werke feilboten.
Mein erster Schritt in Nadines Leben hatte mit einer Reise auf die andere Seite der Erde begonnen. Doch noch war ich nicht Nadine. Ich war unter meinem eigenen Namen eingereist und hatte auch so in der Hotelanlage eingecheckt.
Adrian hatte mich im selben Flieger begleitet, wohnte in Praia do Forte jedoch in einem anderen Hotel. Tagsüber traf er mich am Strand, wobei er stets darauf bedacht schien, von möglichst wenigen Menschen mit mir zusammen gesehen zu werden. Eine reine Vorsichtsmaßnahme, hatte er mir auf meine Nachfrage erklärt.
Ich war mir sicher, dass es nur eine Frage der Zeit war, bis ich hinter seine wahren Beweggründe kommen würde. Es gab Momente, da schien er mir wie ein misstrauischer kleiner Junge, der in Wahrheit jeden Moment damit rechnete, von mir übertölpelt zu werden. Er konnte nicht ahnen, wie fern mir diese Absicht lag. Ich hatte das graue Holland vorerst gegen die Sonne Brasiliens getauscht, und ich genoss diesen unerwarteten Urlaub, so gut ich konnte.
Adrians Begründung für diese Reise war überzeugend gewesen: Nachdem sich Nadine für ihren Selbstfindungstrip offenbar auch hierher begeben hatte, musste ich, wenn ich unvorhergesehen wieder in Lindach auftauchte, eine Ahnung davon haben, wie es in Südamerika aussah.
Bisher hatte ich Praia do Forte nicht verlassen. Nach dem Frühstück begab ich mich hinunter an den Strand. Abseits vom größten Trubel arbeitete ich allerlei Unterlagen durch, mit denen mich Adrian täglich aufs Neue versorgte. Es waren Landkarten, Ortspläne sowie Lebensläufe diverser Personen aus Nadines Umgebung: ehemalige Schulfreunde, Nachbarn, die Mitarbeiter des Schattengruberschen Brauereibetriebs.
Je mehr ich mich mit ihrem sozialen Umfeld vertraut machte, desto stärker schwand der Neid, den ich anfangs unterschwellig gespürt hatte. Nadines Leben war nicht viel besser als meines, nur anders. Während sich bei mir die Ereignisse fortwährend überschlugen, schritt sie eine Einbahnstraße entlang, von der es keine Abzweigungen zu geben schien. Sie arbeitete im Betrieb ihres Stiefvaters, machte dort die Buchführung und kümmerte sich um Verträge mit dem Gastgewerbe. Selbst ihre geräumige Wohnung, von der aus sie einen direkten Blick auf die Altmühl hatte, die Lindach wie eine Sichel umfasst, lag im Hause des Vaters.
Ihr Bekanntenkreis schien nur aus Freunden zu bestehen, die sie schon lange kannte. Die Freundschaften wirkten oberflächlich. Seit der Trennung von ihrem Mann hatte sie sich anscheinend aus dem öffentlichen Leben weitgehend zurückgezogen – es sei denn, es ging um Berufliches. Ihr Leben kam mir ziemlich langweilig und eintönig vor.
»Warum hat sich Nadine eigentlich von diesem Gerald getrennt?« Ich legte das Foto des Mannes, mit dem Nadine einst vor den Altar getreten war, zur Seite.
»Was weiß ich.« Adrian zuckte mit den Schultern und nahm einen Schluck von der Piña Colada, die uns vor einigen Minuten direkt am Liegestuhl serviert worden war. »Was spielt das schon für eine Rolle?«
»Eine große.« Ich fixierte ihn mit meinem Blick. »Wenn ich ihn treffe, muss ich schließlich wissen, ob ich ihm freundschaftlich oder mit Vorbehalten begegne.«
»Sie werden ihm nicht begegnen.«
»Woher wollen Sie das wissen?« Ich war nicht bereit, so schnell nachzugeben. »Was ist, wenn er mir unerwartet gegenüber steht? So groß ist Lindach ja wirklich nicht, dass dieses Risiko völlig auszuklammern wäre!«
»Sie werden ihm nicht begegnen«, wiederholte Adrian, in dessen Stimme nun ein genervter Unterton mitschwang. »Er ist Entwicklungshelfer in Brasilien. Er kommt nicht nach Lindach zurück.«
»Entwicklungshelfer? Hier, in Brasilien?« Ich schaute ihn ungläubig an. »Es kann also sein, dass ich ihn hier treffe?«
»Herrgott noch mal!« Adrian setzte sich auf und verdrehte die Augen. »Dieses Land ist mehr als zwanzigmal so groß wie Deutschland und hat knapp 200 Millionen Einwohner. Wie hoch schätzen Sie die Wahrscheinlichkeit ein, dass Sie dem Mann hier über den Weg laufen?«
Seine Frage war eindeutig rhetorischer Natur.
»Ist Nadine etwa auch hier in Brasilien? Trifft sie sich mit Gerald?« Die Vorstellung, dass wir uns möglicherweise in diesem Moment nicht weit voneinander entfernt aufhielten, ließ mein Herz schneller schlagen.
»Unsinn!« Adrian schlug sich mit der flachen Hand auf den nackten Oberschenkel. »Hören Sie doch bitte endlich auf, so dumm daher zu reden! – Nadine ist irgendwo in Südamerika, weiß der Himmel wo! Aber sie ist ganz sicher nicht bei Gerald!«
»Wie können Sie da so sicher sein?«
»Halten Sie mich eigentlich für dämlich? Ich habe mich als erstes mit Gerald in Verbindung gesetzt. Wie ich schon vermutet hatte, ist Nadine nicht bei ihm, und er hat auch keine Ahnung, wo sie steckt. Die beiden haben keinen Kontakt mehr. – Ich würde wohl kaum eine Doppelgängerin engagieren, wenn ich das Original einfach nur nach Hause bitten müsste.«
Ich kniff die Augen zusammen. Die Geschichte wurde für mich immer abstruser.
»Was ist eigentlich, wenn Nadine plötzlich nach Lindach zurückkommt – unangemeldet? Was ist, wenn sie plötzlich vor mir steht, so gänzlich unvorbereitet? Dann fliegt Ihr Spiel auf, und Nadine bekommt den Schock ihres Lebens.«
»Erstens: Das wird nicht passieren. Nadine wird erst dann zurückkommen, wenn der alte Magnus tot ist.« Adrian leerte das halbe Glas Piña Colada mit hastigen Schlucken. Wieder einmal nannte er seinen eigenen Vater den »alten Magnus«, eine Eigenart, die mich immer noch irritierte. »Zweitens: Im Gegensatz zu Ihnen wusste sie, dass sie adoptiert ist. Sie hat vor Kurzem Einsicht in ihre Adoptionsunterlagen genommen. Dadurch hat sie erfahren, dass damals Zwillinge vor diesem Krankenhaus gefunden worden sind. Sie wollte Sie ohnehin kennenlernen.«
»Wollte?«
»Will.« Er sah mich mit festem Blick an. »Sie will Sie kennenlernen. Ganz gewiss. Sie wird sehr dankbar sein, dass Sie für sie eingesprungen sind, in dieser Notlage. Am liebsten hätte sie Sie damals sofort gesucht. Sie war ganz außer sich, als sie mir davon erzählte. Sie bat mich, ihr bei der Suche nach Ihnen zu helfen. Leider überschlugen sich die Ereignisse.«
»Nadine ist also Hals über Kopf aus Lindach abgehauen? Weshalb?«
Er verzog das Gesicht.
»Nadine und mein Vater sind sich massiv in die Haare geraten. Sie müssen wissen: Der alte Magnus hat sehr konservative Ansichten vom Leben. Und er ist ein unerbittlicher Despot. Er verträgt es nicht, wenn sich jemand gegen ihn stellt. Solange einer die Füße bei mir unter dem Tisch hat, wird nach meinen Regeln gespielt, war sein Wahlspruch. Ewiges Streitthema mit Nadine war die gescheiterte Beziehung mit Gerald. Der alte Magnus verkraftet die Trennung der beiden nur schwer. Für ihn sind das keine geordneten Verhältnisse, und Gerald war wie ein zweiter Sohn für ihn. Nadine hatte diesmal wohl die Nase voll. Ich weiß nichts Genaueres über diesen Streit, aber sie packte noch am selben Abend ihre Koffer und sagte mir, sie käme erst wieder, wenn den Alten das Zeitliche gesegnet hätte. Es reichte ihr offenbar endgültig.«
An dieser ganzen Geschichte konnte ich persönlich nur die letzten zwei Sätze nachvollziehen. Weshalb wohnte eine erwachsene Frau mit Studium überhaupt noch im Haus ihres despotischen Stiefvaters und hielt seine Launen aus? An Nadines Stelle wäre ich wohl schon Jahre zuvor getürmt!
»Und jetzt soll ich als Nadine zurückkommen und Ihrem Vater begegnen, als hätte es diesen Streit nie gegeben?«
Er fuhr sich mit der Zunge über die Lippen.
»Sie werden sich natürlich entschuldigen müssen.«
»Natürlich«, wiederholte ich und konnte mich des Sarkasmus, der sich meiner bemächtigte, nur schwer erwehren. »Ich trete diesem alten Mann gegenüber, quetsche ein paar Tränchen hervor und stimme ihm zu, dass meine Trennung von Gerald ein Fehler war. Nadine wird mich bei ihrer Rückkehr dafür lieben!«
»Wie ich schon sagte, es geht um Nadines Erbanteil.« Adrian ließ sich nicht provozieren. »Vater will sie schließlich enterben!«
»Ich verstehe noch immer nicht, weshalb Ihnen das so wichtig ist«, erwiderte ich. »Es ist für Sie doch vorteilhaft, wenn Ihr Vater Ihre Schwester enterbt. Dann sind Sie Alleinerbe.«
Er starrte mich an, als wäre ich von einem anderen Planeten.
»Denken Sie das?« Er klang regelrecht beleidigt. »Sie enttäuschen mich. – Als Einzelkind haben Sie die Stärke geschwisterlicher Bande eben nie kennengelernt. Ich würde alles für meine Schwester tun! Und umgekehrt würde sie dasselbe für mich tun. Wir hatten ein sehr enges Verhältnis.«
Sein linkes Augenlid zuckte – ein Tick, den ich bereits mehrmals an ihm bemerkt hatte, wenn ihm meine Fragen zu unangenehm wurden.
Die Geschichte rund um Nadine bekam mit jedem Tag mehr Kontur. Dennoch umschlich mich weiterhin der Verdacht, dass mir eine entscheidende Information fehlte.
Adrian war aufgestanden und zum Meer gegangen. Ich sah ihm zu, wie er sich in die Wellen stürzte und einige Längen ins offene Wasser hinausschwamm.
Ich hatte ihn bei unserer ersten Begegnung in Kleve unsympathisch gefunden, und ich hatte diesen ersten Eindruck bisher noch nicht revidieren können. Die Überheblichkeit, die er zeitweise an den Tag legte, war nur schwer zu ertragen. Er tat nicht nur mir, sondern auch den brasilianischen Barkeepern und Kellnerinnen gegenüber überlegen. Letzteren machte er sogar in meiner Gegenwart eindeutige Angebote. Die jungen Frauen reagierten sehr unterschiedlich darauf. Einige stiegen tatsächlich auf einen Flirt mit ihm ein. Ob anschließend mehr lief, konnte ich nicht beurteilen, denn spätestens nach dem Abendessen, das wir immer in einem anderen Strandrestaurant einnahmen, trennten sich unsere Wege. Es gab aber auch Frauen, denen seine Annäherungsversuche genauso auf den Wecker zu gehen schienen wie mir seine gesamte Art. Sie ließen sich weder von seinem Waschbrettbauch noch von den Dollarscheinen beeindrucken, mit denen er seit unserer Ankunft in Praia do Forte bei jeder Gelegenheit herumwedelte. Geld schien die Komponente in seinem Leben zu sein, mit der er sich stark fühlte.
Auf all meine Fragen lieferte er Antworten, die für mich weitere Fragen aufwarfen. Nach diesem Gespräch war mir nur eines klar: Dass er mir mehr von der Wahrheit verschwieg als offenbarte.
Ich mochte zwar keine eigenen Erfahrungen haben, was Geschwisterliebe betraf. Doch dass ein Halbbruder, den zudem satte elf Jahre Altersunterschied von seiner Schwester trennten, vor lauter Liebe 80.000 Euro an mich zu zahlen bereit war, nur um ihr Erbe zu retten, kam mir absolut absurd vor.
In allen Märchen, die mir meine Adoptivmutter als Kind vorgelesen hatte, hassten sich Stiefmutter, Stiefvater und Stiefkinder. Prinzessinnen und Prinzen waren grün vor Neid, wenn es darum ging, das Königreich des Vaters zu erben. Warum sollte es im wahren Leben anders sein?
Aber schließlich ging es um meine Schwester. Damit schüttelte ich diese Gedanken ab. Auch dem Geld war ich nicht mehr abgeneigt – jetzt, wo ich ein Gefühl dafür bekam, wie es sein musste, welches zu besitzen.
Ich stieg aus dem gemieteten Jeep und starrte ungläubig auf die drei heruntergekommenen Häuser, die sich um eine Tankstelle herum gruppierten. Links der Siedlung bogen sich Kokospalmen im Wind. Darunter standen mehrere rostige Autos mit deformierten Kotflügeln und zerbrochenen Fensterscheiben. An der rechten Seite der Siedlung führte die Küstenstraße vorbei, die Praia do Forte mit Salvador verband.
Der Staub, den die vorbeifahrenden Autos aufwirbelten, brannte in meinen Augen. Ich hob die Sonnenbrille vom Haar auf die Nase herab.
»Hotel Sol« stand auf dem roten Blechschild, das zwischen zwei Pfosten vor dem zweistöckigen Gebäude befestigt war. Der schwarze Schriftzug war mit Rostflecken gesprenkelt.
Über der einzigen Zapfsäule, die die Tankstelle zu bieten hatte, hing eine schmutzige, mit Ölspritzern übersäte brasilianische Nationalfahne. Bei jedem Windstoß wölbte sich das untere Ende des Stoffes, um schließlich mit einem lauten Klacken zurück an die metallene Zapfsäule zu schlagen.
Ich sah zum Wagen. Adrian saß noch immer hinter dem Steuer des Jeeps.
»Das ist nicht Ihr Ernst, oder? Ich werde hier ganz sicher nicht bleiben. Das ist am Ende der Welt! Hier gibt es nichts – nicht einmal ein Restaurant.«
»Der Besitzer des Hotels grillt abends auf der Terrasse«, erwiderte Adrian mit unbewegter Miene, die Augen wie üblich hinter den dunklen Gläsern der Sonnenbrille versteckt. »Ich habe gehört, seine Steaks sollen durchaus essbar sein. Im Übrigen verlange ich nicht, dass Sie hier ewig wohnen. Zwei Nächte, mehr nicht.«
»Sie haben mir noch immer nicht verraten, weshalb das notwendig ist. Wieso muss ich ein tolles Hotelzimmer an einem Traumstrand gegen diese Absteige im Nirgendwo tauschen?«
»Sie sind hier nicht, um Urlaub zu machen.« Er streckte mir einen Schlüssel mit Anhänger entgegen. »Das ist Ihr Zimmerschlüssel. Sie werden jetzt in dieses Hotel gehen und erst einmal Ihr Zimmer aufsuchen. Danach können Sie sich gerne auf die Hotelterrasse begeben.« Als er meinen skeptischen Blick bemerkte, fügte er hinzu: »Keine Sorge, es ist schöner, als es auf den ersten Blick aussieht.«
Den Schlüssel hatte ich inzwischen an mich genommen. Jetzt hielt er mir einen Schnellhefter unter die Nase.
»Wir treffen uns übermorgen um neun Uhr hier, genau an dieser Stelle.«
Es dauerte einige Sekunden, bis ich den Inhalt seiner Worte begriff. »Heißt das, Sie werden mich hier alleine lassen?«
Er lachte.
»Sie werden schon nicht vor lauter Sehnsucht nach mir umkommen! Und fressen wird Sie hier auch niemand. Lauter nette Leute, die nichts anderes sprechen außer Portugiesisch. Perfekt also für einen erholsamen Kurzausflug mit Übernachtung. So. Und jetzt nehmen Sie diese Mappe und gehen Sie auf Ihr Zimmer. Das Einchecken ist bereits für Sie erledigt.«
Er startete den Motor. Ich kam nicht dazu, einen genaueren Blick auf den Schnellhefter zu werfen.
»Warten Sie gefälligst«, herrschte ich ihn an. »Ich muss meinen Koffer noch ausladen!«
»Den brauchen Sie nicht. Kleidung finden Sie auf Ihrem Zimmer.«
Mit quietschenden Reifen setzte sich der Wagen in Bewegung und hüllte mich in eine Wolke aus Staub und Sand.
Einige Minuten verharrte ich bewegungslos und versuchte zu begreifen, was mir hier gerade widerfahren war. Dieser Typ hatte mich im Nirgendwo ausgesetzt, mit nichts als einem Zimmerschlüssel und einigen Blättern bedrucktem Papier.
Eine Katze folgte mir, als ich mich in Richtung des Hotels bewegte. Als ich an dem verrosteten Blechschild vorbeiging, öffnete sich die verwitterte Holztüre des Gebäudes. Ein dunkelhäutiger, gedrungener Mann mit Strohhut blinzelte kurz in die Sonne. Dann sah er mich und verharrte mitten in der Bewegung. Seine Augen waren groß und dunkel.
»Senhora«, sagte er. Es klang überrascht.
Unsicher, wie ich mit der Situation umgehen sollte, ließ ich den Schlüssel vor ihm baumeln und sagte so unbefangen wie möglich: »Olá!«
Er kratzte sich am Kinn. Dann bewegte er sich in Richtung der Zapfsäule. Während ich über die Schwelle ins Innere des Gebäudes trat, spürte ich seinen nachdenklichen Blick immer noch in meinem Rücken.
Augenblicke später stand ich vor Zimmer Nummer 12. Mein Herz klopfte, ohne dass ich genau sagen konnte, weshalb. Der Schlüssel knirschte im Schloss. Ich stieß die Tür auf und trat ein.
Sonnenlicht, das durch zwei große Fenster an der rechten Seite des Raums fiel, machte das Zimmer hell und freundlich. Der Boden, rot-blau gesprenkeltes Linoleum, war frei von Staub und fleckenlos. Es roch leicht nach Essig und parfümierter Seife.
In der Mitte des Raums stand ein weiß überzogenes Doppelbett, an jeder Seite ein schlichtes Nachtkästchen aus dunklem Holz. Die Mischung aus Essig und Seife kribbelte in meiner Nase. Ich öffnete eines der Fenster.
Adrian hatte recht gehabt. Es war nicht so schlimm, wie es auf den ersten Blick aussah. Unter meinem Zimmerfenster lag die Terrasse des Hotels, ungefähr viermal so groß wie mein Zimmer; ein mit Terrakottafliesen ausgelegter Platz, auf dem ein Grill, drei Liegestühle und einige kleine Plastiktische mit Stühlen standen.
An einem der Tische saß eine ältere Frau, vor sich eine Kiste kleiner Fische. Sie war offensichtlich dabei, sie zu entschuppen. Als sie den Kopf hob und sich unsere Blicke trafen, bemerkte ich ihre indigenen Gesichtszüge. Ich erinnerte mich an die Textpassage in einem der Reiseführer, die in Praia do Forte ausgelegen hatten. Über 400.000 Indios lebten angeblich in Brasilien, weniger als ein Prozent der Bevölkerung.
Ich rief ein freundliches »Olá!« nach unten, weil es mir angebracht schien. Die Frau mit den Fischen wandte wortlos ihren Blick ab und widmete sich wieder ihrer Arbeit.
Ich ließ mich auf das Bett fallen. Die Matratze war weich und ließ mühelos erahnen, dass vor mir schon Hunderte auf ihr genächtigt hatten.
Oberflächlich betrachtet, sah alles sauber aus.
Mein Blick fiel auf den breiten, dunklen Schrank gegenüber dem Fußende des Bettes. Hatte Adrian nicht von einem Koffer gesprochen, der mich angeblich erwartete?
Die Kleider, die sorgfältig auf Plastikbügeln an der Stange hingen, entsprachen mit ihren Blumenmustern und Rüschen zwar ganz und gar nicht meinem Geschmack, hatten jedoch alle Größe 34 – meine Größe. Die Schuhe, die auf dem Hartschalenkoffer aufgereiht waren – ein Paar Turnschuhe und zwei Paar Sandalen – passten mir, als wären sie für mich gemacht. Das überraschte mich. Schuhkauf war für mich immer ein Problem. Mit meinen kleinen Füßen – Größe 35! – musste ich stets ewig nach dem Passenden suchen.
Die Schuhe waren nicht neu. Die Sohlen wiesen deutliche Gebrauchsspuren auf; der Riemen der einen Sandalette war leicht eingerissen. Gehörten sie meiner Schwester?
Im Badezimmer, das kaum größer war als eine Abstellkammer, fand ich einen Kulturbeutel vor. Flüssigseife, Körperlotion und Shampoo waren nur noch halbvoll und Produkte bekannter internationaler Markenfirmen – mit deutscher Beschriftung. Die gebrauchte Zahnbürste – war es die von Nadine? Hatte meine Schwester hier gewohnt? Und warum war ich jetzt hier?