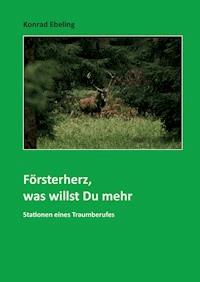
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Selten kommen in einem Forstmann verantwortlichvolles Jagen und Waldpflegen so harmonisch zusammen, wie bei Konrad Ebeling. Seine Menschen mitreißende Passion für Wald und Wild löst den vermeintlichen Widerspruch im praktischen Forstbetrieb auf. Als Bauernsohn in der Hildesheimer Börde mit der Natur und Jagd von Kindesbeinen aufgewachsen, geht Konrad Ebelings Lebenstraum mit der Leitung eines Forstamtes in der Lüneburger Heide in Erfüllung. Fast 30 Jahre lang treibt der Autor vor Ort sowie zwischenzeitlich auf Landesebene zwei Aufgaben vorbildlich voran: Die Jahrhundertaufgabe des Umbaus der Kiefern-Pionier-Wälder aus der Heideaufforstungszeit in naturnahe Mischwälder und eine damit verbundene dem Wild und Wald angepasste Jagdstrategie. Dabei verschweigt Konrad Ebeling nie, dass ihm beides gleichzeitig großen Spaß macht. In diesem Buch rücken die jagdlichen Höhepunkte seines Försterlebens in den Vordergrund. Mit leichter Feder, abgewogenem Sachverstand und einfühlsamer Beobachtungsgabe, aber auch mit großer Begeisterung und herzerfrischendem Humor zeichnet er die jagdlichen Freuden und Leiden im Revier und der ihn begleitenden Menschen nach. Der Leser erlebt die locker aneinandergereihten Erzählungen und Anekdoten hautnah mit und nimmt zugleich einen wichtigen Teil neuzeitlicher Jagdgeschichte in sich auf.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 290
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bildnachweis
Umschlagfoto:
Hartmut Kleinschmit
S.
→
Gertrud Schmidt
S.
→
Wolfram Ehrhardt
S.
→
/
→
Ruprecht Sinnhuber
S.
→
Martin Groffmann
S.
→
Wolfgang Fritzsche
S.
→
Hartmut Kleinschmit
S.
→
/
→
Jens Oehmigen (movit GmbH mediaproduktion, Hardegsen)
Rückseite
Heidrun Mitze, LAND & Forst-Redaktion
Danksagung
Für die Durchsicht des Manuskripts und die vielen wertvollen Anregungen gilt mein besonderer Dank Heide Ebeling, Irmgard Gruner, Hartmut Kleinschmit und Dr. Günter Lindloff.
Inhalt
Und herrlich ist das Studentenleben
Referendarzeit
Niederwildjagd in der Börde
Der Kuhlenkieker
Namibia
Im Naturschutzgebiet
Ein Traum geht in Erfüllung
Hamra
Schwedenwochen
Reisender in Sachen Forstwirtschaft
Gästehirsche
Drückjagden
Der Hirsch aus der Jafel
Und herrlich ist das Studentenleben
Im Juli 1971 stand ich auf dem Innenhof der Forstlichen Fakultät in Göttingen und muss wohl etwas ratlos gewirkt haben. Ein älterer, stattlicher Herr kam auf mich zu und fragte: „Kann ich Ihnen helfen?“ Ja, was wollte ich eigentlich? Ich hatte das Abitur in der Tasche und wollte studieren. Mein heimlicher Traum war Forstwissenschaft. Schon als kleiner Junge hatten mich die Geschichten in den Jagdzeitschriften und Jagdbüchern meines Vaters gefesselt und später waren es Bücher von Kramer, Frevert und Beninde, die meine Fantasie beflügelten. Aber waren meine geheimen Wünsche nicht völlig unrealistisch? Seit Generationen sind die Chancen, in den Forstberuf übernommen zu werden, immer sehr gering gewesen. Die großen Länderforstverwaltungen schalteten dem Studium ein Auswahlverfahren voraus und neben körperlicher Fitness mussten natürlich die Abiturnoten stimmen. Und dennoch, nur wenige der vielen Bewerber wurden auserwählt. Wer es geschafft hatte, konnte dann allerdings davon ausgehen, dass er später nach erfolgreichem Studium in den Staatsdienst übernommen wurde.
Ich war von Kindesbeinen an Brillenträger und mein Abiturzeugnis war alles andere als ein Glanzstück. Die mündliche Englischprüfung verfolgte mich noch Jahre nach meinem Schulabschluss. Wie viele andere Bauernsöhne Niedersachsens hatte ich die Michelsenschule in Hildesheim durchlaufen, die der Landwirtschaftskammer in Hannover unterstand und deshalb schon etwas speziell war. Zwischen Mittlerer Reife und der gymnasialen Oberstufe musste eine zweijährige landwirtschaftliche Lehre absolviert werden. Weil es mir auf meinem Lehrbetrieb so gut gefiel, schloss ich noch ein Gehilfenjahr an und verdiente damit etwas Geld. In der 12. Klasse erwischte es mich dann. Ich blieb hängen. Gute Freunde behaupten noch heute, wenn ich damals nicht meine spätere Frau Jutta kennengelernt hätte, wäre nie etwas aus mir geworden. Wie sagt es doch Schiller in der Glocke: „Sie mehrt den Gewinn mit ordnendem Sinn.“ Auf jeden Fall war ich über den Ausbildungsweg 22 Jahre alt geworden und mein Gesuch zur Teilnahme an einem Auswahlverfahren wurde mit dem Hinweis abgelehnt, dass ich die Altersgrenze überschritten hätte.
„Kommen Sie mal mit in mein Büro“, sagte der nette ältere Herr zu mir. Die Forstliche Fakultät war 1970 vom traditionsreichen Standort Hannoversch Münden nach Göttingen umgezogen. Alles war neu und wir gingen zu einem der drei Blöcke. Oben angekommen, konnte ich im Vorbeigehen auf dem Türschild des Büros lesen: „Prof. B. - Waldbau der gemäßigten Zonen“. In diesem Büro fielen die für meinen weiteren Werdegang so bedeutenden Worte: „Also junger Mann, die Chancen waren noch nie so gut wie heute.“ Dieses Gespräch war so ermutigend, dass ich mich nur wenige Tage später im Sekretariat der Georg August Universität in Göttingen für Forstwirtschaft einschrieb. Wenn man schon nicht später in den Staatsdienst übernommen werden konnte, warum sollte es nicht mit einem Forstamt im Privatwald klappen?
Forstliche Fakultät Göttingen
Wir waren 24 Studenten, die ihr Glück versuchten. Einige davon gehörten zu den Privilegierten, den Angenommenen. Das Studium umfasste seinerzeit acht Pflichtsemester mit insgesamt 28 Prüfungen und im 7. und 8. Semester wurde parallel zu den Vorlesungen die Diplomarbeit geschrieben. Obwohl ich zu Beginn von forstlichen Tagesfragen wenig verstand, weckte das Studium zunehmend mein Interesse. Selbst in den weniger beliebten Grundlagenfächern wie Chemie, Statistik oder Genetik wurden schwierige Zusammenhänge von den Professoren so anschaulich dargestellt, dass man erstaunlich viel verstand. Es war wirklich kein Vergleich zur Schule, und Kernfächer wie Betriebswirtschaft, Waldbau oder Bodenkunde machten richtig Spaß.
Gleich zu Beginn des Studiums schloss ich mit meinem Kommilitonen Wolfgang F. Freundschaft. Wir hatten schon einige Jahre den Jagdschein und fühlten uns im Vergleich zu vielen Mitkommilitonen als alte Hasen. Groß geworden sind wir beide in Niederwildrevieren. Bald schon wurden wir in Göttingen von verschiedenen Studentenverbindungen angeworben, man sagt „bekeilt“. Sollten wir uns binden? Das Verbindungsleben ist zeitaufwendig und durfte unser gemeinsames Ziel, später Forstamtsleiter zu werden, nicht gefährden. Wie stand es doch in den alten Forst- und Jagdbüchern: „Erst kommt der liebe Gott und dann…der Forstamtsleiter.“ Die Neugierde überwog aber und der Reiz, mal bei sogenannten „Alten Herren“ jagen zu können, war groß. Also ließen wir uns von einer traditionsreichen forstlichen Verbindung aufnehmen und wurden Fuchs, Chargierter und Präside. Es wurden legendäre Kneipen geschlagen und ausgiebige Tanzfeste gefeiert.
Kneipe
Neben Studenten der forstlichen Fakultät gehörten Landwirte, Betriebswirte, Juristen und Mediziner unserer Gesellschaft an. Wir haben viele schöne Stunden im Verbindungshaus oder bei unseren „Alten Herren“ verbracht. Manchmal wurde auch hart diskutiert und wenn es sein musste, Meinungsverschiedenheiten mit einem „Bierjungen“ beendet.
Mein sogenannter Leibvater – die Funktion entspricht einer Patenschaft – war Forststudent. Heiko B. hatte sein Praktikum im Sollingforstamt Winnefeld bei dem bekannten Forstamtsleiter Steinhoff absolviert. „Du kannst mit zur Drückjagd kommen, ich habe mit Steinhoff gesprochen“, sagte Heiko und löste damit bei mir natürlich Begeisterung aus. Ich hatte bis dahin keinerlei Erfahrung mit Hochwild und auf der Fahrt von Göttingen in den Solling stieg die Spannung mit jedem Höhenmeter an. Alles war neu. Nach der Begrüßung und der Freigabe durch den Forstamtsleiter wurden wir auf unsere Stände gebracht. Meine Nachbarn zur Linken und Rechten waren etwa 80 Meter entfernt. Wir standen in einem Buchenaltholz, vor uns auf ca. 100 Meter fiel der Blick auf eine große, geschlossene Verjüngungspartie. Das Treiben war wohl gut eine Stunde alt, da hörte ich vor mir in der Verjüngung ein leises Knacken. Ein Alttier mit Kalb löste sich aus der Dickung und wechselte im leichten Troll auf meinen Stand zu. Ich war sehr aufgeregt. Als ich den Mannlicher Stutzen im Kaliber 8x57 IS – damals noch ohne Glas – in Anschlag brachte, ging der Pulsschlag so richtig hoch. Auf 40 Meter verhoffte das Kalb, der Schuss fiel und zu meiner Erleichterung lag es im Feuer.
Nach dem Treiben riefen mir die Nachbarn Waidmannsheil zu. Auch Heiko war glücklich und wir beide machten uns ans Aufbrechen. Als unerfahrene Hochwildjäger brauchten wir dazu eine Ewigkeit und allmählich kamen Zweifel auf, ob das überhaupt ein Kalb war. Kurze Zeit später fuhr der Revierleiter an uns vorbei und sagte ganz beiläufig: „Das ist aber ein schwaches Kalb.“ Wir waren erleichtert und der Weg zum hirschgerechten Jäger war geebnet.
Zum Studium gehörten auch zwei achtwöchige Forstamtspraktika, die in die Semesterferien gelegt wurden. Wir waren natürlich daran interessiert, in jagdlich interessante Forstämter zu kommen. Ich fragte bei einem „Alten Herren“ an, also bei einem Forstamtsleiter aus meiner Verbindung, und erhielt eine Zusage. Der Weg führte mich in das Forstamt Knobben in den schönen Solling. Dort wurde ich der Revierförsterei Donnershagen zugeordnet. Der zuständige Revierleiter H. nahm mich sehr freundlich auf. Für den ersten Tag – es war Mitte Februar – steht in meinem Berichtsheft: „Am Nachmittag habe ich zusammen mit dem Revierförsteranwärter B. die drei vorhandenen Wildfütterungen beschickt. Gefüttert wird mit speziellem Rotwildfutter, Mais und Heu.“ Ja, es waren noch andere Zeiten.
Der ausgewiesen kompetente Revierleiter H. erkrankte leider schwer, so dass schon nach kurzer Zeit Oberförster M., Revierförsterei Solingen, die weitere Ausbildung übernahm. Es war für mich ein Glücksfall. Ich wurde in der Familie aufgenommen wie ein eigener Sohn, wohnte in der Försterei und nahm selbstverständlich am Essen teil. Im Revier wurde mir Hoch- und Niederdurchforstung, die Buchen- und Fichtenwirtschaft, die Verlohnung der Waldarbeiter, das Vermessen des Holzes – der gesamte Jahresablauf in einer Försterei nahegebracht. Auch in die Geheimnisse der „Hohen Jagd“ wurde ich eingeführt. Viele Dinge hat mir mein geschätzter Ausbilder in Versform mit ins forstliche Leben gegeben. Eine Kostprobe–Schnitthaar:
„Rund, gedrillt mit schwarzen Spitzen –
auf dem Rumpfe muss die Kugel sitzen.
Doch ist solch Haar glatt, ohne Beule –
verlass Dich drauf, es ist von der Keule.
Und ist es weiß, dünn, fein wie Flaum –
kurz waidwund, darauf kannst Du bauen.
Ganz langes Haar, rüsch und gebogen –
vom Halse sind sie weggeflogen.
Weiß-gelb bis weiß das harsche Haar –
die Hose glatt durchschlagen war.
Ganz kurzes Haar aschfahl und fein
vom Brustkern oder Lauf wird’s sein.
Gestanztes Haar ohne Lug und Trug –
die Kugel durch die Decke schlug.“
Jagdpraktisch war in den Monaten Februar und März natürlich wenig zu machen, nur Überläufer mit einer Gewichtsbegrenzung auf 40 Kilogramm waren frei. Mir wurde ein Hochsitz zugewiesen, von dem aus ich es doch mal versuchen sollte. Er stand am Unterhang eines Fichtenaltholzes, das mit Fichtenna-turverjüngungspartien durchsetzt war. Obwohl die Märzsonne schon viel Kraft aufwies, waren große Teile des Sollings noch mit Schnee bedeckt. Schon rechtzeitig hatte ich den Hochsitz bestiegen. Zwei Hasen konnte ich beobachten, die ganz offensichtlich in Frühlingsstimmung waren. Sie verschwanden in der vor mir liegenden Dickung und gleichzeitig sah ich, wie ein Fuchs in die Dickung schnürte. Kurze Zeit später setzte ein jammervolles Klagen ein. Hatte der Fuchs einen Hasen gegriffen? Einer der Hasen kam auf jeden Fall in Windeseile aus der Dickung und machte 100 Meter neben mir einen Kegel. Kurze Zeit später erschien der Fuchs am Bestandesrand, erspähte meinen Hasen und ging in Lauerstellung. Der Hase, liebestoll, hoppelte nun genau auf den Fuchs zu. Dann sah ich nur noch ein wildes Knäuel aus Fuchs und Hase und – oh Wunder – der Hase hoppelte davon.
Der Tag ging allmählich zur Neige. In der Dickung vor mir hörte ich es hin und wieder knacken. Das konnten Sauen sein! Mein Griff ging vorsichtig zur Büchse. Es tat sich aber lange Zeit nichts. Dem gelegentlichen Knacken folgten immer wieder lange Phasen ohne jegliche Geräusche. Der Tag war inzwischen der Nacht gewichen und nur der Schnee ließ noch Konturen erkennen. Da, plötzlich stand am Dickungsrand eine Sau. Ich nahm vorsichtig das Glas hoch und kam zu dem Schluss, die passt. Vor lauter Aufregung streifte ich beim Anheben der Büchse einen Hochsitzholm, worauf die Sau, die inzwischen weiter in das Altholz gewechselt war, kehrt machte. Kurz vor der Dickung verhoffte sie noch einmal und schon war der Schuss raus. Nach dem Schuss hörte ich es in der Dickung noch brechen, dann war Ruhe. Ich hatte kein gutes Gefühl, alles war so schnell gegangen. Unzufrieden mit mir baumte ich ab und fuhr zur Försterei. Da meine Gasteltern aushäusig waren, berichtete ich am nächsten Morgen den Vorfall verbunden mit meiner Einschätzung: „Das Gewicht wird stimmen, aber ich glaube es ging vorbei.“ Mein Ausbilder, die Ruhe selbst, sagte: „Na, da wollen wir doch mal sehen.“
Am Ort der Tat ging ich vor dem Revierleiter den Hang hoch, in Richtung des Anschusses. „Kommen Sie mal hier her“, rief er hinter mir. Vor lauter Aufregung hatte ich den Anschuss überlaufen. Eine dicke Schweißspur führte nach 20 Metern zur Sau. Sie hatte einen exzellenten Schuss, aber-war deutlich zu schwer. Es war eine Überläuferbache von gut 50 Kilogramm, ein für damalige Verhältnisse im Solling stolzes Gewicht. Große Teile des Sollings waren ja zu jener Zeit gegattert und die Gewichte der Sauen entsprechend gering. Dennoch wurde mir ein herzliches Waidmannsheil ausgesprochen. Es war meine erste Sau.
Den kennen Sie doch
Oberförster M. war auch sehr bemüht, meine Formen- und Artenkenntnisse zu verbessern. Einmal hielten wir an einem verschneiten Holzpolter. Oben auf dem Polter saß ein Vogel. „Den kennen Sie doch?!“. Es war weniger eine Frage, als eine klare Erwartungshaltung. Ich weiß bis heute nicht, was es war. Als ich verneinte, zeichnete mein Oberförster merklich. Seine Betroffenheit gab auch mir sehr zu denken. Zukunftszweifel überfielen mich. War ich für den Forstberuf wirklich geeignet? Brachte ich nicht viel zu wenig Arten- und Formenkenntnisse mit? Ich fuhr eiligst nach Göttingen und kaufte mir eine Karte, auf der die heimischen Vogelarten abgebildet waren. Mit Jutta hatte ich eine gemeinsame Wohnung, in der die Karte angebracht wurde. Als ich einmal mit meinem Fernglas in einem benachbarten Baum einen bunten Vogel entdeckt hatte und diesen auf meiner Karte als Buchfink identifizieren konnte, bin ich begeistert zum Tierzuchtinstitut gefahren. Jutta war dort angestellt. Und als ich dann von meinen Beobachtungen voller Enthusiasmus berichtete, stand zufällig der Präparator daneben. „Ist das was Besonders?!“, war sein süffisanter Hinweis. Dennoch, es war der Beginn einer sich entwickelnden, großen orni-thologischen Passion.
Jutta und ich, wir hatten uns in der Landjugend kennen gelernt. Sie stammt ebenfalls aus der Landwirtschaft und ist stolz, dass sie den Flüchtlingsausweis C besitzt. Ihr Vater war gebürtiger Ostpreuße. Neben der Landwirtschaft spielte in der Familie die Jagd immer eine große Rolle. Sie behauptet noch heute, sie sei auf mich nur aufmerksam geworden, weil ich im Kreis der Bauernsöhne vom Jagdscheinkurs erzählt hätte. Wir waren damals 19 Jahre alt.
Im Tierzuchtinstitut in Göttingen war sie als attraktive Assistentin von Professoren, Institutsassistenten und Doktoranden umgeben. Einige davon scharrten mächtig mit den Hufen. Durch meine regelmäßigen Besuche im Institut herrschte aber bald Beziehungsklarheit. Meine Anwesenheit wurde mit der Zeit nicht nur akzeptiert, ja es entstanden sogar Freundschaften fürs Leben. Ein türkischer Doktorand nannte mich „Oberlandforstmeister“. Wo er diesen Begriff her hatte, ist mir nie klar geworden. Als einige der Doktoranden in Göttingen an der Ausbildung zur Jägerprüfung teilnahmen, schloss sich Jutta an und wurde Prüfungsbeste. Unsere gemeinsame Passion hat uns bis heute begleitet.
Mondschein-Sauen
Einer der Doktoranden war der Sohn eines Klostergutpächters und eröffnete uns damit Jagdgelegenheit auf Schwarzwild. Bei Mondschein saßen wir an den großen Weizenfeldern des Gutes. Häufig hörten wir die Sauen genüsslich schmatzen, aber Anblick hatten wir selten. Das änderte sich, wenn der Weizen gemäht war. Die Sauen hielten noch eine Zeit lang ihren Wechsel und die Uhrzeiten ein. Ich erinnere mich an zwei spannende Nachtansitze.
Einer davon war Ende August. Jutta und ich hatten jeweils einen Hochsitz gegen 20 Uhr bezogen und verabredet, bis 24 Uhr zu sitzen. Die Hochsitze standen direkt am Waldrand, nur wenige Meter von der Grenze zum Staatswald. Vor uns abgeerntete, weitläufige Weizenfelder. Die Gleichförmigkeit der Strohschwaden gab den Feldern eine bemerkenswerte Geometrie. Das Tageslicht war gerade vom Mondlicht abgelöst, da wechselte eine starke Bache mit 5 Frischlingen auf die Stoppeln. Mit meinem sechsfachen Zielfernrohr konnte ich wohl die Bache erfassen, die Frischlinge verschwanden aber im diffusen Licht. Die Sauen hielten sich auch nicht lange auf und wechselten, noch lange sichtbar, auf ein anderes Ziel zu. Etwa zehn Minuten später erschien auf dem gleichen Wechsel eine einzelne, sehr starke Sau. Uns war zu Ohren gekommen, dass ein starker, alter Keiler hier seine Fährte ziehen sollte. Die Versuchung war groß. Kurz entschlossen ließ ich fliegen und sah außer einem Feuerschein nichts mehr. Mit meinem Fernglas suchte ich dann die Stoppeln ab, irgendwo musste doch ein dicker schwarzer Klumpen liegen? Vergeblich, nichts war zu sehen. Zweifel verdrängten meine anfängliche Euphorie. War das zu weit? Ich fing an, die Schwaden zu zählen, kam aber zu keinem vernünftigen Ergebnis. Da konnte nur eine Nachsuche am nächsten Morgen Klarheit bringen.
Für den Rest des Abends war Hahn in Ruh, das nahm ich mir zumindest vor. Aber bis 24 Uhr war noch viel Zeit. So gegen 23 Uhr hörte ich im Wald eine weitere Rotte anwechseln und kurze Zeit später stand eine einzelne Sau auf den Stoppeln – weit weg. Aber sie kam näher und näher, bis auf geschätzte 80 Meter. Im Mondlicht konnte ich deutlich erkennen, dass es ein Keiler war, von der Größe vermutlich ein strammer Überläuferkeiler. Ich kämpfte mit meinen Restriktionen und drückte ab. Die Sau verschwand im Niemandsland der vielen Schwaden. Völlig fertig von den Ereignissen baumte ich ab und fuhr zu Jutta. Dort angekommen soll ich gemurmelt haben: „Ich kann nicht mehr.“ Am nächsten Morgen wurde Wolfgang früh geweckt und zusammen mit Tünnes, unserem Teckel, fuhren wir zur Nachsuche. Nach 100 Metern fand Tünnes den Überläuferkeiler mit gutem Schuss. Dann baumte ich auf und wies Jutta und Wolfgang auf den ersten Anschuss ein. Sie entfernten sich und entfernten sich und mir wurde klar, dass ich auf eine viel zu große Entfernung auf den starken Keiler abgedrückt hatte. Er war klar Unterschossen. Es war mir eine Lehre fürs Leben.
Ein zweites Mal saßen Jutta und ich zusammen auf einem der Hochsitze. Das Jahr war weit fortgeschritten, die Stoppeln gegrubbert und auch der Mond schien nicht. Da das Gut benachbart zu Göttingen auf einem Hochplateau liegt, reicht der über Göttingen stehende Lichtkegel häufig aus, um auch ohne Mond verantwortungsbewußt jagen zu können. Hatte man den Hochsitz erreicht, so sah man allerdings erst einmal nicht viel, aber mit der Zeit wurde es besser. So gegen 20 Uhr beobachteten wir im Fernglas, wie sich eine Sau aus dem Waldrandschatten löste. Deutlich war zu erkennen, dass sie stark schonte. Der Entschluss war klar, aber das Licht doch ziemlich erbärmlich. Irgendwann war ich davon überzeugt, dass das Absehen nicht auf der Keule, sondern auf dem Blatt stand. Auf den Schuss hin stürmte die Sau auf unseren 11 Meter hohen Hochsitz zu und verendete 40 Meter neben uns, genau auf dem Grenzweg. Wir ließen uns Zeit und genossen die Situation. Etwa eine halbe Stunde später sahen wir im Wald Scheinwerferlicht. Die Türen klappten und ein Pärchen, Arm in Arm, wechselte auf dem Grenzweg genau auf unsere im Dunkeln liegende Sau zu. Wir waren gespannt, was passieren würde. Kurz vor der Sau stutzten sie und gingen schnellen Schrittes zum Auto zurück. Dann fuhren sie mit Scheinwerferlicht auf die Sau zu, hielten für Sekunden an, drehten eilig und fuhren dann sehr zügig von dannen. Was mögen sie gedacht haben? Wahrscheinlich hat dieses Erlebnis sie für den Rest des Abends genauso beschäftigt wie uns.
Deppoldshausen
Das Krokodil
Die Jagdkundeprüfung war eine der vielen Prüfungen im Forststudium. Die Vorlesungen wurden von Prof. N., Oberlandforstmeister a.D., und Prof. F., frisch berufener Wildbiologe der Fakultät, gehalten. Auch ist mir noch der von Prof. M-U. übernommene Vorlesungsteil zur Biologie des Auerhuhns in besonderer Erinnerung. Er ahmte dabei den Auerhahn nach, sprang beim sogenannten Schleifen von Tisch zu Tisch. Dieses Spektakel hatte sich in Göttingen herumgesprochen und so waren neben den Forststudenten auch Studenten anderer Fakultäten vertreten.
Vor allen Prüfungen hielten wir einen sogenannten Streberkonvent ab, das heißt, wir trafen uns zu dritt oder viert, gut vorbereitet und fragten uns anhand der Sehschlangen gegenseitig ab. Sehschlangen sind von Vorgängerjahrgängen aufgeschriebene Prüfungsfragen. Als wir in die Jagdkundeprüfung gingen, fühlten wir uns wie immer gut vorbereitet. Unsere Prüfungsgruppe bestand aus zwei Niedersachsen, einem Westfalen und einem Nigerianer. Der Verlauf der Prüfung ist wohl an Kuriosität kaum zu übertreffen.
Roy Makwe war negroid, dabei Albino. Er hatte eine helle Hautfarbe und leicht rötlich unterlaufene Augen. Durch sein Erscheinungsbild war er in Göttingen sehr bekannt. An ihn ging die erste Frage.
Prof.: Herr Makwe, Sie kommen aus Afrika?
Roy mit kurzer Antwort: Ja.
Prof.: Aus Nigeria?
Roy: Ja.
Prof.: Nennen Sie mir doch mal ein afrikanisches Säugetier.
Roy, lange überlegend, ganz lange überlegend, dann: Krokodil.
Nach kurzem Staunen konnte keiner der Anwesenden mehr das Lachen zurückhalten. Roy erhielt dann noch viele, in die Tiefe gehende wissenschaftliche Fragen, so dass er irgendwie die Prüfung schaffte. Die Kuriosität dieser Prüfung nahm aber weiter ihren Lauf. Ich war der Nächste.
Prof. N.: „Herr Ebeling, schauen Sie mal aus dem Fenster, wenn dort oben am Waldrand ein Reh steht, was denken Sie sich dabei?“ Ich muss ziemlich ratlos ausgesehen haben. „Na ja“, sagte der Prof., „es ist August.“ Ich war vollgepumpt mit Wissen, aber auf diese Frage war ich nicht vorbereitet. Bevor ich was Unsinniges sagen konnte, fuhr der Professor fort. „Na ja, es ist Blattzeit“, und erzählte anschließend voller Begeisterung, dass er gerade in seinem Lieblingsrevier Zorge/Harz einen Bock geschossen hatte. Ich hatte mich inzwischen erholt, stand geistesgegenwärtig auf und gratulierte dem Professor per Handschlag zum Waidmannsheil – unter Zeugen!
Der weitere Prüfungsverlauf war dann halbwegs normal. Aber die Prüfung war noch nicht zu Ende. Wolfgang kam dran. In den Streberkonventen hatte er auf die Frage nach Altersmerkmalen beim Rotwild sich folgende Antwort zurechtgelegt. Frage nach Sehschlange: „Ein Hirsch tritt auf die Schneise, nach welchen Merkmalen können Sie ihn einklassifizieren?“ Spezialantwort von Wolfgang: „Zuerst kommt immer der junge Hirsch, ich mache mich dann fertig, denn der alte kommt hinterher.“ Es kam wie es kommen musste. Wolfgang erhielt genau diese Frage und konnte seine Spezialantwort nicht mehr zurückhalten – zum Erstaunen des Professors.
Vor unseren Professoren hatten wir eine große Hochachtung. Ein wesentlicher Teil von ihnen hatte „Stallgeruch“, das heißt, sie hatten selbst das Forststudium und das Referendariat durchlaufen und leiteten neben ihrer Professur ein Lehrforstamt, jeweils in der Nähe der Uni. Dass wir unsere Jagdhunde verschiedenster Couleur mit in die Vorlesungen nahmen, war für alle Beteiligten selbstverständlich. Die Hunde, meistens leinenfrei geführt, kannten den Ablauf, suchten sich zu Beginn einer Vorlesung ein Plätzchen und wurden erst wieder munter, wenn zum Ende der Vorlesung zum Dank an den Professor anerkennend auf den Tisch geklopft wurde. Der eine oder andere fing dann auch schon mal an zu heulen.
Jutta und ich hatten unseren Teckel Tünnes getauft. Mein Vater hatte sich ihn – als Welpe – zur Fuchsjagd beschafft. Tünnes hatte aber eine absolute Abneigung zu Füchsen. Er ging zum Bau, nässte, zog die Rute ein und entfernte sich möglichst schnell. Das Urteil war klar - unbrauchbar! Daraufhin wurde er mein Uni-Hund und am Ende des Studiums hätte auch er ein Diplom verdient. Wir waren eine unzertrennbare Einheit, es sei denn, er machte sich selbstständig, um stundenlang bergauf, bergab zu jagen, ohne dass ich ihn zu fassen kriegte. Dann hätte ich ihn „umbringen“ können.
Der „Jahrhundertsturm“
Als meine Diplomarbeit anstand, begleitete Tünnes mich auch auf meinen Fahrten von Göttingen in das Norddeutsche Tiefland. Der Sturm vom 13. November 1972 hatte die Wälder Norddeutschlands weitgehend zerstört. In wenigen Stunden waren 15 Millionen Kubikmeter Holz geworfen worden oder zu Bruch gegangen. Es war klar, dass es einer gewaltigen logistischen Leistung bedurfte, das Holz aufzuarbeiten und ohne große Verluste marktgerecht zu verwerten.
Folgen des „Jahrhundertsturms“ vom 13.11.1972
Das Institut für Betriebswirtschaft der Fakultät unter Leitung von Prof. M. hatte eine Diplomarbeit mit dem Titel „Anwendungsmöglichkeiten der Netzplantechnik in Forstbetrieben zur Bewältigung der Aufgaben nach Sturmkatastrophen…“ angeboten. Ich übernahm diese Arbeit, obwohl Prof. M. als nicht ganz einfacher Diplom- und Doktorvater galt. Einige Arbeiten unter seiner Themenstellung sind nie beendet worden.
Aber es ging alles gut. Durch die Diplomarbeit erhielt ich wertvolle Einblicke in die laufende Praxis, bereiste niedersächsische Forstämter wie Ahlhorn, Cloppenburg, Sellhorn oder Ebstorf, lernte die Regionen, die forstfachlichen Probleme und die Menschen kennen. Überall wurde ich als kleiner Diplomand freundlich empfangen und konstruktiv begleitet. Herr Prof. M. hatte zudem erreicht, dass wir gemeinsam an den Holzmarktbesprechungen der damaligen Regierungsbezirke Oldenburg und Lüneburg teilnehmen durften. Auf diesen Besprechungen wurden die wichtigen Weichen zur Bewältigung der Sturmkatastrophe gestellt. Aus der Sicht eines Studenten war die Atmosphäre jener Besprechungen schon sehr beeindruckend. Eingehüllt im Zigaretten- und Zigarrenqualm saßen am Tisch vereint die damaligen Führungsspitzen aus Forstmeistern, Oberforstmeistern und Landforstmeistern, natürlich in Uniform, wie es zu der Zeit üblich war. Die Gesprächsatmosphäre war auch hier freundschaftlich, konstruktiv. Ich glaube, das hat die Forstpartie schon immer ausgezeichnet.
Auf den Fahrten zu diesen Besprechungen war ich bei Prof. M. meist Mitfahrer. Diese Fahrten waren nie langweilig. Prof. M. berichtete stets aus seinem reichhaltigen Erfahrungsschatz als Professor und Forstamtsleiter. Auf einer dieser gemeinsamen Fahrten führten bei ihm die intensiven Gespräche auf den Autobahnen zu einer gewissen Unkonzentriertheit. Er fuhr mit seinem Käfer mal schneller, mal langsamer – und das in dem Geschwindigkeitsbereich der LKW. Auch gelegentliches Hupen der LKW brachte keine Besserung. Mir wurde in dem kleinen Käfer heiß und kalt. Da passierte es. Wir fuhren auf der rechten Spur und ein LKW überholte uns - auf der Standspur! Der Professor völlig empört: „ Herr Ebeling, sehen Sie sich das mal an, das ist ja völlig unmöglich. Was sagen Sie dazu?“ Es gibt im Leben Situationen, da sagt man besser nicht die ganze Wahrheit.
Ich muss gestehen, dass die Ergebnisse meiner Arbeit zur Bewältigung des „Jahrhundertsturms“ praktisch nicht mehr zur Anwendung kamen, aber sie wurden doch hoch bewertet und rundeten damit ein beachtliches Diplomendergebnis ab. Es war geschafft: So schlecht wie ich in das Forststudium reingekommen war, so gut bin ich rausgekommen.
Referendarzeit
Im Forstamt Lüß
Ich hatte mich in Niedersachsen auf einen Referendarsplatz beworben und bekam eine Bestätigung. Der erste Ausbildungsabschnitt war für alle die Forstamtszeit. Unser guter Freund Günter, seinerzeit Doktorand am Tierzuchtinstitut in Göttingen und passionierter Jäger, ist in der Lüneburger Heide beheimatet. Durch seine Erzählungen machte er mir einen Aufenthalt in einem Heideforstamt schmackhaft, das in seiner Nachbarschaft liegt. „Probiere es doch mal im Forstamt Lüß“, war seine Empfehlung. Zum Forstamt Lüß, im Nordosten des Landkreises Celle gelegen, gehörten seinerzeit 6.600 Hektar geschlossener Staatswald. Ich fragte beim zuständigen Forstamtsleiter Dr. Sch. an und bekam eine Zusage.
Katastrophenbewältigung
Dr. Sch. war seit gut drei Jahren im Amt und ich sein erster Referendar. In den drei Jahren seiner Amtszeit waren bereits zwei Naturkatastrophen über das Forstamt gegangen – der „Jahrhundertsturm“ vom 13. November 1972 und der große Waldbrand vom August 1975. Im Forstamt mussten annähernd 300.000 Festmeter Kalamitätsholz aufgearbeitet, vermarktet und auf über 2.000 Hektar Neukulturen begründet werden.
In dieser Phase trat ich meinen Dienst im Forstamt an. Es war der 1. November 1975. Die Arbeiten liefen auf Hochtouren. Ich hatte mir fest vorgenommen, die Chance zu nutzen und alle Tätigkeiten im Forstamt, wie auch die Führungsaufgaben, weitestgehend zu durchdringen. Nach dem Referendariat wollte man ja in der Lage sein, ein Forstamt zu leiten.
Forstamt Lüß
Trotz aller Umstände hatte mein Chef den Humor nicht verloren. Das machte ihn sympathisch und erleichterte das Miteinander. Wir haben uns gut verstanden. Ob im Büro oder als Begleiter auf den Fahrten in die Forstamtsflächen, ich war eigentlich ständig an seiner Seite. Mitgenommen wurde selbstverständlich auch der Dackel des Chefs, ich glaube, er wog eher 20 als 15 Kilogramm. Dabei war er allerdings einigermaßen hochläufig. Am ersten Haltepunkt im Wald sprang er regelmäßig aus dem Auto und ging seines Weges. Wir fuhren weiter und weiter, hielten an verschiedenen Stellen, vom Hund war nichts mehr zu sehen. Anfangs hatte ich Dr. Sch. besorgt nach dem Verbleib gefragt. „Der findet schon allein nach Haus“, und so war es auch. Er kam auf der Spur des Autos – meistens ein bis zwei Stunden später – zum Forstamt zurück. Lag er im Büro, schnarchte er grundtief. Wie viele Anrufer, die den Chef sprechen wollten, haben wohl dieses Schnarchen im Hintergrund gehört?
Glück gehabt
Eines Tages rief einer der Revierbeamten an. Man merkte schon an der Reaktion des Amtsleiters, dass etwas Besonderes vorgefallen sein musste: „Kommen Sie, wir müssen uns einen verluderten Hirsch ansehen.“ Vor Ort angekommen, begrüßte uns der zuständige Revierförster der Revierförsterei Queloh, Herr E.. An dem Hirsch war nichts mehr zu erkennen. Das weitere Gespräch sollte für mich dann aber einen sehr positiven Verlauf nehmen.
„Herr Dr. Sch., ich habe gestern ein Rudel Kahlwild mit einem sehr geringen Hirsch gesehen, einem schwachen Gabler“, sagte Herr E.
„Kommt nicht mehr häufig vor“, erwiderte Dr. Sch.
„Hat der Referendar denn schon einen Hirsch geschossen?“, fragte dann der Revierleiter mich. Ich verneinte artig und merkte, dass diese Wendung des Gesprächs dem Chef nicht recht war. „Na, das wäre doch einer für Sie“, ließ Herr E. nicht locker. Dr. Sch. tat sich sichtlich schwer. Ich warja erst drei Wochen im Forstamt und damals gingen die Uhren noch anders. Mit der Freigabe eines Hirsches wurde sehr restriktiv umgegangen. Letztlich stimmte er zu und der Revierleiter gab mir noch mit auf den Weg, mich nun aber auch zu kümmern. Zwei Tage später rief mich morgens Herr E. an: „Ich habe den Hirsch wieder gesehen. Er steht in Abteilung 223. Sie müssen los.“ Mittags ging ich zum Chef und erzählte ihm das. Er wünschte mir Waidmannsheil. Im Rausgehen fragte ich ihn noch, ob die Freigabe sich ausschließlich auf den Gabler beziehen würde oder es auch ein anderer passender Hirsch der Klasse III sein könnte. „Ja, geht auch“, ich merkte, dass er die Freigabe inzwischen entspannt sah.
Nachmittags saß ich auf den empfohlenen Hochsitz. Vor mir kam zuerst eine ca. zehn Meter breite Abteilungslinie, dann folgte eine stubenhohe, lückige Kieferndickung, die wohl 200 Meter tief war. Daran schloss sich ein Kiefernstangenholz an, das ich von meinem Hochsitz noch teilweise einsehen konnte. Noch bei gutem Tageslicht zog ein Rudel aus der Kieferndickung in das Stangenholz ein. Es war das beschriebene Rudel, am Ende „mein“ Gabler und ein Sechser. Sie ästen ganz vertraut, die Entfernung betrug gut 200 Meter. Wie sollte mir dieses Rudel auf Schussentfernung kommen? Ich ging mal probehalber mit meinem Stutzen in Anschlag und hatte dabei den Gabler gut im Visier. Aber welchen Eindruck würde ich als junger Spucht hinterlassen, wenn ich auf diese Entfernung den Revierleiter zum Anschuss einweisen müsste? Völlig unmöglich, dachte ich, da fuhr einer der Forstwirte nach getaner Arbeit mit dem Moped auf einem nahegelegenen Schotterweg am Rudel vorbei. Beunruhigt zog das Wild wieder in die Kieferndickung ein. Nach einer Weile erschienen auf einer der Dickungslücken Alttier und Kalb. Sollte ich die Chance nutzen? Ich hatte ja erst ein Stück Rotwild erlegt und die Erlegung eines Stück Kahlwildes würde im Forstamt sicher gern gesehen werden. Entschlossen ging der Griff zum Stutzen, aber Alttier und Kalb standen so verschachtelt, dass ein Schuss nicht möglich war. Da sah ich im Zielfernrohr, wie ebenfalls der Sechser auf die Lücke zog. Noch besser, dachte ich, und wartete darauf, dass er sich breit stellen würde. Den Gefallen tat er mir aber nicht - und da kam auch schon der Gabler. Als er breit stand, drückte ich ab. Die Entfernung mag 140 Meter betragen haben. Nach dem Schuss preschte das Rudel auseinander und flüchtete in verschiedene Himmelsrichtungen. Vergeblich versuchte ich, dabei den Gabler zu entdecken. Hat er die Kugel? Diese unangenehme Ungewissheit über den Sitz des Schusses wollte mich gerade ergreifen, da sah ich beim Absenken meines Glases unmittelbar vor mir am gegenüberliegenden Dickungsrand – vielleicht zehn Meter entfernt! – ein verhoffendes Stück Rotwild, den Hirsch! Das Haupt und der Stich waren frei, der übrige Teil des Wildkörpers von der Kieferndickung verdeckt. Ich musste handeln. Verdammt, der Blick auf mein Gewehr zeigte mir, dass ich vor lauter Aufregung gar nicht repetiert hatte. Der Hirsch verhoffte immer noch. Ich schob ganz vorsichtig die Mündung des Stutzens auf den Hochsitzholm, repetierte blitzschnell und schon war der Schuss auf den spitz zu mir stehenden Hirsch raus und der brach in der Fährte zusammen. Puh, noch mal gut gegangen. Aber Moment mal, war das denn überhaupt der Gabler oder war es der Sechser? Hatte ich vielleicht sogar auf zwei Hirsche geschossen? Nicht auszudenken, dass könnte das frühzeitige Ende meiner Karriere sein!
Als ich vom Hochsitz stieg, zitterte ich in dieser Mischung zwischen Jagdfieber und Zukunftsangst dermaßen, dass ich Mühe hatte, die Sprossen der Leiter geordnet hinunter zu steigen. Es war der Gabler. Das Geweih des zweijährigen Hirsches war wirklich sehr kümmerlich, kaum Augsprossen. Der erste Schuss saß mitten auf dem Wildkörper und nur so konnte man sich erklären, dass er ausgehalten hatte.
Glück gehabt
Ich brach den Hirsch auf und fuhr voller Glücksgefühle zum Revierleiter. Der war leider nicht vor Ort und Handys gab es ja noch nicht. Also fuhr ich zum Forstamt, wo mein Chef nach wie vor am Schreibtisch saß. Er konnte es nicht glauben, wir hatten uns ja erst vor drei Stunden getrennt. Ich merkte, dass bei ihm die Spannung groß war, was wohl sein Referendar da vollbracht hatte. Alles war gut und ein paar Tage später wurde mein erster Hirsch gebührend in der „Alten Kamphütte“ totgetrunken. Alle Beamten waren da und blieben auch bis zum gemeinsamen Aufbruch am nächsten Morgen.
Hirschvater Reisch
Hin und wieder hatte ich Kontakt zu den Pensionären des Forstamtes. Viele von ihnen hatten am 2. Weltkrieg teilgenommen, einige von ihnen stammten aus dem Osten und waren dort auch forstlich groß geworden. Dazu zählte auch Oberförster Erich Reisch, der nach dem Krieg im Forstamt eine Revierförsterei leitete. Wenn im Forstamt ein Hirsch zur Strecke gekommen war, so nahm ihn Hirschvater Reisch – so wurde der Pensionär genannt – ausgiebig in Augenschein. Vorher gab es keine Auflassung. Ich habe dieses Spektakel einmal miterleben können. Auf der Strecke lag ein Sechser, ein typischer Abschusshirsch. Vater Reisch legte sich vor dem Hirsch auf den Boden, dann neben den Hirsch, links und rechts, stand auf, schüttelte sich den Dreck und die Nadeln von der Kleidung und sagte zum Erstaunen aller: „Meine Herren, aus diesem Hirsch hätte mal ein guter I b werden können.“
Die Haustiere meines Chefs
Während meiner Forstamtszeit war Tünnes natürlich mein ständiger Wegbegleiter. Wenn er auch von der Fuchsjagd nichts hielt, so war er doch richtig katzenscharf. Eines Tages fuhr ich zu einem Waldarbeitergehöft und stieg dort aus. Vor der Haustür lag eine große, wuschelige Katze. Ehe ich mich versah, startete Tünnes den Angriff. Ich machte mir Sorgen um die Katze. Doch es passierte das Gegenteil, die Katze saß oben auf dem Rücken meines Hundes. Der jaulte fürchterlich und suchte das Weite. Ich nahm meinen Hund, steckte ihn ins Auto und war sicher, dass er erst einmal bedient war.
Am Forstamt angekommen, saßen auf dem Hof die beiden stattlichen Katzen meiner Chef-Familie. „Na ja, der wird ja wohl nicht wieder…“, dachte ich so. Aber Tünnes gab wieder Gas, worauf die Katzen durch das offene Kellerfenster des Forstamtes flüchteten. Der Höhenunterschied zwischen Kellerfenster und dem Boden des Kellers betrug sicher 1,5 Meter. Tünnes schoss hinterher, es plumpste kräftig und die Hetze ging im Keller weiter. Ich klingelte etwas kleinlaut bei der Chefin und war froh, dass Frau Sch. Verständnis für diese Art Jagd aufbrachte. Der Vorfall vor dem Waldarbeitergehöft hatte bei Tünnes jedenfalls keine psychischen Beeinträchtigungen hinterlassen und ich gestehe, darüber war ich dann ganz froh.
Tünnes
Zu dem Inventar der Familie Sch. gehörte auch eine große, stattliche Ziege. Als ich gegen Mittag vom Wald kommend in das Forstamtsgehöft einbiegen wollte, sah ich, dass die Ziege mitten auf der Straße stand. Man sagt ja, dass sie ausgesprochen stur sein können. Was sollte ich machen, stehen bleiben konnte sie da nicht. Es war Winter, ich nahm meinen Schal und legte ihn um den Hals der Ziege. Nun passierte Folgendes: Nicht ich, sondern die Ziege zog mich von der Straße und galoppierte zum Forstamtshof zurück. Dort kam der Chef gerade aus seiner Dienstwohnung mit einem großen weißen Zettel in der Hand und sah staunend dem Spektakel zu. Die Ziege nahm nun – mich immer noch im Schlepptau – Kurs auf ihn, schnappte sich im Vorbeigaloppieren den großen weißen Zettel und mümmelte ihn in Windeseile auf. Und das ist kein Jägerlatein! Ich glaube, auf dem Zettel soll das Programm für den Nachmittag gestanden haben. So schnell hat sich der Chef auf jeden Fall nie wieder ein Konzept aus der Hand nehmen lassen.
Eine imposante Nachsuche





























