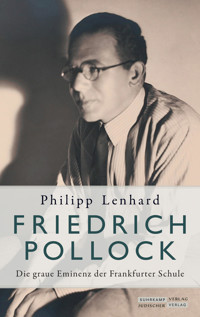
27,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Juedischer Verlag im Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Philipp Lenhards Buch ist die erste Biografie Friedrich Pollocks (1894–1970). Sie erzählt das Leben eines Mannes, der eine prägende Rolle in der deutsch-jüdischen Geistesgeschichte spielte und sich doch stets im Hintergrund hielt.
Ein Fabrikantensohn, der das Privateigentum abschaffen wollte; ein Jude, der vom Judentum nichts wissen wollte; ein Professor, der wenig publizierte; ein Ökonom, der sich an der Börse verzockte; ein Kommunist, der den Marxismus für anachronistisch hielt; und schließlich: ein kritischer Intellektueller.
Wer sich mit der politischen Kultur der Weimarer Republik, der Entstehung der »Kritischen Theorie« und der deutsch-jüdischen Emigration in die USA auseinandersetzt, kommt an Friedrich Pollock nicht vorbei. Der Weggefährte Max Horkheimers und Gründer des Frankfurter Instituts für Sozialforschung spielt als bedeutender Vertreter der Kritischen Theorie eine tragende Rolle in der deutsch-jüdischen Geistesgeschichte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 514
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Philipp Lenhard
Friedrich Pollock
Die graue Eminenz der Frankfurter Schule
Inhalt
Einleitung
1. Das Fin-de-Siècle in der Provinz
2. Ein Freund fürs Leben
3. Gescheiterte Revolution
4. Marxismus als Wissenschaft
5. Auf der Suche
6. Dämmerung
7. Praktische Hilfe
8. In der Emigration
9. Eine neue Ordnung?
10. Dinner im Weißen Haus
11. Rückkehr?
12. Das neue alte Deutschland
13. Automation
14. Über das Altern
Epilog
Verwendete Archivbestände
Abkürzungsverzeichnis
Abbildungsnachweise
Personenregister
Zeittafel
Anmerkungen
Einleitung
1964 veröffentlichte Max Horkheimer in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung anlässlich des siebzigsten Geburtstages seines engsten Mitstreiters und lebenslangen Freundes Friedrich Pollock eine kleine Würdigung. Darin heißt es: »Daß Friedrich Pollock […] ausschließlich als Gelehrter bekannt ist, läßt einzig durch seine tiefe Bescheidenheit sich erklären. Wie sehr seine wissenschaftlichen Leistungen der Beurteilung entscheidender wirtschaftlich-gesellschaftlicher Phänomene dienen mögen, seine praktische Wirksamkeit bei der Entstehung, Entfaltung und Erneuerung der Sozialwissenschaften in Deutschland, nicht zuletzt bei der Rettung einzelner ihrer Vertreter zur Zeit der Verfolgung, bildet ein bedeutsames Kapitel in der Geschichte des lange vernachlässigten Forschungszweiges. Sein der Pflicht unendlich viel mehr als dem eigenen Wohl gewidmetes Leben, die produktive Solidarität mit theoretischen Bestrebungen und Institutionen im einzelnen darzustellen, wäre ein Beitrag zum Verständnis der intellektuellen Situation des letzten halben Jahrhunderts.«1
Diese zugegebenermaßen recht hagiographischen Worte, die vom tief empfundenen Respekt vor der Lebensleistung eines Freundes zeugen, könnten dem vorliegenden Buch zweifellos als Vorwort voranstehen. Doch eine Antwort auf die Frage, warum der laut Horkheimer so immens wichtige »Beitrag zum Verständnis der intellektuellen Situation« der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts erst jetzt, fast ein halbes Jahrhundert nach Pollocks Tod rekonstruiert wird, erschließt sich, wenn man eine zweite, weniger überschäumende Würdigung kontrastierend hinzuzieht. Das Nachrichtenmagazin Der Spiegel publizierte nach dem Tod Pollocks am 16. Dezember 1970 einen Nachruf mit folgendem Wortlaut: »Der Mitbegründer des Frankfurter Instituts für Sozialforschung blieb bewußt im Schatten seines großen Freundes Max Horkheimer, dessen Helfer und Hausmeier er ein Leben lang war. Als Organisator und Finanzverwalter des Instituts hatte er Anfang der dreißiger Jahre Zweigstellen in London, Genf und Paris eingerichtet und damit die Fortführung der Arbeit im Ausland nach Hitlers Machtübernahme ermöglicht. […] Als Nationalökonom erwarb sich Pollock durch seine Veröffentlichungen den Ruf eines Kenners der marxistischen Ökonomie. Der Emeritus lebte im Nachbarhaus Horkheimers in Montagnola bei Lugano. Dort starb er am Mittwoch vorletzter Woche.«2
Auch der Spiegel erwähnt Pollocks wissenschaftliches Werk, mit dem er sich, so heißt es vage, einen »Ruf« als »Kenner der marxistischen Ökonomie« erworben habe – ob zu Recht oder zu Unrecht bleibt offen –, doch die Figur des »Gelehrten«, als die Pollock doch laut Horkheimer einzig bekannt geworden sei, bleibt im Spiegel nur eine blasse Randgestalt. Stattdessen wird er als »Finanzverwalter«, »Helfer«, »Nachbar«, ja »Hausmeier« Horkheimers dargestellt, der bewusst im Schatten der Öffentlichkeit geblieben sei. Es ist vornehmlich dieses Bild, das sich in der Rezeption der Geschichte der Frankfurter Schule etabliert hat. Horkheimers Würdigung musste vor diesem Hintergrund als Freundschaftsdienst, als Lobhudelei unter Kompagnons verstanden werden. Dass Pollock tatsächlich mehr war als nur ein »Hausmeier«, dass sein wissenschaftliches Werk, aber auch sein Lebensweg von überragender Bedeutung für das intellektuelle Profil des Instituts für Sozialforschung gewesen ist und zugleich Dutzende deutsch-jüdischer Intellektueller ihm ganz praktisch überlebensnotwendige Hilfe im Exil verdanken, wird in diesem Buch dargestellt.
Wie alle Persönlichkeiten, die so faszinierend sind, dass Historiker Biographien über sie schreiben, war freilich auch Pollock ein Mann kleiner und großer Widersprüche: Ein Fabrikantensohn, der das Privateigentum abschaffen wollte; ein Professor, der wenig publizierte; ein Ökonom, der sich an der Börse verzockte; ein Badenser, der sich nur noch im Englischen heimisch fühlte; ein Kommunist, der den Marxismus für anachronistisch hielt; ein Jude, der vom Judentum nichts wissen wollte; und schließlich: ein kritischer Intellektueller, der glaubte, das gute Leben in einer intimen, lebenslangen Freundschaft antizipieren zu können. Ihn als Individuum mit all seinen Konflikten, Stärken und Schwächen vorzustellen, die verschlungenen Wege seines Lebens nachzuzeichnen und zugleich in sein Werk einzuführen ist Zweck des vorliegenden Buches.
Weil der Einzelne einer bekannten Wendung Marx' zufolge immer auch ein »Ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse« ist, in denen er lebt, gewährt die vorliegende Studie darüber hinaus Einblicke in die politische, kulturelle und intellektuelle Geschichte des 20. Jahrhunderts. Doch sosehr der zeitgeschichtliche Kontext die konkreten Entscheidungen, Handlungen und Denkweisen der historischen Persönlichkeit auch immer prägen mag, so sehr ist doch davor zu warnen, das Individuum als bloßen Knotenpunkt allmächtiger Triebkräfte wahrzunehmen. Der Begriff des Individuums, dem die vorliegende Biographie trotz oder gerade wegen seiner Gebrochenheit durch die Verheerungen der Moderne noch immer verbunden ist, kann nur dann sinnvoll verwendet werden, wenn der Einzelne nicht vollkommen mit seiner Zeit identisch ist, sondern sich auch durch seine Abweichung, durch sein Überschreiten der bestehenden Normen und seinen Widerspruch zum gesellschaftlichen Mainstream auszeichnet. Das vorliegende Buch ist somit keine Gesellschaftsbiographie, die dem Glauben verfällt, anhand eines einzigen Menschen könne sich das Jahrhundert ablesen lassen, sondern ganz bewusst eine Studie über eine fesselnde Persönlichkeit, die in einer Zeit gewaltiger Katastrophen, Konflikte und Umbrüche lebte und in ihrer eigenen, wie wir sehen werden, durchaus eigentümlichen Weise auf diese reagierte.
Wer sich mit der Geschichte der deutschen Soziologie, des westlichen Marxismus, der sogenannten »Frankfurter Schule« oder auch der deutsch-jüdischen Emigration in die USA auseinandersetzt, kommt an Pollock nicht vorbei. Sein Name taucht in der Literatur und vor allem in den Quellen immer wieder auf, und doch ist Pollock, nach einem Wort von Rolf Wiggershaus, »der letzte Unbekannte der Frankfurter Schule« geblieben.3 Als Wiggershaus seine Diagnose 1994 niederschrieb, hoffte er, damit die Aufmerksamkeit der Forschung auf ein Leben zu lenken, das innerhalb der Geschichte des Instituts für Sozialforschung eine prominente Rolle einnahm. Doch in den mehr als zwanzig Jahren, seit Wiggershaus' knappe biographische Skizze erschien, hat sich nichts Wesentliches am Bekanntheitsgrad Pollocks geändert. Noch immer fristet er ein Schattendasein hinter den Stars der Kritischen Theorie wie Theodor W. Adorno, Walter Benjamin, Max Horkheimer oder Herbert Marcuse. Nur eingefleischten Experten ist ein kleiner Ausschnitt seines Werkes bekannt und von wenigen Ausnahmen abgesehen ist Pollocks theoretische Arbeit einzig als Fußnote zu den anerkannten Denkern der Frankfurter Schule rezipiert worden. Seine immense theoriegeschichtliche Bedeutung für die Entwicklung der Kritischen Theorie ist bisher höchstens in Ansätzen erfasst.4
Dies erstaunt umso mehr, als Pollock keine Randfigur war, sondern als Mitbegründer und langjähriger (Co-)Direktor des Instituts für Sozialforschung in höchstem Maße die persönliche wie theoretische Kontinuität der Frankfurter Schule repräsentierte und deren wissenschaftlichen Weg entscheidend mitprägte. Der nun endlich vorliegende erste Band der Gesammelten Schriften, der die Frühen Schriften aus der Zeit vor 1933 enthält, mag, so ist zu hoffen, zusammen mit den fünf weiteren geplanten Bänden das Interesse für Pollocks Werk erhöhen.5 Wie nicht zuletzt an der ausgezeichneten, seit 1985 im S. Fischer Verlag erschienenen Horkheimer-Gesamtausgabe zu sehen ist, kann eine solche Veröffentlichung für die intellektuelle Auseinandersetzung mit einem bedeutenden Denker und dessen Werk äußerst fruchtbar sein. Sie lässt das Werk, trotz aller Beeinflussungen von außen, auch als immanent sich entwickelnde Gesamtheit erscheinen, die sowohl durch Kontinuitäten als auch durch Fortschritte, Revisionen und Neuentdeckungen gekennzeichnet ist. Dies hilft, Pollock nicht nur in Abhängigkeit zu anderen, bekannteren Vertretern der Kritischen Theorie zu verstehen, sondern auch als originären Denker, der seinerseits andere nachhaltig beeinflusst hat.
Ganz ähnlich verhält es sich mit Pollocks Leben: Anders als in der bisherigen Literatur zur Geschichte der »Frankfurter Schule«, in der Pollocks Biographie nur dann Erwähnung fand, wenn sie Informationen über Max Horkheimer, Theodor Adorno, Walter Benjamin, Herbert Marcuse, Leo Löwenthal oder Franz Neumann bereithielt, wird auf den folgenden Seiten gezeigt, dass Pollocks Lebensgeschichte mindestens ebenso spannend ist wie die seiner Mitstreiter. Hin- und hergerissen zwischen dem Leben auf zwei Kontinenten, zwischen revolutionärer Sehnsucht und realpolitischer Skepsis, zwischen einem theoretischen Pessimismus und einer utopischen Existenzweise, zwischen weltbürgerlicher Selbstdefinition und antisemitischer Fremdzuschreibung war Pollocks Leben durch die Spannung zwischen seinen Vorstellungen, Überzeugungen und Träumen auf der einen Seite und der als zunehmend feindlich erfahrenen Außenwelt geprägt. Nicht zuletzt seine symbiotische Freundschaft mit Horkheimer, die zweifellos aus sachlichen Gründen im Zentrum einer jeden Pollock-Biographie stehen muss, bezog ihre Dynamik und Energie aus dieser Konstellation.
Auch Pollocks Version der Kritischen Theorie spiegelt diese Widersprüchlichkeit, diese Zerrissenheit wider. Weil Pollock es sich zum Grundsatz machte, auf breiter empirischer Grundlage antizipierend Theorie zu treiben und dadurch gesellschaftliche Tendenzen der Zukunft aufzuspüren, war bei ihm die Fallhöhe gewiss größer als bei rein deskriptiv arbeitenden Sozialwissenschaftlern. Manche seiner Prognosen mögen sich daher als falsch oder zumindest übertrieben erwiesen haben. Andere, wie etwa die einer bevorstehenden »Revolution der Roboter«, vor der Pollock in den sechziger Jahren warnte, klangen damals, als seien sie direkt einem Science-Fiction-Roman entnommen. Heute beherrschen die Debatten über Roboter und Automation wieder die Schlagzeilen.6 Obwohl seine Analysen einer anderen, uns bisweilen fremd erscheinenden Zeit entstammen, sind viele von ihnen – etwa über die wachsende ökonomische Überflüssigkeit der Menschen, die Automatisierung der Industrie oder die zunehmende Bürokratisierung der Gesellschaft – erstaunlich aktuell. Pollock hat diese Entwicklungen, die sich in seiner eigenen Zeit erst partiell abzeichneten, in ihrem totalen Anspruch hellsichtig vorausgeahnt und beschrieben. Wenn es gelingen sollte, diese und andere Diagnosen wieder ins Bewusstsein einer kritischen Öffentlichkeit zu heben, wäre nicht nur der Anspruch des Autors erfüllt – es wäre auch eine dem Werk Friedrich Pollocks angemessene Form der Ideengeschichte.
* * *
Dieses Buch wäre ohne vielfältige Hilfe nicht entstanden. Danken möchte ich allen voran Michael Brenner für die jahrelange Unterstützung und wissenschaftliche Förderung. Eine wichtige Phase in diesem Buchprojekt war auch die Zeit als Gastwissenschaftler am Institute of European Studies der University of California in Berkeley, die vom Deutschen Akademischen Austauschdienst großzügig gefördert wurde. Martin Jay danke ich herzlich für die vielen anregenden Diskussionen über Friedrich Pollock, ganz besonders aber auch für den Zugang zu seinem privaten Archiv. Während eines Aufenthalts als Gastwissenschaftler am Deutschen Literaturarchiv in Marbach hatte ich zudem die Gelegenheit, verschiedene Nachlässe zu sichten und mich über einen längeren Zeitraum hinweg ungestört dem Schreiben zu widmen. Dafür sei ganz besonders Caroline Jessen gedankt.
Mathias Jehn, Oliver Kleppel und Stephen Roeper vom Archivzentrum der Universitätsbibliothek Frankfurt am Main waren mit ihrer Hilfsbereitschaft und Unterstützung über die Jahre hinweg für die Entstehung dieses Buches unverzichtbar. Furio Cerutti, Carlo Campani und Maria Enrica Vadalà haben meine Arbeit mit dem bislang noch weitgehend unbekannten Teilnachlass in der Universitätsbibliothek Florenz bereitwillig unterstützt. Auch Carol A. Leadenham von der Hoover Institution in Stanford, Robert Bierschneider vom Staatsarchiv München, Jochen Rees vom Landesarchiv Baden-Württemberg, Hans-Peter Widmann vom Stadtarchiv Freiburg im Breisgau, Claudius Stein vom Universitätsarchiv München, Melissa McMullen vom Bibliotheksarchiv der State University of New York in Albany sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der New York City Municipal Archives, des Leo Baeck Institute New York und der Asociación de Genealogía Judía de Argentina möchte ich für ihre Unterstützung herzlich danken. Christine Broit, Liliana Ruth Feierstein und Carlos Abraham Weil haben mir geholfen, die argentinischen Spuren der Familie Pollock nachzuverfolgen.
Thomas Sparr und Sabine Landes vom Suhrkamp Verlag danke ich für ihre Unterstützung und für das sorgfältige Lektorat. Die Berthold Leibinger Stiftung hat durch ihren Druckkostenzuschuss dazu beigetragen, dass das Buch in dieser schönen Form erscheinen konnte.
Aufschlussreiche Hinweise habe ich zudem von John Abromeit, Nicola Emery, Jan Gerber, Sander Gilman, Jürgen Habermas, Dirk Heißerer, Hans Dieter Huber, Doris Maja Krüger, Johannes Platz, Gregor-Sönke Schneider, Bernd Serger, Andrea Sinn und Jörg Später erhalten. Alex Gruber, Hartmut Lenhard, Janina Lenhard, Niklaas Machunsky und Elisabeth Uebelmann haben verschiedene Versionen des Manuskripts gelesen und mir wertvolle Anregungen gegeben.
1. Das Fin-de-Siècle in der Provinz
Ein riesiger, massiver Holztisch in der Mitte des Saales, eingedeckt für siebzehn Personen. Es ist Freitagabend, der 5. Februar 1943, kurz vor acht, mitten in Washington, D. C. Draußen ist es kalt, um null Grad, doch der Saal ist gut beheizt. Das Kerzenlicht spiegelt sich in den blank polierten Weingläsern, die aufwendig zu einem Fächer drapierten Servietten liegen nun gefaltet neben den Tellern. Die Bediensteten servieren einen Gang nach dem nächsten, es duftet nach gutem Essen. Es gibt Austern, gebackenen Schinken mit Ananas, verschiedene Gemüse als Beilage, dazu Salat und Käse. Einer der Gäste hat sich sichtlich in Schale geworfen, er trägt einen Dreiteiler mit Fliege. Die dunkelbraunen Haare sind sorgfältig mit Pomade zurückgekämmt. Durch seine schwarzumrandete Brille fixiert er die ihm gegenübersitzende Frau und spricht mit ruhiger Stimme auf sie ein. Er bekräftigt seine Worte mit gestikulierenden Händen, die seine Souveränität unterstreichen sollen, aber es ist ihm trotzdem ein Hauch von Nervosität anzumerken. Die Angesprochene hört aufmerksam zu, schaut ihn mit ihren freundlichen blauen Augen an, manchmal nickt sie leicht. Auf ihrem bis zum Hals geschlossenen weiten Kleid ruht eine Perlenkette. Bisweilen schaut die fast 60-jährige, resolute Dame nach rechts zu ihrem Gatten, der eher teilnahmslos mit seinem Essen beschäftigt ist. Ihr Gatte – das ist der 32. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, Franklin Delano Roosevelt. Seine Frau Eleanor hat die um den reichhaltig gedeckten Esstisch sitzenden Gäste eingeladen, die nun seine Abendgesellschaft bilden. Eleanor Roosevelts Neffe Henry ist gekommen, außerdem die Schwiegertochter Ruth Josephine.1
Inmitten dieser familiären Runde sitzen, nicht so ganz ins Bild passend, auch vier Gäste aus Deutschland, allesamt inzwischen amerikanische Staatsbürger, die ihre Pläne für eine europäische Nachkriegsordnung präsentieren wollen. Der ebenfalls anwesende Vizepräsident Henry A. Wallace notiert später über zwei der Gäste: »Lowe and Polak are Jews«, woher auch immer er diese Information hat, und fügt anerkennend hinzu, sie hätten eine exzellente Ausbildung in Wirtschaftsstatistik genossen.2 »Polak« heißt eigentlich Pollock, doch in der amerikanischen Aussprache klingen beide Namen nahezu identisch.
Für Friedrich Pollock, den Mann mit Dreiteiler und Fliege, ist dieser Abend im Februar 1943 der Höhepunkt seines Schaffens.3 Sein Freund Max Horkheimer gratuliert ihm einige Tage später aus Kalifornien zu der einzigartigen »Möglichkeit, Gesprächen von historischer Bedeutung zuhören zu können«.4 Pollock fühlt Genugtuung. Der inzwischen Jahrzehnte währende Einsatz dafür, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, hat ihn vom beschaulichen Freiburg im Breisgau durch halb Europa bis ins Weiße Haus geführt. Jetzt hat er die Gelegenheit, vor dem mächtigsten Mann der Welt seine Ideen und Pläne auszubreiten – auch wenn ihm vorerst nur dessen Frau wirkliche Aufmerksamkeit schenkt. Lang und breit erklärt er, nur die Einrichtung einer »wahren Demokratie« in Deutschland könne langfristigen Frieden bringen. Er verstehe, dass Teile des State Department und der Armee eine Militärverwaltung bevorzugten, doch sei dies nur eine kurzfristige Lösung. Auf lange Sicht bestehe die Gefahr, dass Europa nach einem Abzug der Besatzungstruppen »entweder kommunistisch oder faschistisch« würde.
Die First Lady folgt seinen Ausführungen mit großem Interesse, während der Präsident sich vom etwas oberlehrerhaften Stil Pollocks genervt zeigt. Trude Lash, eine der engsten Vertrauten Eleanors, die wie Pollock aus Freiburg stammt und ebenfalls an dem Abendessen teilnimmt, bemerkt zuhause gegenüber ihrem Mann: »Die Deutschen waren nicht so klar und gut wie letztes Mal. Für das Weiße Haus, den Vizepräsidenten und den Präsidenten war das zu viel. Ihr Auftreten war zu professoral und am Ende forderte der Präsident sie auf, Schulbücher zu verfassen – und behandelte sie damit wie Schulmeister, was insbesondere Pollock Kummer bereitete.«5 Die Sorgen waren allerdings unbegründet, denn es sollte nicht die letzte Unterredung mit den Roosevelts bleiben.
Doch wie kam es eigentlich dazu, dass ausgerechnet Friedrich Pollock zum Abendessen in die 1600 Pennsylvania Avenue NW eingeladen wurde? Was war das für ein Leben, das im Obergeschoss eines kleinen Damenmodegeschäfts in der Freiburger Innenstadt seinen Anfang nahm und bis ins Zentrum der politischen Macht des 20. Jahrhunderts führte?
* * *
Als Friedrich Pollock am 22. Mai 1894 in der 50 000 Einwohner zählenden badischen Universitätsstadt Freiburg im Breisgau zur Welt kam,6 war sein Geburtsort eine mittelgroße Provinzstadt – gerade groß genug, dass städtische Sozialformen, unternehmerisches Know-how und wissenschaftliche Neuerungen spürbar waren, andererseits aber doch so klein, dass das traditionelle Gesellschaftsgefüge durch die politischen und ökonomischen Umwälzungen nicht aus den Angeln gehoben wurde. Die 1457 gegründete Albert-Ludwigs-Universität hatte als eine der ältesten und renommiertesten Hochschulen Deutschlands über 2000 Studenten (erst 1899 wurde die erste Frau immatrikuliert), die im städtischen Leben gut sichtbar waren. Das liberal und bürgerlich geprägte Freiburg hatte nach dem deutsch-französischen Krieg enorm von der Annektierung des Elsass profitiert, insbesondere von der neu errichteten Eisenbahnverbindung nach Colmar. Der wirtschaftliche Aufstieg schlug sich auch in der Architektur und Infrastruktur Freiburgs nieder: Seit 1891 gab es einen Pferdeomnibusbetrieb, ab 1901 sogar eine elektrische Straßenbahn; zahlreiche vom Historismus beeinflusste Bauten entstanden und veränderten das Stadtbild. In der Folge dieses rasanten wirtschaftlichen und kulturellen Aufstiegs wuchs die Bevölkerung bis zum Ersten Weltkrieg auf über 80 000 an, vor allem durch den Zuzug wohlhabender Bürger aus dem Ruhrgebiet und aus Hamburg, die 1892 vor einer Choleraepidemie bis an den Rand des Schwarzwaldes geflohen waren.
Auch die kleine jüdische Gemeinde, die zur Zeit von Friedrich Pollocks Geburt etwa 1000 Mitglieder hatte, war fest im Bürgertum verankert und pflegte einen liberalen Ritus, was häufig zu Konflikten mit der benachbarten Gemeinde in Sulzburg führte, die das Paradebeispiel einer orthodoxen jüdischen Landgemeinde darstellte.7 Als 1886 der Sulzburger Rabbiner verstarb, wurde die Gemeinde im Zuge einer Gebietsreform derjenigen in Freiburg angeschlossen. Anlässlich der Ausschreibung einer neuen Rabbinerstelle in Freiburg klagte die orthodoxe Zeitschrift Der Israelit: »Die Freiburger Gemeinde ist streng – unfromm. Eine Orgel spielt dort am Sabbat und Feiertage: gesinnungstüchtigen, prinzipientreuen Rabbinern war also die Bewerbung unmöglich gemacht. Nun, wie es ein altes Sprichwort ist, daß wie die Gemeinde, so der Rabbiner, so hat auch die Freiburger Gemeinde einen Rabbiner bekommen, der seiner ›Richtung‹ nach vollkommen für sie geeignet ist. Und wir sind tolerant genug, den Freiburgern ihren Rabbiner zu gönnen; nur eines wünschen wir, daß er uns nicht aufgedrängt werde.«8
Der für die Frommen offenbar unzumutbare Rabbiner, von dem hier die Rede ist, hieß Adolf Lewin und stammte aus Posen. Er war am berühmten Breslauer Jüdisch-Theologischen Seminar ordiniert worden und hatte vor seiner Anstellung in Freiburg bereits reichlich Erfahrung als Rabbiner im polnischen Koźmin sowie in Koblenz gesammelt. Lewin prägte die Gemeinde in seiner 24-jährigen Amtszeit nachhaltig. In der 1870 eingeweihten, ersten neuzeitlichen Synagoge Freiburgs führte Lewin 1894 eine neue Synagogenordnung ein, die unter anderem verbindlich einen bürgerlichen Kleidungsstil für den Gottesdienst vorschrieb: »Es wird von den Synagogenbesuchern erwartet, daß sie in passender, möglichst dunkler Kleidung erscheinen. […] Verheirathete Gemeindemitglieder müssen an Samstagen und Festtagen mit schwarzen Cylinderhüten bekleidet sein. Bei Erwachsenen ist dunkler Hut geboten.«9 Stattdessen wurde das Tragen des Gebetsmantels ebenso untersagt wie lautes Beten. Mit dem liberalen Judentum Lewins war zugleich ein ostentativer Patriotismus verbunden, der insbesondere in Auseinandersetzungen mit Judenfeinden selbstbewusst hervorgehoben wurde, wenn diese die Juden der nationalen Unzuverlässigkeit bezichtigten.10 Lewins Haltung war damit charakteristisch für viele Mitglieder der Freiburger jüdischen Gemeinde: Der bürgerliche Habitus verband sich mit einer sehr selektiven religiösen Praxis, so mancher entsagte dem Gemeindeleben sogar vollständig, ohne formell auszutreten. Das Judentum bestimmte zwar meist nicht mehr den Alltag, die jüdische Identität wurde aber gegenüber Angriffen von außen selbstbewusst verteidigt.
Familie Pollock, 1902
Auch Friedrich Pollocks Eltern scheinen diesem Typus entsprochen zu haben. Ein Foto aus dem Jahre 1902 zeigt die vierköpfige Familie in geradezu klassisch bürgerlicher Selbstinszenierung: Der Vater, Julius Pollock (1866-1937), einen Kaiser Wilhelm II. Respekt zollenden Bart tragend, ist mit Abstand die größte Person auf dem Bild. Er repräsentiert das Zentrum der Familie und richtet seinen Blick nach außen, auf die Gesellschaft. Die Mutter, Elisabeth »Elsa« Pollock (1867-1930), züchtig gekleidet, schaut zur Seite auf den jüngeren der beiden Söhne, Hans Pollock (1895-1973), der einen seinerzeit modischen Matrosenanzug trägt. Auch Friedrich Pollock, ganz rechts, trägt diesen Anzug, der dem hohen Ansehen der kaiserlichen Marine entspricht. Er steht jedoch etwas abseits, ganz so, als ob er bereits den ersten Schritt gemacht hätte, der eines Tages in die Unabhängigkeit führen sollte. Gleichwohl hält er sich noch mit einem Arm an der Mutter fest, die den Kopf von ihm abwendet.
Zweifellos waren solche in bürgerlichen Kreisen ganz üblichen Familienaufnahmen vom Fotografen arrangiert und folgten dem immer gleichen Muster. Zweck dieser Fotografien, die für Besucher gut sichtbar in der Wohnstube ausgestellt wurden, war es, das Bild einer den sozialen Normen des Kaiserreiches entsprechenden bürgerlichen Kleinfamilie zu erzeugen. Zwischen jüdischen und christlichen Familien gab es diesbezüglich kaum Unterschiede. Im Falle der Familie Pollock deutet nichts auf ihre jüdische Herkunft hin – die jüdische Identität war ihr offenbar in ihrer Außendarstellung nicht wichtig.
Die Mutter, zu der Friedrich Pollock bis zu ihrem frühen Tod ein enges Vertrauensverhältnis hatte, stammte aus der alteingesessenen Kölner Familie Franck.11 Ihre Eltern seien »zwar noch an Feiertagen in die Synagoge gegangen«, erinnerte sich Pollock später, »aber sie waren ja auch schon liberale Juden und meine Mutter hat ja zugestimmt, daß sie nie in die Synagoge geht, sie war ja genauso wenig in der Synagoge wie ich«.12 Wie es um Julius Pollocks religiöse Erziehung bestellt war, ist nicht bekannt, doch sein Sohn erinnerte ihn rückblickend als »Antisemiten«, »der mit Juden eigentlich nicht verkehren wollte«.13 Allerdings scheint es, als hätte die negative Stellung zum Judentum in erster Linie denjenigen Juden gegolten, die nicht seinem bürgerlichen Ideal entsprachen – wie etwa die orthodoxen Mitglieder der jüdischen Gemeinde Sulzburgs. Jedenfalls ist Julius Pollock, anders als sein Bruder Isidor Louis (später: Hans Ludwig), nie aus der jüdischen Gemeinde ausgetreten und liegt im Israelitischen Teil des Stuttgarter Pragfriedhofes begraben.14
Als Teilhaber der im Jahr 1900 gegründeten Firma Nördlinger & Pollock, einer großen Leder- und Reisewarenfabrik im 200 Kilometer entfernten Stuttgart, gehörte Julius Pollock zu den wirtschaftlichen Aufsteigern der Stadt, doch die Familie lebte noch jahrelang in einer Wohnung oberhalb ihres Ladenlokals in der Freiburger Innenstadt. Der Vater musste, wie man heute sagen würde, zwischen den beiden Standorten »pendeln« – keine einfache Aufgabe in einer Zeit, da das Automobil noch ein Luxusgut war. Sooft er konnte, fuhr er mit der Eisenbahn nach Stuttgart, aber sein Lebensmittelpunkt blieb vorerst der Breisgau. Der wirtschaftliche Erfolg rechtfertigte den alltäglichen Spagat zunächst. Die Lederindustrie hatte, so schreibt Werner Sombart, »in Deutschland schon um die Mitte des [19.] Jahrhunderts einen Entwicklungsgrad erreicht, wie wenig andere Industriezweige in jener Zeit«.15 Um die Jahrhundertwende hatte das Konkurrenzprinzip die Anzahl der 1846 noch 551 gezählten deutschen Lederunternehmen allerdings merklich ausgedünnt. Auch Julius Pollock war gezwungen gewesen, sich mit einem Partner zusammenzuschließen, um am Markt bestehen zu können. Wie so häufig fand sich auch in diesem Falle der Geschäftspartner im Kreis der Familie: Sigmund Nördlinger (1868-1942) war zugleich der Ehemann von Julius' Schwester Rosalia (1871-1942).
Die Firma Nördlinger & Pollock war bereits Ausdruck eines seit der Großen Depression ungemein verschärften Konkurrenzkapitalismus. Dabei hatte Julius Pollock das Glück, bei der Unternehmensgründung von seinen Eltern Salomon (1834-1899) und Pauline Pollock (1839-1912) kräftig unterstützt zu werden.
Salomon Pollock – Friedrichs Großvater – stammte ursprünglich aus dem kleinen Ort Rust, nördlich von Freiburg gelegen, in dem es seit dem 17. Jahrhundert eine jüdische Gemeinde gab. Um die Mitte des 19. Jahrhunderts verarmte die Gemeinde, die etwa 10 % der Gesamtbevölkerung ausmachte, und die jüdischen Bewohner zogen zunehmend in die Städte.16 Seit 1810 das auf Napoleons Code Civil basierende Badische Landrecht eingeführt wurde, durften sich Juden nach über vierhundert Jahren auch in Freiburg wieder offiziell ansiedeln. Ganz langsam kam es dort aufgrund der Verschlechterung der Situation der umliegenden Landgemeinden zu einem Anstieg der jüdischen Bevölkerung, aber noch in der Mitte des Jahrhunderts hielten sich in Freiburg aufgrund der nach wie vor bestehenden rechtlichen Beschränkungen lediglich zwanzig Juden auf.17 Erst ab 1862, als den Juden volle Gewerbefreiheit und die freie Wahl des Wohnsitzes zuerkannt wurde, stieg ihr Bevölkerungsanteil sukzessive an.18
Annonce in der Freiburger Zeitung, 1869
Familie Pollock, 1898
Salomon und Pauline Pollock nutzten diese Chance und kamen kurze Zeit später in die Stadt. Friedrichs Großvater eröffnete am 18. Oktober 1862, nur zwei Wochen, nachdem das »Gesetz über die bürgerliche Gleichstellung der Israeliten im Großherzogtum Baden« erlassen worden war, ein »Herren-Kleider-Magazin« mit »deutscher, französischer und englischer Mode« in der Schustergasse.19 In der Zeitungsannonce, die die Eröffnung des Ladens verkündete, verwies Salomon Pollock ausdrücklich auf seine »vielfältige[n] Erfahrungen in allen Zweigen dieses Geschäfts«. Nachdem er 1864 das Bürgerrecht erhalten hatte, nahm er »auf vielseitigstes Verlangen, neben meinem Herrenkleider-Geschäft auch das Feinste und Modernste in Damen-Mäntel & Jacken« in sein Angebot auf.20 Im Jahr seiner Einbürgerung erwarb Pollock in der Eisenstraße 6 in der Freiburger Innenstadt ein Wohnhaus – in Sichtweite des Freiburger Münsters, dessen Innenportal eine antijüdische Synagoga-Darstellung ziert, und wenige hundert Meter vom ersten Betsaal der Gemeinde entfernt.21 Die ›Israelitische Religionsgesellschaft Freiburg‹, zu deren Gründungsmitgliedern die Pollocks als eine von 35 in der Stadt lebenden jüdischen Familien zählten, konstituierte sich ebenfalls 1864 zum ersten Mal.22 Doch schon bald lockerte sich die religiöse Bindung der Pollocks und sie nahmen immer seltener am Gottesdienst teil.23 Sie waren vor allem Geschäftsleute, die am bürgerlichen Leben der Stadt partizipieren wollten. Salomon Pollock wurde ein begeisterter Anhänger der ›Fasnet‹ und engagierte sich im lokalen »Carnevals-Verein«, der zu den »angesehenen, eher großbürgerlichen Vereinigungen« gehörte, in dem sich »vor allem Fabrikanten und Unternehmer, Rechtsanwälte und Architekten« zusammenfanden.24
Im Oktober 1873 eröffnete Salomon Pollock zusätzlich zu seinem Kleidergeschäft auch noch ein »Großes Schuh- und Stiefellager« in der Eisenstraße 1-2, in direkter Nachbarschaft zum eigenen Wohnhaus.25 Das Geschäft scheint nicht gut gelaufen zu sein, denn 1880 stellte er den Schuhverkauf wieder ein und konzentrierte sich voll und ganz auf das sich inzwischen im Erdgeschoss des Wohnhauses befindliche Modegeschäft.
Zwei Jahre nach dem Tod von Friedrich Pollocks Großvater ging das »Damenkonfektionsgeschäft S. Pollock« 1901 auf den ältesten Sohn Julius – Friedrich Pollocks Vater – über, der nun zwei Unternehmen zu verwalten hatte.26 Mit Erfolg: Seine Entscheidung, sich nur noch auf Damenkleidung zu konzentrieren, brachte dem Geschäft nochmals Aufschwung und Julius Pollock wurde 1905 zum »großherzoglich badischen Hofflieferanten« ernannt. Doch schon 1910 entschloss er sich, mit der Familie ganz nach Stuttgart überzusiedeln, um in der Nähe seiner Fabrik zu sein, und machte 1911 die vormalige Angestellte Adele Rüdenberg zur Teilhaberin des Damenkonfektionsgeschäftes.27 Jetzt konnte er sich voll und ganz auf seine Lederwarenfabrik konzentrieren. 1914, als die Firma Nördlinger & Pollock auf Kriegsproduktion umstellte und ihre Produktionskapazitäten vervielfachte, verkaufte er schließlich seine Anteile am Damenmodegeschäft ganz an Rüdenberg.28 Der Zusammenschluss mit dem Geschäftsmann Sigmund Nördlinger brachte zwar eine konkurrenzfähigere Kapitalstärke mit sich, bedeutete zugleich aber auch eine Teilung der Macht innerhalb des Unternehmens. Julius Pollock war nicht mehr der unumstrittene Alleinherrscher wie noch sein Vater Salomon, sondern ein Teilhaber, der seinem Partner gegenüber Rechenschaft ablegen musste.
Sein Status als Familienoberhaupt stand dadurch freilich nicht zur Debatte. Zu bieten hatte Julius Pollock, der auch in der Ehe den Ton angab, seinen Söhnen Friedrich und Hans immerhin eine vielversprechende Zukunft als Nachfolger in seiner Firma. Dafür verlangte er von seinen Kindern Unterordnung, Fleiß und Gehorsam. Nicht Liebe, Herzlichkeit und Humor dominierten somit das alltägliche Leben im Elternhaus, sondern vielmehr eine »puritanische Einstellung«,29 die sich ausschließlich ums Arbeiten und Geldverdienen drehte. Für geistige Dinge hatten die Eltern wenig übrig. Das änderte sich auch nicht, als die Familie in die Großstadt Stuttgart umzog, die 300 000 Einwohner zählte und wo das kulturelle Leben blühte.30 Die Pollocks waren »relativ kleine Leute«: bürgerlich, auch wohlhabend, aber man entbehrte der Weltläufigkeit und klassischen Bildung des großstädtischen Bürgertums. Die im Jahr 1890 geborene Tochter eines anderen in Stuttgart ansässigen jüdischen Textilfabrikanten, Alice Nägele-Nördlinger, berichtete beispielsweise 1961 rückblickend über ihre Kindheit: »Wir hatten eine schöne Jugend, da unsere Eltern trotz großer Sorgen um meines Vaters Gesundheit außerordentlich aufgeschlossen und bestrebt waren, uns Kinder an allem teilnehmen zu lassen, was Stuttgart an Kulturellem zu bieten hatte. Man las außer dem Neuen Tagblatt den Beobachter und die Frankfurter Zeitung, man war im Theater und zu den Symphonie-Konzerten abonniert, man ging regelmäßig in den Kunstverein und zu den Vorträgen im Handelsgeographischen Verein.«31 Wenn die Pollocks sich derlei Veranstaltungen gelegentlich anschlossen, dann vor allem, um gesellschaftlichen Verpflichtungen nachzukommen. Lieber unternahm man an Sonn- und Feiertagen gemeinsam »mit befreundeten Familien Wanderungen auf der Schwäbischen Alb und im Remstal«. Die Naturbegeisterung war Ausdruck eines ausgeprägten Heimatstolzes, der nicht im Widerspruch zur jüdischen Identität stand. Anders aber als Alice' Vater, der sich »nicht als schwäbischer Jude, sondern als jüdischer Schwabe« fühlte und die Zugehörigkeit zur israelitischen Religionsgemeinschaft als eine Selbstverständlichkeit betrachtete, hielt sich Julius Pollock vom Gemeindeleben fern.32 Während Alice' Vater, der nur zwei Gehminuten entfernt von den Pollocks wohnte, gewisse religiöse Vorschriften einhielt, an Feiertagen den Gottesdienst besuchte und einige Ehrenämter in der Gemeinde bekleidete, hatte Julius Pollock sämtliche religiösen Verbindungen zum Judentum abgebrochen.33 Er war zuerst Unternehmer, dann Deutscher und schließlich Familienvater. Seine jüdische Herkunft verleugnete er zwar nicht, aber sie spielte für sein Selbstbild keine Rolle. Trotzdem bestand sein unmittelbares soziales Umfeld, sowohl beruflich als auch privat, fast ausschließlich aus Juden. Politisch konservativ eingestellt, aber wenig interessiert an allen Dingen, die über das persönliche Geschäft hinausgingen, verachtete Julius Pollock das liberale Großbürgertum mit seinem Hang zum Ästhetischen. Die schönen Künste, aber auch Religion und Philosophie wurden als unnütz angesehen, ja sogar die Medizin, wie Pollock sich erinnerte: »Ich weiß aus meiner eigenen Familie, daß man alle Universitätsprofessoren, die nicht Naturwissenschaften lehrten, einschließlich der Mediziner, im Grunde verachtete. Ein ordentlicher Kaufmann, der leistet etwas. Was die leisten … die lesen Bücher!«34
Villa Pollock in Freiburg
Diese Haltung mag durch die Konkurrenzsituation zwischen Julius und seinem weitaus jüngeren Bruder Isidor Louis (1873-1939) verstärkt worden sein, der sich bewusst gegen den kaufmännischen Beruf des Vaters entschieden hatte und Urologe geworden war. Isidor Louis, oder, wie er sich seit seiner Promotion zum Doktor der Medizin 1898 nannte: Hans Ludwig Pollock, Vater der beiden Söhne Heinz und Walter, war fest in das gesellschaftliche Leben in Freiburg integriert und, anders als sein Bruder, 1904 aus der Jüdischen Gemeinde ausgetreten.35 Damit repräsentierte er in Julius Pollocks Wahrnehmung den Weg des geringeren Widerstandes: Er schien die vom Vater übertragene Verantwortlichkeit zu scheuen und sich aus rein opportunistischen Gründen dem Zeitgeist anzupassen. So distanziert Friedrich Pollocks Vater auch dem Judentum gegenübergestanden haben mag, es weder offiziell zu verlassen noch gar zum Christentum überzutreten war eine Sache des Stolzes.
Wie Julius Pollock das Geschäft seines Vaters weitergeführt und sein Bruder Hans Ludwig einen anderen Lebensweg gewählt hatte, so wiederholte sich die Geschichte – gewissermaßen auf einer höheren Stufe – bei Julius' eigenen Kindern. Diesmal sollte es allerdings ausgerechnet der ältere der beiden Söhne, nämlich Friedrich, sein, der vom ›rechten Weg‹ abkam. Sein Bruder Hans Pollock dagegen, geboren am 9. September 1895 und somit knapp eineinhalb Jahre jünger als Friedrich, sollte das väterliche Geschäft übernehmen und Fabrikant werden. Friedrich scheint kein besonders enges Verhältnis zu ihm gehabt zu haben, sah vielmehr etwas arrogant auf das Brüderchen herab, dem anscheinend der Mut fehlte, eigene Entscheidungen zu treffen. Hans heiratete wie sein Vater in eine jüdische Kaufmannsfamilie ein und nahm Ida Stern (1892-1982), geborene Joseph, zur Frau, deren erster Ehemann, Emil Stern, 1916 im Krieg gefallen war. Aus ihrer ersten Ehe stammte die Tochter Liselotte (geb. 1913), die 1922 von Hans adoptiert wurde.36 Als die politische Situation im Deutschen Reich vollends unerträglich wurde, floh die Familie zunächst im Januar 1936 nach Amsterdam, dann weiter nach Buenos Aires. Hans hispanisierte seinen Vornamen in »Juan«. Nach dem frühen Tod der Mutter im Jahr 1930 und dem des Vaters 1937 blieb der Kontakt zwischen den Brüdern auch während des Krieges auf ein Minimum beschränkt. Einen ausgeprägten Familiensinn sollte Friedrich Pollock erst im hohen Alter entwickeln.
Doch all das lag noch in der Zukunft. Der Ablösungsprozess von seiner Familie und ihren Wertvorstellungen ging langsam vor sich. Friedrich Pollock besuchte bis zum ›Einjährig Freiwilligen‹ in Freiburg das humanistische Gymnasium und wurde von seinen Eltern frühzeitig darauf vorbereitet, später in die Firma des Vaters einzusteigen. Die schulischen Leistungen Friedrichs waren nicht herausragend und so war es nicht verwunderlich, dass ihm, als die Familie nach Stuttgart umzog, die Aufnahme ins dortige Gymnasium verwehrt blieb.37 Da ein späteres Studium ohnehin nicht in Betracht kam, benötigte er aus Sicht der Eltern auch kein Abitur. Vielmehr sollte er praktische Erfahrungen in des Vaters Firma sowie in befreundeten Unternehmen im Ausland sammeln. Derartige Ausbildungswege waren in wohlhabenden Kaufmanns- und Unternehmerfamilien keineswegs Ausnahmen: Die Söhne (nur selten auch die Töchter) lernten in der Praxis des Firmenalltags, was es bedeutete, Entscheidungen zu treffen, Anordnungen zu geben und die Tätigkeiten der Angestellten optimal zu koordinieren. Auslandserfahrungen wurden dazu genutzt, Fremdsprachen zu erlernen und Kontakte mit anderen Unternehmerfamilien zu knüpfen. Im besten Falle ließ sich auf diesen Reisen sogar eine geeignete zukünftige Ehefrau finden.
Der Lebensweg Friedrich Pollocks schien also vorgezeichnet zu sein: Er sollte ein erfolgreicher Unternehmer werden, heiraten, ein oder zwei Kinder bekommen und sich ansonsten als guter Staatsbürger in den Dienst des Vaterlandes stellen. Dass seine Zukunft anders verlaufen würde, hatte auch mit einer ganz besonderen Freundschaft zu tun, die in der Jugend ihren Anfang nahm und bis zum Tod das Leben bis in die kleinsten Verästelungen des Alltags hinein bestimmen sollte: die Freundschaft mit Max Horkheimer.
2. Ein Freund fürs Leben
Als die Familie Pollock im März 1910 nach Stuttgart zog, war Friedrich 15 Jahre alt. Er musste seinen Freiburger Freundeskreis zurücklassen und sich in der neuen Heimat zurechtfinden. Zum Abschied hatten seine Freunde eine kleine Feier organisiert, deren Protokoll sie ihm als Erinnerung überreichten. Ein reichliches Programm musikalischer Darbietungen (Bach, Vivaldi, Mozart, Schumann, Wagner) wechselte sich mit Rezitationen von Gedichten ab. »Die Auswahl der rezitierten Gedichte«, so merkt Horkheimers Biograph Ernst von Schenck an, »mag als eine Art Bekenntnis der Gruppe verstanden werden: ›Cidher, der ewig junge, sprach‹ von Rückert, Schillers ›Bürgschaft‹, Hamlets Monolog, die ›Ode an den scheidenden Freund‹ von Lessing.«1 Auch Pollock – von seinen Freunden »Pollux« genannt – hatte immer wieder Gedichte rezitiert oder Dramen mit verteilten Rollen gelesen. Besonders wurde er von seinen Freunden für seine Fähigkeit gelobt, verschiedene Stimmen zu intonieren. »Wer war's, der jeder Rolle neue Fassung gab, ein neuer Ton die anderen übertrumpfte?«, heißt es anerkennend in dem ihm gewidmeten Prolog zum Protokoll des Abschiedsfestes.2 Auch in Mathematik scheint Pollock ein guter Schüler gewesen zu sein; gerühmt wird zudem sein außerordentliches Gedächtnis. Nach einem Opernbesuch – »sei es Walküre, Tiefland, Strauss« – habe er immer die Hauptmelodien auswendig zitieren können.
Doch all diese Fähigkeiten reichten nicht aus, um in Stuttgart wieder auf dem Gymnasium angenommen zu werden. Die Schulnoten waren zu schlecht, und so kam er, im Einklang mit den Plänen des Vaters, auf die Höhere Handelsschule. Hier waren die Klassen sozial durchmischter als auf dem elitären, bildungsbürgerlich geprägten Gymnasium. Die Kinder aus den Familien, mit denen seine Eltern verkehrten, und ihr eingebildeter Habitus waren ihm suspekt. Dazu gehörte etwa sein späterer Freund Adolph Löwe (1893-1995), der ein Jahr älter war und als Sohn eines wohlhabenden Kaufmannes das Stuttgarter Realgymnasium besuchte. Am 18. Januar 1911, dem 40. Jahrestag der Reichsgründung, hielt Löwe als Primaner eine schwülstige Rede auf der Schulfeier, in der er mit gehörigem Pathos das »befreiende Erwachen aus einem langen, schweren Traume« beschwor: »Die Geister waren versöhnt, wir waren wieder ein Volk geworden.«3 Solche Reden zu schwingen wäre Friedrich nicht in den Sinn gekommen. Zum Ärger seiner Eltern ging er zu den Kindern aus benachbarten bürgerlichen Familien auf Distanz und entwickelte sich zum etwas trotzköpfigen Eigenbrötler. Vielleicht war diese Haltung auch eine Reaktion auf die veränderten Lebensumstände. Trotz relativen materiellen Wohlstandes spiegelte die neue Wohnsituation einen sozialen Abstieg wider: 1908/1909 waren die Pollocks endlich aus der Wohnung über dem Ladengeschäft, mitten in der Freiburger Innenstadt in unmittelbarer Nähe des Münsters, in eine Villa im großbürgerlich geprägten Stadtteil Wiehre auf der anderen Seite der Dreisam umgezogen, die sich in der Dreikönigstraße 13 befand. In Stuttgart wohnten sie nun wieder in einer Wohnung, in der Reinsburgstraße, nur einige Meter von der Reiseartikel- und Kofferfabrik in der Reuchlinstraße entfernt.4
Ausflug mit Freunden (Pollock mit Ballonmütze), 1921
Im Winter 1910 erreichte Friedrich Pollock plötzlich ein in merkwürdig umständlicher Sprache verfasster Brief: »Als wir begannen, unsere Tanzstunde zu gründen«, heißt es in dem an den »sehr geehrten Herr[n] Pollock« adressierten Schreiben, »hatten wir gehofft, daß auch Sie sich an unserem kleinen Wintervergnügen beteiligen werden, jedoch erwies sich damals unsere Hoffnung als trügerisch, da Sie damals, wie ich hörte, glaubten, Sie würden unseren schönen Heimatort über diese Zeit verlassen. Vor einigen Tagen sagte mir nun Herr Eisenmann, daß Sie nun doch den Winter hier verbringen würden und daß Sie vielleicht nicht abgeneigt wären, einen Abend in der Woche mit uns zu verbringen und so mit uns tanzen zu lernen. […] In dieser Hoffnung und in derjenigen, Sie morgen abend um ¾ 9 Uhr im Olgabau beim Herrenabend begrüßen zu dürfen, verbleibe ich Ihr Max Horkheimer.«5
Max Horkheimer, der einzige Sohn des Kommerzienrates Moriz Horkheimer, eines angesehenen Bürgers und religiös observanten Mitgliedes der jüdischen Gemeinde, war für Pollock auch einer dieser verwöhnten Snobs aus gutem Hause, denen er misstrauisch gegenüberstand. Er kannte ihn nicht persönlich, hatte ihn vielleicht ein, zwei Mal gesehen, denn die Eltern waren lose miteinander bekannt. Auch Horkheimers Freund Walter Wolf, der Pollock ursprünglich für den Tanzkurs empfohlen hatte, war ein Sprössling aus dieser arrivierten großbürgerlichen Schicht.
Eine Tanzstunde also. Das war nicht unbedingt, wonach er sich verzehrte, zumal der Tanz als »Statussymbol der feinen bürgerlichen Gesellschaft« genau das repräsentierte, was er immer stärker zu verachten begann.6 Noch dazu waren die Teilnehmer des Tanzkurses allesamt Söhne von prominenten Mitgliedern der jüdischen Gemeinde und er hatte, obwohl als Jude geboren, mit der Religion und erst recht mit einer religiösen Gemeinschaft nichts im Sinn. Schließlich ließ er sich doch überreden und nahm an der Tanzstunde teil. Ausgerechnet der Einladende, Max Horkheimer, war ihm jedoch von Anfang an unsympathisch: Dieser habe ihn »zur Weißglut gebracht. Und ich habe mich da mit einer Reihe Unzufriedener in der Tanzstunde verbunden und wir waren also im Begriffe, unsere eigene Tanzstunde zu machen, und ihn mit zwei oder drei seiner engsten Spezis alleine zu lassen.«7
Horkheimer, der von der kleinen Verschwörung erfuhr, aber diese Art der Zurückweisung nicht gewohnt war, fühlte sich tief gekränkt. Er besuchte den zu diesem Zeitpunkt noch etwas außerhalb, in einem Neubauviertel im Westen Stuttgarts wohnenden Pollock und bat ihn um eine Aussprache: »Und er hat mir gesagt: ›Also hör mal, ich weiß natürlich, was du vorhast, und das kommt alles daher, weil du mich gar nicht kennst. Ich bin gar nicht der, als der ich erscheine. Ich bin ein ganz verzweifelter Mensch. Und wenn mir niemand hilft, werde ich wahnsinnig.‹« Pollock war überrascht, denn plötzlich zeigte sich eine ganz andere, schwache und menschliche Seite Horkheimers, die nichts mehr mit dem siebengescheiten Sohn des Kommerzienrates zu tun hatte. Dieser Max Horkheimer zeigte sich verletzlich und hilfebedürftig, doch Pollock blieb misstrauisch. Anstatt ihn zu trösten und moralisch wieder aufzubauen, antwortete er nur knapp, er werde sich das alles durch den Kopf gehen lassen. Schockiert von der neuerlichen Zurückweisung trottete Horkheimer von dannen.
Pollocks Leben hätte wohl einen ganz anderen Weg genommen, wenn er sich nicht nach reiflicher Überlegung dazu entschlossen hätte, Horkheimer doch eine Chance zu geben. Sie freundeten sich an und traten kurze Zeit später das erste Mal als verschworenes Zweierpaar auf, indem sie von nun an beide die Tanzstunde sabotierten und sich von den anderen Teilnehmern abkapselten. Pollocks anfängliches Misstrauen schwand und so entschieden die beiden Freunde, ihrer Beziehung ein festes Fundament zu geben: einen Freundschaftsvertrag. Es ist wohl kein Zufall, dass die beiden Unternehmersöhne einen Vertrag aufsetzten, ein Geschäftsdokument also, um sich ihrer gegenseitigen Treue und Verlässlichkeit zu versichern. Aber der Vertrag, der im Laufe ihres Lebens immer wieder erneuert und durch gemeinsame Beschlüsse, Memoranda und selbst erstellte psychologische Gutachten ergänzt werden sollte, enthielt noch mehr: ein utopisches Programm. »Unsere Freundschaft«, heißt es in dem leider verschollenen Schriftstück, »erachten wir als höchstes Gut. In dem Begriff der Freundschaft ist ihre Dauer bis zum Tode eingeschlossen. Unser Handeln soll Ausdruck der Beziehung Freundschaft sein und jeder unserer Grundsätze nimmt in erster Linie diese Rücksicht.«8 Der Vertrag sei, heißt es weiter, »Ausdruck eines kritisch-humanen Elans« und diene der »Schaffung der Solidarität aller Menschen.« Im Folgenden wurde im Einzelnen aufgeführt, wie das gemeinsame Leben zu gestalten sei, sogar die Uhrzeiten für gemeinsame Diskussionen wurden festgelegt.
In der Praxis sah das Leben der Freunde vorerst allerdings etwas prosaischer aus. Abgesehen davon, dass besonders die Horkheimers äußerst wohlhabend waren und sich dies auch in der Lebensgestaltung ihres Sohnes widerspiegelte, unterschied sich der Alltag der Freunde nicht besonders von dem ihrer Mitschüler, zumal wenn diese auch aus bürgerlichen Familien stammten. Man traf sich auf einer Bank in der Stadt oder im Café, um »über die Sinnlosigkeit des Lebens unserer Eltern«9 zu diskutieren. Die sich bereits andeutende Revolte gegen das Elternhaus war typisch für Heranwachsende aus bürgerlichen Familien, die, getreu dem Freudschen Ödipus-Modell, Autonomie nur erlangen konnten, wenn sie sich gegen die Macht des Vaters auflehnten. Das Leben der Eltern drehte sich in der Wahrnehmung der Kinder nur darum, »sich fortwährend Sorgen darüber zu machen, wie sie noch mehr Geld zusammenbringen können«.10 Diesem kapitalistischen Lebensmodell stellten die beiden Freunde ein moralisches Ideal gegenüber, das sie in der Gestaltung ihrer eigenen Beziehung, die auf Gleichberechtigung, Wahrheit, Treue und Solidarität gründen sollte, realisieren wollten. Dies implizierte nicht zuletzt eine bis zum Extrem getriebene Exklusivität der Beziehung: »Donnerstag also komme ich nach Stuttgart«, schrieb Horkheimer im September 1912 aus der Sommerfrische in Bregenz. »Ich werde dich sofort, wenn ich zu Hause bin, anrufen, dann können wir ja unser Rendez-vous ausmachen. Um noch eins bitte ich dich: Sage niemand, daß ich komme, denn ich möchte die ersten Abende ganz ungestört mit dir verbringen und nicht vielleicht am zweiten Abend die Stuttgarter jeunesse dorée bei mir empfangen.«11
Die nächste Stufe der Revolte bestand darin, sich dem Zugriff der Eltern bewusst zu entziehen. Als Pollock und Horkheimer 1912 mit der Aussicht, einmal die väterliche Firma zu übernehmen, Lehrlinge in deren Fabriken wurden, schienen sie zunächst ausgerechnet auf den Weg des Geldmachens festgelegt, den sie doch so ablehnten. Einen Ausweg stellte der von beiden Eltern schließlich für gut befundene Vorschlag dar, im Ausland im Rahmen eines Volontariats Berufspraxis und Sprachkenntnisse zu sammeln. Nachdem der ursprüngliche Wunsch, in das als Sündenpfuhl geltende Paris zu gehen, am Widerstand der Eltern gescheitert war, die ihre Söhne lieber in das Industriemekka Manchester geschickt hätten, einigte man sich auf einen Kompromiss – Brüssel. Während Horkheimer in einer Konfektionsfabrik hospitieren sollte, war Pollock in dem großen Warenhaus »À l'innovation« tätig, dem belgischen Hauptabnehmer der Waren aus der väterlichen Fabrik. Sie erhielten den für ein Volontariat beträchtlichen Betrag von 400 belgischen Francs monatlich, womit sich komfortabel leben ließ. Insgeheim verfolgten Pollock und Horkheimer das Ziel, im Ausland fernab der elterlichen Macht ihre Freundschaftsideale zu leben. Horkheimer war schon etwas früher nach Brüssel gereist, hatte sich um zwei Appartements in direkt nebeneinander liegenden Pensionen gekümmert und erwartete Pollocks Ankunft nun ungeduldig. Dieser schrieb am 10. Mai 1913 in die belgische Hauptstadt, wie glücklich er darüber sei, »daß wir nun zusammen fortkommen«.12 Nur vier Tage später antwortete Horkheimer sehnsüchtig: »Ich möchte erst aufwachen, wenn Du da bist, aber es geht nicht, es sind noch 12 lange, schwere Tage.«13 Einigen Stellen des Briefwechsels eignet der Charakter eines Liebesbriefes, sie weisen durchaus homoerotische Züge auf. Horkheimer ging dabei wohl bisweilen etwas zu weit. Er wisse, dass »Du es nicht liebst, daß ich so schreibe, aber ich bin krank u. es tut mir wohl.«14 Die Schwärmereien der beiden beschränkten sich indes nicht aufeinander und auf das eigene Geschlecht. Horkheimer hatte es seine Jugendfreundin Alice Rosenstraus angetan, die gar nicht ahne, »wie wahnsinnig lieb ich sie habe«.15
Auch Pollock nahm die Gelegenheit wahr, erste Erfahrungen mit dem weiblichen Geschlecht zu sammeln. Die Freunde führten regelmäßig Damen zum Abendessen aus, etwa in die vornehme Taverne Royal in der Passage Saint-Hubert. Oftmals bestand ihre Begleitung aus jungen Verkäuferinnen, die so wenig verdienten, dass sie sich Theater- oder Restaurantbesuche selbst nicht leisten konnten. Die beiden Unternehmersöhne, die auch noch blendend aussahen, konnten sich als wahre Gentlemen aufspielen. Auch mit der Haushälterin von Horkheimers Vermieter, eines gewissen Dr. Moskowitz, hatte Pollock ein amouröses Techtelmechtel. Die deutlich ältere Dame, »die sich prompt in diesen jungen und schlanken und offenbar noch ziemlich unschuldigen Mann verliebte«, legte ihm eines Tages den Finger auf den Mund und sagte, »er solle mit ihr kommen. Und er kam mit ihr und dann führte sie ihn an eine Türe, er solle durch das Schlüsselloch schauen. Und da sah er, wie Herr Dr. Moskowitz sich mit einer Patientin auf dem Divan amüsierte.«16 In einer Zeit, da Sexualität noch deutlich schambesetzter und tabuisierter war als heute, waren solche Erfahrungen für den jungen Mann Pollock durchaus einschneidend.
Brüssel war also weniger der Ort, an dem »die Solidarität aller Menschen« geschaffen wurde, wie es im ersten Freundschaftsvertrag heißt, als vielmehr der soziale Raum, innerhalb dessen die jungen Männer Erfahrungen sammeln und der repressiven Sexualität des Elternhauses entkommen konnten. Die beiden Freunde verhielten sich wie wohlhabende Junggesellen, die das schöne Leben genießen und es sich leisten konnten, das Elend in der Welt auszublenden. Gleichzeitig jedoch suchten sie in Gesprächen und in der Literatur einen höheren Sinn des Daseins zu finden. Angezogen fühlten sie sich besonders von der naturalistischen und symbolistischen Literatur, deren antibürgerliche, die traditionellen Geschlechterverhältnisse aufsprengende Haltung wie gemacht war für die Stimmung innerhalb einer so intimen und verschworenen Gemeinschaft. Henrik Ibsens Stück Ein Volksfeind etwa, 1882 verfasst und von den beiden Freunden regelrecht verschlungen, präsentiert eine Hauptfigur, die gegen den Strom schwimmt und der Gesellschaft attestiert, sie lebe auf dem »Boden der Lüge«.17 Die bürgerliche Gesellschaft sei, so heißt es in dem Stück weiter, der »gefährlichste Feind der Wahrheit und der Freiheit«.18 Der »Volksfeind« ist demnach eine positive Figur, mit der sich die beiden Freunde identifizieren konnten, denn er wird zwar von den Massen verachtet, führt aber einen gerechten Feldzug für Wahrheit und Freiheit. In Ibsens Stück Gespenster wird die Familie gar als Gefängnis dargestellt, das auf Unterdrückung und Verdrängung beruht – die Gespenster der Vergangenheit lassen die Protagonistin nicht los, sondern zerstören ihr Leben. Und in dem Drama Die Wildente geht es sogar direkt um die Beziehung zwischen zwei Freunden: Die eine Hauptfigur, Gregers Werle, strebt an, was auch Horkheimer und Pollock anstrebten: eine Freundschaft, die auf Wahrheit gründet und mit allem oberflächlichen Tand, mit Lüge und Verstellung bricht; eine Freundschaft, die auf Leben und Tod geschlossen wird, immer bereit, das eigene Leben für das des Freundes zu opfern. Solche Geschichten halfen den Freunden, ihr ausschweifendes Leben mit höheren Weihen zu versehen. Sie fühlten sich nicht wie zwei verwöhnte Sprösslinge der herrschenden Klasse, sondern meinten, durch ihr neues Leben einen Unterschied zu machen. Brüssel stellte für sie den Gegenort zur Fabrik dar: Während in der belgischen Hauptstadt Freiheit, Genuss und Wahrheit den Alltag der Freunde bestimmten, waren es in Stuttgart die Enge, Tyrannei und Lüge der bürgerlichen Gesellschaft.
Obwohl es schon aus dieser Zeit politische Stellungnahmen gegen Unterdrückung und Ausbeutung besonders aus der Feder Horkheimers gibt, waren die Freunde vor allem mit ihrem eigenen Leben beschäftigt. Die Konflikte mit den Eltern und die Versuche, von ihnen geistig unabhängig zu werden, überschatteten alles andere. Sie vernachlässigten die Arbeit im Geschäft, lernten dafür jedoch eifrig Französisch bei dem von ihnen als Vaterfigur wahrgenommenen Privatlehrer Monsieur Calle, einem pensionierten Beamten aus dem Département Loire. Doch damit nicht genug: Es war Pollock, der den ersten Vorstoß in die Philosophie wagte. In einem Buchladen erwarb er preisreduziert und eher beiläufig einige philosophische Klassiker: »Das war Spinoza, als Jude wußte ich etwas von ihm. Dann Kant, Kritik der reinen Vernunft, und Schopenhauer, Aphorismen zur Lebensweisheit.«19 Er fing an zu lesen, konnte aber weder mit Kant noch mit Spinoza etwas anfangen. »Und dann las ich den Schopenhauer und auf einmal redete da einer Deutsch und über Dinge, die einen etwas angingen, von dem, was einer ist, von dem, was einer vorstellt usw.«20 Er lief ganz begeistert zu Horkheimer und hielt diesem das Buch vor die Nase: »Du denkst doch so viel über die Welt nach«, erklärte er ihm, »vielleicht kann dich das interessieren.«21 Bereits einige Tage später erwarb Pollock in der deutschen Buchhandlung sechs in Leder gebundene Bände der Gesammelten Werke Schopenhauers. Der große Pessimist der deutschen Philosophie sollte Pollock und Horkheimer ihr ganzes Leben begleiten.
Doch das Interesse für Philosophie war zunächst begrenzt. Schopenhauer sagte den Freunden vor allem zu, weil er die von ihnen empfundene Sinnlosigkeit des Lebens schonungslos auf den Punkt brachte. Anstatt sich der Misanthropie hinzugeben, wurde das Freundschaftsprojekt immer weiter zu einem alternativen, anscheinend sinnvollen Lebensentwurf ausgebaut. Wie viel die Eltern vom Lebenswandel ihrer Söhne wussten, lässt sich nicht genau rekonstruieren, aber es ist anzunehmen, dass sie von ihren Geschäftspartnern, bei denen die Söhne angestellt waren, durchaus über deren Betragen informiert wurden. Ende 1913 entschieden sie, dass Friedrich und Max Brüssel verlassen und schließlich doch nach Manchester, in die Textilhauptstadt Europas, wechseln müssten. Dort sollten sie sich neue Volontariate suchen und Englisch lernen.
Anstatt sich, wie von den Eltern gewünscht, in der Industriemetropole niederzulassen und eine Arbeit zu suchen, entschieden sich die Freunde allerdings für ein gemeinsames Appartement im Vorort Withington, der außerhalb des Stadtzentrums gelegen war. Abrupt vom belgischen »Sündenpfuhl« getrennt, nahmen sie in Manchester so viele Aspekte des Brüsseler Lebens wieder auf, wie sie konnten, doch es blieb mangels Alternativen vor allem bei ausgedehnten Spaziergängen am River Mersey und tiefschürfenden Diskussionen über den Sinn und Unsinn des Lebens, die Bigotterie der bürgerlichen Gesellschaft und den verlogenen Materialismus ihrer Eltern. Der Aufenthalt in Manchester langweilte sie schon nach kurzer Zeit. Es gab kaum Möglichkeiten zur kulturellen Zerstreuung und das soziale Leben vor Ort war noch immer von proletarischen Lebensformen geprägt, mit denen die Freunde, sosehr sie auch Mitleid mit den ausgebeuteten Arbeitern verspüren mochten, wenig anfangen konnten. Leo Löwenthal hat diese ambivalente Haltung zur Arbeiterklasse, von der nicht nur Friedrich Pollock und Max Horkheimer erfüllt waren, später folgendermaßen charakterisiert: »Proletarische Lebensformen, soweit es sie überhaupt noch gibt, sind wohl kaum nachahmenswert. Die nachproletarischen, ich meine die kleinbürgerlichen Lebensformen, sind irgendwo auch nicht viel besser, aber in ihrem wesenhaften Kern imitieren sie Lebensformen der Oberschicht. […] Ich würde direkt sagen, der Luxus ist die Vorwegnahme der Utopie. Vielleicht hätte auch Marx manches besser und differenzierter sagen können, wenn es ihm nicht so schlecht gegangen wäre.«22
Der antibürgerliche und antimaterialistische Gestus war auch bei den Freunden nicht mit dem Wunsch nach Askese oder der Sehnsucht nach dem einfachen Leben verbunden. Vielmehr reifte in ihnen die Einsicht heran, dass erst eine gleiche Verteilung des materiellen Überflusses dessen glückverheißenden Gehalt einlösen könnte. Einsam und unverdient Privilegien zu genießen schien ihnen falsch und unehrlich zu sein, aber sich als Privilegierter in Sack und Asche zu kleiden, war viel schlimmer: Es wäre eine Verhöhnung der Armen und Ausgebeuteten, die sich nichts sehnlicher wünschten, als am gesellschaftlichen Reichtum zu partizipieren. Diese Einsicht, dieser erste Schritt in Richtung kritische Gesellschaftstheorie war noch eng mit dem antibürgerlichen Geist der naturalistischen Literatur verknüpft und beruhte noch nicht auf philosophischen oder gar ökonomiekritischen Überlegungen. Schopenhauer und Nietzsche waren begnadete Polemiker, die scharfsinnig gesellschaftliche Tendenzen ihrer Zeit benannten. Aber sie waren auch Nihilisten, die wenig Interesse an der Frage zeigten, wie die Welt vernünftig eingerichtet werden könnte. Dieses Problem nagte zusehends an den Freunden, und in der Literatur, die sie lasen, fanden sie keine Antworten. Nach nicht einmal zwei Monaten verließen sie Manchester unverrichteter Dinge und zogen nach London weiter, wo sie sich in ein kleines Appartement im heutigen Nobelstadtteil Hampstead einmieteten, der vier Jahre zuvor ans Londoner U-Bahn-Netz angeschlossen worden war. Hampstead war das genaue Gegenteil von Manchester: Bis ins 18. Jahrhundert hinein war es ein Kurort gewesen und noch immer zierten Brunnen und Parkanlagen das Viertel, während gleichzeitig alle kulturellen Etablissements im Zentrum Londons ohne größere Schwierigkeiten erreicht werden konnten.
Der Umzug nach London sollte aber noch aus einem anderen Grund einen Einschnitt markieren: Eine junge Frau trat ihrem Freundschaftsbund bei. Noch während der Brüsseler Zeit hatte sich Horkheimer auf einer Paris-Reise, die er ohne Pollock unternommen hatte, Hals über Kopf in Suzanne »Suze« Neumeier verliebt, eine entfernte französische Verwandte. Mehrfach besuchte er sie in den folgenden Monaten, auch von Manchester und London aus. Bald drängte er darauf, sie in die verschworene Gemeinschaft aufzunehmen. Pollock war skeptisch, denn er wollte nicht, dass eine dritte Partei zwischen sie träte, noch dazu eine Frau. Er »blieb ruhig und kalt wie das Meer« und trieb Horkheimer damit »beinahe zur Verzweiflung«.23 Doch als Horkheimers Enthusiasmus auch drei Tage nach dem letzten Rendezvous noch nicht verblasst war, ließ er sich schließlich umstimmen. Suze hatte Horkheimer wiederholt offenbart, sie fühle sich im Haus ihrer Eltern wie eine Gefangene und leide unter den gesellschaftlichen Normen und Erwartungen.24 Die Gemeinsamkeit der Empfindungen und Bedürfnisse, mit denen sie sich doch so allein wähnten, war für alle drei überraschend. Aber war diese Übereinstimmung, so fragte Pollock, wirklich stark genug, um den vertraglich festgehaltenen Grundsätzen der Freundschaft standzuhalten?
Friedrich Pollock, ca. 1916
Auf Pollocks Anraten hin schilderte Horkheimer Suze in einem langen Brief noch einmal ausführlich die Bedingungen, die erfüllt sein müssten, um in ihre verschworene Gemeinschaft eintreten zu können: »Nun konnte kein Mißverständnis mehr bestehen, ich hatte alles, selbst das kleinste Geheimnis, das uns betraf, enthüllt.«25 In einem mit Blut unterschriebenen Brief antwortete Suze: »Ich bin euer Körper und eure Seele.« Der Entschluss, dem Freundschaftsbund beizutreten, war somit, um in der Sprache der Verträge zu bleiben, rechtskräftig. Im Mai 1914 schließlich fuhren Pollock und Horkheimer von London aus mit dem Zug in den nordfranzösischen Küstenort Fort-Mahon, um mit Suze zusammenzutreffen. Die kurze, aber sehr intensive Zeit, die nun folgte, hat der junge Horkheimer in einer offen autobiographischen Novelle unter dem sprechenden Titel L'île heureuse aufgezeichnet. Der Name der Novelle war einem Gedicht des symbolistischen französisch-jüdischen Schriftstellers Éphraïm Mikhaël (1866-1890) entnommen, das 1890 auch von Emmanuel Chabrier, dem »neuen Offenbach«, als Vokalwerk vertont worden war. In dem Gedicht, das Horkheimer so nachhaltig beeindruckte, lautet die letzte Strophe: »Aber da draußen, unter der Sonne / taucht das teure, leuchtendrote Land auf / von wo sich ein Lied des Erwachens und der Freude erhebt; / Dies ist die glückliche Insel im wolkenlosen Himmel / Wo ich, unter den fremden Lilien, / in den Obstgärten schlafen werde / in Deiner Umarmung.«26
Die in Mikhaëls Gedicht zum Ausdruck kommende träumerisch-hoffnungsvolle, ja fast messianische Stimmung spiegelte auch die Atmosphäre zwischen den drei Freunden wider: »Hier saßen wir, auf dem heißen Dünensand, die Augen glückselig auf das tiefblaue, weite Meer gerichtet, die Seele voll von unendlicher Freude und die Brust von unsagbarer Liebe zu dieser herrlichen, flammenden Natur und zu uns selbst, zu uns, die wir frei waren und an denen nichts Fremdes, nichts Niederes mehr haftete. Zwischen uns stand nichts mehr, kein Interesse, keine Vorsicht, keine Ehre, keine Würde und keine Pflicht: Jeder war den anderen nur der vollkommen freie Mensch, den sie bis auf den Grund seines Wesens kannten, der ewig zu ihnen gehörte, mit dem sie diese Höhe erklommen hatten. Noch weiter müssen wir steigen, diese Welt immer mehr begreifen und genießen lernen, immer mehr handeln, wie es gut und wahr ist.«27
Die »glückliche Insel« war eine von Horkheimer bewusst gewählte literarische Metapher für die Gemeinschaft der Freunde. Die zuweilen schwärmerisch klingende Beschreibung steht in eindeutiger Beziehung zu den zeitgenössischen lebensreformerischen Bewegungen, etwa im Tessiner Örtchen Monte Verità, wo sich Anarchisten, Vegetarier, Theosophen und Künstler trafen, um die Einheit von Seele und Körper, Geist und Natur mit neu erfundenen Ritualen zu zelebrieren.28 Zwar wurde auf Pollocks und Horkheimers Insel, anders als auf dem ›Berg der Wahrheit‹, auf Eurythmie, Feldarbeit und Walkürefelsen verzichtet, aber die Ideen der Lebensreform kommen in Horkheimers Bericht deutlich zum Ausdruck: »Dadurch, daß Suze ein Weib war, bekam unser Verhältnis etwas in sich Geschlossenes, etwas Unabhängiges, etwas Ganzes. Alles Menschliche an uns konnten wir unserem Bunde weihen, von Seele, Geist und Körper gehörte nichts mehr der Außenwelt, alles – selbst gemeine Triebe – fanden in unserer Mitte ihre Beruhigung, denn Suze freute sich ihrer sinnlichen Schönheit, weil sie uns ein Geschenk damit machen konnte.«29 Die durch libidinöse Ganzheitsvorstellungen inspirierte Gemeinschaft war nicht zuletzt ein erotisches Abenteuer. Aber die Weltauffassung der Freunde – bisweilen nannte Horkheimer sie »unsere Religion« – war trotzdem keine bloße Rationalisierung sexueller Fantasien. Die Ausbildung eines unabhängigen Bewusstseins und die Entwürfe eines guten, wahrhaftigen Lebens standen ganz klar im Vordergrund. Nächtelang diskutierten die Freunde leidenschaftlich darüber, wie sie sich ihr neues Leben vorstellten, und schmiedeten sogar Pläne, in Südafrika eine Farm zu bewirtschaften und nur von dem zu leben, was die Erde ihnen schenken würde. Diese Sehnsucht nach einer einfachen und ursprünglichen Naturverbundenheit – damals in den lebensreformerischen Bewegungen jeglicher Couleur, von der Bündischen Jugend bis zu den Zionisten, weit verbreitet – war ein neuer Aspekt ihres Freundschaftsgedankens, und, wie sich zeigen sollte, ein äußerst kurzlebiger. Letztlich stand er im Widerspruch zur Hochschätzung großbürgerlicher Lebensformen, die die Freunde trotz ihrer Kritik an den Werten der Eltern weiterhin pflegten.
Im Juni 1914 war die Ménage-à-trois auf ihrem Höhepunkt angelangt. Suzanne Neumeier hatte sich tatsächlich von ihren Eltern losgeeist und war zu Pollock und Horkheimer nach London gekommen. Nun waren sie wieder vereint und konnten das Leben auf ihrer île heureuse genießen. Suze hatte ihren Eltern einen Abschiedsbrief hinterlassen, in dem sie ihre Absichten erklärte. Diese waren alarmiert und verständigten sich sofort mit den Horkheimers, die wiederum die Pollocks informierten. Pollocks Mutter, die kein Englisch verstand, interpretierte die Adresse ihres Sohnes – das Appartement war in der Castle Road – als »Kastell« und dachte, Friedrich sei im Gefängnis. Sie schrieb ihm einen Brief und beteuerte, wie lieb sie ihn habe und dass sie zu ihm halte, was immer er auch getan habe.
Julius Pollock war nicht so nachsichtig. Gemeinsam mit Moriz Horkheimer und Suzannes Vater machte er sich nach London auf und verständigte dort sogar Scotland Yard, um die aufsässigen Kinder ausfindig zu machen. Als Suze und Horkheimer eines Abends zu zweit ausgingen und Pollock alleine in der Wohnung zurückgeblieben war, klingelte es plötzlich an der Tür. Er öffnete und zwei »finster aussehende« Polizisten erklärten ihm, es liege ein Haftbefehl wegen Mädchenhandels gegen ihn vor. Pollock wurde zwar nicht verhaftet, aber doch in der Wohnung festgesetzt und verhört. Glücklicherweise kamen bald die Eltern hinzu, schließlich auch Horkheimer und Suzanne Neumeier, so dass die Situation aufgeklärt werden konnte. Die Söhne wurden von den Eltern gezwungen, nach Stuttgart zurückzukehren und dort fortan unter ihrer Aufsicht im Familienbetrieb zu arbeiten. Suzanne verbrannte alle Briefe und erklärte ihren Abschied von den einstigen Freunden, mit deren Bund sie nichts mehr zu tun haben wolle. Der Schock saß tief. Nicht nur das vorläufige Ende ihres gemeinsamen Lebens in den europäischen Metropolen, sondern vor allem die als Verrat empfundene Aufkündigung der Freundschaft durch Suzanne Neumeier war eine tiefe Kränkung, die ihr weiteres Leben prägen sollte.
3. Gescheiterte Revolution
Ging es nach Julius und Elisabeth Pollock, so wünschten sie sich nach der London-Episode nichts sehnlicher, als dass endlich wieder Ruhe und Ordnung einkehrte. Friedrich sollte sich seiner Pflichten bewusst werden und seine Träumereien aufgeben. In der väterlichen Fabrik mussten ihm, so waren sie überzeugt, durch den Arbeitsalltag Manieren beigebracht werden. Doch nur einen Monat nachdem Friedrich Pollock zurück in Stuttgart war, geschah etwas, mit dem noch kurz zuvor kaum jemand gerechnet hatte: Am 1. August 1914 erklärte Deutschland Russland den Krieg, zwei Tage später auch Frankreich. Der Krieg, der offiziell die Ehre Deutschlands verteidigen sollte, erforderte eine Festlegung neuer Prioritäten. Die Wirtschaft sollte in dieser Stunde der Not in den Dienst der Nation gestellt, aller Eigennutz dem Wohl des Reichs untergeordnet werden.
Dass diese scheinbar altruistischen Parolen sich mit guten Geschäften verbinden ließen, wusste Pollock nur allzu gut. Er selbst wurde zunächst nicht als Soldat eingezogen, da er in einem kriegswichtigen Betrieb arbeitete. Die Firma Nördlinger & Pollock – sein Vater trennte sich nun endgültig vom Damenkonfektionsgeschäft S. Pollock in Freiburg – produzierte schließlich Lederwaren und Reiseartikel und forcierte nun die Kriegsproduktion, allem voran die Herstellung von Pistolenhalftern und Munitionstaschen. Die Produktionskapazität stieg dank der staatlichen Nachfrage rasant an, ebenso wie die Profite. Julius Pollock wurde reich. Der 1916 vollzogene Umzug in eine schicke Villa in bester Lage, nur fünf Gehminuten von der Villa der Horkheimers entfernt, dokumentiert diesen Aufstieg.1
Friedrich Pollock wollte noch immer nicht im Betrieb arbeiten





























