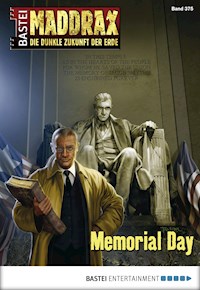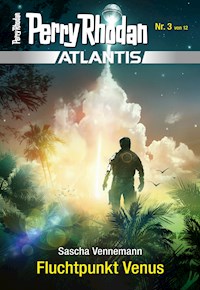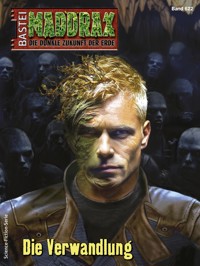9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bildner Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Frozen Metropolis – Ein Permafrost Roman Wenn alles zusammenbricht, beginnt der Kampf ums Überleben. In naher Zukunft versinkt die Welt im Chaos: Aus unbekannten Gründen kommt der Mond von seiner Umlaufbahn ab, Gezeiten geraten außer Kontrolle, Naturkatastrophen überrollen die Kontinente – und eine neue Eiszeit bricht über die Menschheit herein. Während Regierungen zerfallen und die Ordnung schwindet, kämpfen in der einstigen Megacity Metropolis deren Bewohner ums nackte Überleben. Unter ihnen sind auch Sheriff Ethan Cane, seine Tochter Robyn, die Soldatin Anna, der Arzt Dr. Richard Sonenberg und der skrupellose Geschäftsmann Logan Boyce, die sich mit der tödlichen Kälte und neuen Gefahren auseinandersetzen müssen: bewaffnete Plünderer, ein fanatischer Kult – und eine Natur, die keinen Fehler verzeiht. Frozen Metropolis ist der atmosphärische Roman zum Survival-Spiel PERMAFROST von Toplitz Productions – die fesselnde Vorgeschichte über Geheimnisse, Intrigen und das Überleben. Die Regeln der alten Welt gelten nicht mehr. Nur wer bereit ist zu kämpfen, hat eine Zukunft. Düster, kompromisslos und erschreckend realistisch!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 341
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
FROZEN METROPOLIS
EinRoman
Die Vorgeschichte zum Survival-Spiel von SpaceRocket Games und Toplitz Productions
von Sascha Vennemann
BILDNER Verlag GmbH Bahnhofstraße 8 94032 Passau http://www.bildner-verlag.de [email protected]
ISBN: 978-3-8328-0718-9
Autor: Sascha Vennemann Herausgeber: Christian Bildner
Bildquellen:Cover: © Toplitz Productions Autorenportrait: © Sascha Vennemann
© 2025 BILDNER Verlag GmbH Passau, Kennziffer 726_01_EPUB Das Werk einschließlich aller Teile ist urheberrechtlich geschützt. Es gelten die Lizenzbestimmungen der BILDNER Verlag GmbH Passau.
Bei Fragen zur Produktsicherheit wenden Sie sich bitte an folgende E-Mail-Adresse: [email protected] oder informieren Sie sich auf unserer Webseite www.bildnerverlag.com/produktsicherheit .
Für Coco (2010 – 2024), den besten Dog-Companion auf der ganzen Welt, und alle anderen tierischen Begleiter, die uns auf dem Weg durch diese dunkle, kalte Welt beistehen.
PROLOG
Die Schreie kamen von überall her.
Robyn schloss die Augen und presste die Hände gegen die Ohren. Aber was sie auch tat, um diese furchtbaren Geräusche nicht hören zu müssen – sie drangen doch irgendwie zu ihr durch, selbst durch die dicken Handschuhe.
Robyns Puls raste vor Aufregung und Erschöpfung. Hier hockte sie, auf dem kalten Boden der Kirche, mit dem Rücken gegen den Haufen hastig aufgeschichteter Bänke gelehnt, mit denen sie selbst und mit ihr etwa ein Dutzend anderer Bewohner des Häuserlagers die Kirchentür verbarrikadiert hatten.
Sie waren in Sicherheit. Vorerst. Und draußen, das war unüberhörbar, starben ihre Freunde.
Tränen stiegen Robyn in die Augen. Sie blinzelte sie weg. Rann die Flüssigkeit über ihre Wangen und verwandelten sich trotz des Salzgehaltes in kleine Eisklumpen auf ihrer Haut, mochte das zu unschönen Erfrierungen führen.
Sie war sich nicht einmal sicher, ob es immer wieder neue Laute des Schreckens waren, die von draußen hineindrangen, oder ob es nur diffuse Echos waren, die zwischen den von trübem Kerzenschein erhellten Dachbalken der Kirche hin und her waberten.
Nein, es waren immer unterschiedliche Schreie. Mal drückten sie Todesangst aus, mal Wut. Mal absolute Verzweiflung. Robyn wunderte sich, wie die qualvollen Laute hier drinnen noch so deutlich zu hören sein konnten.
Die Holzwände der alten Kirche hielten die Todeskälte gut ab. Außerdem schluckte die dicke Schneeschicht draußen in der Regel alle Geräusche, auch wenn die klirrend kalte Luft den Schall unter Umständen gut und weit trug.
Was hoffentlich nicht dazu führte, dass noch mehr Angreifer kamen, angelockt vom Lärm der Schüsse und der schreienden Sterbenden.
Robyn zuckte zusammen, als plötzlich Mule neben ihr auftauchte und sich vor ihr auf den Boden hockte. Der Händler mit dem ungewöhnlichen Namen, eine gute Seele des Häuserlagers und schon lange Teil ihrer Gemeinschaft, hatte sich ein schmutziges Tuch vors Gesicht und um seinen Kopf gebunden. Es ließ nur seine stets gütig dreinblickenden Augen frei. Aber heute sah Robyn in ihnen das, was sie selbst fühlte: Angst.
„Wir sollten noch mehr Bänke vor den Türen aufschichten“, flüsterte Mule und deutete hinter sich auf die verkeilten Möbel. Wie hier am vorderen Eingang hatten sie auch an den anderen Türen Barrikaden errichtet – in der Hoffnung, dass das die Kultisten aufhielt.
Mehrere Schüsse erklangen aus südlicher Richtung, von einem der Tore im Schutzwall des Lagers, die in Richtung der Hochhausruinen im Zentrum von Metropolis lagen. Von dort kamen sie: die Fanatiker des Mondkultes. Die in schneller Folge abgefeuerten Schüsse schlugen hörbar in irgendwelche Metall- und Holzteile ein. Dann fanden sie offenbar ein Opfer – den Schreien nach zu urteilen eine junge Frau.
Hoffentlich ist es nicht Anna …
Robyn presste die Lippen so fest aufeinander, dass sämtliches Blut aus ihnen wich. Unbewusst rieb sie sich die Hände. Die Kälte schien selbst in die Handschuhe zu ziehen, die sie sich vor gar nicht langer Zeit in Mules Laden gekauft hatte, wie ihr jetzt durch den Kopf ging.
Anna Ivashchenko … Ihre Freundin war dort draußen, ebenso wie Robyns Vater: Sheriff Ethan Cane. Er wusste, wie man mit Waffen umging. Alle im Lager wussten das, hatten es lernen müssen, zwangsweise. Nicht nur zur Verteidigung gegen den Kult, sondern auch, um in dieser Welt des ewigen Eises überleben zu können.
Robyn wusste: Mit einer Axt oder Pfeil und Bogen konnte auch sie zur tödlichen Gefahr werden. Ist schon oft genug vorgekommen. Viel zu oft … Wenngleich es meist Tiere waren, die ich töten musste.
Aber die Kultisten waren kein Stück Wild, auf das man in Ruhe, Besonnenheit und angehaltenem Atem zielen konnte. Sie waren wie Wölfe, jagten in Rudeln, trainierten den Kampf. Lebten nur für ihre verrückten religiösen Ideale und ihren immerwährenden Kreuzzug gegen alles, das nicht ihrer Weltvorstellung entsprach.
Deswegen waren diese Monster hier. Deswegen töteten sie. Deswegen wollten sie Robyns Gemeinschaft und alles, wofür sie stand, auseinanderreißen.
Robyn schüttelte den Gedanken ab und wandte stattdessen ihre Aufmerksamkeit auf die anderen Häuserlagerbewohner in der Kirche.
Sie hatten sich in Decken gehüllt. Freunde und Familien hielten einander eng umschlungen, um sich gegenseitig zu wärmen und Trost zu spenden. Jemand hatte einige schmutzige Matratzen aus einem Nebenraum geholt und sie auf dem Boden verteilt.
Rund ein Dutzend dicker Kerzen sorgte für ein wenig Licht in der ansonsten stockfinsteren Kirche. Schon vor langer Zeit waren die Fenster mit Brettern vernagelt worden.
Dr. Richard Sonenberg ging zwischen den verstörten Menschen umher und untersuchte sie auf Verletzungen, redete leise auf die Personen ein und versuchte, sie zu beruhigen.
Robyn beneidete den Mediziner nicht um seine Aufgabe. Solange der Kampf draußen tobte, würde niemand von ihnen zur Ruhe kommen können. Robyns eigener Herzschlag klang so laut in ihren Ohren, dass sie fürchtete, er wäre selbst außerhalb der Kirche noch hörbar.
Sie stellte sich vor, wie einer der Kultisten vorsichtig das Ohr gegen das Holz der Kirchentür drückte und ihren galoppierenden Puls hören konnte. Ein weiteres Opfer, das nur darauf wartete, unter den Hieben seines mit Nägeln gespickten Baseballschlägers zerfleischt zu werden …
Halt deine Fantasie im Zaun, Robyn! Sie schüttelte ihre Lethargie ab und fand die Kraft, auf Mules Frage, die er vor fast einer halben Minute gestellt hatte, zu antworten.
„Die Barrikaden werden reichen.“ Sie erhob sich. Zu langes Sitzen war nicht gut. Die Kälte machte die Glieder steif, und hier in der Kirche einen Feuerkorb zu entzünden, damit sie sich alle wenigstens ein bisschen wärmen konnten, war auch keine gute Idee. Es sei denn, sie wollten sich alle durch eine Kohlenmonoxidvergiftung selbst umbringen, bevor es die Angreifer taten.
Mule musterte sie aus seiner sitzenden Position heraus. Er schnalzte leise mit der Zunge. „Ich wünschte, ich könnte deinen Optimismus teilen“, murmelte er. „Aber nachdem ich gesehen habe, was diese Tiere mit meinem Geschäft gemacht haben …“
„Unsere Leute sind noch da draußen!“, unterbrach Robyn ihn brüsk. Laut genug, dass Mule vor Überraschung ein wenig zurückwich, aber auch leise genug, dass die anderen ihr Gespräch nicht mit anhören konnten. „Was willst du machen, wenn Überlebende gegen die Tür hämmern und reingelassen werden wollen? Sollen wir sie einfach ihrem Schicksal überlassen?“
Robyns kondensierender Atem bildete einen dichten Nebel vor ihrem Mundtuch. „Sie kämpfen für uns da draußen, Mule. Mein Vater, Anna – sogar Jeremiah Crow, und der kümmert sich normalerweise um nichts anderes als um sich selbst.“ Robyn sah den Händler durchdringend an.
Mule wandte den Blick ab. „Verdammt, Robyn … Selbst uns ist es nur knapp gelungen, uns hier in Sicherheit zu bringen. Wir haben keine Waffen bei uns und können nicht riskieren, dass die Kultisten hier eindringen.“ Er senkte den Kopf und vergrub sein Gesicht in seinen Handschuhen. „So viele Monate harter Arbeit. Und diese Monster machen in wenigen Augenblicken alles kaputt. So etwas darf doch einfach nicht sein!“
Ihn dermaßen verzweifelt zu sehen, schockierte Robyn mehr als die anonymen Schreie, die außerhalb der Kirche nach wie vor erklangen. Allerdings nun sehr viel seltener - und weiter entfernt?
Hoffentlich nicht, weil alle tot sind, sondern weil sie flüchten konnten, durchfuhr es sie.
Am Roten Turm, den Hang zum Gebirge hinauf, gab es noch ein paar Baracken, die Schutz boten. Noch weiter, hinter der Jägerlichtung, gab es sogar noch einige Höhlen, in denen man notfalls eine Nacht ausharren konnte – vorausgesetzt, man fand etwas Holz, das trocken genug für ein Feuer war.
Vielleicht, und darauf hoffte Robyn insgeheim, wollte sich der Mondkult nicht so weit von dessen Unterschlüpfen in der Innenstadt entfernen und gab sich damit zufrieden, so viel Unruhe im Häuserlager gestiftet zu haben, dass sich die Siedlung wohl nicht so schnell davon erholen würde – wenn überhaupt.
Bamm! Bamm! Bamm!
Etwas hämmerte von draußen mit Gewalt gegen die Kirchentür.
„Das sind sie!“, hörte sie einen jungen Mann stöhnen, der mit einer blutenden Oberschenkelwunde auf einer der Matratzen in der Mitte der Kirche lag. „Jetzt kommen sie uns holen!“
Augenblicklich begannen einige andere Geflüchtete zu wimmern und drängten sich noch dichter zusammen. Eltern bildeten einen lebenden Schutzwall um ihre Kinder. In den Augen der Erwachsenen sah Robyn todesmutiges Funkeln.
Bamm! Bamm! Bamm!
„Robyn? Bist du da drin?“ Am Griff der Tür wurde kräftig gerüttelt, aber sie bewegte sich keinen Millimeter nach innen. Die aufeinander getürmten Bänke waren zu schwer.
„Dad?“ Das war die Stimme des Sheriffs! Robyn beugte sich über die Bankbarrikade. „Dad? Bist du das?“
Auch Mule war jetzt aufgesprungen. „Sheriff?“, rief er. „Wie ist die Lage da draußen?“
Eine kurze Pause. Dann ein lautes Seufzen. „Ihr seid tatsächlich da drin“, hörte Robyn ihren Vater mit unendlicher Erleichterung in der Stimme sagen. „Wie viele seid ihr?“
Die junge Frau sah sich um, zählte grob nach. „Nicht viele“, lautete ihre ernüchternde Antwort. Nicht genug, dass es da draußen lediglich einige wenige Opfer gegeben haben könnte – sondern ein verdammtes Massaker.
„Was ist mit den Kultisten?“, wollte Mule wissen. „Sind sie …?“
„Weg. Ja. Nehme ich zumindest an.“ An der leiser werdenden Stimme von Ethan Cane erkannte Robyn, dass er sich vermutlich umgedreht hatte, um sich umzuschauen. „Sie haben ein paar unserer Verletzen oder Toten mitgenommen. Rauf in Richtung Jägerlichtung und Eissee. Weiß der Teufel, was sie dort mit ihnen vorhaben.“
Robyn erschauderte. Sie hatte schon häufig Opfer des Kultes gesehen – gepfählt auf Zäunen oder Pflöcken, zu Mahnmalen des Wahnsinns gefroren. Eisige, mit dunkel gefrorenem Blut verschmierte Statuen, die nur einem Zweck dienten: Angst und Schrecken zu verbreiten.
„Wir räumen die Barrikaden weg, damit ihr reinkommen könnt“, traf Robyn endlich eine Entscheidung. Wenn ihr Vater sagte, die Gefahr sei vorerst vorüber, dann konnte man ihm das glauben.
„Gut.“ Ethan Canes Stimme hatte wieder ihren gewohnten, festen Klang, mit der er sich schon so gegen manchen Widersacher hatte durchsetzen können. „Doktor Sonenberg soll sich bereithalten, mit ein paar Helfern eine Art Lazarett in der Kirche herzurichten. Wir haben einige ziemlich schwer verletzte Menschen hier draußen – und ich fürchte, die Kirche wird erst einmal ein Zuhause für alle werden müssen, die noch übrig sind.“
Er stockte. „Ich weiß nicht, ob ich jemals so viel roten Schnee gesehen habe“, hörte Robyn ihn gedankenverloren hinzufügen.
TEIL I – ZERFALL
Kapitel 1
Artikel aus der Tageszeitung „Voice of Metropolis“,Ausgabe vom Montag, 19. August 2024, Seite 3,Rubrik: „International“:
„Weltweite Gezeitenphänomene geben der Wissenschaft Rätsel auf“ (Autor: Max Gondrom, Redaktion Ostküste)
Die auffälligen Änderungen bei den Gezeitenhöhen überall auf dem Planeten, die erstmalig in der vergangenen Woche von führenden Wissenschaftlern bestätigt wurden, halten weiter an. Nachdem die indigenen Völker Polynesiens bereits vor einigen Monaten von Unregelmäßigkeiten bei der Überflutung ihrer Pfahlbauten an den flachen Stränden der Inselgruppe berichteten, breitet sich das Phänomen nun offenbar immer weiter aus.
„Wir haben uns mit anderen Forschern weltweit zusammengetan, weil wir vor einem Rätsel stehen“, erklärte Dr. Clemens Sammorra, Leiter der geologischen Fakultät an der Universität von Metropolis, bei einer Pressekonferenz am Wochenende. „Wir haben die Ausbreitungsschwankungen selbst bei lokalen Gewässern anmessen können“, erklärte der Geophysiker gegenüber den Reportern. „Es sind also nicht nur Ozeane betroffen – auch in Flüssen und Bächen, Seen und Teichen bewegt sich das Wasser nicht so, wie wir es bislang gewohnt waren.“
Auf die Frage, wie die bisherige Arbeitshypothese der internationalen Wissenschaftlergemeinschaft bei der Untersuchung der ungewöhnlichen Ereignisse lautet, antwortete Sammorra ausweichend. „Die Gezeiten werden üblicherweise durch die Anziehungskraft des Mondes hervorgerufen“, erklärte er. Aktuell lägen aber keine verwertbaren Erkenntnisse darüber vor, ob der Erdtrabant etwas mit den Veränderungen zu tun haben könnte.
Besteht unmittelbare Gefahr für die Bevölkerung von Metropolis – oder gar weltweit? „Aktuell würde ich das verneinen“, lautete Sammorras Antwort an unsere Leserinnen und Leser. „Sollte sich das Phänomen aber nicht wieder legen oder wir, wenn wir die Ursache dafür gefunden haben, nicht gegensteuern können, sieht die Situation anders aus“, fügte er hinzu. Er sei jedoch zuversichtlich, dass es eine natürliche Ursache gebe.
Donnerstag, 23. Januar 2025 – etwa fünf Monate später
Mit einem Seufzen kratzte Ethan Cane die letzten Reste des Kaffeepulvers aus der Vorratsdose und schüttete sie in die French Press-Stempelkanne. Der Wasserkocher, der neben ihm auf der Anrichte der kleinen Küche stand, blubberte geräuschvoll. Gleich würde sich das Gerät mit einem Klack selbst abschalten, und Ethan konnte mit dem kochend heißen Wasser endlich seine morgendliche Dosis Koffein zubereiten, an die er sich so sehr gewöhnt hatte.
„Gut möglich, dass es vorerst das letzte Mal ist, alter Freund“, murmelte Ethan vor sich hin, während er das Wasser eingoss und darauf achtete, dass ihm keine Kaffeespritzer auf das Oberteil seiner Polizeiuniform gerieten. Aktuell hatte er nur zwei Garnituren, die er im Wechsel trug. Und weil er gestern einer Familie beim Reifenwechsel an einem liegengebliebenen Wohnmobil geholfen hatte und dafür unter das Fahrzeug hatte kriechen müssen, war die andere Uniform derzeit, nun, eher wenig ansehnlich.
Heute Abend werfe ich die Waschmaschine an, schwor er sich. Hoffentlich war noch etwas von dem Spezialreiniger da, mit dem sich auch Ölflecken rauswaschen ließen. Ethan erinnerte sich dunkel an ein unbeschriftetes Fläschchen, das irgendwo im Putzschrank stehen musste. Claudia hatte das Zeug besorgt. Im Gegensatz zu ihm hatte sie sich schon immer mit solchen Dingen ausgekannt. Er hatte sich erst damit befassen müssen, nachdem sie gegangen war.
Ethan war nicht stolz darauf, sich so wenig an den gemeinsamen Haushaltspflichten beteiligt zu haben, als sie noch verheiratet waren. Wenn es das einzige gewesen wäre, was bei uns im Argen gelegen hat, hätten wir uns vielleicht sogar wieder zusammenraufen können. Allein schon wegen Robyn …
Der Polizist hörte seine Tochter im Bad des ersten Stockwerks herumpoltern und warf einen Blick auf die Küchenuhr. Schon kurz nach sieben Uhr! Wenn sie noch lange herumtrödelte, würde sie zu spät zu ihrer Schicht im Einkaufszentrum kommen.
Er zuckte mit den Schultern. Nicht mein Problem.
Ethan drückte den Stempel des Kaffeebereiters langsam nach unten. Das Pulver wirbelte durchs Wasser und wurde vom hinuntergepressten Sieb an den Boden der Kanne gedrückt. Ein verführerischer Duft stieg von dem Gebräu auf. Der Cop schenkte sich sofort eine Tasse davon ein und hätte sich beinahe die Zunge verbrüht, als er den ersten Schluck nahm. „Schon viel besser“, entfuhr es ihm, als sich der herbe Geschmack in seinem Mund ausbreitete.
Er drehte sich zum Fenster über dem Spülbecken um und schob die bislang noch geschlossenen Vorhänge zur Seite. Draußen erwachte die Siedlung langsam zum Leben. Im dumpfen Schein der Straßenlaternen sah Ethan seine Nachbarn auf der morgendlichen Runde mit ihren Hunden sowie Eltern, die ihre Kinder für die Schule fertig machten. An einigen Häusern waren sogar noch Weihnachtsbeleuchtungen zu sehen, dabei war das Fest doch bereits fast einen Monat her.
Ethan nahm den nächsten Schluck Kaffee und lächelte. Er erinnerte sich noch gut daran, wie seine Ex-Frau und er morgens Robyn für die Schule fertiggemacht und sie dann dorthin gebracht hatten – entweder er auf dem Weg zum Revier, oder Claudia auf dem Weg zum Büro in der Innenstadt von Metropolis.
Seine Frau war täglich fast eine Stunde zu ihrem Job gependelt – und sie hatte es gehasst. Fast so sehr, wie Ethan es verabscheute, inmitten von Hochhäusern und Straßenlärm in einer kleinen Stadtwohnung zu leben. Und so hatten sie sich, als sie jung und frisch verheiratet waren, darauf geeinigt, in diesen Vorort zu ziehen und sich hier ihr gemeinsames Leben aufzubauen.
Etwa zehn Jahre lang war das auch gut gegangen. Nun ja, was man so gut nannte. Sicher hatten sie ihre Probleme gehabt, und auch er war nicht immer glücklich damit gewesen, dass sie ihm ständig das Gefühl gab, er mache ihr das Leben schwer und bremse sie und ihre beruflichen Ambitionen aus.
Aber da war nun einmal Robyn, und sie liebten sie. Und erst als Claudia wusste, dass ihre Tochter und ihr Mann - den sie zwar immer noch sehr mochte, dessen Engstirnigkeit sie aber nicht mehr länger ertrug - gemeinsam ohne sie zurechtkommen würden, da war sie gegangen.
Wie es wohl wäre, wenn sie jetzt noch bei uns wäre und nicht da drüben? Ethan schaute hinüber zur Skyline des Stadtzentrums, das sich wie ein Gebirge am Horizont auftürmte. In einem dieser Wolkenkratzer arbeitete Claudia. Ethan wusste nicht, ob sie derzeit in ihrem Büro saß und das nächste große Geschäft für die Firma, die weltweit Solarparks baute und betrieb, abschloss, oder ob sie mal wieder für längere Zeit im Ausland unterwegs war, um dort ein Projekt zu begleiten. Vielleicht wusste Robyn es. Sie hatte öfter Kontakt mit ihrer Mutter als er.
„Hey, was ist mit dem Kaffee? Kann ich auch was davon haben?“
Ethan blinzelte verwirrt. War er dermaßen in Gedanken versunken gewesen, dass er nicht bemerkt hatte, wie Robyn die Treppe heruntergekommen war? Offensichtlich.
Die junge Frau hatte ihre dunkelblonden Haare zu einem kurzen Pferdeschwanz zusammengebunden und trug einen bordeauxroten Oversized-Kapuzenpulli, weite Jeans und weiße Sneaker mit einer so dicken Sohle, dass sie damit selbst über ein Nagelbrett hätte laufen können, ohne es zu merken. Ohne jegliche Körperspannung schlurfte sie zum Kühlschrank und nahm eine Packung Milch heraus, griff sich eine Schüssel aus der halb geöffneten Spülmaschine und klemmte sich eine Packung Cornflakes von der Anrichte unter den Arm, bevor sie sich an den kleinen Küchentisch setzte.
Ethan schob ihr eine Tasse und die Kanne herüber. „Aber nur, wenn du dieses edle Getränk auch zu schätzen weißt“, mahnte er und deutete auf die Milch. „Wehe, du streckst es mit dem Zeug da!“
Robyn stellte Milch und Schüssel auf dem Tisch ab, schüttete die Cornflakes aus der Packung in die Schale und übergoss sie mit Milch. Dann gähnte sie und schaffte das Kunststück, sich dabei direkt den ersten Löffel Frühstücksflocken in den Mund zu schieben, ohne ihn zwischendurch noch einmal geschlossen zu haben. „Keine Bange. Heute brauche ich den Stoff pur, um in die Gänge zu kommen.“
In der Kanne war noch ein letzter Rest, nachdem sie ihre Tasse gefüllt hatte. Ethan schüttete ihn in seinen inzwischen halb geleerten Becher. „Das war der letzte Rest von unserem Vorrat. Gut möglich, dass wir erst mal keinen mehr bekommen. Wir könnten noch die restlichen Bohnen mahlen, die wir für den Kaffeevollautomaten gekauft hatten …“
„Igitt, auf keinen Fall!“ Robyn verzog angewidert das Gesicht. „Wie alt sind die schon? Als du die gekauft hast, hab ich noch gar keinen Kaffee getrunken.“
Der Polizist zuckte mit den Schultern. „In den Geschäften gibt es nichts mehr. Weder Pulver, noch Bohnen. Vielleicht diese Instantkrümel, aber dann könnte man auch einfach gleich Blumenerde aufgießen.“
Und doch würden sich die Leute bestimmt darum reißen. Genauso wie um Konserven mit Südfrüchten, die es schon seit drei Monaten nicht mehr gab, ohne dass man dafür Preise jenseits von Gut und Böse zahlen musste.
Die zunehmenden Umweltkatastrophen, Fluten und Erdbeben hatten vor allem den globalen Süden getroffen und Lieferketten zusammenbrechen lassen. Alles, was im Land selbst produziert werden konnte, erreichte die Läden noch irgendwie. Alles andere wurde zur Luxusware – oder war ganz aus den Regalen verschwunden.
„Mmh“, machte Robyn, während sie geräuschvoll schlürfte. „Siehst du, ich genieße ihn. Ich möchte mich immer an diesen Geschmack erinnern können, falls es tatsächlich der letzte Kaffee meines Lebens sein sollte!“
Ethan lachte leise, obwohl ihm eigentlich nicht danach war. Robyn war jung, gerade mal Mitte Zwanzig. Sie war clever, aber aus irgendeinem Grund schien sie das manchmal zu vergessen. Das sah man schon an ihrer Kleidung, fand Ethan: Obwohl sie längst kein Teenager mehr war, lief sie immer noch am Liebsten wie einer herum. Sicher, das hatte auch mit ihrem Job zu tun, denn der Freizeitlook passte nun mal zum Image und auch zum jugendlichen Klientel des Sportartikelgeschäftes, in dem sie täglich genau die Schichten übernahm, die sonst keiner machen wollte. Damit verkaufte sie sich aber weit unter Wert, dachte Ethan. In ihr steckte mehr als eine simple Verkäuferin.
Er hoffte, dass es nur eine Phase war und sich seine Tochter doch noch für den Besuch eines Colleges entscheiden würde. Für ein Kunststudium, wie sie es sich als Kind gewünscht hatte – bevor ihre Mutter gegangen war und ihr geordnetes Leben auf den Kopf gestellt hatte.
Ethans Blick ging zum Kühlschrank, an dem zahlreiche vergilbte, selbst gemalte Bilder von Robyn hingen, die sie in der Elementary School und in der High School gezeichnet hatte. Er hatte ihr Talent immer bewundert und fragte sich, von wem sie das haben könnte. Claudia und er waren künstlerisch völlig unbegabt. Aber man sagte ja auch: Minus mal Minus ergibt Plus. Vielleicht war das eine Erklärung.
Statt zu studieren, hatte Robyn in den vergangenen Jahren immer nur solche Jobs angenommen, die andere nebenbei machten: Sie hatte als Aushilfe in Läden gearbeitet, gekellnert … Einmal hatte sie für eine befreundete Musikband sogar ein Plattencover gemalt.
Reich wurde man damit natürlich nicht. Und auch wenn viele ihrer Freundinnen und Freunde bereits ausgezogen waren und ein eigenes Leben begonnen hatten, zeigte Robyn keine großen Ambitionen, das Haus, in dem sie aufgewachsen war, zu verlassen. Ethan war sich ziemlich sicher, dass das mit den Kosten zu tun hatte, die ein eigenes Appartement mit sich brachte und nicht damit, dass sie ihren Vater so gernhatte. In mancher Hinsicht kam sie nämlich nach ihrer Mutter, was Ethan verständlicherweise doppelt aufregte: einmal, wegen der Tatsache an sich, und dann deswegen, weil sie ihn dann an seine Ex-Frau erinnerte – und an die Streitereien mit ihr.
„Da wir gerade von Erinnerungen sprechen …“ Der Polizist deutete mit seiner Tasse auf die Küchenuhr, die bereits 7:25 Uhr anzeigte. „Erinnere ich mich richtig und du musst um acht Uhr in der Mall sein?“
Robyn sah auf und ihre Augen wurden groß. „Verdammt! Das wird knapp!“ Hastig stürzte sie den Rest Kaffee hinunter und rannte hinaus auf den Flur, wo ihre Jacke und ihr Rucksack hingen. „Es wird später heute!“, rief sie Ethan über die Schulter zu, während sie sich die Sachen schnappte und zur Haustür eilte. „Ich treffe mich nach der Schicht noch mit Emma und wir essen einen Happen.“
„In der Mall?“
„Ja, sie holt mich am Laden ab. Bis später, oder morgen dann!“, rief sie und warf die Tür hinter sich zu.
Ethan sah ihr nach, wie sie über den Gehsteig in Richtung der nächsten U-Bahn-Haltestelle rannte, mit einem Arm im Ärmel der Jacke, mit dem anderen den Rucksack umklammernd. Dann war sie außer Sicht.
Der Cop warf einen weiteren Blick auf die Uhr und entschied, dass es auch für ihn Zeit wurde, das Haus zu verlassen. Er sammelte das benutzte Geschirr ein und stellte es in die Spüle. Er würde sich heute Abend darum kümmern, genau wie um die schmutzige Uniform.
Wenn Robyn sich mit ihrer alten Schulfreundin Emma traf, konnte es tatsächlich spät werden. Das Mädchen aus einem der besseren Stadtviertel musste sich jedenfalls um Geld keine Sorgen machen und würde Robyn, wenn die nicht zu stolz dazu war, gerne zum Essen einladen. Und vielleicht zu dem ein oder anderen Cocktail.
Als Ethan hinter sich abschloss, hellte sich seine Miene schlagartig auf: Ihm war gerade eingefallen, dass es auf dem Revier noch Kaffee gab!
Und damit war der Tag vorerst gerettet.
Logan Boyce hatte schlechte Laune.
Die Geschäfte seiner Import-Export-Firma gingen schlecht, und das seit Monaten. Dabei war er doch in den vergangenen Jahren so gut darin gewesen, die Sachen zu finden, die die Leute im Ausland haben wollten und die er hier günstig einkaufen konnte, und die andere Produzenten aus anderen Ländern wiederum günstig abstoßen wollten, die sich aber hierzulande mit einem ordentlichen Gewinn verkaufen ließen. Wenn man es richtig anstellte.
Logan stellte es immer richtig an. So gut, dass sein Unternehmen, mit dem er in einer gemieteten Garage angefangen hatte, innerhalb von rund 15 Jahren immer weitergewachsen war. Heute gehörten ihm mehrere Hallen im Metropolis-Gewerbepark nahe des Industriehafens.
Alles lief prächtig. Bis plötzlich der Mond verrücktspielte und Logan ins Unglück stürzte. Naturkatastrophen, Fluten, Erdbeben … Die Opferzahlen gingen in die Hunderttausende. So manche Firma, mit der er im Süden der Welt Geschäfte gemacht hatte, war von Monsterwellen hinweggespült oder von wild gewordenen Tropenstürmen hinweggefegt worden.
Der inländische Markt konzentrierte sich seitdem nur noch auf das Nötigste. Niemand kaufte mehr asiatisches Plastikspielzeug, verpackte Süßwaren aus Mittelamerika oder polnischen Sauerkrauteintopf in Dosen – außer ein paar Einwanderer vielleicht. Die Reedereien, die seine sonst gut gefüllten Überseecontainer herbrachten und wieder abtransportieren, hatten ihren Betrieb eingestellt, nachdem ein paar ihrer Schiffe auf hoher See in heftige Stürme geraten und in den haushohen Wellen gesunken waren.
Seit dem Jahreswechsel schien sich nun gar nichts mehr zu bewegen. Logan konnte nur noch auf das setzen, was er in seinen Lagern hatte, und versuchen, das Zeug so gewinnbringend wie möglich loszuwerden.
Es gab also allen Grund dafür, schlechte Laune zu haben.
Immer, wenn Logan schlechte Laune hatte, verließ er sein Büro im ersten Stock des Lagerhauses, schritt gemächlich über die Empore zu der Wendeltreppe, die hinab in den hinteren Bereich der großen Halle führte, und begab sich in das Labyrinth aus Regalen und Paletten, um so lange zwischen ihnen herumzuwandern, bis seine Stimmung wieder besser war.
Das half inzwischen nicht mehr so gut, wie es früher der Fall gewesen war. Deswegen hatte er ja jetzt auch die Tennisbälle.
Logan knirschte mit den Zähnen. Kapitalismus war so eine schöne Sache! Man dachte sich irgendeinen Blödsinn aus, stellte ihn her und sorgte dafür, dass jeder ihn haben und für viel Geld kaufen wollte. Aber das funktionierte nur, wenn sich die Menschen keine Sorgen um ihre Zukunft machen mussten. Globale Umweltkatastrophen, bedingt durch eine abweichende Mondlaufbahn, gehörten nun wahrlich nicht dazu, ein gutes Wirtschaftsklima zu befördern.
Wie man es auch drehte und wendete: Im Moment lief einfach alles beschissen.
Zeit für den Tennisball, dachte Logan. Er griff in die rechte Seitentasche seiner Lederweste. Seine Wut musste irgendwo hin. Also nahm er den Ball heraus und bearbeitete ihn, quetschte ihn zusammen, so gut es ging.
Dann spannte er seinen gesamten Körper an und schleuderte den Ball mit aller Kraft auf den Boden. Der Tennisball knallte auf den Beton und sprang in die Höhe.
Logan folgte dem Ball mit den Augen. Auf einer Höhe, die er auf etwa fünf Meter schätzte, siegte schließlich die Schwerkraft und der Ball fiel wieder abwärts – in Logans ausgestreckte Hand.
Der Geschäftsführer wanderte ein paar Meter weiter, und das Spiel ging von vorne los. Seit rund drei Wochen pflegte er dieses Ritual. Mitunter dauerte es Stunden, bis seine Wut über die Gesamtsituation abgeklungen war. Seine Mitarbeiter hatten schnell herausgefunden, dass man ihn lieber in Ruhe ließ, wenn er so drauf war.
Logan sah sich um. Unbemerkt war er in den Gang mit den Waren aus Indien und Bangladesch eingebogen. Die Sachen, die hier lagerten, waren derzeit schwierig zu verkaufen, weswegen er in der Regel selten vorbeischaute, um nachzusehen, was da noch in den Regalen war.
Aber da waren einige seltsame Bündel, die etwas nach hinten geschoben auf einem Regalboden lagen und nun seine Aufmerksamkeit geweckt hatten. Die Bündel waren in etwa so groß wie Schuhkartons, wenn auch viel unförmiger. Sie sahen so aus, als habe jemand kleinere Packungen zusammengequetscht und sie mit Papier umwickelt.
Logan zog eines der seltsamen Pakete nach vorne. Schwer war es nicht. Die Hallenbeleuchtung ließ jetzt erkennen, dass das umwickelte Papier eine blassrosa Färbung hatte. Für Logan unlesbare Hindi-Zeichen schienen den Inhalt genauer zu beschreiben. Er musste ein wenig suchen, dann fand er allerdings auch ein paar lateinische Buchstaben, die verrieten, was sich in dem Bündel befand.
Logan grinste. Schon als er das Paket nach vorne gezogen hatte, war ihm der würzige Geruch aufgefallen, der von ihm ausging. Und als er las, worum es sich handelte, hatte er auch sofort wieder die Situation vor Augen, wie er an diese besondere Ware herangekommen war.
Er sah noch einmal genau im Regal nach. Ja, es waren tatsächlich noch die sechs Pakete, die damals im ersten Überseecontainer aus Bangladesch geliefert worden waren. Ein Geschenk seiner Geschäftspartner dort: Insgesamt 300 kleine Packungen sogenannter Beedies.
Beedies waren getrocknete Pflanzenblätter, in die man eine parfümierte Tabakmischung eingerollt hatte und die mittels eines Bindfadens an einem Ende zusammengehalten wurden. Man konnte sie wie Zigaretten rauchen. Sie waren aber viel stärker, da sie keine Filter hatten und so eher einer kleinen Zigarre oder einem Zigarillo ähnelten. In Bangladesch waren diese Rauchwaren weit verbreitet – hierzulande kannte sie kaum jemand, und verkaufen konnte man sie auch nicht, wenn sie keine Steuermarke besaßen.
Aber es ist Tabak. Und auch der wird in absehbarer Zeit knapp werden, so wie der Kaffee - und damit immer wertvoller.
Logan wusste sofort, was mit den Bündeln geschehen sollte. Er nahm ein kleines Sprechfunkgerät aus der Innentasche seiner Weste. Das Gerät trug er stets bei sich, seit das Mobilfunknetz nur noch ab und zu funktionierte – noch so eine Auswirkung des verdammten Mondes, der irgendwas mit den Kommunikationssatelliten veranstaltete.
„Miller!“ Logan hatte die Sprechtaste des Walkie-Talkies gedrückt. „Kommen Sie mal mit einem großen Karton in Gang 42. Ich habe hier etwas, das wir an die Kundennummer 22-2806 ausliefern müssen.“
Es knackte im Lautsprecher, dann erklang Robert Millers Stimme: „Verstanden, Chef. Ich übernehme den Transport persönlich.“
Logan nickte zufrieden. „Nichts anderes hatte ich erwartet. Boyce, Ende.“
Miller war einer von Logans Kontoristen und arbeitete schon fast so lange für ihn, wie er selbst im Geschäft war. Sie waren „auf einer Wellenlänge“, wie man so schön sagte. Deswegen wusste Miller auch genau, dass mit der Kundennummer keine Firma und kein Laden gemeint war. Die Zahlenkombination war ein Code für ein geheimes Warenlager.
Logan hatte mehrere davon anlegen lassen, als sich abzeichnete, dass die Welt in eine nie dagewesene Krise stürzen würde. In zahlreichen Garagen und Lagerräumen, in gemieteten Kellerwohnungen oder in Lodges außerhalb der Stadt, hatte er kleinere und größere Depots angelegt.
Dort lagerte er die Dinge ein, von denen er glaubte, dass sie künftig an Wert gewinnen würden. Wie nun die Beedies, die Miller als Wertanlage für die Zukunft in ein Appartement in der Nähe des Stadtparks bringen würde, wo schon einige große Kartons lagerten: eine Auswahl an billigem Fusel und frei verkäuflichen Schmerzmitteln.
Keiner von Logans Mitarbeitern wusste von allen Lagern, selbst Miller nicht. Nur er allein hatte die Liste der Depots im Kopf, die ihm den Hals retten würden, wenn die Situation sich noch weiter verschlechterte.
Logan bemerkte, dass seine schlechte Stimmung tatsächlich für einen Augenblick verschwunden war. Deswegen tätschelte er den Tennisball, der nun wieder in seiner Westentasche steckte, auch nur leicht, während er beschwingt zu seinem Büro zurückging. Die beruhigenden Dienste des Balles waren jetzt nicht mehr erforderlich – vorerst.
Es war vor allem die Stille, die Dr. Richard Sonenberg genoss, als er endlich die Tür des Wartungsraumes hinter sich schließen konnte. Tief durchatmend lehnte er sich mit dem Rücken gegen die Wand und schloss die Augen. Diese Ruhe! Himmlisch!
Das Kellergeschoss des Metropolis City Hospitals war für die Öffentlichkeit gesperrt. Nur über einen speziellen Zugangschip konnte man die Türen zu dem Stockwerk öffnen oder den entsprechenden Knopf in den Aufzügen aktivieren, wenn man hinunter wollte. Und wenn man hier doch jemanden traf, dann waren es nur ein paar Hausmeister – oder die Krankenpfleger, die die unliebsame Aufgabe hatten, verstorbene Patienten in die Kühlkammern zu bringen, wo man sie aufbewahrte, bis die Bestatter sie abholten.
Der Wartungsraum, in dem Richard sich befand, lag genau hinter dem Raum mit den Kühlfächern. Er hörte das Brummen der Anlage, die eine gewisse Wärme in den Wartungsraum abstrahlte. Dann war da noch das leise Zischen der Lüftung, die diese warme Abluft nach draußen beförderte und Frischluft von außen zurück hineinleitete.
Aber diese Geräusche empfand Richard eher als beruhigend – ganz anders als die pausenlosen Schmerzensschreie der Verletzten in der Notaufnahme, neben der die Operationssäle lagen, in denen er bis gerade noch Dienst getan hatte. Dort brüllten Ehepartner herum, Kinder plärrten, Verwandte heulten und klagten … Es war ein Chor der Verzweiflung, der ihm, dem Notfallchirurgen, dort tagtäglich und ohne Unterbrechung in die Ohren drang.
Entsprechend erleichtert war Richard stets, wenn er endlich die medizinischen Einmalhandschuhe abstreifen und in den Müll werfen konnte, die OP-Maske gleich hinterher, und er sich dann auf den Weg zu seinem kleinen Rückzugsort machte, den er sich – nach langer Suche für einen passenden Raum – hier unten geschaffen hatte.
Die Haustechniker ließen ihn hier in Ruhe, auch wenn sie längst über sein „geheimes“ Refugium Bescheid wussten. Richard spendierte ihnen einmal im Jahr, bei der Betriebsfeier, einen Karton Scotch. Er wusste, dass sie ihn hier unten irgendwo deponiert hatten und sich ab und zu nach der Arbeit ein paar Gläser genehmigten.
Er verriet sie nicht – und sie ihn nicht. Das war der Deal.
Richard streifte den Arztkittel ab und warf ihn über die Lehne eines kleinen Sofas, das er eines Nachts unbemerkt durch die sonst nur von Lieferanten genutzte Tiefgaragenzufahrt hierhergebracht hatte.
Auch den Rest der Einrichtung hatte er auf diese Weise hergeschafft. Die beiden großen Terrarien beispielsweise, die auf einem Tisch ganz in der Nähe der Lüftungsanlage standen.
Richard schaltete die Beleuchtung der Glaskästen ein, und sofort begann sich darin etwas zu regen. Aufgescheucht von dem Licht wuselten unzählige kleine Tiere über den mit Erde, Ästen und Moos versehenen Grund der Terrarien.
Der Arzt beugte sich vor und sah dem Treiben zu. „Na, meine Kleinen? Wie geht’s uns denn heute?“
Natürlich antworteten ihm die Insekten nicht. Küchenschaben waren keine guten Gesprächspartner. Mehlwürmer ebenso wenig.
Richard wandte sich zu seinem Kittel um und zog ein paar welke Salatblätter heraus, die er am Nachmittag aus der Kantine mitgenommen hatte. Das Buffet dort war so gut wie abgegrast gewesen. Niemandem fiel es auf, wenn er an der Salatbar irgendetwas einsteckte.
Er warf das Grünzeug in beide Glasbehälter und schaute dabei zu, wie sich die Kakerlaken und die Würmer auf das Futter stürzten. Innerhalb kürzester Zeit hatten sie alles weggefressen.
Richard warf sich beruhigt auf sein Sofa. Mit hinter dem Kopf verschränkten Armen blickte er zur Decke, an der sich die braunen Ränder eines großen Wasserflecks abzeichneten. Irgendwo hier musste mal eine Leitung defekt gewesen sein. Richard hoffte, dass es keine Abwasserleitung gewesen war.
Egal. Er schloss die Augen und erlaubte sich, zu entspannen. Viel Zeit hatte er nicht. In einer halben Stunde war der nächste OP-Termin anberaumt. Eine Amputation, wenn er sich richtig erinnerte.
Normalerweise wusste der Arzt nicht viel über die Vorgeschichte desjenigen, der da vor ihm auf dem Operationstisch lag. Aber diesmal hatte Richard die Einlieferung des jungen Mannes mitbekommen, dem er gleich das linke Bein bis unterhalb des Knies abtrennen musste.
Der Kerl war noch keine zwanzig Jahre alt und gehörte wohl zu irgendeiner Straßengang aus einem der ärmeren Stadtviertel. Bei einer Schießerei mit einer verfeindeten Gruppe war er am Unterschenkel getroffen worden. Der Schuss war glatt durchgegangen, aber die Wunde hatte sich infiziert. Der Verletzte hatte sich – vermutlich aus Angst vor den Fragen der Ärzte oder Polizei – nicht in Behandlung begeben und das Antibiotikum, das ihm seine Gangkollegen verabreichten, war wohl schon jahrelang abgelaufen und damit vollkommen wirkungslos gewesen.
Jetzt hatte ihm der Wundbrand das Fleisch zerfressen und der Unterschenkel war nicht mehr zu retten.
Richard fühlte kein Mitleid mit dem Jungen. Das konnte er sich in seinem Beruf nicht leisten, schon gar nicht in Zeiten wie diesen. Wegen der zunehmenden Weltuntergangshysterie häuften sich die Fälle von Gewaltverbrechen, bei denen Menschen zu Schaden kamen. Und die füllten dann die Notaufnahmen und OPs der Krankenhäuser, wo sich Richard und seine Kollegen um sie kümmern mussten.
Die Betten waren seit Monaten knapp. Häufig mussten sie die Patienten auf mobilen Liegen in den Fluren platzieren.
Außerdem gab es kaum noch Nachschub an Arzneien. Schmerzmittel wurden rar, Fiebersenker sowie Antibiotika. Selbst Verbandsmaterial war nur noch schwer zu bekommen.
Richard hatte das vorausgesehen. Sobald klar war, dass irgendetwas mit dem Mond nicht stimmte, war er dazu übergegangen, bei welcher Gelegenheit auch immer es möglich war, das gute Zeug für sich abzuzwacken.
Ein Patient bekam Opioide? Dann notierte Richard in der Patientenakte, dass er zwei Pillen bekommen hatte, gab ihm aber nur eine und steckte die andere in einen Zipbeutel, den er stets in seinem Arztkittel bei sich trug. Und so machte er es auch mit anderen Arzneien.
Inzwischen hatte Richard eine ansehnliche Sammlung zusammengetragen. Sie lagerte sicher in dem Fach unter der Sitzfläche des Sofas, auf dem er gerade lag. Hier war sie gut versteckt. Seine Reserve für schlechtere Zeiten, von denen Richard überzeugt war, dass sie kommen würden.
Aus diesem Grund züchtete er auch die Schaben und die Mehlwürmer. Was immer auch mit der Welt geschah: Diese Insekten würden einen Weg finden, damit zurechtzukommen. Sagte man nicht, dass Kakerlaken selbst einen Atomkrieg überleben würden?
Was viele nicht einsehen wollten, war, dass Insekten eine hervorragende Proteinquelle waren. In der westlichen Welt war der Verzehr der Krabbeltierchen zwar verpönt und wurde mitunter sogar als ekelhaft angesehen. Aber überall sonst snackte man die Viecher schon seit Ewigkeiten. Egal ob frittiert oder gefriergetrocknet. Sie schmeckten zwar nicht besonders gut und man musste sie gut kauen … Aber bevor man verhungerte, war es sicher eine Option, seine Vorurteile über Bord zu werfen, oder?
Die Terrarien dienten Richard dazu, auszuprobieren, unter welchen Umständen die Insekten am besten gediehen, was sie am liebsten fraßen und welche Temperaturen ihrem Wachstum entgegenkamen. Die von der Kühlanlage erzeugte Wärme trug offenbar gut zur Reproduktion bei. Die Mehlwürmer mochten am liebsten Gemüse, Obst und Weizenprodukte. Die Schaben hingegen fraßen so gut wie alles, das sie mit ihren Kauwerkzeugen kleinkriegen konnten.
Der Chirurg war sich inzwischen sicher, er könnte seine Zucht problemlos größer aufziehen, wenn es nötig werden sollte. Aber noch war es ja nicht soweit.
Richard öffnete ein Auge und zog seinen rechten Arm unter sich hervor, um auf seine Armbanduhr schauen zu können. Verdammt, es wurde Zeit, dass er nach oben zurückkehrte. Missmutig richtete er sich auf, zog den Kittel wieder an und wandte sich zum Gehen.
Da ertastete er ein Salatblatt, das er in seiner Kitteltasche übersehen hatte.
Richard ging noch einmal zurück zu den Terrarien und zog das schon recht welke Blatt hervor. „Na, wer möchte Nachtisch?“, fragte er amüsiert, bevor er es in zwei Hälften riss und jeweils eine davon zu den Mehlwürmern und eine zu den Schaben gab.
Er schloss die Behälter, begab sich zur Tür und schaltete im Hinausgehen das Licht aus. Nach seiner Schicht würde er noch einmal nach den Insekten sehen.
Jetzt wartete erst einmal die Knochensäge auf ihn.
Als Ethan Cane auf dem Revier ankam, merkte er bald, dass er sich zu früh gefreut hatte: Deputy Barnes hatte ihm auf seine Frage, ob sie schon Kaffee angesetzt hätte, mitgeteilt, dass auch hier der Vorrat komplett zur Neige gegangen war.
„Sorry, Sheriff. Wir müssen schauen, dass wir künftig auch ohne das Zeug durch den Tag kommen.“ Charlene Barnes lächelte ihn entschuldigend an, als sie seinen enttäuschten Blick bemerkte. Die rothaarige Mittvierzigerin mit dem hübschen Gesicht und der Kurzhaarfrisur, die hinter ihrem mit Akten voll beladenen Schreibtisch saß, deutete hinüber zur Küchenzeile der kleinen Polizeistation. „Wir hätten da noch eine Menge verschiedener Kräutertees, die Brandon irgendwann angeschleppt, aber selbst nie angerührt hat.“
Ethan verzog angewidert das Gesicht. „Da könnte ich ja gleich den Rasen im Vorgarten mähen und den aufgießen. Nein danke, Charly“, wehrte er ab, während er sich durch den engen Durchlass zwischen den Aktenschränken und dem Schreibtisch seines zweiten Deputys, Brandon Yates, hindurchzwängte.
Dahinter lag die Tür zu Ethans Büro. Als Sheriff stand ihm ein eigener Raum zu, während Barnes und Yates sich das Vorzimmer teilen mussten, das durch einen brusthohen, hölzernen Tresen vom Besucherbereich abgetrennt war, den man direkt vom Eingang aus betrat.
Ethan ließ die Tür zu seinem Büro meist offen. Zwar war er offiziell der Chef der Station, aber mit seinen Kollegen kam er auch so gut aus, ohne ständig den Boss raushängen zu lassen.
Er setzte sich und fuhr den Computer hoch. Ein paar handschriftliche Protokolle warteten noch darauf, abgetippt zu werden, und weil die Station keine eigene Schreibkraft beschäftigte, blieb das am Ende an jedem einzelnen Polizisten hängen – auch an ihm.
Ethan runzelte die Stirn, als sein Blick auf den Dienstplan fiel, von dem er stets einen großen Ausdruck an einer Pinnwand neben seinem Arbeitsplatz hängen hatte. „Wo ist Brandon überhaupt? Er müsste eigentlich im Dienst sein, aber ich sehe nicht, dass seine Straßenkleidung am Haken hängt oder einer unserer Wagen fehlt.“
„Er hat sich per Funk bei mir gemeldet.“
Von seinem Platz aus konnte Ethan Charly nicht sehen. Sie klang, als hätte sie gerade einen Bissen von ihrem Frühstück genommen. Häufig war das ein Burrito, den sie vom Dinner am Abend zuvor aufgehoben hatte. Sie liebte mexikanisches Essen, was man ihr aber nicht ansah: Sie als spindeldürr zu bezeichnen, mochte zwar keine nette Umschreibung sein, kam der Wahrheit allerdings ziemlich nahe.
„Er hat heute Morgen überraschend Besuch von einem Nachbarn aus der Parallelstraße bekommen, bei dem offenbar eingebrochen wurde. Der Mann hat ihn gebeten, sich die Sache mal anzusehen, und weil es ja sowieso in der Nähe war, ist Brandon gleich mal hingefahren, ohne vorher hier vorbeizuschauen.“