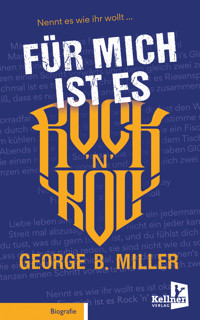
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kellner, Klaus
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
George B. Miller hat den Rock ’n’ Roll dort erlernt, wo der Musikstil in den 1950er-Jahren mit Elvis ankam: in Bremerhaven. Als Sohn eines amerikanischen Soldaten und einer deutschen Mutter kam Miller dort 1947 zur Welt und wurde sogleich in die zweisprachige Welt der GIs mit Jazz, Soul und Rock ’n’ Roll hineingezogen. Seine Karriere als Musiker begann schon 1959 als Cellist, 1964 machte er seine ersten Erfahrungen mit einer Rock-’n’-Roll-Band. Zwischen 1970 und 1990 war er als Berufsmusiker tätig und arbeitete u. a. mit Cracker Jack (Top 40), den Rattles in Hamburg, der Band Wolfsmond in Bremen/Bremerhaven sowie Stephan Remmler zusammen. In der Band Meier/Miller/Kaiser konnte er sich am ehesten mit eigenen Kompositionen verwirklichen. Noch heute spielt er in der regional bekannten Band »Hagen Allstars«. Unzählige Liedtexte erschienen von ihm in deutscher und englischer Sprache, veröffentlicht auf diversen Tonträgern mit verschiedenen professionellen Bands. Der von ihm getextete Radio-Hit »Für mich ist es Rock ’n’ Roll« läuft seit 1982 im Radio und wurde zu seinem Lebensmotto: Fühlt euch frei und genießt das Leben! Diese Biografie ist geradezu ein zeitgeschichtliches Dokument. Plastisch lässt Miller in den Erzählungen die Welt der Musik in den verruchten Kneipen der 60er wieder aufleben und führt sie bis ins Youtube-Zeitalter. Ein spannendes Lesevergnügen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 544
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Nennt es wie ihr wollt... Für mich ist es Rock ’n’ Roll
GEORGE B. MILLER
FÜR MICH IST ES
Dieses Buch ist bei der Deutschen Nationalbibliothek registriert. Die bibliografischen Daten können online angesehen werden: http://dnb.d-nb.de
Dieses Buch ist meinen Schwestern Carol und Gisela gewidmet sowie allen Musikern und anderen tollen Menschen, die mich ein Stück auf meinem Weg begleitet haben. Dazu gehört auch Truck ’n’ Roller Helmut Frank, der diese Zeilen von da ganz oben lesen wird.
Besonderer Dank an Jochen Laschinsky.
GB
VORWORT
Als die Amerikaner Mitte der 1940er nach Bremerhaven kommen, entstehen nicht nur Kasernen, in denen die Soldaten einquartiert werden, und brandneue Mietwohnungen für ihre Familien in verschiedenen Stadtteilen, sondern auch AYA-Clubs (American Youth Association), Lokalitäten für Jugendliche. Eine Jugendgruppe mit dem bezeichnenden Namen »Schwalbe« ist 1946 im Café Simon in der Weserstraße untergebracht. Wegen starker Baufälligkeit durch die Kriegsjahre muss schnell eine neue Stätte her.
Einer der eifrigsten Befürworter eines neuen Jugendheims, Brigadegeneral Charles W. Canham, der in seiner Ansprache ausdrücklich betont, wie wichtig ein Gebäude für die unabhängige Jugend sei, führt im selben Jahr den ersten Spatenstich in Wulsdorf durch. Das Gorch-Fock-Heim, ein Blockhaus im typischen Stil der amerikanischen Camps, hat seinen Platz. Natürlich formieren sich Steine, Bretter und Balken nicht von allein zu einem Gebäude, aber für eine begeisternde Idee gibt es immer freiwillige Helfer. Jugendliche und Angehörige der U.S. Army sind mit Freude im Einsatz, besonders hervorzuheben die amerikanische Football Mannschaft »Blue Devils«. Gemauert und getischlert wird von den Mitarbeitenden der »Labor Service Unit«. Sämtliche Kosten für Materialien kommen durch Spenden zusammen.
Im nördlichen Stadtteil Bremerhavens, Speckenbüttel, wird fast zeitgleich, also kurz nach der Kapitulation, der erste AYA-Club im Parkhaus eröffnet. Pop Lindner, Ermächtigter des Clubs, übergibt Anfang der 1950er-Jahre die Leitung an Rolf Köhler. Der sorgt unter anderem dafür, dass ortsansässige Boxgruppen dort trainieren und Musiker in den Kellergewölben ihre Proben abhalten können. Währenddessen spielen im großen Saal des Hauses die Rixer Bennys oder die Ex-Combo der MS Europa, die Pommerenke Band, zum Tanz auf.
Nur fünf Minuten zu Fuß entfernt wird ein Blockhaus, in der Bauweise exakt wie das Gorch-Fock-Heim, als Stätte für die Jugend freigegeben. Auch hier besteht neben vielschichtiger Freizeitbeschäftigung die Möglichkeit für angehende Talente, sich in Sachen Musik probieren zu können. Sogar Instrumente wie Schlagzeug, Kontrabass und Klavier werden zur Verfügung gestellt.
Wir gewöhnen uns ziemlich schnell an die diversen Vorteile durch die amerikanische Besatzung. Der Schwarzmarkt boomt und nirgends in der Republik gibt es so viele Kneipen wie in Bremerhaven, gemessen an der Stadtgröße. Die kleinen punkten mit Musikbox, die etwas größeren engagieren Einzelkünstler, und wo es passt, spielen sogar Bands.
Etwa zwanzig Jahre später ist die Stadt an der Wesermündung Hochburg der Beatmusik. Die Vorbilder etlicher Formationen kommen aus England und den USA. Man spielt wie sie, kleidet sich wie sie, und manch Männlein ist von Weiblein angesichts der Haarpracht kaum noch zu unterscheiden.
Das wiederum ruft den Menschen mit schmalem Gehirnbeutel, Zögling der breiten Masse auf den Plan, der immer alles in einer festen Verbindung sehen muss. Für ihn sind Baum und Rinde untrennbar wie Dummheit und Brot, und Musiker gehen gar nicht ohne Alkohol und Drogen. Dabei verschreibt der Hausarzt doch schon beim Anflug einer Erkältung Drogen. Dann kommt jemand von der britischen Insel über den Kanal und hält ein Schild hoch, auf dem steht, dass zu dieser idealen Verbindung auch noch Sex gehöre.
Plötzlich wird aus dem Künstler ein schwer einzuschätzender Hippie mit filzig langer Matte, der sich wahrscheinlich nur einmal pro Woche wäscht, vorausgesetzt es regnet. Sex ist indes in jedem Haushalt zu finden. Man redet eben nur nicht darüber.
Hier in Bremerhaven redet auch niemand über Rock ’n’ Roll. Alle zelebrieren ihn. Hier geht er zuerst los, importiert wie ein Virus durch die US-Jungs von den Truppentransportern, Tag und Nacht vom AFN-Radio über den Äther gesendet, um sich erst dann über die gesamte Republik zu verteilen.
Eine Handvoll Jahre später erfinden die Briten die Beatles, Stones, The Who und andere Beatgenossen, und der Rock wird vom Roll getrennt, gerät ein bisschen ins Abseits. Nichtsdestotrotz schießen Tribut- und Coverbands weiterhin wie Unkraut aus dem Boden, und ich mittendrin.
Allerdings bin ich ein Spätzünder, quäle mich mit Kolophonium und Bogen auf dem Cello im Symphonieorchester herum, bis mich der Sohn meines Cellolehrers in die Moderne einweist. Kein wirklich außergewöhnlicher Weg, eine Rockkarriere zu starten. Dennoch, um Verwechslungen vorzubeugen, es gibt nur einen, der ist wie ich, es gibt nur einen, der so ist wie du. Deshalb kann ich dich nicht meinen, nur mich. Ich bin ich; denn wäre ich du, dann würde ich diesen Text nicht schreiben. Also, gib dich bitte nicht damit zufrieden, hier nur oberflächlich zu blättern. Erst wenn du mitdenkst, wird das Gelesene zu deinem Besitz. Wenn du ab einer bestimmten Seite nicht mehr zwischen Realität und Fiktion unterscheiden kannst, träume weiter. Alles andere wäre nur Zeitverschwendung. Sollte dir das nicht gefallen, dann genieße wenigstens die Zeit, die du verschwendest.
DER ANFANG (OHNE ENDE)
Mein richtiges Leben beginnt mit der Einschulung in die Zwinglischule, der Auflösung der ersten Klasse wegen Überfüllung und dem folgerichtigen Umzug in die Neulandschule. Zum ersten Mal erlebe ich, wie zwei Vertreterinnen des anderen Geschlechts mein Innerstes in Aufruhr versetzen. Monika Wilkens, in meinem Alter, und meine Klassenlehrerin Fräulein Schäfers.
Von Letzterer bin ich so hingerissen, dass ich ständig etwas unternehme, um ihre Aufmerksamkeit auf mich zu lenken. Als wir das Thema »Post« behandeln, so wie sie früher mal war, überrede ich meinen Vater, mir eine originalgetreue Postkutsche aus Pappe mit vier Pferden zu basteln. Fräulein Schäfers ist mächtig beeindruckt, auch wenn ihr klar ist, dass das nicht allein mein Werk sein kann. Immerhin komme ich ganz nah an sie heran, rieche ihr Parfüm und gestehe ihr gern, dass es nur meine Idee und meine Vorgaben waren.
Meine sonstigen schulischen Leistungen sind aber auch nicht von schlechten Eltern, und ich avanciere schnell zum Klassenersten. Ein verantwortungsvoller Posten. Ich muss nämlich in dem Zeitfenster, in dem die Lehrkraft mitten im Unterricht mal verschwindet, nach vorn und alle aufschreiben, die lauter sind oder sich nicht benehmen.
Gewievt nutzt mein Schwarm Monika unsere Freundschaft aus, ist mit Abstand die lauteste, wissend, dass ich ihren Namen nicht an die Tafel schreiben werde. Die Klasse weiß das natürlich auch und benimmt sich dementsprechend angepasst. Monika ist ein adrettes Mädel, bei dem ich bereits zweimal zu Hause war. Familie Wilkens hat schon einen Fernseher. Tochter Monika macht nach sechs Monaten Schluss, weil sie sich sicher ist, dass ich nur wegen des Fernsehers zu ihr komme. Geküsst haben wir uns nämlich noch nicht, weil ich unsicher bin, ob das angebracht ist.
Es sind die Jahre der Tante-Emma-Läden, des Sarotti Mohrs, Lurchis lustigen Salamander-Geschichten, und für die etwas härter Gestrickten die Abenteuer großer Helden wie Tarzan, Sigurd, Falk oder Kit Carson in Comic-Streifenheftchen für zwanzig Pfennig. Da sie in Fortsetzungen veröffentlicht werden, greifen sie das schmale Budget empfindlich an.
Mein Abenteuer beginnt kostenlos an einem unbeschwerten Tag X im Freizeitheim Klushof in der Stresemannstraße. Mit vierzehn Jahren lege ich da das erste Mal eine von einem Freund geliehene 45er (»California Sun«, Rivieras) auf den Plattenteller eines nagelneuen Grundig TW 504 GT des Hauses. Geliehen, ja, kaufen ist nicht drin. Dafür reicht das Taschengeld eben nicht. Ich sehe zum ersten Mal, wie die Mädels in dem circa zehn Quadratmeter kleinen Aufenthaltsraum mit den Hüften wackeln. Unter meinesgleichen lerne ich ziemlich schnell, dass es effektiver ist, mit Jungs abzuhängen, die mehr draufhaben als ich. Das bringt mich schneller weiter. O nein, bitte nicht missverstehen, ich liebe geschütteltes Haar, bewegliche Hüften und andere Frauenbewegungen, solange sie rhythmisch sind. Ich bin hetero, aber eindeutig spätpubertär. Meine innere Stimme schreit nach etwas ganz anderem: Musik!
In diesen Tagen habe ich ein amerikanischeres Hörgefühl als die meisten Teenager um mich herum, die die Beatles und die Stones favorisieren. Danny & the Juniors, Everly Brothers, Brenda Lee, Dion & The Belmonts, Chuck Berry, das sind meine Helden und viele mehr.
Ich liebe den Doo Wop der Orioles, Blue Jays und anderer Gesangsgruppen aus den amerikanisch-afrikanischen Gemeinden. Mag sein, dass es daran liegt, dass ich inmitten einer amerikanischen Soldatensiedlung aufwachse und ziemlich schnell Kontakte zu den Kids knüpfe. Ich lerne ihre Sprache wie das Essen mit Messer und Gabel.
Meine Mutter nimmt mich mit ins Kino zu krausen Peter Filmen, weil sie glaubt, Peter sei besser für mich als Tarzan oder Perry Rhodan. Sie liebt lustige Unterhaltung wie Süßes zu ihrem Kaffee. Mit Rock ’n’ Roll hat Peter allerdings wenig zu tun, ungeachtet seines Erfolges. Das ist alles viel zu seicht, schöne Welt, nicht wild hämmernde Schreie voller Sehnsucht nach Freiheit wie bei Little Richard, Jerry Lee Lewis oder Elvis. Aber das ist ja Geschmackssache und Erfolg gibt meistens recht.
Mit meinem Klassenkameraden Detlef Kolze, der schon ein amtliches Tonbandgerät sein Eigen nennt, machen wir Aufnahmen von den Radio Luxemburg Hitparaden, katalogisieren und vergleichen sie, und haben großen Spaß dabei. Wir eruieren viel über Autoren, Plattenfirmen, die deutschen sowie internationalen Charts und stellen dabei verwundert fest, dass immer nur Lennon/McCartney bei den Beatles oder Jagger/Richard bei den Stones die eigenen Songs allein zeichnen. Was ist mit den Kollegen? Können sie nicht oder dürfen sie nicht?
Bei Detlef finden auch schon richtig interessante Geburtstagspartys statt. Sie sind innovativer, fortgeschrittener als bei den anderen aus meinem Freundeskreis, wo Kakao, Kuchen und bunte Luftballons die Höhepunkte sind. Unser Lieblingsspiel heißt »Miau Brrr«. Eine Person wird ausgelost und muss sich in einem kleinen Kabuff hinter einen Vorhang stellen, während aus dem Kreis der Verbliebenen am Tisch jemand »Miau« macht. Wer immer hinter dem Vorhang steht, antwortet nun entweder mit »Miau« oder mit »Brrr«. Miau heißt so was wie »Komm«, »Brrr« bedeutet »Nein, danke«.
Als ich endlich mit meinem »Miau« akzeptiert werde, wartet meine Klassenkameradin und geheime Favoritin Margrit mit ihrem riesigen Kussmund auf mich.
Was nun? Sie sieht mich an, will mich küssen. So sind die Regeln. Ich erschrecke mich dermaßen, dass ich im ersten Moment nicht weiß, was ich tun soll. Spontan umarme ich sie und klopfe ihr freundschaftlich auf den Rücken. Sie lacht leise, dennoch hörbar genug. Nun wissen es wohl alle: Wer lacht, küsst nicht. Immerhin, der erste wirkliche Kontakt mit einem weiblichen Wesen, der lediglich eine Ganzkörper-Transpiration mit sich bringt. Mehr kann man es wohl nicht nennen. Darüber denke ich aber erst am Montag in der Schule nach, als mich die anderen Schülerinnen aus meiner Klasse auf dem Schulhof tuschelnd von der Seite mustern. Ich glaube, jeder kennt diesen Blick und das Gefühl, wenn ein Geheimnis kein Geheimnis mehr ist. Sollte ich mich also zu einem naiven Bürschlein entwickeln, das ständig ein bisschen hinterherhinkt?
1963 kommt dieser unglaubliche Instrumentalhit der Surfaris aus den USA in die deutschen Radios: Wipe Out. Keine Ahnung, weshalb ich in der Schule mit wachsender Begeisterung versuche, das Teil bei jeder Gelegenheit, also zwischen den Unterrichtsstunden, mit den Händen im Ablagefach unter dem Tisch zu trommeln.
Irgendwann fragt mein Sitznachbar Thomas Stöwsand mich: »Sag mal, bist du Schlagzeuger?«
Ich kann das Wort noch nicht einmal fehlerfrei schreiben, nicke aber. Er ist Erster Cellist im Symphonieorchester der Schule. Ich auch, aber nicht Erster. Der könnte ich zweifellos sein, sagt mein Cellolehrer Kurt Albes, aber Begabung allein würde nicht ausreichen. Übung macht den Meister. Das weiß man doch.
Ich bin alt genug, es besser zu wissen, andererseits zu jung, dass es mich einen Scheiß interessiert. Ich will diese Kniegeige überhaupt nicht erlernen. Blockflöte in der Grundschule habe ich nur wegen Fräulein Schäfer mit Inbrunst gespielt, in die ich ja unsterblich verknallt war. Für eine Extrastunde mit ihr nahm ich die Flöte gern in Kauf.
Auf dem Gymnasium legt man mir dann nahe, es wäre durchaus vorteilhaft, ein Instrument zu bedienen, das zu meiner Figur passen würde. Soll ich mich freuen, dass es nicht der Kontrabass ist? Mir geht es nur um die Note Sehr gut in Musik, die man automatisch bekommt, wenn man im Orchester mitwirkt.
Das teure Instrument wird von der Schule kostenlos zur Verfügung gestellt. Höchst angenehmer Nebeneffekt für mich: Ich muss im Musikunterricht keine lästigen Fragen nach Dur oder Moll beantworten, die Musiklehrer Inderst in Akkorden auf dem Flügel anschlägt.
Raten habe ich nie wirklich gemocht. Der Quintenzirkel erinnert mich eher an einen Lesemappenverleih. Wie wichtig er sein kann, erfahre ich erst viel später.
»Das ist doch prima!«, erwidert Thomas mein Nicken. »Ich spiele ein bisschen Bass. Da sind noch ein paar Jungs, die haben auch Instrumente. Komm doch einfach mal in das Freizeitheim im Speckenbütteler Park. Da treffen wir uns immer. Das nächste Mal Donnerstag, 17 Uhr.«
Das Blockhaus ist bei gutem Fuß nur fünfzehn Minuten von unserem Haus entfernt. Da ich als Knirps von meinem Großvater sonntags zum Fußball beim ATSB mitgenommen wurde, ist mir der wunderschöne Park mit seinen tausend Wegen nicht fremd, auch wenn mein Blick die meiste Zeit nur nach unten gerichtet war.
Opa trug stolz die goldene Ehrennadel dieses Vereins am Revers, führte mich in die taktischen Geheimnisse des Spiels ein und versprach mir fünf Mark für jede Eichelhäherfeder, die ich finden würde. Ich entdeckte bis heute keine, und das Abseits beim Fußball bereitete mir zwanzig Jahre später noch Probleme.
Im FZH (Freizeitheim Speckenbütteler Park) bin ich vorher noch nie gewesen, aber es gefällt mir. Ein Flur zum Saal mit abzweigenden Räumen, in denen viele Dinge gebastelt werden, die man eigentlich nicht haben muss. Frauen, die meine Mutter sein könnten, vertreiben sich hier ihre Zeit mit dem Brennen von Ton, oder was weiß ich. Alle Generationen vertreten.
Deshalb wird irgendwann aus Jugendheim wohl Freizeitheim. »Heim« hat aber auch einen leichten Beigeschmack. Das empfindet der Namensgeber wahrscheinlich ebenso und nennt es Stätte oder Freizeitzentrum.
Überall riecht es verdammt gut nach Holz. Geradeaus durch kommt man zum Saal. In dem stehen Tischtennisplatten, und ganz hinten ist eine Bühne. Die Jungs sitzen in einem kleinen Raum links davon.
»Hallo, George, toll, dass du gekommen bist«, werde ich von Thomas begrüßt. »Das sind Hans und Franz und Wilfried, und da, das wäre dein Instrument.«
Ich bedanke mich. Auf Anhieb hätte ich es nicht erkannt. Die Schlagzeuge, die ich inzwischen von Bildern kenne, sehen alle anders aus, in diesem Moment aber unwichtig, es ist nämlich ein Anfang. Da ich vorher noch nie hinter so einer Schießbude gesessen habe, fummle ich erst einmal hier und da herum, versuche den anderen das Gefühl zu vermitteln, ich wüsste genau, was Sache ist.
Es passiert relativ schnell, und plötzlich weiß ich es. Der rechte Fuß ist für die Eins und die Drei, die linke Hand für Zwei und Vier, die rechte Hand im doppelten Tempo auf dem Becken.
Dann geht’s mit einem Mal richtig ab. Aber wie! Ein heilloses Durcheinander von blauen Geräuschen und anderen Unstimmigkeiten, dass es einem problemlos einen Bluterguss in der Membran besorgen könnte. An meinen rhythmischen Vorgaben orientiert sich niemand. Das kann es nicht sein. Dennoch, keiner scheint frustriert.
Jeder hat sein eigenes Instrument einigermaßen fest in der Hand, von Zusammenspiel aber keine Spur. Alles völlig planlos. Aller Anfang ist schwer. Das steht wie ein fettes Banner im Raum.
Am darauffolgenden Donnerstag treffen wir uns nur noch zum antialkoholischen Trinken und musikalischen Klugscheißen. Ich bin eine Stunde früher da und übe den einzigen Beat, den ich kann, bis zum Umfallen.
In der Schule spricht mich wenige Wochen später Posaunist Herbert Wessels an. Er habe gehört, ich sei Schlagzeuger, und fragt, ob ich eventuell Lust hätte, in seiner Abiturienten-Jazzband auszuhelfen. Das ist nun schon eine ganz andere Liga. Ihr »Jazz« ist Dixieland, Dixieland ist viel Swing, Swing ist viel Foxtrott, und alles immer geradeaus.
Trotzdem, ganz so einfach, wie ich es hier schreibe, ist es nicht. Ich lerne den Begriff »Arrangement« kennen, den ich mir merken muss, und dass die Bass Drum, im Gegensatz zum Rock ’n’ Roll nicht permanent getreten wird.
Herbert gibt mit dem rechten Fuß das Tempo vor. Von einer Probe zur nächsten macht es immer mehr Spaß. Nach einem Monat ist der alte Trommler wieder gesund und ich bin raus. Das war so abgemacht.
Da nimmt mich unser Musiklehrer Heinz Inderst zur Seite.
»Sag mal, ich habe gehört, du spielst bei den Abiturienten?«
Ich sage ihm, dass leider nicht mehr. Er bietet mir trotzdem einen Job als Marschtrommler im Blasorchester der Schule an. Der würde ihnen noch fehlen. Nun also auch noch mit Noten. Da es in meinem nahen Umfeld niemanden gibt, der mir kostenlos exaktes Trommeln vermitteln kann, werde ich zum Autodidakten.
Vom Steinmetz in der Friedhofstraße hole ich mir ein Bruchstück Marmor. Darauf sollen die Stöcke besser springen, und es macht keinen Lärm.
In jeder Pause, wenn meine Kameraden auf dem Schulhof heimlich auf die belegten Brötchen der Mädels aus den höheren Klassen schielen, bring ich mir das Links-rechts-links-rechts bei, übe Triolen und stiere auf die Punkte zwischen den Linien, bis sie zu einem schwarzen Wirrwarr verschwimmen. Das Notensystem für eine einzige Trommel ist allerdings wesentlich simpler als für ein komplettes Schlagzeug. Alles auf einer Reihe. Irgendwann denke ich, das Wichtigste sind die Pausen, sonst fällt man nur unangenehm auf, wenn alle anderen aufhören. Na gut, und dann wieder die Einsätze.
Ich versuche mich in verschiedensten Übungen, die mir selbst einfallen. Das, was da auf dem Blatt steht, kann ich nämlich schon rückwärts spielen. Wipe Out, im Original auf den Toms getrommelt, und Drumming Up A Storm von Sandy Nelson werden zu meinen Etüden. Auf der Platte nur undeutlich auszumachen, wie die Schlagzeuger das wirklich spielen, zumal man bei den Aufnahmen wohl einen Effekt draufgegeben hat. Wie auch immer, ich komme den Originalen immer näher. Zudem sind beide Nummern eine wunderbare Lockerungsübung. Es ist Rock ’n’ Roll, und es ist ein tolles Gefühl, Schule und Musik offiziell verbinden zu dürfen.
Da sind diverse Gründe, weshalb ich Schlagzeuger werden will. Ich bin süchtig nach Musik. Mir würde es gefallen, im Hintergrund zu wirken und dennoch das Herz, der Motor einer Band zu sein. Grund Nummer drei: Ich möchte mein eigenes Groupie. Zu dem Zeitpunkt ist mir noch nicht klar, dass Frontleute für dieses Anliegen wesentlich bessere Chancen haben. Last, not least, meine tänzerischen Qualitäten sind gleich null. Mir fehlt der Mut zur Ambition. Damit möchte ich sagen, als Musiker würde ich vorzugsweise ein anderes Parkett nutzen wollen und lieber für die Tanzenden spielen.
Jedenfalls ist das mein Ziel. Das festigt sich an einem frühen Samstagabend bei einer Candlelight Party im Klushof. Mit zwei Mark bewaffnet, gebürstet und echt adrett, wohlriechend von einem bescheidenen Spritzer Tabac, der das Kernseifenaroma verdrängen soll, und einem fetten Schlüsselbund in der engen Jeans, betrete ich ziemlich verunsichert den im Dämmerdunkel gehaltenen Saal.
Auf der Bühne eine gut, aber an meinem Ohr vorbeispielende Vier-Mann-Combo in schwarzer Klamotte. An den neun Tischen etwa zwölf Leute wenig nachbarlich verteilt. An einem Tisch sitzt eine junge Dame, die gerade ihre Cola leergetrunken hat. Auf mein Geheiß bringt ihr der ehrenamtlich arbeitende Getränkeservice eine frische Cola. Wir prosten uns zu. Dann ein verschämt züchtiger Wimpernschlag, wenn auch mit zunehmender Frequenz. Meine Einbildung suggeriert mir, der letzte Blick hatte fast zärtlichen Charakter. Dennoch, mir fehlt ganz einfach die Traute. Stattdessen lasse ich ihr noch eine Cola schicken.
Sie nimmt die Flasche in die Hand, steht auf und kommt an meinen Tisch, beugt sich tief, dass ich ihre schwarz geränderten Augen sehen kann, und fragt: »Hey, weshalb Cola? Warum tanzt du nicht mit mir?«
Ich erfinde spontan eine Kurzgeschichte über mein lädiertes Knie, verursacht durch sportliche Aktivitäten.
»Ich werde das berücksichtigen und ganz vorsichtig mit dir umgehen«, haucht sie.
Die Band spielt einen Dreivierteltakt. Ich nehme das wohl zu wörtlich und walze über das arme Ding hinweg. Nachdem ich dreimal hintereinander so unglücklich mit meinen 47ern auf ihren zarten Ballettfüßen lande, glaube ich, es ist ihr egal wie nur was, welches Leiden ich habe.
»Wollen wir uns setzen?«, fragt sie. »Muss ja nicht wieder an getrennten Tischen sein!«
Sie stellt sich als Inge vor, und ich sage ihr, dass ich die Band toll finde und den Drummer kenne. Sonst fällt mir nichts ein. Die Welt des verbalen Schäkerns ist nicht meine. Ihre wohl auch nicht. Fische auf dem Trockenen. Sie wiegt ihren Körper zur Musik, etwas unrhythmisch, und ich versuche, mit dem Klopfen meines Zeigefingers ihr den richtigen Takt auf der Tischplatte zu geben.
Mit einem Mal ist die Zeit um.
»Bringst du mich zur Bushaltestelle? Ich muss nämlich noch ganz nach Wulsdorf.« Straße, Haus- und Telefonnummer nennt sie in einem Atemzug. Mein Kugelschreiber hakt, und der Zettel wellt sich. Als der Bus vorfährt und sie einsteigt, scheint es, als würde sie humpeln. Etwa meinetwegen?
Ihr Abschiedskuss macht mich erst schwindelig, dann nachdenklich. Wollte ich in meinen Träumen nicht immer derjenige sein, der ritterlich um weibliche Gunst kämpft? Erobert zu werden liegt mir nicht, ebenso wenig, wenn man es mir zu leicht macht.
Ich brauche ein Erfolgserlebnis, gehe zurück in den Ballsaal, warte auf die nächste Pause der Band und frage den Schlagzeuger nach der Marke seiner Stöcke. Als er mir dann noch den Preis für seine Schießbude nennt, weiß ich, mein Wunschzettel muss um einen Traum erweitert werden.
»Dieses Haus hat einen Musikraum. Da steht ein komplettes Schlagzeug, das jeder nutzen darf. Man muss nur Mitglied im Verein sein«, sagt Drummer Eddy.
Leiter des Hauses, Emil Oczkowsky, erkennt wohl die Gier nach Musik in meinen Augen und hilft mir beim Ausfüllen der Registrierung. Weshalb ich so brenne, weiß ich gar nicht, da ich ja noch nicht einmal Musiker kenne, mit denen ich eine Band gründen könnte. Vielleicht ist es auch nur der intensive Wunsch, Teil einer Gemeinschaft, eines Teams zu sein.
Bei Inge bin ich nur ein einziges Mal zu Hause. Ihre ältere Schwester betritt in einem ungünstigen Moment das Zimmer und serviert lockerplaudernd Kaffee und Butterkuchen. Sie gefällt mir mit ihrer Wortgewandtheit auf Anhieb. Ob das nun umgekehrt auch der Fall ist, keine Ahnung. Unsere Augen treffen sich zwar nur zweimal, dafür etwas länger. Das ist dennoch zu kurz, um in die Zukunft sehen zu können, und die daraufhin missgelaunte Stimmung der Gastgeberin erinnert mich daran, dass ich am anderen Ende der Stadt wohne. Distanz kann auf Dauer eine Beziehung zerstören.
Nach wenigen Wochen ist es so weit. Stolz stehe ich hinter der extra für mich von der Schule erworbenen Messingtrommel und werde den anderen im Blasorchester vorgestellt.
Schiefe Töne wie bei den Trompeten und Klarinetten gibt es bei mir nicht. Ich kann allerdings den gesamten Ausflugsdampfer zum Kentern bringen, wenn ich mich mit Offbeats und Synkopen nicht an das vorgegebene Notenmaterial halte. Jedenfalls ist das Trommeln unter zweiundzwanzig Bläserinnen und Bläsern neben dem Mann an der großen Trommel, der für die Eins und die Drei zuständig ist, ein erhabenes Gefühl.
Das Symphonieorchester, dem ich inzwischen nur noch als dritter Cellist angehöre, spielt permanent zu traurigen oder seriösen Anlässen, beispielsweise der Entlassung der Abiturientinnen und Abiturienten, dem letzten Schultag vor den großen Ferien oder irgendwelchen Gedenkfeiern.
Das Blasorchester aber wird eingeladen zur Silberhochzeit von Autohaus Schmalzried, bekommt Kaffee und Kuchen und eine Spende für die Notenkasse. Ist alles viel lustiger da, und deshalb fallen die zusätzlichen Stunden der Orchesterprobe nach dem normalen Schulunterricht, die hin und wieder sein sollen, mir auch nicht schwer.
Irgendwann aber wiederholt sich alles, ungeachtet der neu einstudierten Stücke. Für mich bleiben bei den Märschen nach wie vor nicht viel mehr als die Zwei und die Vier. Dann muss etwas Neues her, es muss rhythmisch nur passen. Was nicht schon als Idee, von anderen ungesehen, auf der Straße verkümmert, erfinde ich.
Im Unterricht bringt das meine Lehrkräfte ziemlich schnell an die Schwelle eines neuen Denkens. In meiner Klasse sitzen Genies, Schwachköpfe und Ehrgeizige, allgemein als Streber bekannt, die sich durch die Stunden schwitzen. Ich zähle zu keiner der genannten Kategorien. Meine Haushefte, sorgfältig mit Skryptol und vielen Farben aus dem Tuschkasten ausgemalt, bringen mich zwar als einen Fleißmuffel bei meinen Freunden in Verruf, im Vergleich zu ihnen muss ich aber durch die guten Noten für die Hefte nie nach vorn an die Tafel. Das funktioniert allerdings nicht in jedem Fach so. In Algebra bin ich grottenschlecht, in Geometrie etwas weniger schattig. Wäre mein Nachbar ein talentierterer Zeichner, würde er mir etwas unkomplizierter die Sicht auf seine Werke freigeben, ich könnte in der Noten-Hitparade ganz oben mitmischen. Zu viele Konjunktive, um einen Sinn zu verstehen. Chemie, Physik und andere Reaktionen, danke nein, ganz sicher nichts für mich.
Meine Talente liegen eindeutig im Zeichnen, der Musik, also der Kunst, im Englischen und meiner Muttersprache. Diese vier Einsen reichen aber nicht. Künstler sind eben anders. Auf einem mathematisch-naturwissenschaftlichen Gymnasium aber mit Sicherheit im falschen Haus.
Geschickt versuche ich mich andererseits in spontanen Entschuldigungen bei den Lehrkräften.
»Tut mir aufrichtig leid, dass Sie mich beim Abschreiben (oder was weiß ich) ertappt haben!«
»Ach? Tatsächlich? Sie wollen mir also sagen, es tut Ihnen leid, dass ich Sie erwischt habe, dass Sie es nicht cleverer angestellt haben?«
Diesen Gedanken habe ich ihnen quasi suggeriert. Ich mache sie stolz auf sich selbst, lasse sie in dem Glauben, mich durchschaut zu haben, sammle so Sympathiepunkte. Das muss nicht zwangsläufig so sein. Da ist Hoffnung im Spiel, und immer ist das sowieso nicht drin. Dann muss eben wieder was Neues her.
Wenn ich etwas genauer hinsehe, entdecke ich schon mal eine hochgezogene Augenbraue oder ein abfälliges Grinsen bei unserem Mathelehrer Dr. Klatt, wie auch bei Herrn Blau, dem Physiklehrer, wenn ich von dieser oder jener Stunde befreit werde, weil eine wichtige Probe mit dem Blas- oder Symphonieorchester ansteht. Dabei haben Mathematik und Musik ein sehr enges Verhältnis, denkt man an Takte, den Quintenzirkel, den Dreiklang und dass Umfang oder Länge eines Instrumentes den Klang verändern.
Ich sag’s mal so: Entweder geht das den Herren Pädagogen nicht wirklich auf oder sie sind neidisch auf etwas, das ihre Unterrichtsstunde an die zweite Stelle setzt. Es kommt zudem nicht oft vor, aber ich gestehe, es trifft häufig meine absolut schwächsten Fächer.
Geübt wird ja ansonsten grundsätzlich nach Schulschluss in der Aula. Wenn allerdings Abschlussfeiern im Kalender stehen oder eine Auslandsfahrt geplant ist, sind zusätzliche Orchesterstunden nicht ungewöhnlich.
In diesen Tagen bereiten wir uns auf eine Reise nach Agersted in Nordjütland für beide Ensembles vor. Nur die Besten dürfen mit. Ich habe mich unentbehrlich gemacht, weil von mir zwei Instrumente in den Bus kommen. Insgesamt etwa vierzig Musikerinnen und Musiker plus Dirigent Heinz Inderst nebst weiblicher Begleitperson. Sogar Sprachunterricht im Dänischen ist anberaumt. Tak, mange tak, tusend tak, mehr kann ich mir erst einmal nicht merken.
»Höflichkeit steht in Skandinavien ganz vorn«, erinnert Herr Inderst. »Sie hat Priorität. Zudem sind wir musikalische Botschafter unseres Landes.«
Mir schwillt der Kamm. Während der unendlich langen Busfahrt, die zwangsläufig unangenehme Sitzfleischzerrungen beschert, weil Hin- und Herlaufen untersagt ist, werden alle immer wieder an ihre Aufgaben erinnert.
Geiger Wilfried Müller ist beispielsweise als Notenwart eingeteilt und für einen recht schweren Koffer verantwortlich. Das erwähne ich nur, weil Willi relativ klein ist, und das wuchtige Behältnis häufig auf dem Boden schleift, wenn sein Arm nach fünf Schritten lang und länger wird. Insgeheim scheint er sich aber zu freuen, dass er nicht für die Koffer mit den Notenpulten zuständig ist. Die älteren Musikerkollegen sollen auf die jüngeren achten. So haben sie auch etwas zu tragen. Verantwortung.
»Was findest du denn an ihr?«, entgegnet er relativ gut hörbar für alle, sodass meine Schwärmerei nun wohl allen bekannt ist.
Nach kurzer, aber überaus herzlicher Begrüßung werden wir an Gastfamilien verteilt. Ich komme zu den auf Anhieb sympathisch wirkenden Slettens, die im Dorf eine Molkerei besitzen. Ein Glückslos, denke ich sofort. Drei Söhne, Torben, Björn und Magnus, das passt, die passen. Alle spielen ein Blasinstrument. Im ersten Moment könnte man auf den Gedanken kommen, ganz Agersted sei musikverrückt.
»Fast jedes Dorf hat hier ein Orchester oder zumindest einen Spielmannszug«, erklärt Torben mir auf Englisch. »An jedem Wochenende wird irgendwo öffentlich musiziert.«
Gleich am ersten Abend sind Geselligkeit und Tanz zum dorfeigenen Akkordeon-Bass-Schlagzeug-Trio im Kro angesagt, der einzigen Kneipe weit und breit mit separatem Gesellschaftsraum. Die erste Gelegenheit, dem Tambour Major näherzukommen. Aber wie? Tanzen ist ja nun mal nicht mein Ding. Torben hat mir ihren Namen verraten. Sie heißt Ane-Marie Thomsen, und einen festen Freund soll sie auch nicht haben. Vielleicht funktioniert die Cola-Nummer wie damals im Klushof. Nein, sie sitzt nicht an einem Tisch, schaut nicht zu mir herüber, vor allem, sie trinkt Squash und keine Cola.
»Geh hin, rede mit ihr«, schlägt Torben vor. »Sie spricht gut Englisch.«
Herzklopfen, Adrenalin, dann stehe ich neben ihr.
»Hi!«, sage ich und sie erwidert es ebenfalls mit einem Hi. Plötzlich ein drittes Hi. Herbert Wessels. Verdammt, wo ist der denn so plötzlich hergekommen?
Hatte Ane-Marie mich nur kurz angelächelt, sein Hi strahlt sie mit vollen Lippen so lange an, dass ich denke, ich könnte in aller Seelenruhe problemlos ihre blendend weißen Zähne aus der Oberreihe zählen.
Doch so schnell gebe ich nicht auf. Da es hier im Saal viel zu laut ist, schreibe ich einen Zettel mit der Bitte um ihre Telefonnummer und stecke ihn ihr heimlich zu. Sie gibt ihn mir tatsächlich zurück, wenn auch heimlich. Am nächsten Tag nach der Orchesterprobe rufe ich sie an und verabrede ein Rendezvous im Kro. Sie erscheint wirklich. Herbert auch. Ich bin aber früher da.
Die Slettens freuen sich jedes Mal offensichtlich über meine vielen Taks. Mehr als würde ich Danke sagen, glaube ich. Innerhalb kürzester Zeit entsteht ein freundschaftliches Verhältnis. Auf eigenen Wunsch darf ich in der Molkerei mithelfen und lerne eine Menge über Milch, Butter, Käse und Zentrifugalkraft.
Beim Frühstück oder Mittagessen immer wieder Fragen über mein Zuhause. Klar, dass ich irgendwann stolz meine Banderfahrung erwähne, auch wenn ich im Moment gar keine Formation habe. Die Jazzer waren ja nur eine kurze Episode.
»Du könntest doch am Sonntag beim Fest auf dem Sportplatz in unserer Garde trommeln!« Torben überrascht mich damit beim Abendbrot. »Die Jacke von Magnus sollte dir passen. Er muss nach Aarhus und kann beim Festumzug nicht dabei sein.«
Was für eine großartige Idee! Vater Sletten, unter anderem mitverantwortlich für die Patenschaft und den Austausch der Orchester, hat nichts dagegen. Die Uniform sitzt wie für mich gemacht. Es soll eine Überraschung sein und deshalb geheim gehalten werden. Mächtig stolz denke ich sofort an Ane-Marie. Was sie wohl sagen wird.
Zunächst fahren wir aber erst einmal an die Spitze Nordjütlands nach Skagen, um ein Freiluftkonzert zu geben. Ich werde sie also den ganzen Tag nicht sehen, ganz sicher aber ihr Bild während der anderthalbstündigen Busfahrt ständig im Kopf haben.
Zwei Stunden vor Beginn sind wir da. Über Skagen strahlt ein blauer und wolkenloser Geigenhimmel. Dazu bläst indes ein Wind der Güteklasse Notenblatttod. Jeder Musiker wurde rechtzeitig und immer wieder auf Wäscheklammern für die Blätter hingewiesen.
»Wilfried, den Koffer, bitte!« Koffer? Das darf doch nicht wahr sein. Er hat ihn vergessen.
»Dann lauf zurück und hole ihn!« Herr Inderst hört sich nicht an, als würde er das witzig meinen. Fünfundsiebzig Kilometer? Willi weiß gar nicht, in welche Richtung er laufen soll. Was tun? Hinsetzen und auswendig spielen? Genau so!
Nur die Ersten aus jeder Kategorie, Geigen, Bratschen, Celli, haben die einfachsten Stücke einigermaßen im Gedächtnis. Peter Jung, Konzertmeister, sowieso, Bruder Rolf dagegen weniger. Deshalb spielt er wohl auch nur die zweite Geige. Ich habe fürs Cello nicht eine einzige Note im Kopf.
An der Trommel ist das Spielen nach Gehör dagegen nicht mehr ungewöhnlich für mich. Der Rest ist ungeheuer froh, dass der ungnädige Wind das heillose Durcheinander verweht. Ich bin irgendwie erleichtert, dass der schicke Tambour Major nicht Zeuge des Debakels geworden ist. Eines wird jedoch deutlich: Die wenigen Dänen um uns herum sind bestechend höflich. Das hat man uns ja schon vor der Reise gesagt. Irgendwann ist aber auch solch ein Unglück vergessen, und der Moment, an dem man darüber lacht, rückt mit jedem vergangenen Tag näher.
Projekt »Dänemark« ist als Orchesteraustausch gedacht, und Besuche in unseren Partnerstädten Cherbourg und Grimsby kommen ebenfalls hinzu. Immer wieder eine geballte Ladung Kultur, anders gesprochene Sprachen als im Unterricht, erste Gleichgewichtstörungen vom Rotwein und verbissenes Munterbleiben bei den langwierigen Acht-Gänge-Menüs in Frankreich. Fish and Chips in England sind definitiv problemloser. Diese Reisen werden von der Stadt subventioniert, sind aber für jeden Einzelnen keinesfalls kostenlos. Keine einfache Situation, zumal meine Familie gerade einen zusätzlichen Ernährer braucht. Mein Vater ist GI und in Korea unterwegs. Na gut, »Ernährer« ist natürlich maßlos übertrieben. Die Zeiten für Taschengeld sind nicht gerade optimal, es sei denn, es wird eigenhändig verdient. Während der Schulzeit bringt mich der Job bei einer kleinen Wäscherei um meine Freizeit. Tonnenschwere Nasswäsche bei Wind und Wetter mit dem Fahrrad ausfahren, in die fünfte oder sechste Etage schleppen, um dann zu hören: »Junge, kann ich das beim nächsten Mal bezahlen?«
»Kommt überhaupt nicht in Frage!«, hat mir der Chef eingebläut.
»Tut mir leid, geht leider nicht«, sage ich, »dann muss ich alles wieder mitnehmen.« Das miese Gefühl, das ich bei diesem Satz habe, macht die Last nicht gerade leichter. Fünfzig Pfennig bekomme ich pro Stunde, keine Verschleißgebühr oder Kilometergeld für mein Fahrrad. Am Ende der Woche besitze ich fünfzehn DM, von denen ich unaufgefordert zehn zu Hause abgebe.
Abends bin ich im wahrsten Sinne des Wortes gerädert, viel zu kaputt, um noch meine Schularbeiten zu erledigen. Das muss dann wieder in der Schule passieren, wie der Name schon sagt. Der Gedanke, dass möglicherweise für die Schule, nicht in der Schule gemeint ist, dass es eigentlich Hausaufgaben heißt, nun gut, der ist mir zu schwierig.
Meine Familie bekommt davon nichts mit, da es an meinen Zensuren nicht auszumachen ist, und feiert mich dafür als kleinen Helden. Meine beiden jüngeren Schwestern Gisela und Carol besonders. Ein tolles Selbstwertgefühl mit dem zusätzlichen Bonus: Der Sohn der Heißmangel-Besitzerin nimmt mich samstags auf seiner Kreidler Florett mit ins Kino, wo sich ganz andere Helden auf der Leinwand von Liane zu Liane schwingen.
Er ist siebzehn und darf in Filme ab sechzehn. Ich bin fünfzehn und werde bei einer Kontrolle im Foyer gleich beim zweiten Mal erwischt. Das bringt ziemlichen Ärger zu Hause.
Als man mir eines guten Tages nahelegt, die Schule aufgrund meines Benehmens zu wechseln, obwohl ich leistungstechnisch nicht zum unteren Drittel gehöre, akzeptiere ich das Angebot. Nur die Lehrerinnen haben sich für mich gerade gemacht, weil ich ihnen gegenüber immer höflich war und die Klassenzimmertür öffnete, nur um sie nach ihnen zu schließen.
Ich soll auch das Grinsen eines Hinterhof-Casanovas haben, sagt mein Klassenlehrer. Bei ihm würde es aber null Wirkung zeigen. Trotzdem sei die Fünf in Algebra sehr wohlwollend.
Ich nehme also die Versetzung in die elfte Klasse als Geschenk und wechsle in die Schule des Lebens. Das mag nach einem Schritt zurück klingen, ist es für mich aber nicht. Ich habe ja nicht die Absicht zu studieren. Dazu gehören Fleiß und Ausdauer, ganz sicher auch ein Ziel. Die drei fehlen mir gerade.
Da ist ja auch immer noch mein geliebter Aufenthaltsort, der Klushof. Ich lerne Rolf Appelt kennen, der mich in die Kunst des DJs einweist. Das ist der absolute Wahnsinn. Alles, was auf den Teller kommt, macht die Tanzfläche voll. Selbst die schicksten Mädels sprechen ihn an, haben ständig irgendwelche Wünsche, und das liegt ganz sicher nicht an seinem biederen Outfit. Sie zu erfüllen, ist ihm aber ein Pläsir. Mir auch, wenn ich dran bin.
Da ist schon ein bisschen Rampenlicht. Eine blaue Lampe, eine rote, und die zwei weißen über dem Mischpult. Stimmt, etwas mickrig, aber ein Anfang. Ein ehrenamtlicher Job, bei dem es nichts zu verdienen gibt. Immerhin, meine Getränke muss ich nicht selbst zahlen.
Die Bühne, auf der unser Tisch mit Plattenspieler, Anlage und Mikrofon steht, ist riesengroß. Samstags spielt hier die Schwarze Vier zum Fummeln bei Kerzenlicht im Cola-Rausch. Livemusik! Das klingt magisch und hat natürlich noch wesentlich mehr Anziehungskraft für meine Augen und Ohren als Lieder aus der Konserve.
Dann passiert etwas Unerwartetes.
Im Klushof höre ich eines Nachmittags noch nie vernommene Geräusche aus einem Raum, von dem ich gar nicht wusste, dass er überhaupt existiert. Es klingt verdammt nach Chuck Berry, Johnny B. Goode, etwas anders, aber doch erkennbar.
Vorsichtig öffne ich die Tür. Da stehen zwei Jungs mit Gitarren und ziepen sich die Finger wund. Schüchtern versuche ich, mich in einer Ecke unsichtbar zu machen und lass sie gewähren.
»Kannst du trommeln?« Die Stimme reißt mich aus meinen Gedanken. »Dann hau rein!«
War das witzig gemeint? Ich kann nicht, aber ich will. Das Schlagzeug in der Ecke, Eigentum des Freizeitheims, habe ich gar nicht wahrgenommen. Mein Blick gilt den beiden Gitarreros. Hans-Otto in-der-Wische an einer roten, halbakustischen Höfner-Gitarre und Axel Hedemann an einer weißen Framus Solid Body.
Ich greife mir die beiden ziemlich abgewetzten Stöcke und trommle jedes Lied aus der gehörten Erinnerung. Wir fangen zusammen an, (was zwischendurch passiert geht niemanden etwas an) hören gemeinsam auf und sind wie im Fieber. Wir verstehen uns, ohne etwas voneinander zu wissen. Das ist die Eintrittskarte in den Rock-’n’-Roll-Zirkus mit eigener Band. Dafür lohnt es sich, jeden Tag zu proben.
Im Büro hängt ein Kalender, auf dem steht, dass der Raum leider nicht nur uns allein zur Verfügung steht. Also gut, dann eben nur zweimal in der Woche.
Hans-Otto und Axel lieben künstliches, schummriges Licht. Das schafft Club-Atmosphäre, bereitet vor auf die Realität, sagen sie. Ich ziehe die Gardinen aber immer wieder zurück, damit die vorbeistreichenden Mädchen, die auf dem Weg zum Bastelraum sind, uns sehen können. Publikum macht mich an.
Akustisch sind wir sowieso nicht zu überhören. Laut ohne Ende, aber leider nur mittig und hochfrequent.
Uns fehlt ein Bassist für die tiefen Töne. Den finde ich in meiner Klasse. Er heißt Wolfgang, möchte aber mit Io (sprich: i-o) angesprochen werden. Io besorgt sich einen Bass, kann ihn zwar nicht wirklich gut bedienen, sieht dafür aber blendend aus und verkauft sich gut. Will sagen, jedes Groupie würde ihm sofort abnehmen, dass er toll spielen kann, so wie er sein Instrument hält. Wir sind ja alle keine Perfektionisten, ich am allerwenigsten. Singen kann er auch.
Für mich bleiben die Chuck-Berry-Nummern, für die anderen Beatles, Stones, Kinks. Durch Rolf Appelt gibt es immer wieder aktuelles Material zur Erweiterung unseres Programms für unsere Proben am Dienstag und Donnerstag. Zweifellos ein großer Vorteil.
Die Arbeit bei der Wäscherei brauche ich mehr denn je, um mir neue Stöcke kaufen zu können. Ohne Fleiß keinen Preis. Die Band ist komplett. Den Namen steuere ich bei, The Soulbeats, obwohl wir nur Rock ’n’ Roll spielen. Er gefällt den anderen trotzdem. Hat ja was mit Seele zu tun.
War Drummer Eddy bis dato mein Vorbild, ist es jetzt Manner Bönig von den Black Stars, Bremerhavens Top-Band, der gerade völlig entfesselt seine Übungen in unserem Proberaum auf einem Ludwig donnert. Auf dem Kalender im Büro stehen aber wir, und ich frage ihn, wie lange er noch braucht.
»Höchstens zehn Minuten, nur noch den einen Fill. Hab dann sowieso eine Verabredung mit meiner Freundin.«
Zwanzig Minuten später stehe ich wieder vor ihm.
»Was ist mit deiner Freundin?«
»Die muss warten!«
Ich bin beeindruckt. Dann ist er fertig und ich sehe ihm beim Abbauen seines Ludwig Kits zu. Solch eine Schießbude, die ich vorher nur bei Ringo Starr gesehen habe, wäre für mich nicht einmal in der abgespeckten Version finanzierbar. Selbst wenn ich besser rechnen könnte als irgendjemand anders, den ich kenne, würde es wohl Jahre dauern, bis ich solch ein Teil in der Spardose hätte. Wie haben es bloß die anderen zu einem eigenen Instrument geschafft? Besser bezahlte Jobs? Reiche Eltern? Banküberfall?
Mitten in unserer Probe dann eine außergewöhnliche und denkwürdige Begegnung. Ein unscheinbares Häufchen Mensch mit einem Sack in der Hand, in dem es augenscheinlich eine Gitarre aufbewahrt, steht plötzlich verschüchtert im Raum, hört zu, wartet, bis wir eine Pause machen und sagt:
»Hallo, mein Name ist Klaus Meier. Ich bin Gitarrist. Kann mir hier jemand die Akkorde von Summertime zeigen?«
Wir schauen uns verblüfft an.
»Klar«, sagt Hans-Otto erfreut darüber, dass er helfen kann. »Wir spielen es schon länger.« Dann legt er los mit Eddy Cochrans Hit.
»O nein, den Summertime Blues meine ich nicht, den aus Porgy und Bess, den von George Gershwyn.«
Das ist zu viel des Guten. Wir haben unsere Mühe mit Zwei-Akkord-Nummern, und dieser Nobody, von dem niemand weiß, ob er überhaupt ein Namensschild unter der Türglocke hat, will gleich an einen Titel, an den wir uns vielleicht in einem Jahr wagen könnten. Vorausgesetzt wir kommen weiter so zügig voran.
Tut uns leid, damit können wir nicht dienen. Ich sehe mir Klaus genauer an und entdecke an seinem Handgelenk eines dieser begehrten silbernen Panzerketten-Armbänder. Darauf prangt ein amerikanischer Adler, und der Name »George« ist in fetten Lettern eingraviert.
»Hey, Klaus, ich heiße George. Du doch nicht. Willst du mir das Armband nicht vermachen? Oder wollen wir irgendwas tauschen?«
»Nein«, sagt er bestimmt. »Es ist ein Geschenk. Ich tausche nicht. Eher nenne ich mich selbst George.«
Dann geht »George« ohne sich umzudrehen und ohne Tschüs zu sagen. Das sitzt. Ein selbstbewusster und knackiger Auftritt.
Als wir nach drei Monaten endlich zehn Nummern so gut einstudiert haben, dass wir sie fast neunundneunzig Prozent fehlerfrei hintereinander wegspielen können, denken wir das erste Mal über einen Auftritt nach. Io erzählt von einem Manager, den er gut kennt und der ständig auf der Suche nach Bands ist.
Zwei Wochen später sollen wir an einem Samstagabend zu Seebeck am Markt kommen. Ein riesiger Rock-’n’-Roll-Schuppen, auch Hein Wuppdi genannt, für etwa tausend Leute.
Strenge Sitten herrschten damals ein Jahrzehnt vorher in den 1950ern. Vorn am Eingang wurde gerufen: Achtung, Sperrstunde, Polizei!
Blitzartig waren alle hinten durch die Toilettenfenster raus. Draußen standen aber schon Uniformierte und nahmen die Fliehenden in Empfang. Noch heute schmunzelt man über die Angeber, die mit einer Hand in der Tasche klimperten, als wären es Autoschlüssel und dann vergessen hatten, von ihrem Hosenbein die Fahrradklammern abzumachen.
Jeden ersten Freitag im Monat drängeln sich junge Talente hinter der Bühne beim Sängerwettstreit unter der Regie von Harry Nestler. An diesem Abend aber spielen die Zöglinge von eben diesem Manager, Klaus Lukas, die Rhythm Brothers aus Cuxhaven, seine Vorzeigeband. Eine prima Gelegenheit, eine Einlage zu geben.
Man darf erst ab sechzehn rein. Io kennt aber den Mann an der Kasse. No risk, no fun. In einer Ecke, links vor der Bühne, sitzt der Mann, der uns weiterhelfen soll.
»Ihr seid also die Soulbeats. Na, dann zeigt mal was ihr draufhabt. In der Pause könnt ihr hoch.«
Ganz ruhig kommen diese Worte, emotionslos, cool, kaum vernehmbar gegen den hämmernden Beat der Rhythm Brothers, der mir Angst macht. Dann ist es so weit. Wir sind dran.
Ich darf hinter dieses, unglaublich Respekt einflößende Drum Kit. Von irgendwo höre ich: »Okay, leg los, zähl vor!«
Panikschübe, und ich fühle mein Herz im Tempo von I Saw Her Standing There wummern. Das würde ja passen. Ich schlage mit verschwitzten Fingern die Stöcke aneinander. Etwas zu schnell, aber es hält sich in Grenzen bis zur Bridge Well, My Heart Went Boom.
Ich kann das Tempo nicht halten, muss mit der rechten Hand halbieren, statt zu vierteln und glaube, Arme zu bekommen wie meine Oberschenkel. H. O. zählt da schon wesentlich entspannter die nächste Nummer vor, Route 66.
Ich habe alles vergessen, hole falsch Luft, Schweiß tropft mir in die Augen. Egal, ich habe auch vorher niemanden und nichts gesehen. Da sind nur automatische Befehle an Hände und Füße, spielt, spielt, spielt!
Dann Johnny B. Goode, das ich singe. Ein immenser Kraftakt geboren aus Nervosität und geruchlosem Angstschiss. Meine Stimme geht in ein Krächzen über, aber ich ziehe durch, und irgendwann ist alles Geschichte.
Das waren mit absoluter Sicherheit die zwölf aufregendsten und der Wirklichkeit völlig entrückten Minuten meines Lebens. Auf dem Weg von der Bühne kommen uns Lead Gitarrist Zotty Brockhoff und Bassist Bernd Zamulo entgegen, klopfen uns auf die Schulter.
»Das war klasse, Jungs!« Verstehe ich nicht.
»Das war ordentlich!«, sagt der Manager. »Das hat mir gefallen. Ich heiße Lukas, Klaus Lukas. Wenn ihr wollt, und George zukünftig seine Hi Hat weiter aufmacht, kommen wir ganz bestimmt zusammen.«
»So viele zusammenhängende Worte habe ich von ihm noch nie gehört«, sagt Io. »Ein wirklich gutes Zeichen.«
Um mich herum Dunst, Nebel, Stimmengewirr, aufgewühlte Seligkeit durch die bestandene Feuerprobe. Das Schönste aber ist die gerechtfertigte Aussicht auf öffentliche Auftritte.
Klaus Lukas aus Otterndorf hat das Equipment, wenn auch für uns erst einmal nur die zweite Garnitur. Die erste ist für seine Stars, die Rhythm Brothers. Wenn die aber nicht spielen, dürfen wir deren Sachen nutzen. Das klingt immer noch nicht wie auf Platte, aber das allgemeine Hörgefühl ist ja auch noch nicht so verwöhnt.
In diesen Tagen denke ich nicht über das große Geld oder Ruhm nach. Da ist dieses unbeschreibliche Glücksgefühl, das Talent zum Mitspielen zu besitzen, eine Band zu haben. Ein wunderbares Geschenk.
Chuck Berry ist immer noch mein absoluter Favorit. Seine Songs lassen meine Brustwarzen hart werden, und Hans-Otto hat ihn richtig gut drauf.
Abends ziehen wir manchmal gemeinsam in die Roxy Bar in der Fährstraße, wo die Indonesier spielen, und geben eine Einlage. Der Drummer fasziniert mich. Er spielt anders als ich. Rechte Hand Viertel auf dem Beckenkopf, linke Hand Achtel auf der Snare. Passt super zu dem kantigen Taka Taka der Gitarristen.
Frankie and the Spiders sind dankbar, dass wir ihnen eine viertelstündige Pause schenken. Wir machen ab, dass H. O. und ich abwechselnd die Lieder ansagen, und vielleicht hier und da eine kleine verbale Pflaume zum Besten geben, um das Ganze ein wenig aufzulockern. Kommunizieren nennt man so was wohl oder auch Entertainment. Der Bassist der Rhythm Brothers macht das super. Hier ein Späßchen, da eine knackige Ansage. Zusammen mit seiner lockeren Art macht ihn das zum Publikumsliebling.
Der Verdacht liegt nahe, dass sie so ihre Fans erobern; denn dafür bekommen sie häufig genauso viel Applaus und Lacher wie mit ihrem Programm. Damit will ich ganz gewiss nicht sagen, dass sie musikalisch nicht genug glänzen. Sie spielen brillant, aber die Frage ist wohl berechtigt, ob gecoverte Musik allein ausreicht, zumal alle anderen Bands ja ein ähnliches Programm spielen. Mit flotten Sprüchen glätten sie jedenfalls ihren Weg zum Erfolg. Die Leute wollen Spaß. Die Cuxhavener liefern ihn.
Unseren ersten Auswärtsjob in der Bremer La Paloma Grotte müssen wir uns mit einer Einlage bei ihnen erarbeiten.
Bernd Zamulo sagt uns an: »Meine Damen und Herren, liebe Kinder! Wir bitten Sie jetzt, das Rauchen einzustellen, damit ihr euch voll auf den nächsten Programmpunkt konzentrieren könnt. Schnallt euch an! Hier kommen sie, direkt aus Bremerhaven, die Nachwuchsband der Superlative! The … Soulbeats! Bitte empfangt sie mit einem herzlichen Applaus!«
Das ist typisch für ihn. Das respektvolle Sie mit dem freundschaftlichen Du zu mischen, als wäre er einer von ihnen. Der Applaus ist sofort da. In diesem Moment hoffe ich, dass wir ihm gerecht werden können.
Henry Mancinis Peter Gunn in der Duane-Eddy-Version läuft wie von selbst und kommt sehr gut rüber. Unsere Vorgänger haben den Titel extra ausgelassen, weil sie wissen, dass wir ihn spielen wollen. Trotzdem ergeben sich Wiederholungen, die nun von uns zumindest mit einem Spruch aufgefangen werden müssen.
»We would like to play a song by The Beatles, and it’s called I Saw Her Standing there!« Ein bisschen kantig, fetter Frosch im Hals, aber geschafft.
»Rede Deutsch!« Eine Stimme von irgendwo aus dem Dunkel. »Wir sind hier doch nicht in Amiland!«
Die ersten Misstöne? H. O. versucht in seiner typischen Hausmacherart, die unangenehme Situation zu klären.
»Unser Drummer ist Amerikaner. Tut uns leid. Wenn wir das nächste Mal hier sind, singt er vielleicht schon auf Platt.«
Das schlucken sie gnädig mit vereinzelten Klatschern. Als er dann allerdings den Chuck Berry Duckwalk für Arme anbietet, hat er die Lacher auf seiner Seite. Meine Ansagen sind erst einmal gestrichen, was mir sehr entgegenkommt. Ich wirke lieber im Hintergrund.
Die halbe Stunde ist schnell vorbei und mit ihr das Lampenfieber. Der Erfolg, am Beifall gemessen, ist exakt wie wir ihn uns gewünscht haben. Kleine technische Mängel und Schnitzer, so what, Musiker-Polizei haben wir nirgends entdecken können.
Vor Leuten zu spielen, wow, das ist das Größte. Es spornt zusätzlich an, pünktlich bei jeder Probe aufzulaufen. Leider wirft Axel nach wenigen Wochen das Handtuch. Seine Verlobte hat gesagt, entweder sie oder die Musik. Ich hätte das Handtuch behalten. Jeder Mensch empfindet da wohl anders.
Der neue Mann an der Rhythmusgitarre, Ami Rentzel, ist schnell gefunden. Er bringt Micky Kaiser von den Ragamuffins mit, der irgendwann Io ersetzen soll. Ami und Micky sind leider so gar keine Berry-Fans. Sie favorisieren Leadbelly, Howling Wolf, Muddy Waters, also den schwarzen Blues. Auch wenn der Rock ’n’ Roll sein Baby ist, wie man sagt, unser gesamtes Repertoire erfährt plötzlich einen Wandel, den außer Manager Klaus niemand so richtig realisieren will. Io bleibt vorerst Bassist. Micky soll nur singen und auf der Mundharmonika blasen.
Während um uns herum die Konkurrenz mit Black Beats, Griffins und Tombstones ihren Fan Kreis permanent erweitert, weil sie das spielen, was die Leute gern hören, schrumpft unsere eh schon verschwindend kleine Gemeinde zu einem zählbaren Haufen. Wir rocken für die amerikanischen Teenager in ihrem Club und kommen in den Genuss der verdammt leckeren Milchshakes. Na ja, auch der weiblichen Hüftshakes, die nämlich ein bisschen anders sind als die unserer Mädels. Feuriger, frivoler, freier, und man muss kein Englisch können. Gesprochen wird mit den Augen.
Die Girls finden Musiker exciting und awesome. Unsere Mucke natürlich auch, weil es ja um Chuck und andere Amis geht, und nicht mehr primär um irgendwelche englischen Mersey-Beatlinge von der Insel.
Ihren Begleitern sieht man an, so würden sie auch gern angehimmelt werden. Schade, dass wir keine Beach-Boys-Songs oder andere Surflieder draufhaben. Dann hätten die Chicks uns wohl gleich zum Wellenreiten mit nach Hause genommen und ihren Eltern vorgestellt. Zugegeben, das ist hypothetisch und wäre wohl zu viel des Guten.
Irgendwie drängt sich mir die Frage auf, ob wir alle dasselbe wollen. Micky und Ami würden am liebsten nur das spielen, was sie auch gern zu Hause hören. Hans-Otto und Io sehnen sich nach Aufstockung der Fans. Klaus hätte gern eine Band, die gut ankommt und die Läden vollspielt, was im Grunde ja dasselbe ist. Ich bin nur der Schlagzeuger, und in Hamburgs Kaiserkeller packen die Beat Brothers vor Tony Sheridan in der Pause ihre Stullen aus.
Wir müssen uns neu orientieren. Wir müssen neue Spielplätze auftun, breit gefächert erobern, mehr Bekanntes rocken. Dann klappt’s auch wieder mit dem Applaus, dem Brot des Künstlers. Locker bleiben, auch wenn das Korsett drückt. Das ist so leicht gesagt. Sollten nicht alle in einer Band in dieselbe Richtung wollen müssen? Zu Hause kann sich ja jeder immer noch das auflegen, was ihm lieb ist.
Raus aus der eigenen Stadt, in der wir eher als Pioniere durchgereicht werden statt viel gepriesener Propheten. Dank unseres Managers scheint das auch zu klappen. Er selbst möchte so nicht genannt werden. Wir glauben, er fürchtet das Finanzamt mehr als seine unmusikalische Schwiegermutter oder die schwule Kampfdogge seines bissigen Nachbarn.
Solche Ängste müssen wir nicht haben, denke ich, da unsere Hälfte immer durch vier geteilt wird. Dieser Anteil reicht in der Regel für eine Packung Zigaretten und zwei Cola. Häufig gibt es zusätzlich ein Essen für Musiker und Manager, und das ist immer gut und reichhaltig. Okay, immer ist vielleicht übertrieben.
Irgendwann spielen wir wieder in Langenfelde bei Bokel, finsterste Provinz im südlichen Landkreis. Auch da gibt es aber Radios, auch da hören die Leute Rock ’n’ Roll. Durch Mickys Blues-Nummern vom letzten Gig, die inzwischen einen Großteil unseres Repertoires einnehmen, ist der Laden nur spärlich besetzt. Früher lief es hier immer prima. Kann ja noch kommen. Kommt aber nicht.
Der Laden nennt sich Wackernah’s Tanzdiele, hat aus Sicht eines Cowboystiefels die Größe einer Streichholzschachtel mit einem Wirt, der als überdimensionale Billardkugel das Bild abrundet. Einer, der mit seiner Figur den Raum schon ganz allein fast bis auf den vorletzten Platz füllt. Einer von diesen Unbeweglichen, die meilenweit davon entfernt sind, den Spaß erfunden zu haben, ihn eher überholt finden.
Nach dem ersten Set, es ist bei den zwei ländlichen Damen im Auditorium geblieben, wuppt er ganz allein seine Musikbox aus der Gaststube an eine Seite abseits der Tanzfläche, schmeißt eine halbe Mark rein und drückt Hippy Hippy Shake. Dann bittet er zu Tisch.
»Nach dem Essen könnt ihr einpacken, Jungs. Euch will hier keiner mehr hören.«
Er knallt uns die Teller auf die Plastiktischdecke des von einem ganz sicher paranoiden Holzwurm befallenen Jaffa-Tisches. »Guten Appetit!« Der Kartoffelsalat kommt direkt aus dem Gefrierfach. Cool. Hey, blind sind wir ja nun nicht. Wären wir es, das Klirren der Zähne beim Beißen würde uns garantiert das Augenlicht, respektive die sinnliche Wahrnehmung des Sehens ersetzen. Die einzelnen Kartoffelscheiben zu separieren, ohne die Kristalle der Mayonnaise zu gefährden, das ist eine Kunst für sich und nimmt ihre eigene Zeit in Anspruch. Andererseits fördert es wiederum das gesellige Beisammensein.
Wir haben gelernt, Positives im Negativen zu entdecken. Die dazugehörige Currywurst ist allerdings etwas ausgefallener. Mir haben sie immer gesagt, mit Essen spielt man nicht. Diese Wurst verleitet aber dazu. Man wartet, bis sie stillliegt, zielt, um dann geschickt und trotzdem blitzartig mit der Gabel zuzustechen. Erst spritzt es nach allen Seiten, sehr zur Freude des Tischnachbarn, dann kann man sie an einem Ende hochheben und aus der Hülle gleiten lassen, wenn man will. Klaus lässt seine Wurst heimlich in eine mitgebrachte Plastiktüte rutschen. Wahrscheinlich für seinen Hund. Der stirbt eine Woche später.
»George, das ist doch Quatsch. Was du immer denkst. Er war altersschwach. Das hat mit der Wurst rein gar nichts zu tun.«
Die Band isst sonst alles, was nicht rechtzeitig vom Tisch verschwindet. Wir wollen da ja schließlich wieder spielen. So lange, bis wir es uns leisten können, Absagen zu erteilen.
»Wenn dem so ist, dann habt ihr es geschafft«, sagt Klaus.
Seine Promotion-Ideen sind auch nicht ohne. Er hat Plakate drucken lassen, auf denen steht: »Heute Abend (fett) spielen für Sie nicht die (kleingeschrieben) BEATLES (in riesengroß), dafür aber die Soulbeats (in halb so groß).«
Von der anderen Straßenseite kann man nur »Beatles« lesen, läuft dann neugierig rüber, um herauszubekommen, was Sache ist. Dann allerdings ist man bestens informiert. Wir steigen Sprosse für Sprosse auf der Erfolgsleiter, spielen sogar im Club 99 in Bremen. Ein klarer Beweis für unsere Popularität, sagen die Kollegen. Wie auch immer, ich bin mächtig stolz auf meinen Sprung von der Schülerband in eine tourende Formation.
Jedem, ob er es nun wissen will oder nicht, erzähle ich mit dicker Brust davon. Dem Mann vor der Bühne in der Bürgerpark Waldschenke, der mich mit Komplimenten einlullt, auch.
»Tolle Band, volles Haus, ihr kommt ja hervorragend an. Was will man mehr? Ihr habt bestimmt gut zu tun.«
»O ja, wir spielen fast jedes Wochenende.« Ein bisschen dicker auftragen kann nicht schaden, denke ich mir.
»Kannst du mir eine Kontaktadresse geben? Vielleicht habe ich mal was für euch.« Ich gebe ihm meine.
Drei Wochen später liegt eine Aufforderung vom Finanzamt im Briefkasten, da mal zu erscheinen. Unsere Spielwiese haben wir im Landkreis abgesteckt. Das wiederum liegt wohl daran, dass Klaus dort auch viele Jobs für seine Rhythm Brothers aufgerissen hat, somit gute Referenzen vorweisen und die Soulbeats als Nachwuchsband anbieten kann. In der eigenen Stadt spielen wir kaum.
Eines Tages dann der kleine Durchbruch für uns in Stagge’s Hotel in Osterholz-Scharmbeck. Das klingt zwar nicht nach Cavern oder Star Club, aber der Laden mit seiner oberen Rocketage hat nicht nur im norddeutschen Raum einen ausgezeichneten und beinahe ebenso wirkungsvollen Namen für Livemusik.
Hier geben sich auch häufig angesagte Bremer Bands die Klinke in die Hand. Fritz Stagge ist ein begeisterter Rockfan, und wir sind uns auf Anhieb sympathisch.
Klaus beschwört uns: »Das ist das Sprungbrett nach Bremen. Wer hier gut ankommt, der hat beste Chancen, ein paar richtig gute Gigs in der Landeshauptstadt zu bekommen. George! Vergiss nicht, deine Hi Hat aufzumachen!«
Es muss doch aber auch möglich sein, in der eigenen Stadt Fuß zu fassen. Vielleicht im Sanssouci von Ernst Luka? Eine herabgekommene Spelunke, Absteige für Fischjäger und andere Seefahrer.
An einem Tisch in der Nähe der Bühne protzt einer mit gruseligen Storys über die Behebung seines ersten Trippers durch eine glühende Langnadel. Mit hängenden Unterkiefern klebt eine winzige Gruppe an seinen Lippen.
Unser Auftritt interessiert niemanden wirklich, wird aber auch nicht als störend empfunden. Okay, das ist dann eine bezahlte Probe. Bezahlt? Nach Feierabend sucht unser Klaus mit S im Nachnamen den Ernst ohne, sieht ihn die Treppe vom Büro heruntersteigen, sämtliche Hosen- und Jackentaschen nach außen gestülpt.
»Nix Umsatz, nix Geld.« Ernst schwört es.
»So einfach geht das nicht«, sagt Klaus dem Chef, und drückt ihn sanft zurück in sein winziges Büro. Geduldig hilft er ihm, Zehner für Zehner unterm Sitzkissen, unterm Teppich, aus dem Papierkorb oder unter einem Karton mit Getränkekarten hervorzuzaubern. Klasse Verstecke, aber nicht gut genug. Vor allem, was wäre wohl, wenn es hier mal brennt?
»Woher wusstest du das mit dem Geld?«, frage ich Klaus. »Woher wusstest du, dass er lügt?«
»Er hat die Lippen bewegt.« Der Mann ist ja so cool. Wenn es dann aber doch mal so kommt, dass unsere Gage absolut unauffindbar ist, müssen wir anschließend noch in den Zweitladen von Luka.
Das Femina liegt im Petroleumviertel in der Georg-Seebeck-Straße und wird ebenfalls von Fischdampfer Yankees frequentiert, wie der Volksmund sie gern nennt. Mit geübten Fingern entgräten sie mitgebrachte Heringe aus einem Eimer an der Bar. Wehe, du gehst zu ihnen, willst freundlich sein und sagst: »Das kann ich auch!«
Ich habe viel zu viel Ehrfurcht. Bloß nicht in fremden Revieren wildern. Letztlich ist es absolut denkbar, dass die halbnackten, opulenten Mägde hinterm Tresen inhaltlose Fische als Anzahlung für ihre noch ausstehenden Dienste anrechnen, nachdem sie die Jungs bereits nach Strich und Faden selbst ausgenommen haben. Hans-Otto und seine vorlaute Klappe muss man aber häufig bremsen.
Andererseits gibt es auch unzählige schöne und einzigartige Momente, ganz besonders wenn wir zu fünft samt kompletter Anlage in unserem Opel Rekord-Caravan-Tour-Vehikel auf winterlichen Straßen in ferne Städte reisen.
An einem von diesen bitterkalten, winterlichen Spätnachmittagen sind wir unterwegs nach Celle. Die Sonne sowieso nie da, wenn man sie braucht, und der Mantel des Zwielichts legt sich ganz sanft über das verschwindende Wenig, das es gerade noch zu sehen gab. Die Kabine im Wagen ist vom Rauch der Roth-Händle, Revals und eigenhändig Gedrehten so intensiv geschwängert, dass man fast nur an der Stimme erkennen kann, wer neben einem sitzt. Keine Spur von Sauerstoff. Während der Fahrt das Fenster zu öffnen, hätte sofort ein Schneechaos zur Folge. Kälte wäre nicht das Problem. Die Heizung funktioniert eh seit Wochen nicht. Wir haben uns dran gewöhnt, zumal wir nur in unserer Gegend gespielt haben. Also husten und leiden, und immer wieder die klebrige, handgewärmte Glühweinflasche herumreichen. Bis einem das Ziel, das im Grunde eh niemand wirklich kennt, weil noch nie jemand von uns vorher da war, völlig egal ist.
Der Fahrer ist Nichtraucher, darf nicht trinken, und findet auch als Einziger die kursierenden Witze überhaupt nicht komisch. Ich glaube, wir haben ihn bis dato immer nur nach unseren Auftritten lachen gesehen, genauer gesagt, nachdem er die Gage problemlos abrechnen konnte.
Fast profillos schlittern die Reifen über die verschneite Landstraße. Die Scheibenwischer klatschen eine stumpfe, rhythmische Slowfox-Nummer. Die Augen, beeinflusst vom Glühstrumpf auf leeren Magen, schicken aufregende, irreale Bilder im Schneetreiben ans Großhirn, sogenannte Hallus.
Der eigenwillige Geruch von Fisch passt allerdings so gar nicht in diese zauberhafte Winterwunderwelt, und ich wage einen Blick nach hinten. Tatsächlich, Hans-Otto hat sich von seiner Mutter zwei saure Heringe für die Fahrt einpacken lassen. Das Gemisch aus kaltem Rauch, Glühwein und totem Fisch, unentschuldbar grausam. Allein der Gedanke, wegen des Mangels an Mikrofonen mit ihm in eins singen zu müssen. Eine erbarmungslose Attacke auf das Geruchsorgan. Jetzt schon.
Dann die Erlösung. Das Kasino der Panzer-Division Celle liegt in all seiner winterlichen Pracht vor uns. Ein uniformiertes Empfangskomitee mit leuchtend rotwangigen Gesichtern und wild gestikulierenden Armen dirigiert uns.





























