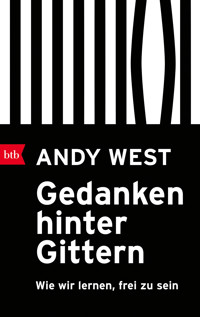
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Kann man im Gefängnis freier sein als draußen? Könnten wir jemals »gut« sein, wenn wir nie Scham oder Reue empfänden? Was macht einen Menschen der Vergebung würdig?
Andy West unterrichtet Philosophie in Gefängnissen. Er führt mit den Insassen Gespräche über ihr Leben, erörtert ihre Ideen und Gefühle und hört ihnen zu, wenn sie neue Wege finden, um über ihre scheinbar ausweglose Situation nachzudenken. Doch immer wenn er ein Gefängnis betritt, wird er auch mit seiner eigenen Familiengeschichte konfrontiert: Sein Vater, sein Onkel und sein Bruder saßen alle hinter Gittern. Andy hat sich zwar ein anderes Leben aufgebaut. Tief drinnen fürchtet er aber immer noch, dass deren Schicksal auch das seine sein könnte. Während er mit seinen Schülern über drängende Fragen von Wahrheit, Identität und Hoffnung diskutiert, sucht er gleichzeitig auch selbst nach seiner eigenen Form der Freiheit. Bewegend, einfühlsam, weise und oft auch witzig: »Gedanken hinter Gittern« ist eine ungewöhnliche und gelungene Mischung aus Erzählung und sanfter philosophischer Hinterfragung von vermeintlichen Wahrheiten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 555
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Andy West unterrichtet Philosophie in Gefängnissen. Er führt mit den Insassen Gespräche über ihr Leben, erörtert ihre Ideen und Gefühle und hört ihnen zu, wenn sie neue Wege finden, um über ihre scheinbar ausweglose Situation nachzudenken. Doch immer wenn er ein Gefängnis betritt, wird er auch mit seiner eigenen Familiengeschichte konfrontiert: Sein Vater, sein Onkel und sein Bruder saßen alle hinter Gittern. Andy hat sich zwar ein anderes Leben aufgebaut. Tief drinnen fürchtet er aber immer noch, dass deren Schicksal auch das seine sein könnte. Während er mit seinen Schülern über drängende Fragen von Wahrheit, Identität und Hoffnung diskutiert, sucht er gleichzeitig auch selbst nach seiner eigenen Form der Freiheit.
Bewegend, einfühlsam, weise und oft auch witzig: Gedanken hinter Gittern ist eine ungewöhnliche und gelungene Mischung aus Erzählung und sanfter philosophischer Hinterfragung von vermeintlichen Wahrheiten.
Andy West ist Philosophiedozent, Konfliktmediator und Publizist. Seine Artikel sind bei The Guardian, Aeon, 3:AM Magazine, The Big Issue, openDemocracy, The Times Education Supplement und Bloomsbury erschienen. Gedanken hinter Gittern ist sein erstes Buch. Er lebt in London und arbeitet für The Philosophy Foundation. Seit 2015 unterrichtet er u. a. in zahlreichen britischen Gefängnissen.
Andy West
Gedanken hinter Gittern
Wie wir lernen, frei zu sein
Aus dem Englischenvon Leon Mengden
Die englischsprachige Originalausgabe erschien 2022 unter dem Titel »The Life Inside« im Verlag Picador, London, UK.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Deutsche Erstausgabe Juli 2024
btb Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Copyright © Andy West 2022
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2024
btb Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH
Redaktion: Antje Steinhäuser
Covergestaltung: semper smile, München
Satz und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck
JT · Herstellung: sc
ISBN 978-3-641-25793-4V001
www.btb-verlag.de
www.facebook.com/penguinbuecher
Für meinen Bruder
Inhalt
Vorbemerkung des Autors
Identität
Freiheit
Scham
Begehren
Glück I
Glück II
Warten
Wahnsinn
Vertrauen
Erlösung
Vergessen
Wahrheit
Hinsehen
Lachen
Hautfarbe
Hinter Gittern
Veränderung
Geschichten
Daheim
Freundlichkeit
Copyrightvermerke und Literaturhinweise
Danksagungen
Die Kräfte des Geistes werden durch Kummer entwickelt
Marcel Proust, Auf der Suche nach der verlorenen Zeit
Indem ich mich schuldig machte, gelangte mein Geist zu höheren Weihen
Jean Genet, Tagebuch eines Diebes
Vorbemerkung des Autors
Bei den in diesem Buch vorkommenden Personen, Orten und Geschehnissen habe ich mich nicht immer an die tatsächlichen Gegebenheiten gehalten. Ich habe sie mit anderen Namen versehen oder sie abweichend von der ursprünglichen Situation miteinander verknüpft; bestimmte Ereignisse haben auch nicht immer zu dem im Buch genannten Zeitpunkt stattgefunden. All dies geschah in dem Bestreben, nicht nur den Sicherheitsbestrebungen staatlicher Vollzugsanstalten gerecht zu werden, sondern vor allem die Privatsphäre der in diesem Buch erwähnten Menschen zu schützen, und das gerade auch dann, wenn diese auf die eine oder andere Weise Leidtragende der hier beschriebenen Ereignisse geworden waren. Ich wollte das von mir Erlebte in die Erzählform einer persönlichen Geschichte kleiden.
Die Begriffe Gefängnis oder Gefangener können niemals als abstrakte Begriffe aufgefasst werden. Es gibt eine Vielzahl verschiedener Gefängnisse, und jeder einzelne Gefangene hat seine ganz eigene Lebensgeschichte. Ich habe mich bemüht, etwas von dieser Vielfältigkeit einzufangen, habe dieses Buch aber doch in erster Linie aus der subjektiven Perspektive desjenigen geschrieben, der Angehörige im Gefängnis hat und nunmehr gleichzeitig dort unterrichtet. Die hier zitierten Gespräche aus den Unterrichtsräumen entstammen einem Zeitraum von vier Jahren, und ich habe stets versucht, den wesentlichen Kern dieser Unterhaltungen wiederzugeben – auch wenn ich mich nicht mehr Wort für Wort an das Gesagte erinnern konnte. Ich habe meine persönlichen Erfahrungen so aufgeschrieben, wie sie mir in Erinnerung geblieben sind, und wo mir dies möglich war, habe ich mich entweder der Korrektheit meiner Erinnerungen versichert oder mir diese von anderen Beteiligten bestätigen lassen. Und doch ist es möglich, dass andere die hier beschriebenen Begebenheiten nicht genau so im Gedächtnis behalten haben wie ich selbst.
Denjenigen, vor denen ich im Gefängnis meine Kurse gebe, ist der Zugang zu den sozialen Netzwerken verwehrt, sodass sie dort nichts ohne die Einwilligung des Justizministeriums veröffentlichen können. Manche dieser Gefangenen haben zudem Schwierigkeiten, ihre Gedanken in Worte zu fassen, und viele von ihnen leben mit einem sozialen Stigma, was oft bedeutet, dass ihre Stimmen ungehört bleiben oder dass sie gar nicht den Wunsch haben, über ihre Erfahrungen zu sprechen, wenn dies mit sich bringen könnte, dass sie sich damit als Insassen oder Ex-Insassen einer Strafvollzugsanstalt outeten.
Während meiner Arbeit an diesem Buch war mir sehr wohl bewusst, dass ich über Menschen schrieb, die oft gar keine Möglichkeit hatten, etwas über sich selbst zu Papier zu bringen. Ein jeder hat so manche Geschichten zu erzählen, doch nur wenigen wird das Privileg zuteil, diese Geschichten einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Ich habe mich bemüht, mir die mit meiner besonderen Rolle einhergehende Verantwortung stets vor Augen zu halten. Wo es mir angebracht erschien, habe ich sowohl mit ehemaligen Gefangenen als auch mit Kollegen und anderen Personen aus dem akademischen Bereich Rücksprache gehalten, um sicherzugehen, die richtigen Worte gefunden zu haben.
Bei meinen Angehörigen bedanke ich mich dafür, dass ich ihre Geschichten erzählen durfte, und ich hoffe, mich mit Sorgfalt und Ehrfurcht über sie geäußert zu haben.
Identität
Gerechtigkeit: Beständig zu der Annahme bereit sein, dass ein anderer etwas anderes ist als das, was man in ihm liest, wenn er zugegen ist.
Simone Weil
Der Mann neben mir im Fahrstuhl ähnelt auf geradezu unheimliche Weise meinem Vater, den ich seit zwanzig Jahren nicht mehr zu Gesicht bekommen habe – seit er nämlich im Gefängnis sitzt. Dieser Mann ist von kleiner Statur und hat gelblich verfärbte Fingerspitzen; die Ärmel seiner viel zu groß geschnittenen Anzugjacke reichen ihm fast bis an seine Fingerknöchel. Ich bin schon früher Männern begegnet, die meinem Vater ähnlich sahen – in Autobussen oder in Zügen oder vor einem Urinal in der Herrentoilette eines Londoner Pubs. Solche Männer gab es auch in Manchester, Berlin oder Rio de Janeiro.
Hier im Fahrstuhl werfe ich dem Mann einen diskreten Blick zu und glaube tatsächlich, die permanent zusammengebissenen Zähne und das auf ein Lungenemphysem hindeutende Pfeifen seines Atems wiederzuerkennen. Also ziehe ich meinerseits den Ärmel bis über mein Handgelenk, um meine Armbanduhr darunter zu verbergen, und frage den Mann, wie spät es ist. Aus seiner Antwort kann ich keinerlei Liverpooler Akzent heraushören, also ist er nicht mein Vater – ebenso wenig, wie die Männer in Deutschland oder in Brasilien es waren. Schweigend fahren wir weitere fünf Etagen hinauf. Der Lift hält, die Türen öffnen sich, und der Mann steigt aus.
Morgen früh werde ich zum ersten Mal in ein Gefängnis gehen. Ich werde vor den männlichen Gefangenen dort Philosophieunterricht erteilen. Vor ein paar Monaten hatte ich für den Guardian einen Artikel zum Thema Philosophieunterricht geschrieben, in dem ich unter anderem erwähnte, dass sowohl mein Vater als auch mein Bruder und mein Onkel allesamt im Gefängnis säßen, worauf mir im vergangenen Monat ein Philosoph namens Jamie von einer hiesigen Universität vorschlug, als Co-Referent mit ihm in einer Strafanstalt zusammenzuarbeiten. Ich gehe davon aus, dass mir diese Einladung deshalb zuteilwurde, weil ich mich aufgrund meines kulturellen Hintergrunds vermutlich gut in die Psyche Strafgefangener würde einfühlen können – besser jedenfalls als die meisten Akademiker, die ständig mit hochwissenschaftlichen Traktaten unter dem Arm herumlaufen.
Kurz nachdem Jamie mich gefragt hatte, ob ich mit Gefangenen arbeiten wolle, entdeckte ich in einem Schaufenster ein Paar schwere, knöchelhohe schwarze Stiefel. Es ist jetzt Frühjahr, und normalerweise trage ich zu meinen unten zweimal umgeschlagenen stonewashed Jeans bequeme Lederhalbschuhe. Heute Nachmittag bin ich trotzdem in den Laden gegangen, um die Stiefel zu kaufen, aber sie hatten sie nur in einer Größe da, nämlich zehn. Ich habe Schuhgröße neun, aber das war mir in dem Moment egal – ich kaufte sie trotzdem.
Am nächsten Morgen haben Jamie und ich in unserem Unterrichtsraum im Gefängnis die Stühle im Kreis aufgestellt und warteten auf unsere Schüler. Unser Klassenzimmer dient gleichzeitig als Kunsterziehungsraum der Strafanstalt. Er sieht genauso aus wie die Kunsträume zu meiner Schulzeit – bloß dass hier Gitter vor den Fenstern sind. Und sämtliche Stifte und Pinsel und alle sonstigen Gegenstände mit spitzen Enden in fest verschlossenen Schubladen aufbewahrt werden.
Ich überfliege noch einmal die Seiten mit unserem Unterrichtsplan. Wir wollen uns mit John Lockes Identitätstheorie befassen. Ich stelle mir meinen Vater vor, wie er versuchen würde, durch das Ganze hindurchzusteigen – und streiche mit einem Rotstift komplette Absätze durch. »Die müssen uns ja auch folgen können«, sage ich zu Jamie. »Da werden eine Menge darunter sein, die keinen Schulabschluss haben und kaum lesen und schreiben können. Wir dürfen die Leute nicht gleich überfordern.« Dann höre ich das Geräusch schwerer Metalltüren, die aufgeschlossen werden und die widerhallenden Stimmen von Männern, die auf dem Gang draußen miteinander reden. Unsere Schüler sind im Anmarsch. Ich trage meine neuen Stiefel; die blitzblanken Schuhspitzen glänzen, wie es sich für den ersten Schultag gehört.
Ein Mann erscheint in der Tür. »Ist das hier Philosophie?« Man riecht an seinem Atem, dass er sich nach dem Aufstehen nicht die Zähne geputzt hat. Außerdem sind seine Augen blutunterlaufen.
»Philosophie, ja«, antworte ich.
Er zuckt mit den Achseln, tritt ein und setzt sich auf einen Stuhl.
Ein weiterer Mann betritt den Raum und begrüßt mich mit einem knochenbrecherischen Händedruck, während er über meine Schulter hinweg an mir vorbeischaut. Der nächste ist aschfahl im Gesicht und leidet offensichtlich unter zurückgehendem Zahnfleisch. Ein weiterer hält krampfhaft eine Plastiktüte mit dem Aufdruck Leeds University an sich gedrückt; sie ist zwar schon an der Seitennaht aufgerissen, aber er trägt scheinbar seine aus der Gefängnisbibliothek ausgeliehenen Bücher darin mit sich herum. Ihm folgt ein Mann mit einem runden Gesicht, der auf dem Foto auf seiner Erkennungskarte wie der leibhaftige Tod aussieht. Während ich von einem zum anderen gehe, um mich vorzustellen, zucke ich bei jedem Schritt innerlich zusammen. Meine neuen Stiefel scheuern an meinen Füßen. Ich spüre schon das stechende Gefühl, mit dem sich bald Blasen an meinen Hacken bilden werden.
Immer mehr Männer betreten den Raum, bis sie schließlich zu zwölft sind. Jamie und ich werfen einen letzten Blick auf unsere Aufzeichnungen für die heutige Unterrichtsstunde. »Nicht gleich überfordern«, ermahne ich Jamie noch einmal.
Die Männer setzen sich im Kreis hin, und ich erkläre, was es mit John Lockes Theorien auf sich hat.
»Das stimmt nicht ganz«, meldet sich ein Schüler mit Namen Macca zu Wort.
»Wie bitte?«, frage ich.
»Locke ging es nicht nur um die menschliche Erinnerung.« Er zeigt auf das Whiteboard hinter mir. »Sondern mehr um den Begriff des Bewusstseins.«
Alle zwölf Männer sehen mich an. Ich gehe hinüber zur Tafel – auf Zehenspitzen, um den Schmerz an meinen Hacken nicht so stark zu spüren. Ich wische das Wort »Erinnerung« weg und schreibe »Bewusstsein«. Die Männer lachen und flüstern miteinander. Ich versuche noch einmal, Lockes Theorien zu erklären, wobei ich mich nur mit ganz kleinen Schritten bewege und mich bemühe, nicht mit dem ganzen Fuß aufzutreten.
Ein paar Minuten später meldet sich ein weiterer Schüler, der gerade mit Erfolg einen Fernkurs abgeschlossen hat, um zu erörtern, inwiefern Rousseau hier möglicherweise anderer Ansicht als Locke gewesen sein könnte. Wir haben erst vor zwanzig Minuten angefangen und sind schon weit über das hinaus, was wir uns vorgenommen hatten. Von der gegenüberliegenden Seite des Raumes wirft Jamie mir einen vielsagenden Blick zu. »Nicht gleich überfordern«, klingt es uns beiden im Ohr.
Jamie teilt die Schüler in kleine Arbeitsgruppen ein, verteilt ein paar Aufgaben und weist auf ein Pult in einer Ecke des Raumes. Dort sollten wir uns besprechen, meint er. Er geht zu dem Pult hin, und ich folge ihm auf Zehenspitzen.
Freiheit
Drinnen kannst du mit einer Seite deines Wesens ganz allein sein,
wie ein Stein am Brunnengrund,
doch die andere Seite
muss sich so sehr ins Weltgetümmel mischen,
dass du drinnen erzitterst,
wenn draußen, vierzig Tage entfernt, ein Blatt sich regt.
Nâzim Hikmet
Es sind nun paar Monate vergangen, und ich trage bei meinen wöchentlichen Besuchen im Gefängnis stets meine Halbschuhe aus weichem Leder, die ich auch sonst fast immer bevorzuge. Ich bin jüngst von einer dreiwöchigen Thailandreise, die ich allein unternommen habe, zurückgekehrt. Meine Haut ist braun gebrannt, und mein Haar hat jetzt einen karamellbraunen Farbton. Ich gehe durch die mit Neonröhren beleuchteten Gänge des Gefängnisses zu unserem Unterrichtsraum. Aus der anderen Richtung kommt mir ein von Vollzugsbeamten bewachter Mann entgegen. Er hat ein blasses Gesicht, und unter seinen Augen pellt die schuppige Haut ab. Ich streife rasch meine Hemdsärmel hinunter, um meine Sonnenbräune zu verbergen. Dann betrete ich das Klassenzimmer und schreibe das heutige Unterrichtsthema an die Tafel: »Freiheit«.
Zwanzig Minuten später ruft der wachhabende Beamte draußen auf dem Gang: »Umschluss!« Umschluss bedeutet, dass die Zellentüren entriegelt werden, damit die Männer sich zum Unterricht, zu ihren Werkgruppen oder zu anderen Aktivitäten in andere Räume, die dann verschlossen werden, begeben können, und ein paar weitere Minuten später treffen auch meine Schüler ein, darunter ein vierzig Jahre alter Mann namens Zach. Er trägt graue Sneakers mit Klettverschlüssen. Solche Schuhe bekommen die Gefangenen hier gestellt, wenn sie keine eigenen haben. Er hat die Ärmel seines Pullovers bis zu den Ellenbogen hochgestreift, wodurch man die Dutzenden von länglichen Narben an seinen Unterarmen sehen kann. Im vergangenen Monat war für ihn eine Anhörung angesetzt, bei der darüber entschieden werden sollte, ob der Rest seiner Strafe auf Bewährung ausgesetzt würde, doch am Tag vor dieser Anhörung schlug er einen Mitarbeiter des medizinischen Personals mitten ins Gesicht.
Nach und nach treffen ein paar weitere Männer ein. Einer von ihnen bleibt kurz in der Tür stehen; er ist ein großer Bursche, der Junior genannt wird, und er trägt ein babyrosafarbenes Muskelshirt, damit auch jeder seine runden Schultern und seinen kräftigen Bizeps bewundern kann. Seine Füße stecken in sündhaft teuren Nike-Sneakers, die wie neu aussehen. Ein paar Wochen zuvor war Junior von einem Mitgefangenen gefragt worden, weswegen er einsäße. »Ich bin Unternehmer«, lautete seine Antwort.
Als er den Klassenraum betritt, schüttelt er mir die Hand. »Eine Freude, wieder hier zu sein, Sir«, sagt er mit klangvoller Stimme. Seine geschwungenen, an den Enden spitz zulaufenden Augenbrauen sind sorgfältig gezupft. Dann macht er im Raum die Runde, um jeden Anwesenden mit Handschlag zu begrüßen. Dabei sieht er seinen Mithäftlingen unverwandt in die Augen und redet auch sie mit »Sir« an.
Junior setzt sich auf den Platz neben Zach und spreizt seine weit ausgestreckten Beine. Zach verschränkt die Arme vor der Brust.
Als Letzter kommt Wallace. Er hat einen sehr aufrechten Gang – nicht, um seine stolz geschwellte Brust zu betonen, sondern einfach nur, weil er sich im Schutz seines fassrunden Körpers gut aufgehoben fühlt. Wortlos nimmt er neben Junior Platz.
Wallace lässt sich nur ungern mit anderen Menschen ein; er ist zu zwanzig Jahren verurteilt worden und hat noch vier davon abzusitzen. Er geht niemals in den Fitnessraum, sondern zieht es vor, ganz für sich allein in seiner Zelle zu trainieren. Jeden Tag schreibt er einen Brief an seinen Sohn.
Der Umschluss ist beendet. Ich schließe die Tür.
Ich setze mich in den Kreis zu den Männern. »In Homers Heldenepos«, beginne ich, »führte Odysseus sein Schiff nach Ende der Belagerung Trojas heim nach Ithaka. Unterwegs aber sollten ihm die Sirenen begegnen. Diese Mischwesen aus Mensch und Vogel lebten auf einer Felseninsel mitten im Meer. Ihr Gesang war so betörend, dass ein jeder Mann, der ihn vernahm, wie von Sinnen vor Verliebtheit war und über Bord sprang, um schwimmend die Quelle dieses Gesanges zu ergründen. Dort wurden die dem Wahn verfallenen Seeleute dann Opfer der Sirenen, die sie verspeisten.«
»Keiner, der je den Sirenengesang gehört hatte, überlebte dies, um andere davor warnen zu können«, fuhr ich fort. »Daher befahl Odysseus seinen Männern, sich mit Wachs die Ohren zu verstopfen, um nicht der Verführung durch die Sirenen ausgesetzt zu sein. So konnten seine Leute weiterhin ihren seemännischen Aufgaben nachgehen, das Essen zubereiten oder Taue spleißen.
Aber es musste ja auch jemanden geben, der es hören konnte, wenn der Gesang verklungen war – damit die Männer sich das Wachs nicht zu früh aus den Ohren nahmen«, sage ich. »Also sorgte Odysseus dafür, dass seine Männer ihn am Mast festbanden. So konnte er dem Gesang lauschen, ohne über Bord zu springen. Er gab seiner Mannschaft den Befehl, auf keinen Fall darauf einzugehen, falls er verlangen sollte, wieder losgebunden zu werden.
Sie setzten ihre Fahrt fort. Odysseus vernimmt die Musik. Sie ergreift vollkommen von ihm Besitz, lässt ihn nicht los. Ein unbändiges Verlangen durchströmt ihn, und er fleht darum, losgebunden zu werden, doch seine Mannschaft fährt seelenruhig mit der Verrichtung ihrer täglichen Pflichten fort. Nur einer von ihnen ist schon so lange auf See, dass sein ständiges Heimweh ihn hat abstumpfen lassen. Ihm entgeht nicht, wie verzweifelt Odysseus sich gebärdet. Also hält er in seinem Tun inne und nimmt sich das Wachs aus den Ohren, denn er möchte wissen, wie sich der Sirenengesang anhört. Und schon ist er wie berauscht davon und springt über Bord in den sicheren Tod.
Als sie die Sireneninsel passiert haben, wird Odysseus losgebunden. Doch von diesem Tag an war ihm ständig weh ums Herz, weil er wusste, dass er nie wieder etwas so Schönes zu hören bekommen würde wie den Sirenengesang.«
»Die Sirenen hatten’s echt drauf«, bemerkt Zach. »Die haben sogar on the rocks gelebt.«
Alle Männer lachen. Bis auf Wallace.
Ich stelle eine Frage: »Da waren also nun die Seeleute mit dem Wachs in den Ohren, da war Odysseus, und dann der Mann, der sich das Wachs aus den Ohren genommen hat. Wer von ihnen war wohl der freieste?«
Ich reiche Wallace das faustgroße Bohnensäckchen, das bedeutet, dass derjenige, der es in der Hand hält, mit Reden an der Reihe ist.
»Die Männer mit dem Wachs in den Ohren, das sind die freiesten«, sagt er. »Sie machen einfach ihr Ding. Das ist so ähnlich wie bei uns hier drin, wir brauchen uns nicht darum zu kümmern, irgendwelche Rechnungen zu bezahlen oder Kinder zur Schule zu fahren. Ich habe Freiheiten, die andere Leute nicht haben.«
»Zum Beispiel?«, hake ich nach.
»Ich habe keine Wahl, was ich tun oder lassen soll – genau wie die Seeleute mit dem Wachs in den Ohren.«
Junior beugt sich in seinem Stuhl vor. »Aber wenn du keine Wahl hast, was du tun sollst, bist du auch nicht frei«, sagt er zu Wallace.
»Draußen gerät man viel zu leicht in Scherereien«, sagt Wallace. »Hier drinnen kann ich besser auf mich aufpassen.«
Nach einer kurzen Pause frage ich Junior: »Wer ist deiner Meinung nach der freieste dieser Männer?«
»Odysseus«, antwortet er. »Er ist der Boss. Die Leute haben zu tun, was er sagt.«
»Aber Odysseus ist so unfrei, wie man nur sein kann«, meldet Wallace sich zu Wort. »Was er auch immer Aufregendes erlebt, er wird immer auf der Suche nach einer noch größeren Herausforderung sein und nie genug davon kriegen.«
»Aber Odysseus hat immerhin etwas aus seinem Leben gemacht«, wendet Junior ein.
»Jedes Mal, wenn er sich an etwas erinnert, was er vollbracht hat, quält ihn das nur umso mehr. Da ist man in einer Zelle freier«, sagt Wallace.
»Die Männer mit dem Wachs in den Ohren quälen sich nicht so wie Odysseus, weil sie nie etwas aus ihrem Leben gemacht haben«, erwidert Junior. »Die sind doch bloß Fußsoldaten.«
»Sie verhalten sich so, wie man es von ihnen verlangt«, antwortet Wallace. »So können sie alles tun, was sie tun müssen, um bald wieder zu Hause zu sein.«
»Was wollen die denn zu Hause, wenn das das einzige Leben ist, das auf sie wartet?«, sagt Junior.
Ich gebe das Säckchen an einen Mann namens Keith weiter. Er legt es sich in den Schoß und sagt: »Nun, das kann man auf verschiedene Art und Weise betrachten.«
Als ich mit meiner Arbeit im Gefängnis anfing, erzählte mir der Gefängnisbibliothekar, dass Keith bereits seit dreizehn Jahren säße, eine Einzelzelle hätte und sich alle zwei bis drei Tage ein neues Buch holte, weil er das davor schon wieder durchgelesen hatte. Keith spricht mit einem ausgeprägten Glasgower Akzent, der ihn als einen Angehörigen der Arbeiterklasse ausweist. Ab und zu streut er in seine Redebeiträge Begriffe wie »Nomenklatur« ein. »Man könnte es aus einer neurowissenschaftlichen Perspektive betrachten«, sagt er gerade. Er spricht ziemlich schnell, wie Autodidakten es oft tun – als wollte er sich von der Bürde seiner eigenen Erkenntnisse befreien; doch einige der übrigen Kursteilnehmer beginnen bereits, in ihren Stühlen zusammenzusinken und nur noch zu Boden zu starren.
»Derjenige, der über Bord springt, ist frei – so, wie der Hofnarr auf eine gewisse Weise freier ist als der König«, fährt Keith fort. Am liebsten würde ich ihn unterbrechen. Ich würde ihn sogar nur zu gerne unterbrechen. Für mich ist es einer der angenehmen Aspekte des Lehrerdaseins, Leuten ins Wort fallen zu können. Außerhalb meines beruflichen Alltags spreche ich leise und wähle meine Worte mit Bedacht, sodass es mir dauernd passiert, dass ich von vorlauten Quasselköpfen abgewürgt werde, und das ist wohl auch einer der Gründe, warum ich Lehrer geworden bin: So kann ich mich für die erlittene Schmach rächen, indem ich mir das Recht herausnehme, auch meinerseits andere beim Reden zu unterbrechen.
Keith fährt indessen unbeirrt fort: »Die Quantenphysik lehrt uns, dass bestimmte Vorgänge nicht unbedingt determiniert sind …« Ich bringe es nicht übers Herz, ihn zu bremsen. Wie soll man einem Mann, der seit dreizehn Jahren in einer Zelle hockt, klarmachen, dass uns die Zeit davonzulaufen droht?
Schließlich gibt Keith das Beutelchen an mich zurück. Zach hat sich die Ärmel seines Pullovers bis über seine Hände hinuntergezogen. Ich frage ihn nach seiner Meinung.
»Der Mann, der über Bord gesprungen ist«, sagt Zach.
»Er stand wie unter einem Zwang«, wirft Junior ein. »Er kann gar nicht frei sein.«
»Aber es kann doch sein, dass auch Mut dazugehört, dem Ruf der Sirenen nachzugeben. Vielleicht war er der Einzige, der Mumm genug hatte, sich diese Freiheit zu nehmen«, erwidert Zach.
»Er wollte allem entkommen, aber was er gemacht hat, ist so, als würdest du aus deiner Zelle fliehen und aufs Dach klettern. Und wie geht’s dann von dort weiter? Du bist beschissener dran, als du es in deiner Zelle gewesen bist«, setzt Junior nach.
»Er ist von Bord gesprungen, weil er merkte, dass er in seiner Situation nur so wirklich frei sein kann«, sagt Zach.
»Er ist gesprungen, weil er es aufgegeben hatte, frei sein zu wollen«, sagt Junior.
Nach einer Stunde Unterricht ist es Zeit, eine Pause zu machen, damit die Männer sich die Beine vertreten können. Ich öffne die Tür des Klassenzimmers, aber der Aufseher draußen auf dem Gang sagt mir, dass ich sie wieder schließen und dafür sorgen soll, dass alle drinnen bleiben. Es hätte einen Zwischenfall auf einer der Etagen gegeben. Ein Mann sei aus Protest auf das Netz gesprungen, das zwischen den einzelnen Etagen gespannt ist. Diese Netze sollen die Gefangenen daran hindern, Gegenstände nach unten zu werfen oder in die Tiefe zu springen, um sich das Leben zu nehmen. Wenn aber trotzdem jemand auf dieses Netz springt, dürfen die Wächter aus Sicherheitserwägungen nicht hinterher, um ihn wieder einzufangen. Wenn sie den Mann durch gutes Zureden nicht bewegen können, wieder von dem Netz herunterzukommen, muss ein mit Helmen und Schutzschilden ausgestattetes Sondereinsatzkommando her.
Von dem Wachhabenden erfahre ich weiterhin, dass der Mann auf dem Netz in Kürze nach Venezuela abgeschoben werden sollte, um dort seine Strafe abzusitzen. Aber das wollte er nicht. Er ist auf das Netz gesprungen, um noch ein wenig Zeit in diesem Gefängnis herauszuschinden.
Ich mache die Tür wieder zu und schließe ab. Wir verbringen unsere fünfzehnminütige Pause im Unterrichtsraum. Zach steckt die Hand durch das Gitter am Fenster und öffnet es ein paar Zentimeter weit. Junior ist inzwischen an die Tafel getreten und hat einen meiner Whiteboardmarker benutzt, um ein Diagramm zu zeichnen, anhand dessen er vier anderen Männern erklärt, wie man mit Bitcoins Millionär wird. Er setzt ihnen gerade auseinander, was sie anstellen müssen, um es innerhalb der nächsten sechs Monate zu einer Rolex oder einem Mercedes zu bringen.
Ein Mann namens Gregg tritt zu mir. Unter seinem rotbraunen Stoppelhaar ist deutlich eine hellrote Narbe zu erkennen. »Diese ganze Philosophie«, sagt er, »wofür soll das alles gut sein?«
»Nun«, setze ich an, »Philosophie ist der altgriechische Begriff für …«
»Was kann man damit anfangen? Für was für Jobs braucht man die?«
»Ein paar Freunde von mir – Leute, die ich kenne – haben es damit zu einer guten Stellung in der City gebracht, würde ich sagen.«
»Was sind Sie denn eigentlich von Beruf?«, will er wissen.
Dass er mir nun diese Frage stellt, nachdem ich ihn schon seit einer Weile unterrichte, legt die Vermutung nahe, dass die Antwort »Philosophielehrer« ihn nicht befriedigen wird. »Manche Menschen verlegen sich auf die Juristerei, nachdem sie einen Abschluss in Philosophie haben«, sage ich stattdessen.
Gregg starrt mich erwartungsvoll an, als sei er überzeugt davon, dass ich bewusst etwas verschweige.
»Was glaubst du denn? Wer ist der Freieste in der Geschichte mit den Sirenen?«, frage ich ihn.
»Keiner von denen. Deswegen spricht man ja auch von Narrenfreiheit. Nur ein Idiot würde daran glauben, dass man mit Freiheit wirklich alles erreichen kann.«
Während der gesamten fünfzehnminütigen Pause bleibt Wallace auf seinem Stuhl sitzen und spricht mit niemandem. Ein paar Wochen zuvor hatte es im Gefängnis einen Sicherheitsvorfall gegeben, weswegen die Männer dreiundzwanzig Stunden am Tag in ihren Zellen bleiben mussten und ihnen nur eine Stunde am Tag das gewährt wurde, was in der Anstaltsordnung »Freistunde« genannt wird: Während dieser Stunde dürfen die Männer ihre Zellen verlassen, um Anrufe zu machen, zu duschen, miteinander in Kontakt zu treten oder sich die Beine zu vertreten. Während solcher Freistunden blieb Wallace allerdings sehr häufig in seiner Zelle, wo er auf seinem Bett liegend in einem Buch las.
Die Männer nehmen wieder ihre Plätze in dem Kreis ein.
»Der Philosoph Epiktet ist als Sklave geboren worden«, beginne ich, »glaubte aber fest daran, prinzipiell ein freier Mensch zu sein. Er sagte, mit Ketten könne man seinen Körper fesseln, nicht aber seine Fähigkeit, für sich selbst zu entscheiden.«
»Man kann immer in seinem Kopf frei bleiben«, pflichtet Wallace mir bei.
»Epiktet war davon überzeugt, dass man Freisein auch erlernen könne, indem man sich bewusst macht, was außerhalb des eigenen Einflussbereichs liegt und was nicht«, füge ich hinzu.
»Jeden Abend, wenn die Schließer ihre Runde machen, um uns für die Nacht in unseren Zellen einzusperren, mache ich meine Zellentür zu, bevor sie sie hinter mir zuknallen können«, erzählt Wallace.
»Um die Macht über die eigene Freiheit zu haben?«, hake ich nach.
»Aus demselben Grund beende ich auch jedes Telefongespräch eine Minute bevor der Schließer mir sagen kann, dass die Zeit um ist.«
»Was passiert, wenn du dann nicht aufhörst?«
»Dann tue ich etwas, was ich später bereuen werde. Vor ein paar Jahren habe ich mitbekommen, wie jemand einfach weitertelefonierte, nachdem der Schließer ihm gesagt hat, er solle aufhören. Da hat der Schließer mit dem Finger auf die Gabel gedrückt. Wenn einer so etwas mit mir machen würde, bekäme er von mir garantiert eins auf die Fresse. Also lasse ich es gar nicht erst so weit kommen, dass ich in so eine Situation gerate. Ich beende das Gespräch lieber rechtzeitig.«
»Und das ist dann Freiheit?«
»Es macht das Leben leichter«, antwortet Wallace.
Eine halbe Stunde später ruft der Wärter draußen vor der Tür: »Umschluss!«, was auch bedeutet, dass der Unterricht zu Ende ist. Ich schließe die Tür auf, und die meisten Männer gehen hinaus, doch ein paar bleiben noch zurück. Einer zeigt auf mein sonnengebräuntes Gesicht und fragt mich, wo ich gewesen bin. Ich versuche, meine Antworten so knapp wie möglich zu halten, denn ich will nicht ausschließen, dass es zu einer peinlichen Situation kommen könnte, wenn ich einer Gruppe von Strafgefangenen von Phuket und seinen tropischen Stränden und den nächtlichen Vollmondpartys dort vorschwärme. Aber sie wollen von mir unbedingt nähere Einzelheiten hören: »Sind Sie schnorcheln gewesen?«, »Wo hat es Ihnen am besten gefallen?«, »Könnten Sie sich vorstellen, für immer dort zu leben?«. Dann fragt mich einer ganz unverblümt: »Waren Sie mit Ihrem Freund dort?« Ich suche in seinem Gesicht nach dem Anflug eines schelmischen Grinsens. Aber ich kann nichts dergleichen entdecken. Es war eine ganz und gar ernst gemeinte Frage. »Dieses Mal bin ich allein geflogen«, sage ich.
Die Männer löchern mich mit weiteren Fragen über Thailand. Ein paar von ihnen sind selbst schon einmal dort gewesen und wollen wissen, ob es diese oder jene Karaokebar in Bangkok noch gäbe. Sie fragen mich, ob ich einen günstigen Flug bekommen und ob ich in Thailand Durchfall gehabt hätte. Während ich die Fragen beantworte, erwäge ich, in das Gespräch einfließen zu lassen, dass ich eine Freundin habe, aber die Atmosphäre im Raum ist gerade so entspannt und freimütig, dass ich es einfach nicht übers Herz bringe, ihnen zu sagen, dass ich nicht schwul bin.
Scham
»Ich bin aber nicht schuldig«, sagte K., »es ist ein Irrtum. Wie kann denn ein Mensch überhaupt schuldig sein. Wir sind hier doch alle Menschen, einer wie der andere.«
»Das ist richtig«, sagte der Geistliche, »aber so pflegen die Schuldigen zu reden.«
Franz Kafka, Der Prozeß
Heute Abend habe ich meine Onlinesteuererklärung abgeschickt. Sowie ich den Computer ausgeschaltet habe, überkommt mich sogleich ein ungutes Gefühl. Ich gehe zu Bett, aber ich kann nicht schlafen. Ich bin mir sicher, irgendetwas verkehrt gemacht, irgendetwas vergessen zu haben und dass man mich wegen Steuerhinterziehung belangen wird.
Als ich dann endlich eingeschlafen bin, träume ich, dass ich mich zusammen mit meinem Vater auf einem Gefängnishof befinde. Rasch trete ich einen Schritt zur Seite; ich möchte nicht, dass die Gefängniswärter uns zusammen sehen. Es ist ein Winternachmittag, und mir ist kalt. Zwei der Wächter lachen und scherzen miteinander. Ich gehe zu ihnen hin und sage ihnen, dass ich hier arbeite und dass ich am Ende der Schicht das Gefängnis mit ihnen zusammen verlassen werde. Sie reden weiter miteinander, als könnten sie mich nicht hören. Ich will meine Schlüssel hervorholen, aber mein Schlüsseltäschchen ist leer. Ich frage die Wärter, ob sie mich hören können, bekomme aber keine Antwort.
Als ich um fünf Uhr morgens erwache, wird es bereits hell. Ich verlasse das Haus ohne einen Schirm und gehe zu Fuß zum Gefängnis, obwohl mir der Regen beinahe waagerecht ins Gesicht peitscht. Hinter den Ohren und am Kragen werde ich ganz nass. An der Sicherheitsschleuse des Gefängniseingangs entledige ich mich meiner durchnässten Schuhe, ziehe den Gürtel aus meiner Hose und lege meine Uhr ab; dann passiere ich den Metalldetektor. Durch meine feuchten Socken hindurch spüre ich den harten Steinboden. Mein Herz rast, und mir ist schwummerig zumute. Wüste, irrationale Angstgefühle halten mich gepackt. Mein Rucksack wird durchleuchtet. Der Sicherheitsbeamte wirft mir einen strengen Blick zu, was mich veranlasst, darüber nachzudenken, welcher Straftat ich schuldig sein könnte. Ich stelle mir vor, wie jeden Augenblick das rote Licht über dem Scanner angeht und ein Alarmsignal ertönt und dass die Wächter dann ein Kilo Heroin in meinem Rucksack finden werden.
Es ertönt kein Alarm. Ich halte dem Sicherheitsbeamten meine ausgestreckten Arme hin, damit er sie abtasten kann. Die Ärmel meines Sweatshirts sind feucht. Ich bringe die Eingangskontrolle unbeanstandet hinter mich, aber das erlöst mich nicht von meiner Panik. Ich gehe über den Hof an einer Reihe von Zellenfenstern vorbei und höre den Ton mehrerer Fernseher – alle auf einmal: das fröhliche Geklimper, mit dem für Joghurt geworben wird, dringende Eilmeldungen der Nachrichtenredaktion, Publikumsgelächter vom Tonband.
Es sind allerhand Jahre vergangen, seit ich zuletzt in einem Anfall von Paranoia überzeugt gewesen war, dass die Sünden meines Vaters irgendwann auf mich zurückfallen würden – unabhängig davon, was ich selber aus meinem Leben machte. Die grausame Gewissheit, dass ich eines Tages hinter Gittern landen würde, machte sich am stärksten bemerkbar, als ich etwa achtzehn Jahre alt war. Es machte mir damals weniger zu schaffen, dass ich überhaupt verhaftet werden würde, als vielmehr, unter welchen Umständen dies geschehen werde. Ich hoffte, dass es bei Tageslicht sein würde und nicht des Nachts und dass ich dann allein wäre und nicht mit Freunden zusammen. Wenn ich auf der Straße Polizeisirenen hörte, wurde ich ganz hektisch und hielt im Gehen inne, um darauf zu lauschen, ob sie sich mir näherten.
Auf dem Gang kommt mir ein Wachbeamter mit einem Schäferhund entgegen, den er an einer Leine führt. Ich verlangsame meine Schritte, als wollte ich dem Hund ganz bewusst einen Anlass geben, mich anzubellen. Aber er geht an mir vorüber und wirft mir nur einen misstrauischen Blick aus seinen dunklen Augen zu.
David, einer meiner Schüler, wird heute nicht am Gemeinschaftsunterricht teilnehmen können, weil er einen Anwaltstermin hat. Also gehe ich um die Mittagszeit zu seiner Zelle, um ihm vor Unterrichtsbeginn ein paar Texte zum Lesen zu bringen. Als sein Zellengenosse mir die Tür öffnet, pralle ich vor dem Geruch zurück, der aus der Zelle kommt. Die beiden haben vier rosafarbene Lufterfrischer auf ihrem Fensterbrett stehen, deren Lavendelduft sich mit dem Geruch von schmutzigen Socken, Instantnudeln und zwei auf engstem Raum zusammenlebenden Männern vermischt hat. Ich erfahre, dass David noch Dienst bei der Essensausgabe hat, also gehe ich in den Speiseraum, wo die Gefangenen in einer langen Schlange auf ihre Mahlzeit warten. Ich überlege mir, ob es nicht besser wäre, später noch einmal wiederzukommen, und frage einen Mann, der aussieht, als wäre er schon um die siebzig, um welche Zeit die Essensausgabe für gewöhnlich beendet ist. »Normalerweise sollten wir schon vor einer halben Stunde gegessen haben«, sagt er. »Ich habe schon gefragt, wann wir denn endlich was zu mampfen kriegen, aber das ist auch schon wieder verdammte zwanzig Minuten her. So was wie Pünktlichkeit scheint’s hier drin nicht zu geben.« Er spricht mit dem gleichen Liverpooler Akzent wie mein Vater.
Ich beschließe, mich um David später zu kümmern, und gehe stattdessen erst einmal in unseren Unterrichtsraum, wo ich eine Frau antreffe, die Spielsachen in einen Karton packt – Teddybären, Legosteine, ein Xylofon in sämtlichen Regenbogenfarben und ein Telefon von Fisher-Price mit Rädern und einem grinsenden Gesicht auf der Wählscheibe. Sie erklärt mir, dass sie den Gefangenen zeigen will, wie man mit diesen Sachen umgeht – damit sie an den Besuchstagen etwas mit ihren Kindern anzufangen wissen.
Dann geht sie. Ich stelle die Stühle wieder im Kreis hin und warte darauf, dass die Wächter »Umschluss!« rufen.
Ein paar Jahre vor meiner Geburt war mein Vater schon einmal achtzehn Monate im Gefängnis gewesen, und dann ist er während meiner ganzen Kindheit immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Als ich zwei Jahre alt war, sind meine Mutter, mein Vater und ich nach Jersey in die Ferien gefahren. Ich war damals natürlich noch zu klein, um mich selbst daran erinnern zu können, aber meine Mutter erzählte mir später, dass mein Vater am zweiten Abend unseres Aufenthalts eifersüchtig auf einen gut aussehenden Kellner geworden wäre, der sich lediglich zuvorkommend meiner Mutter gegenüber verhalten hatte. Sie und ich wären dann in unser Hotel zurückgekehrt, während mein Vater noch weiter um die Häuser gezogen ist. Um ein Uhr früh sei er dann durch die Tür gewankt gekommen und hätte ihr eine Handvoll Schmuck vor die Füße geworfen – goldene Ringe und Ohrringe mit Diamanten.
»Die sind für dich«, hat mein Vater ihr mit alkoholgeschwängertem Atem ins Gesicht gesagt.
»Was hast du angestellt?«, verlangte meine Mutter zu wissen.
Schon hörte man sich nähernde Polizeisirenen. Mein Vater stand nur da; ein Perlenhalsband, das sich an seinem Ring verfangen hatte, baumelte ihm von der Hand hinunter.
Er hatte die Schaufensterscheibe eines Juweliergeschäfts eingeschlagen und ganze Hände voller Ausstellungsstücke an sich gerafft. Ein paar Minuten später erschien auch schon die Polizei und nahm ihn fest. Am nächsten Morgen wurde er dem Haftrichter vorgeführt. Mein Vater wäre sofort wieder im Gefängnis gelandet, wenn es sich bei den Schmuckstücken, die er hatte mitgehen lassen, nicht um Attrappen aus Plastik gehandelt hätte. So befand ihn der Richter lediglich der Sachbeschädigung für schuldig und verurteilte ihn zu einer Geldstrafe, die meine Mutter von dem Rest des Geldes für unseren Urlaub beglich. Dann tauschte sie am Bahnhof unsere Fahrkarten um, und wir fuhren noch am gleichen Tag wieder nach Hause.
Mein Vater wollte nicht, dass die Nachbarn mitbekamen, dass wir vorzeitig nach Hause zurückgekehrt waren, denn dann hätte es sein können, dass sie sich nach dem Grund dafür erkundigt hätten. Also blieben wir die ganze restliche Woche bei zugezogenen Vorhängen im Haus.
Als ich sieben war, trennten meine Eltern sich, und mein Vater bezog eine eigene Wohnung, dreißig Minuten Fahrt von der unseren entfernt. Er fand auch eine Anstellung als Versicherungsvertreter. Jedes zweite Wochenende verbrachte ich bei ihm. Dort spielte ich mit den Kindern, die bei ihm in der Straße wohnten.
Ungefähr anderthalb Jahre später läutete eines Sonntags um die Mittagszeit das Telefon. Dad lag noch im Bett. Als der Anrufbeantworter sich einschaltete, hörte ich, wie ein alter Mann meinen Vater beschuldigte, ihn um Tausende von Pfund betrogen zu haben.
Weitere zwei Wochen darauf holte Dad mich von der Schule ab und fuhr mit mir zu seinem neuen Zuhause. Die Fahrt dauerte vier Stunden. Ich vertrieb mir die Zeit, indem ich aus dem Autofenster schaute und die Peitschenleuchten an der Autobahn zählte, bis ich bei tausend angekommen war – und dann begann ich von vorn, bis ich wieder bei tausend war. Schließlich kamen wir in dem Küstenstädtchen an, in dem er ein Studioapartment in der obersten Etage eines Hauses gemietet hatte.
Abends gingen wir ins Pub um die Ecke, wo mein Vater ziemlich bald einen sitzen hatte. Er stellte sich den Frauen, die an der Bar bedienten, und den übrigen Zechern unter einem falschen Namen vor. Ich saß derweil an unserem Ecktisch, kaute peinlich berührt auf meinen Fingernägeln herum, spielte mit meinem Haar und war auch sonst ziemlich zappelig.
»Sitz still«, sagte mein Vater, als er wieder an unseren Tisch kam.
Ich legte artig die Hände auf die Oberschenkel, aber ich war so nervös, dass ich glaubte, mich gleich übergeben zu müssen.
Mein Vater gab mir einen Knuff und wies mit einer Kopfbewegung auf zwei stämmige Männer, die an der Bar standen. »Wenn jemand hier drin es auch nur wagt, mich anzufassen, gehen diese beiden Burschen dazwischen. Sie sind meine Aufpasser.« Die beiden schienen ihm allerdings keinerlei Beachtung zu schenken. Dad kippte einen weiteren Drink hinunter und sagte: »Falls dich jemand anspricht, darfst du auf keinen Fall verraten, wo wir vorher gewohnt haben.«
Mein Vater hatte in seiner Wohnung keine Bilder an den Wänden. Weil auch kein Tisch da war, hatte er am Fuße seines Bettes ein Bügelbrett aufgestellt, auf dem seine Sachen lagen – ein paar Stifte, Feuerzeuge, eine Rolle Klebeband, seine Schlüssel, ein Kamm, eine kleine Packung H-Milch, eine halb leere Tüte Fruchtgummis und ein paar Speisekarten von Take-away-Restaurants, auf die mein Vater die Namen von irgendwelchen Rennpferden gekritzelt hatte.
Dad trank jeden Abend ziemlich viel und schlief am nächsten Tag bis in den Vormittag, Ich saß dann dicht vor dem Fernseher und sah mir Zeichentrickfilme an, wobei ich die Lautstärke so weit wie möglich heruntergedreht hatte. Dad zuckte im Schlaf immer wieder zusammen und rief laut »Nein!«, bevor er sich herumwälzte und weiterschlief.
Mit den Trickfilmen versuchte ich, mich von der Beklommenheit abzulenken, die mir die Brust zuschnürte. Aber solche Filme liefen nur am Vormittag; ich wechselte von einem Sender zum anderen, aber es wurden nur noch Filme für Erwachsene gezeigt. Also setzte ich mich aufs Fensterbrett und beobachtete die Leute, die unten auf der Straße vorbeigingen.
Am Nachmittag wollte mein Vater mit mir Boxen spielen. Er kniete sich vor mich hin, sodass er in Augenhöhe mit mir war.
»Schlag mich«, sagte er.
Er drehte den Kopf auf die Seite und zeigte auf seinen Unterkiefer.
»Schlag mich«, wiederholte er. »Mach schon.«
Ich ließ die Hände an meinen Seiten herunterbaumeln.
Er klatschte sich mit der flachen Hand auf den Kiefer.
Meine Hände blieben, wo sie waren.
Also gingen wir ins Pub. Er schüttete einen kleinen Schuss von seinem Bier in mein Limonadenglas und sagte, ich solle mal probieren. Aber ich ließ das Glas auf dem Tisch stehen. Ich wollte auf keinen Fall so werden wie er – doch gleichzeitig schämte ich mich bereits dafür, so geworden zu sein wie er.
Als Dad mich am Montagmorgen wieder bei meiner Schule absetzte, überkam mich auf dem Weg ins Klassenzimmer das mulmige Gefühl, dass mir wegen irgendwas etwas Unangenehmes bevorstand. Doch auch als alle Lehrer mich freundlich begrüßten und keinerlei Vorbehalte zeigten, wollte das Gefühl eines schlechten Gewissens nicht von mir weichen. Wie ein Geheimnis musste ich meine Schuldgefühle für mich behalten. Als uns der Religionslehrer von den Heiligen im Himmel erzählte, fragte ich ihn, was für Menschen das wären, die in die Hölle kämen.
Neun Monate später zog mein Vater wieder um – in einen Caravan, eine Stunde Fahrt von seiner bisherigen Wohnung entfernt. Wenn wir in seiner neuen Wohngegend spazieren gingen, stellte sich mein Vater den Nachbarn, denen wir begegneten, unter einem neuen Falschnamen vor. Abends klappten wir die Couch auseinander, und jeder legte sich an einem Ende hin. Mein Vater schlief mit einem Baseballschläger neben seinem Kissen. Ich fühlte mich zunehmend unwohler in meiner Haut und war immer mehr von der Vorstellung besessen, mit irgendeinem Makel behaftet zu sein. Wenn mein Vater schlief, kniete ich mich hin und betete zu Gott, er möge mir noch eine Chance geben, doch noch ein guter Mensch zu werden.
Ein halbes Jahr darauf war der nächste Umzug fällig. Diesmal wohnte mein Vater ein paar Hundert Meter von einem Fährhafen entfernt. Er benutzte wieder einen Falschnamen und schlief immer noch mit seinem Baseballschläger neben sich im Bett. Mit dem Trinken wurde es bei ihm immer schlimmer, und er benahm sich auch zunehmend aggressiver. Meistens schlief er bis mittags. Draußen hörte ich die Fähren tuten, wenn sie aus dem Hafen ausliefen.
Eines Tages – ich war damals zwölf – war ich bei meiner Mutter zu Hause, als ich einen Brief von meinem Vater bekam. Er schrieb, dass er Ärger mit der Polizei hätte und dass sein Anwalt meinte, dass er wohl wieder ins Gefängnis müsse. Da habe ich dann den Kontakt zu ihm abgebrochen. Ich legte mir einen anderen Namen zu, damit ich nicht mehr so hieß wie er. Doch die Angstgefühle blieben.
Als ich siebzehn war, schlenderten mein bester Freund Johnny und ich einmal an einem Wochenende durch die Innenstadt, wo ich in einem Laden ein rotes Hemd sah, das ich gerne gehabt hätte, mir aber nicht leisten konnte. Am nächsten Tag kaufte Johnny das Hemd und schenkte es mir. Als er es mir überreichte, beschlich mich wieder so ein unbestimmtes Schuldgefühl. Ich bildete mir ein, dass dies das letzte Mal wäre, dass mir jemand etwas schenkte, weil die Leute nämlich schon bald herausfinden würden, wer ich in Wirklichkeit war und dann nicht mehr länger mit mir befreundet sein wollten. Als ich das Hemd anzog, überkam mich das verzweifelte Verlangen, meine Sünden zu beichten. Es gab zwar gar keine Sünden, die ich hätte beichten können, aber das machte das Verlangen nicht weniger dringlich.
Es war, als hätte ich einen Scharfrichter in meinem Kopf, der nur darauf wartete, Finsternis über mein Leben kommen zu lassen. Während meiner ganzen folgenden Jugendzeit bangte ich ständig dem Augenblick entgegen, in dem mir schon bald alles fortgenommen würde. Dieses Gefühl hielt an, bis ich Anfang zwanzig war. Jeder Tag, den ich mit meinen Freunden am Strand verbrachte, war von Hoffnungslosigkeit überschattet – wie die letzte Mahlzeit vor dem Gang zum Schafott. Ich versuchte, mir einzureden, dass ich im Grunde ja gar kein Unrecht begangen hatte, das ich mir vorzuwerfen hätte – aber der Henker manövrierte mich in eine kafkaeske Situation, in der sämtliche Beteuerungen meiner Unschuld bloß bestätigten, dass ich etwas zu verbergen hatte. Es gab nichts, was ich dagegen hätte sagen oder tun können. Es war zu spät.
Inzwischen bin ich einunddreißig und schleppe immer noch ein Gefühl ererbter Schuld mit mir herum. Seit ich meine Arbeit in Strafanstalten aufgenommen habe, ist dieser innere Scharfrichter noch präsenter geworden: Ich sehe Männer in ihren Zellen, und mir wird dabei innerlich ganz kalt von dem Gedanken, dass ihre Bestrafung auch die meine sein könnte – oder sein sollte.
Es ist Umschluss. Keith ist der Erste; er nimmt sich einen Stuhl und beginnt in einem Buch über Formale Logik zu lesen, das er sich in der Bibliothek ausgeliehen hat. Vor der Tür ist noch jemand, der zunächst zögert, den Raum zu betreten. Es ist Rodney. Er ist Anfang zwanzig. Bis vor einem Monat hat er in seiner Zelle noch Bücher über Strafrecht verschlungen, bis man ihm sagte, dass sein Antrag auf Berufung abgewiesen worden wäre; nun verbüßt er vierhundert Meilen von seiner Heimatstadt Glasgow entfernt seine Strafe.
Er steckt den Kopf zur Tür herein. »Nächste Woche komme ich nicht«, sagt er.
»Ich freue mich immer, wenn du dabei bist.«
Er zuckt mit den Achseln. »Ich bin diese Woche noch dabei, weil die uns die Zelle aufgeschlossen haben, aber nächste Woche werde ich nicht da sein.«
Das hat mir Rodney schon während der vergangenen drei Wochen gesagt.
»Schön, dass du jetzt hier bist«, sage ich.
Er betritt der Raum und setzt sich.
Ich schließe die Tür.
»In der altgriechischen Mythologie«, beginne ich, »wollte Zeus Prometheus und Epimetheus bestrafen, weil sie den Menschen das Feuer geschenkt haben. Er fesselte Prometheus an einen Felsen, wo die Vögel ihm jeden Tag seine Leber wegfraßen. An Epimetheus’ Hochzeitstag schenkte Zeus dessen Gattin Pandora eine kunstvoll verzierte Büchse, ermahnte sie aber, dass sie nicht hineinschauen dürfe. Während der folgenden Tage vermochte Pandora an nichts anderes zu denken als daran, was sich wohl in dem Geschenk befände, und eines Abends dann öffnete sie es. Sieben Übel kamen zum Vorschein: Hass, Scham, Gier, Langeweile, Faulheit, Irrglauben und Schmerz. Dann rief eine Stimme aus dem Inneren des Behältnisses nach Pandora, und sie öffnete es noch einmal. Diesmal kam die Hoffnung zum Vorschein.«
Rodney reibt sich die Augen.
»Wenn ihr eines der Übel in das Behältnis zurücktun könntet, welches würdet ihr wählen?«, frage ich die Männer.
»Die Hoffnung«, sagt Rodney. »Hoffnung ist das, was die anderen Übel noch schlimmer macht«, erklärt er. »Schmerz wäre nicht so schlimm, wenn es keine Hoffnung gäbe. Wir müssten dann einfach damit leben, anstatt darauf zu hoffen, dass der Schmerz nachlässt.«
»Aber ohne Hoffnung wird gar nichts besser«, widerspricht Keith. »Ohne Hoffnung hätte man immer noch Schmerzen. Aber es wären dann Schmerzen, an denen man verzweifelt.«
»Wenn man darauf hofft, dass sich irgendetwas ändert und das nicht passiert, dann hat die Hoffnung alles nur noch schlimmer gemacht«, sagt Rodney.
Mein Blick wandert zum Fenster und zu den Stacheldrahtspiralen auf den Mauern und den Dächern, die ich dahinter sehe. Überall, wo man im Gefängnis nach oben schaut, winden sich die verdrillten Stahldrahtschleifen.
»Schmerz wäre ohne Hoffnung weniger schlimm«, höre ich Rodney sagen und wende meine Aufmerksamkeit wieder dem Gespräch zu.
»Hoffnung entspringt all den anderen Übeln in der Büchse«, sagt Keith. »Wenn man Schmerzen hat, dient die Hoffnung dazu, einen daran zu erinnern, dass es jenseits des Schmerzes noch eine Zukunft gibt.«
»Ich verschwende meine Energie nicht darauf, zu hoffen, dass der Schmerz weggeht. Ich versuche einfach, mich daran zu gewöhnen«, erwidert Rodney.
Die Diskussion setzt sich fort. Ich schreibe eine Liste der Dinge, die der sprichwörtlichen Büchse der Pandora entspringen, nebst einigen sinnverwandten Begriffen an die Tafel. Keith ist gerade an der Reihe: »Letztes Jahr hatte ich eine Anhörung, und ich habe alles in meiner Macht Stehende getan, damit man mich rauslässt, habe sämtliche Fortbildungsangebote genutzt. Meine Führung war tadellos. Ich war ein Mustergefangener. Also habe ich gehofft freizukommen. Doch letzten Endes dauerte die ganze Anhörung nur acht Minuten. Sie sagten Nein. Da bin ich in den Hungerstreik getreten. Ich habe mir fest vorgenommen, nie wieder auf eine vorzeitige Haftentlassung zu hoffen.«
Rodney gähnt.
»Aber das konnte ich nicht«, fährt Keith fort. »Nicht zu hoffen hinterließ in mir eine Leere. Ich hatte nicht einmal mehr die Energie für mein Fitnesstraining, konnte mit niemandem mehr reden. Ich fühlte mich sogar zu leer, um auch nur zu schlafen. Nach ein paar Tagen fiel drei Jungs in meinem Zellentrakt auf, dass ich nichts mehr aß, und sie brachten mir einen Teller mit Essen an die Zellentür. Da konnte ich nicht mehr anders, als wieder Hoffnung zu schöpfen.«
»Das ist ja eine schöne Geschichte, aber ich werde nicht so blöd sein, gegen die Strömung anzuschwimmen«, bemerkt Rodney.
»Es gibt zu viele anständige Menschen auf der Welt, als dass man nicht mehr hoffen könnte«, sagt Keith.
Rodney zeigt auf die Liste an der Tafel: »Wenn du die Hoffnung zurück in die Büchse tust, geht dir automatisch auch jede Illusion, was ja auch ein Irrglaube ist, verloren.«
Während der nächsten Stunde kommen weitere Vorschläge von anderen Schülern. Rodney wirkt gelangweilt. Zweimal lacht er in sich selbst hinein, aber es ist nicht klar, was er so lustig findet. Ich frage Ed, einen anderen Gefangenen, was er in Pandoras Büchse zurücktun würde. Ed hat einen grauen Spitzbart und eine Glatze. Er verbüßt eine sechsjährige Strafe.
»Die Scham«, murmelt er.
»Dann würdest du bloß weiter Dummheiten machen«, entgegnet Rodney.
»Schon bevor ich meine Dummheiten gemacht habe, wusste ich, dass ich mich nachher ihrer schämen würde – und das hat mich nicht davon abgehalten«, sagt Ed.
»Es wird dir nie gelingen, dich zu bessern, wenn du dich der schlechten Dinge, die du tust, nie schämst«, sagt Rodney.
»Vielleicht ist es ja gerade die Scham, die einen schlechte Dinge tun lässt.«
»Und wie zum Teufel soll man sich dann jemals bessern?«
»Durch Mitgefühl vielleicht. Oder Reue. Aber nicht, indem man sich schämt.«
Eine Stunde später ist der Unterricht zu Ende, und die Männer gehen nacheinander hinaus. Ich nehme meinen Rucksack über die Schulter. Gregg ist noch geblieben, um mir zu sagen, dass er in der nächsten Woche nicht dabei sein wird, weil er freikommt. »Sie haben mir einen Job bei der U-Bahn gegeben«, sagt er.
»Als Zugführer?«, frage ich.
Er zieht die Stirn kraus. Ich spüre, dass ich wieder etwas sehr Dummes gesagt habe.
»Ich führe nachts Instandsetzungsarbeiten an den Schienen durch. Da ist es egal, ob man vorbestraft ist. Sind ja keine Leute da.«
»Und wie findest du das?«
»Es ist immerhin ein Anfang.«
In meinem Magen zieht sich ein Knoten zusammen bei dem Gedanken, dass es für Gregg »schon mal ein Anfang« ist, wenn er nach seiner Gefängniszeit irgendwo tief unter der Erde schwere körperliche Arbeit leisten muss.
Gregg verabschiedet sich von mir und geht. Ich streife meinen Rucksack wieder ab und öffne ihn. Dann gehe ich in die Hocke und fühle in sämtlichen Taschen nach, um sicherzugehen, dass ich auch nichts Illegales mit mir herumtrage.
Begehren
Meine Träume sind eine so unsinnige Zuflucht wie ein Regenschirm, wenn es Blitze hagelt.
Fernando Pessoa
Meine Schüler glauben weiterhin, ich wäre schwul. Im Verlauf einer Diskussion zum Thema »Wissen« rutscht einem Schüler namens Marcus das Wort »Hinterlader« heraus, was ihm missbilligende Blicke vonseiten der anderen einträgt, worauf Marcus mir seinerseits einen Blick zuwirft und »Tut mir leid, Chef« sagt. Ich schenke ihm ein freundliches und wohlwollendes Lächeln. Ich werde hier im Gefängnis also weiterhin als heimlicher Heterosexueller Unterricht abhalten. Als Schwuler scheine ich auf die Schüler weniger bedrohlich zu wirken, wodurch ich mich meinerseits als ihr Lehrer in ihrer Mitte ungezwungener fühle.
Am Abend vor einem weiteren Unterrichtstag fotokopieren Jamie und ich ein paar Texte zur buddhistischen Philosophie. Dann entdecken wir, dass auf den kopierten Seiten tantrische Abbildungen von Göttern und Göttinnen beim ekstatischen Liebesakt vor einem blauen Himmel zu sehen sind.
Aus den Sicherheitsbestimmungen wissen wir, dass bildliche Darstellungen von Geschlechtsverkehr im Gefängnis verboten sind. Erst jüngst hat ein Beamter in sämtlichen Zellengängen Merkblätter ausgehängt, auf denen genau aufgeführt wird, welche Arten von Bildern als Pornografie eingestuft würden und dementsprechend untersagt wären. So dürfen die Männer zwar Fotos von Frauen in Unterwäsche an ihren Zellenwänden haben, aber nur, wenn darauf keine Brustwarzen zu erkennen sind – ebenso wenig wie nackte oder entblößte Vaginas, Frauen beim Urinieren, steife oder zumindest halb erigierte Penisse.
Also müssen Jamie und ich die Texte neu zusammenstellen. Wir besorgen uns eine Schere und entfernen eiligst die religiösen Darstellungen; auf unserem Arbeitstisch häuft sich ein Sammelsurium von Phalli und weiblichen Brüsten.
Als ich am Abend darauf im Bett liege, schaue ich bei Google nach, ob Gefangenen in Großbritannien bei Besuchen ihrer Ehepartner Verkehr mit diesen erlaubt ist. Die Antwort ist Nein.
Ein paar Wochen darauf stelle ich beim Betreten des gefängniseigenen Unterrichtsgebäudes fest, dass mein regulärer Klassenraum von einem Abgesandten einer Kette für gesundes Fast Food besetzt ist, der Ex-Strafgefangene für sein Unternehmen anwerben will. Ein Sicherheitsbeamter namens Baxter, ein Hüne von einem Mann mit einem breiten Kiefer, pockennarbigen Wangen und einem über und über mit Tattoos übersäten Unterarm weist mich an, stattdessen Raum 9 zu benutzen. Als ich die Tür öffne, stelle ich fest, dass mitten im Raum hohe Bücherregale stehen. Wenigstens sind sie auf Rädern, also stemme ich mich gegen eines davon und versuche, es beiseitezuschieben. Aber es rührt sich nicht. »Alles klar bei Ihnen?« Ich drehe mich um und sehe Baxter in der Tür stehen. Er will mir helfen. Nun erst sehe ich, dass in dem Raum außerdem noch ein Pult steht, an dem eine Frau sitzt. Ich kenne sie. Ich habe zwar noch nie mit ihr gesprochen, aber ich weiß, dass sie Anika heißt.
»Ich schaff’s schon«, sage ich zu Baxter, und er geht wieder.
Anika blickt nicht von dem Papierkram auf, mit dem sie beschäftigt ist.
»Tut mir leid, aber ich habe nicht gewusst, dass Sie hier sind«, entschuldige ich mich.
»Schon gut«, sagt sie und blickt immer noch nicht auf. Sie hat wasserstoffblondes Haar, das ihr über die eine Gesichtshälfte fällt. Ich kenne ihren Namen, weil ich schon gesehen habe, dass sie auch hier im Gefängnis unterrichtet und einen Kollegen nach ihrem Namen gefragt habe. Ich finde sie schön; aber das tun auch sämtliche übrigen Männer in diesem Gebäude – Männer, die man wegen Mordes oder wegen Brandstiftung hinter Gitter gesteckt hat, benehmen sich in Gegenwart von Anika wie perfekte Gentlemen. Ich gehe in die Knie und löse den Feststellmechanismus an den Rädern der Regale. Dann stehe ich auf und versuche noch einmal, sie zu bewegen, aber sie rühren sich ebenso wenig wie zuvor.
»Entschuldigung«, sage ich.
Anika blickt mich zwar über den Rand ihrer Brille hinweg an, legt aber nicht den Stift beiseite, mit dem sie sich gerade eine Notiz macht.
»Ob Sie wohl wissen, wie diese Räder funktionieren? Ich dachte, ich hätte die Bremsen losgemacht, aber die Regale bewegen sich immer noch nicht von der Stelle.«
Sie nimmt sich die Brille ab. »Wenn Sie den Feststellmechanismus der Räder lösen, können Sie die Regale verschieben.«
»Dann muss ich wohl irgendwas verkehrt machen.«
Ich sehe, wie ihr Bein unter dem Schreibtisch vor lauter Verstimmung zittert. Sie hat ein schmales Kinn und hohe Wangenknochen. Hier, in einem Männergefängnis, nimmt ihre ohnehin schon außerordentliche Schönheit ein geradezu gnadenloses Maß an. Ich brauche sie nur anzusehen, und schon bekomme ich Mitleid mit den Hunderten von Männern, die sich in ihren Zellen nach ihr verzehren – wobei ich allerdings sagen muss, dass Anika mich zwar an-, aber doch glatt durch mich hindurchsieht, sodass ich mit mir selbst Mitleid bekomme.
Wenn mein Dad in einem Pub eine Schlägerei anzettelte oder Ärger mit der Polizei bekam, habe ich immer gesehen, wie seine Freundinnen sich frustriert abwandten, weil sie solcher Szenen längst überdrüssig waren; ich schloss daraus, dass die Frauen sich einen romantischen und sensiblen Mann wünschten und keinen harten Typen. Ich stemme mich mit der Schulter gegen eines der Bücherregale und drücke so fest ich kann dagegen, aber sie bewegen sich nach wie vor nicht.
Baxter erscheint wieder in der Tür. »Lassen Sie mich mal ran«, sagt er, und ich trete einen Schritt zur Seite. Er packt die Regale mit beiden Händen und schiebt sie scheinbar mühelos beiseite.
»Vielen Dank, Officer«, sagt Anika mit einem Seufzer.
Dem kann auch ich mich nur anschließen. »Ja, vielen Dank.«
Eine Stunde später treffen meine Schüler ein. Rodney rückt gleich damit heraus, dass er diese Woche zwar noch käme, in der nächsten Woche aber nicht – wie er es schon in den vergangenen vier Wochen immer angekündigt hat. Es gibt einen neuen Schüler in der Gruppe, einen ehemaligen Buchhalter namens Jack. Er ist Ende fünfzig, ist zum ersten Mal im Gefängnis und hat gleich sechs Jahre aufgebrummt bekommen. Er trägt eine runde Hornbrille und ein wie ladenneu aussehendes türkisfarbenes Polohemd. Er nimmt neben Solomon Platz, der schon allerhand Knasterfahrung aufweisen kann. Jack beklagt sich, dass man ihm keine Ersatzbatterie für sein Transistorradio geben will. »Wenn jemand sagt, er will dir dein Radio abkaufen, komm zuerst zu mir«, sagt Solomon. »Ich kenne da ein paar Leute.«
Ich schließe die Tür.
»Descartes hat die Frage aufgeworfen«, beginne ich den Unterricht, »ob wir uns jemals sicher sein können, uns nicht gerade in einem Traum zu befinden?«
»Wenn das hier ein Traum ist, werde ich mir erst einmal tüchtig einen runterholen, wenn ich aufwache«, sagt Solomon. Die übrigen Männer lachen.
»Ich weiß, dass ich mich nicht in einem Traum befinde, weil ich niemals träume, dass ich im Gefängnis bin«, sagt Jack.
»Dann bist du noch nicht lange genug hier«, kontert Rodney.
Solomon zeigt mit beiden Zeigefingern auf sein Gesicht und sagt: »Meine Träume sind noch zu Hause.«
»Na, da kannst du ja von Glück reden«, sagt Rodney.
Solomon hebt die Hände zur Decke, zieht einen Schmollmund und schaut überheblich drein.
»Ich habe mal geträumt, dass ich wieder zu Hause wäre«, sagt Rodney. »Aber als ich versucht habe, irgendeinen Gegenstand aufzuheben, ging meine Hand glatt durch ihn hindurch.«
»Woher willst du wissen, dass du dich nicht noch immer in diesem Traum befindest?«, frage ich ihn. »Woher weißt du, dass dies die Realität ist?«
»Was ist denn genau der Unterschied?«, sagt Solomon. »Vor ein paar Jahren bin ich im Krankenhaus zu mir gekommen, und der Arzt hat zu mir gesagt, ich wäre von meinem Balkon gefallen. Ich konnte mich nicht daran erinnern, weil ich total zugekifft gewesen bin. Ich habe es nicht einmal gemerkt, als es passiert ist. Und seitdem habe ich manchmal Träume, in denen ich fühle, wie ich irgendwo hinunterstürze. Ich spüre sogar, wie die Luft an meinen Armen vorbeistreicht.«
»Worin besteht eurer Meinung nach der Unterschied?«, frage ich.
Jack drückt auf den Mittelsteg seiner Brille. »Die Wirklichkeit ergibt Sinn. All das hier ergibt zu viel Sinn, um nur ein Traum zu sein. Es ist körperlich fassbar. Ich kann diesen Stuhl berühren. Ich kann meine Uhr berühren.«
»Auch Träume können körperlich sein, mein Großer«, sagt Solomon.
»Nicht körperlich in dem Sinne. Nicht wie das wirkliche Leben.«
»Neulich eines Nachts«, erzählt Solomon, »ist der Mann in meiner Zelle aufgewacht und hat laut den Namen seiner Frau geschrien. Er hat sich seine Unterhose vollgewichst. Sagte, er hätte geträumt, mit ihr zusammen zu sein.« Er hält die Hände vor sich hin, als hielte er darin etwas von der Größe einer Wassermelone. »Er konnte sie riechen und sie kosten, sie spüren.«
Darüber muss ich grinsen und schaue mich im Raum um, um den Blick von einem der anderen Männer aufzufangen, aber alle lauschen mit ernster Miene auf das, was Solomon zu sagen hat. »Träume können sehr wohl körperlich sein. Der Mann musste aufstehen und sich eine andere Unterhose anziehen.«
Ein Schüler namens Ray lehnt sich in seinem Stuhl zurück und streicht sich nachdenklich übers Kinn.
Ich ergreife wieder das Wort. »Also, was sagt uns dieser nasse Traum über Descartes’ Fragestellung?«
Glück I
Ein Mann in der Wüste kann Abwesenheit in seinen hohlen Händen halten
und wissen, dass sie etwas ist, was ihn mehr nährt als Wasser.
Er weiß von einer Pflanze nahe bei El Tadsch,
deren Herzstück, wenn man es herausschneidet,
durch eine Flüssigkeit ersetzt wird, die alles Lebenswichtige enthält.
Jeden Morgen kann man die Flüssigkeit trinken,
so viel wie das fehlende Herz.
Michael Ondaatje
Vor sieben Jahren ist mein älterer Bruder Jason in seine neue Wohnung gezogen. Er hat die Wände mit fünf Schichten Emulsionsfarbe gestrichen, obwohl auch zwei es getan hätten. Jason meinte, er wolle sichergehen, dass alles um ihn herum vollkommen weiß wäre.





























