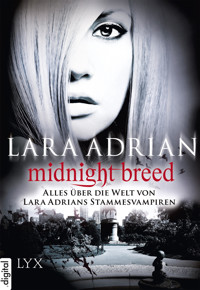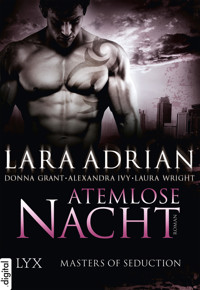9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Midnight Breed
- Sprache: Deutsch
Neues Lesefutter für die Fans der MIDNIGHT BREED
Micah ist einer der besten Krieger des Ordens. Doch bei einer Mission in den verbotenen Deadlands geschieht eine Katastrophe, und Micah ist der einzige Überlebende seines Teams. Alles sieht danach aus, als ob die Atlantiden dahinterstecken. Denn kurz vor dem Angriff hat Micah eine atlantische Frau gesehen. Der Krieger schwört Rache, doch als er die schöne Phaedra wiedertrifft, wird klar, dass Mächte im Spiel sind, die einen Krieg zwischen Atlantis und dem Orden provozieren wollen. Während sie versuchen, den unsichtbaren Feind zu offenbaren, wird es zunehmend schwieriger für Phaedra und Micah, die Leidenschaft zu ignorieren, die zwischen ihnen lodert ...
"Ein aufregendes, leidenschaftliches und actionreiches Lesevergnügen." ESCAPIST BOOK BLOG
Band 17 der MIDNIGHT-BREED-Serie von SPIEGEL-Bestseller-Autorin Lara Adrian
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 340
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhalt
Titel
Zu diesem Buch
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Die Autorin
Die Romane von Lara Adrian bei LYX
Leseprobe
Impressum
LARA ADRIAN
Gefährtin des Zwielichts
Roman
Ins Deutsche übertragen von Firouzeh Akhavan-Zandjani
Zu diesem Buch
Micah ist einer der besten Krieger des Ordens. Doch bei einer Mission in den verbotenen Deadlands geschieht eine Katastrophe – Micah ist der einzige Überlebende seines Teams. Alles deutet darauf hin, dass die Atlantiden hinter dem Anschlag stecken. Denn kurz vor dem Angriff ist Micah eine atlantische Frau erschienen. Der Krieger schwört Rache, doch als er die schöne Phaedra wiedertrifft, wird klar, dass die Antwort nicht so einfach ist. Denn für Phaedra fand die Begegnung mit Micah lediglich in einem der seltsamen Träume statt, die sie seit einiger Zeit heimsuchen. Aber auch wenn sie nichts mit der Attacke zu tun hat, gibt es eine unerklärliche Verbindung zwischen ihnen. Und es sind offenbar Mächte im Spiel, die einen Krieg zwischen Atlantis und dem Orden provozieren wollen. Während sie versuchen, den unsichtbaren Feind zu offenbaren, wird es zunehmend schwieriger für Phaedra und Micah, die Leidenschaft zu ignorieren, die zwischen ihnen lodert.
1
Es war diese Stille, die sie beunruhigte.
Nicht der schwarze, mondlose nächtliche Himmel über ihr. Nicht die Stunden, die sie nun schon mutterseelenallein durch die Dunkelheit stapfte, während sie sich einen Weg durch die endlose Weite verkohlter Bäume und nackter Erde suchte. Nein, es war diese völlige Lautlosigkeit, diese Grabesstille, die ihr das Blut gefrieren ließ.
Die Ödnis, die bar allen Lebens war, ließ sie bis ins Mark frösteln und drang wie Gift in ihre Knochen ein, während sich ihre Füße durch Asche und Nadeln von Kiefern und Fichten arbeiteten.
Phaedra war normalerweise nicht ängstlich. Das galt für die gesamte Spezies der Unsterblichen, der sie angehörte. Doch sie konnte nicht leugnen, dass sie es eilig hatte, hier wegzukommen. Dieser Drang ließ ihr das Herz bis zum Hals schlagen, und das war das einzige Geräusch, das sie in der unerträglichen Stille, die sie umgab, hörte.
Aus lauter Gewohnheit griff sie nach dem Armband an ihrem Handgelenk. Das Lederband mit dem kleinen Stück atlantidischen Kristalls hatte sie, solange sie denken konnte, getragen. Dieses Amulett konnte sie innerhalb eines Augenblicks an einen anderen Ort teleportieren. Doch ihr Handgelenk war bar jeden Schmucks. Vor Wochen hatte sie das Armband ihrer Freundin Tamisia gegeben, ohne zu ahnen, dass sie es vielleicht selbst brauchen würde.
Phaedra war jetzt auf sich allein gestellt. Ihr blieb nichts anderes übrig, als weiterzulaufen.
Die Einöde, das Labyrinth aus entnadelten, wie Skelette aufragenden Bäumen schien immer größere Ausmaße anzunehmen, je mehr sie ihm zu entkommen versuchte. Ein unregelmäßig verlaufender Pfad mündete in den nächsten und nahm dann wieder eine andere Richtung. Gerade Wege verwandelten sich in Bögen, die sie weiter in die Irre führten. Lichtungen, auf die sie meinte zuzusteuern, entfernten sich, ehe sie sich ganz auflösten, waren nichts weiter als Illusionen.
Entmutigung machte sich in ihr breit.
Es musste doch einen Weg geben, der nach draußen führte. Sie musste nur so lange gehen, bis sie ihn fand.
In der stockfinsteren Nacht tauchte plötzlich hinter einigen knorrigen, verkohlten Bäumen in ein paar Metern Entfernung ein blasser Umriss auf.
Ein Reh.
Anmutig, ruhig und milchweiß trat es vor Phaedra auf den kaum auszumachenden Weg. Die dunklen, sanften Augen blitzten kurz auf, doch es war keine Spur von Angst in dem gelassenen Blick des Tieres zu erkennen. Es wartete, und sein Atem dampfte leicht in der eisigen Nachtluft.
»Na du«, flüsterte Phaedra.
Sie wagte nicht, sich zu bewegen, denn sie wollte diese wunderschöne Kreatur auf keinen Fall erschrecken. All ihre Furcht angesichts ihres panischen Umherirrens in der fremden Umgebung schwand in der beruhigenden Gegenwart des Rehs.
»Wo kommst du denn her? Hast du dich genau wie ich verirrt?«
Vorsichtig machte sie einen kleinen Schritt vorwärts. Das Reh wich einen Schritt zurück.
Phaedra blieb sofort stehen und verzog enttäuscht das Gesicht. »Bitte, hab keine Angst vor mir.«
Das Reh wich weiter zurück. Dann drehte es sich ruhig um und zog sich wieder in den leblosen Wald zurück.
Phaedra folgte ihm. Das Reh behielt den großen Abstand bei, hüpfte aber nicht davon. Es ließ Phaedra nicht allein in dieser Ödnis, sondern schien sie irgendwohin zu führen. Es schien ihr einen Weg zu weisen.
Nicht aus dem gottverlassenen Wald heraus, sondern noch tiefer hinein.
Die knorrigen Bäume standen immer dichter zusammen, je weiter sie dem Tier folgte, das versengte Farnkraut wurde immer undurchdringlicher und bedrohlicher.
»Nein.«
Phaedra war sich nicht sicher, ob sie das Wort laut ausgesprochen hatte oder ob es nur durch ihren Kopf gehallt war. Das Reh drehte den Kopf zu ihr um und blieb in der Dunkelheit stehen. In den sanften Augen schien eine Frage zu stehen, fast schon ein Flehen.
Phaedra schüttelte den Kopf, sodass ihr langes braunes Haar in der nächtlichen Brise aufflog. »Ich gehe keinen Schritt weiter.«
Sie wartete darauf, dass das Tier seinen Rückzug in den Wald fortsetzte. Ja, sie erwartete förmlich, dass das ungewöhnliche Geschöpf wie eine Erscheinung verschwand, denn das musste es sein – eine Erscheinung.
Doch das Reh ging nicht weg.
Langsam kam es näher.
Mit ruhiger Entschlossenheit trat es auf sie zu, bis es so nah stand, dass Phaedra es hätte berühren können.
Sie konnte der Versuchung nicht widerstehen, mit den Fingerspitzen über das schimmernde weiße Fellkleid zu streichen. Es fühlte sich wie Samt an, und erst der stete Herzschlag des Rehs, der ihre Fingerspitzen vibrieren ließ, brachte Phaedra zu Bewusstsein, wie sehr sie dieses beruhigende Gefühl gebraucht hatte.
Der freundliche, unergründliche Blick aus braunen Augen sprach von einer Weisheit, die so alt war wie das Leben selbst.
Und von etwas anderem, das sich Phaedra aber nicht erschloss, obwohl sie es so gern verstanden hätte.
»Warum bist du hier?« Sie strich mit den Fingern über die glatte Stirn des Rehs und die zarten Nüstern. »Ich wünschte, du könntest mir sagen, wa…«
Phaedra blieben die Worte im Halse stecken. Irgendwo hinter ihr hatte sich die Stille des öden Waldes plötzlich verändert. Sie nahm Atemzüge wahr.
Es war nur der Hauch einer Veränderung, kaum wahrnehmbar, außer von jemandem wie ihr, die über außerirdisch scharfe Sinne verfügte. Ihre Haut kribbelte, als Unbehagen sie erfasste. Sie nahm ihre Hand von dem weißen Reh und drehte langsam den Kopf, um zu lauschen und den Blick über die Landschaft aus dürren Stämmen und Ästen gleiten zu lassen und nach den Eindringlingen zu suchen, deren Anwesenheit sie instinktiv spürte.
Männer.
Sie konnte sie noch nicht sehen, aber sie spürte sie.
Aber da stimmte irgendwas nicht.
Warum sollte irgendjemand hier an diesen gottverlassenen Ort kommen? Was könnten die Männer wollen?
Ihre Gegenwart konnte nichts Gutes bedeuten, was immer auch ihre Gründe sein mochten. Sie bewegten sich fast geräuschlos voran, und der Geruch von Gewaltbereitschaft und Waffen umwehte sie. Und sie kamen mit jeder Sekunde näher.
Jetzt erhaschte Phaedra einen kurzen Blick auf ihre dunklen Umrisse, die sich in der Ferne zwischen den verkohlten Bäumen hinter ihr bewegten. Es waren mindestens vier, vielleicht sogar mehr. Die Gruppe teilte sich auf und begann, mit militärischer Präzision auszuschwärmen.
Ihr lag eine geflüsterte Warnung auf den Lippen, als sie sich wieder zu dem freundlichen, weißen Reh umdrehte, um es dazu aufzufordern, sich zusammen mit ihr in Sicherheit zu bringen.
Doch es war fort.
Spurlos verschwunden.
Sie wünschte nur, sie könnte ebenfalls untertauchen. Mit einem erneuten Blick nach hinten versuchte sie, die Gefahr abzuschätzen, die da auf sie zukam. Der größte Soldat, der den Trupp anführte, brachte die anderen mit einem ruckartigen Heben seiner Hand, die in einem schwarzen Handschuh steckte, zum Stehen, als er in ihre Richtung schaute.
Oh, nein.
Er hatte sie erspäht.
Obwohl sie unter der schwarzen Kopfbedeckung sein Gesicht, das er der besseren Tarnung wegen auch noch mit Dreck eingeschmiert hatte, nicht erkennen konnte, spürte sie die Wucht seines Blickes, als er sie in der Ferne erblickte. Die Heftigkeit, mit der sein Blick sie traf, ließ sie zurückweichen. Sie meinte zu spüren, wie ein Blitz durch ihren Körper schoss, sodass sich die feinen Härchen auf ihren Armen und im Nacken aufstellten.
Er war kein Mensch … und auch kein Atlantid.
Es war ein Stammesvampir. Der größte Feind ihres Volkes von alters her. Die Blut trinkenden, gefährlichen Nachkommen der wilden Außerirdischen, denen es vor vielen Tausenden von Jahren beinahe gelungen wäre, ganz Atlantis auszulöschen.
Der unbeirrbare Blick ließ sie nicht mehr los, und der riesige Kämpfer löste sich von seinem Trupp, um durch das Farndickicht auf sie zuzukommen.
Phaedra fing an zu laufen.
Ohne das Amulett, das sie auf direktem Wege nach Hause gebracht hätte, blieb ihr keine andere Wahl, als zu flüchten und zu beten, dass sie schneller wäre als der schwer bewaffnete Soldat, der sich an ihre Fersen geheftet hatte.
Knirschend flogen seine Stiefel hinter ihr über den verkohlten Grund und die toten Nadeln. Spröde Äste knackten laut wie Schüsse, als er durchs Unterholz brach.
Er würde sie einholen. Daran bestand für sie kein Zweifel. Was er mit ihr vorhatte, sobald ihm das gelungen war, wollte sie gar nicht in Erwägung ziehen.
Sie rannte noch schneller und nahm all die übernatürliche Kraft zusammen, die sie aufbringen konnte.
Und trotzdem kam er immer näher. Die Jagd trieb sie noch tiefer ins Ödland hinein. Sie hatten die Gefährten des Kriegers längst weit hinter sich gelassen.
»Halt«, rief er ihr zu, und in seiner Stimme lag eine Dringlichkeit, die sie gepresst klingen ließ.
Phaedra rannte weiter. Sie wusste nicht, in welche Richtung sie lief oder wie lange sie noch durchhalten würde, ehe der gefährliche Stammesvampir sie einholte. Ihr war nur eins klar – sie musste diesen Ort so weit wie möglich hinter sich bringen.
Sie hörte ihn näher kommen, spürte die geballte Kraft und Ausdauer des Mannes, der den Abstand zwischen ihnen immer kleiner werden ließ.
Der Himmel möge ihr beistehen. Sie konnte alle Hoffnung begraben, dem Krieger zu entkommen. Aber sie war nicht gänzlich hilflos – alles andere als das.
Reines, atlantidisches Blut strömte durch ihren Körper. Sie spürte, wie sich die Hitze bei jedem panischen Schritt, den sie tat, immer mehr ausbreitete. Ihre Handflächen kribbelten und begannen bereits zu leuchten.
Hinter sich hörte sie den Krieger zischend krächzen: »Verdammt, Frau, ich sagte, halt an.«
Sie spürte den Moment, als er hinter ihr in die Luft sprang, aber es versetzte ihr trotzdem einen Schock, der ihr bis ins Mark fuhr, als sie ihn direkt vor sich auf dem Boden aufkommen sah.
Keuchend kam Phaedra mit einem Ruck zum Stehen. Sie war zwar groß, doch der Stammesvampir überragte sie um mindestens zehn Zentimeter. Die breiten Schultern und die muskulösen Glieder bewegten sich mit der Anmut einer räuberischen Wildkatze.
»Wer bist du?«, wollte er wissen.
Der Blick, mit dem er sie aus der Entfernung durchbohrt hatte, als er ihrer das erste Mal ansichtig geworden war, übte aus der Nähe keine geringere Faszination aus. Seine Augen waren viel zu schön für das Gesicht eines Mannes, der sich dem Krieg verschrieben hatte. Die strahlende Farbe, die an Lavendel erinnerte, begann zu lodern, als sie ihn anstarrte. Bernsteinfarbene Funken ließen seine Augen in einem außerirdischen Feuer aufflammen.
»Antworte.« Die ausdrucksvollen Lippen zogen sich zurück und gaben den Blick frei auf schimmernde weiße Zähne und lange Fänge. »Wer bist du? Was machst du hier draußen?«
Phaedra wich vor ihm zurück. »Ich könnte dich das Gleiche fragen.«
Seine Lippen wurden schmal. »Hier ist es nicht sicher für dich.«
Sie ging eigentlich davon aus, dass diese schreckliche Ödnis für keinen sicher war – vielleicht noch nicht einmal für diesen gefährlichen Mann oder seine Kameraden. »Was für ein Ort ist das hier überhaupt?«
»Das weißt du nicht?« Ein verwirrter Ausdruck huschte über sein Gesicht und milderte die strenge, misstrauische Miene. Doch der Moment währte nur kurz. Sein Blick richtete sich auf ihre Hände, und an seiner Wange begann ein Muskel zu zucken. Sie konnte spüren, wie sich das Glühen in ihren Handflächen angesichts seines forschenden Blicks verstärkte. Er legte den Kopf auf die Seite. Seine Augen glühten jetzt. Ein bernsteinfarbenes Feuer und Argwohn loderten darin. »Allmächtiger. Du bist eine von denen.«
Er machte einen Schritt auf sie zu.
»Bleib zurück.« Phaedra hob die Hände wie einen Schild.
Eigentlich kein Schild, sondern eher eine schreckliche Waffe. Dem atlantidischen Licht, das sie in sich trug, wohnte eine Furcht einflößende Kraft inne. Es war ihr zuwider, diese Kraft einzusetzen, vor allem da der Stammesvampir sie nicht bedroht hatte.
Noch nicht.
Er streckte seine Hand aus, die in einem schwarzen Handschuh steckte. »Du kommst jetzt mit mir mit.«
»Komm nicht näher, sonst …«
Er war weit davon entfernt, eingeschüchtert zu wirken, und stieß einen unterdrückten Fluch aus, in dem Fassungslosigkeit mitschwang. Seine Zähne und Fänge blitzten weiß in der mondlosen Nacht. »Sonst willst du was machen?«
Himmel, sie wusste nicht, was sie tun sollte. Aber sie bekam auch nicht mehr die Gelegenheit, ihm zu antworten.
Plötzlich explodierte der kohlrabenschwarze Himmel. Um sie herum war auf einmal alles in blendend weißes Licht getaucht.
Ein außerirdisches Licht.
Es ging nicht von ihr aus, aber auch nicht von der Welt der Sterblichen. Phaedra schloss die Augen, doch das schirmte kaum die blendende Helligkeit hinter ihren Lidern ab. Die Wucht des Blitzes war so groß, dass es ihr die Beine wegriss.
Sie merkte, wie sie durch die Luft geschleudert wurde, als hätte eine unsichtbare Hand sie gepackt. Sie rechnete damit, dass sie im nächsten Moment auf den harten Waldboden krachen würde. Doch sie blieb in Bewegung, wurde immer schneller nach hinten gezogen, als wäre sie in einen Strudel geraten.
Die Schreie von Männern drangen von irgendwo aus dem leblosen Wald zu ihr, entfernten sich aber immer mehr.
Es waren schmerzerfüllte Schreie. Der Klang unbeschreiblichen Leids.
War der Krieger mit den lavendelfarbenen Augen einer dieser Gequälten und Sterbenden?
Aus Gründen, die sie nicht verstand, durchfuhr sie bei diesem Gedanken ein solcher Schmerz, als würde sie von einem Dolch durchbohrt werden.
»Nein!« Phaedra spürte den Schrei in sich aufsteigen, aber er blieb ihr im Halse stecken. Während sie weiter von einer unsichtbaren Macht nach hinten gezogen wurde, war sie nicht in der Lage, auch nur einen Ton von sich zu geben. Sie taumelte durch einen nicht enden wollenden Abgrund, und der Vernichtungsschlag toste weiter in ihren Ohren.
Diese Qual ließ sie bis tief in die Seele beben.
»Nein … nein. Nein!«
»Phaedra?« Sanfter Druck legte sich auf ihre Schultern, und jemand schüttelte sie sanft. »Phay, wach auf.«
Sie riss die Augen auf und sah plötzlich in die himmelblauen Augen ihrer Freundin Tamisia. Die platinblonde Atlantidin verzog besorgt das Gesicht und schaute sie beunruhigt an. »Geht’s dir gut?«
»Was? Oh, ja. Ich … mir geht’s gut.« Phaedra setzte sich im Sessel auf. Ihr Gefühlsausbruch war ihr peinlich. »Es tut mir leid. Ich muss wohl eingeschlafen sein.«
Sie und Sia hatten gerade Tee und ein leichtes Mittagessen auf der Dachterrasse von Phaedras kleinem Haus in Rom zu sich genommen, als ihre Freundin sich zurückgezogen hatte, um einen Anruf ihres Gefährten Trygg anzunehmen. Sie war bestimmt nicht mehr als ein paar Minuten weg gewesen, doch es hatte offensichtlich gereicht, um Phaedra in einen tiefen Schlaf sinken zu lassen.
Einen schrecklichen, verstörenden Schlaf.
Sia setzte sich in den Sessel neben Phaedra. »Das muss ja ein schlimmer Albtraum gewesen sein. Du bist so weiß wie ein Bettlaken.«
Phaedra schluckte. »Ich habe wieder von diesem abgebrannten Wald geträumt und von dem weißen Reh.«
Seit mehr als einer Woche waren dies wiederkehrende Bilder, sobald sie sich zum Schlafen niederlegte. Der Traum hatte immer einen weitgehend unveränderten Verlauf gehabt … bis jetzt.
»Er hat genau wie auch sonst immer angefangen«, erklärte sie mit leiser Stimme. Die Nachwirkungen des unruhigen Schlafs umfingen sie immer noch wie die Fäden eines Spinnennetzes. »Ich bin dem Reh in den verkohlten Wald gefolgt, aber da war noch jemand. Dieses Mal hat der Traum einen schrecklichen Verlauf genommen, Sia. Und es fühlte sich alles so real an.«
»Willst du mir davon erzählen?«
»Nein.« Phaedra schüttelte den Kopf. Der Eindruck der unsäglichen Qualen, die sie vernommen hatte und trotz ihrer geschlossenen Augen meinte gesehen zu haben, als die Einöde von einem vernichtend grellen Licht erfasst wurde, war noch zu frisch. Sie wollte nicht mehr daran denken und das albtraumhafte Erlebnis erst recht nicht in Worte fassen. »Es war einfach nur ein dummer Traum, sonst nichts. Ich will nicht, dass du denkst, deine Freundin wäre verrückt geworden.«
Tamisia sah sie mitfühlend an, und die darin liegende Sorge ließ ihre Züge ganz sanft werden. »Willst du wissen, was ich wirklich denke? Du arbeitest zu viel, Phay. Sich um die Frauen und Kinder zu kümmern, die bei dir Unterschlupf finden, ist eine Vierundzwanzig-Stunden-Aufgabe. Das ist zu viel für eine Person – selbst für dich.«
»Das ist doch keine Arbeit«, widersprach Phaedra. »Mich um die Frauen und Kinder zu kümmern, die Sicherheit und Schutz bei mir suchen, fühlt sich nicht wie eine Aufgabe an, der ich nachkommen muss.«
»Das weiß ich doch.« Sia war das wohl mehr als den meisten anderen klar.
Vor einiger Zeit hatte Sia Phaedra für ein paar Wochen bei der Arbeit geholfen, nachdem sie aus der Kolonie der Atlantiden ausgestoßen worden war, wo sie einst ein hochrangiges Mitglied des Ältestenrates gewesen war. Eine unpassende Verbindung mit einem Bewohner der Kolonie war sie vor langer Zeit teuer zu stehen gekommen, aber sie hatte das wieder in Ordnung bringen können. Jetzt lebte sie mit Trygg, dem Stammesvampirkrieger, in den sie sich verliebt und der sie zur Gefährtin genommen hatte, in der Kommandozentrale des Ordens in Rom.
Für Phaedra, eine Unsterbliche, die wie ihre Freundin schon unzählige Jahrhunderte alt war, war diese Unterkunft hier zu einem Lebensinhalt geworden.
Sie war alles, was ihr in dieser Welt geblieben war.
»Alles in Ordnung, Tamisia. Bitte mach dir keine Sorgen um mich.«
»Ich bin deine Freundin. Mir Sorgen um dich zu machen, gehört einfach dazu.« Sie legte ihre Hand sanft auf Phaedras Arm. »Du brauchst Urlaub. Nein, was du im Grunde wirklich brauchst, ist eine Vollzeitkraft, die dich hier in der Unterkunft unterstützt. Es würde mich überaus glücklich machen, dir dabei zu helfen, jemanden zu finden, der vertrauenswürdig und tüchtig ist. Noch besser, ich werde mich selbst um die Unterkunft kümmern, während du weg bist.«
»Nein, das ist wirklich nicht nötig.«
»Das ist das Mindeste, was ich für dich tun kann, und davon abgesehen habe ich mit den meisten Bewohnern bereits gearbeitet. Sie kennen mich. Und wenn irgendetwas vorfallen sollte, werden Trygg und ich bestimmt damit fertigwerden.«
»Ich weiß das Angebot sehr zu schätzen, Sia, aber …«
»Wunderbar. Dann haben wir das geklärt.« Sia bedachte sie mit einem Blick, der keinen Widerspruch duldete.
Phaedra hatte mit ihren Eltern zwar einst dem atlantidischen Königshof angehört, doch das war lange her. Tamisia dagegen hatte bis vor ein paar Monaten – bis zu ihrem Ausschluss – den Rang einer Ältesten innegehabt, und diese Selbstsicherheit zeigte sich auch jetzt noch in ihrem unerschütterlich festen Blick.
»Als Erstes essen und trinken wir mal in Ruhe zu Ende, und du erzählst mir, was dieses Mal in deinem Traum passiert ist«, erklärte Sia. »Dann planen wir deinen wohlverdienten und so dringend benötigten Urlaub. Irgendwo, wo du entspannen kannst und keinen Stress hast.«
Phaedra hütete sich davor, mit Tamisia zu diskutieren, wenn diese sich etwas in den Kopf gesetzt hatte. Und sie musste sich eingestehen – und sei es auch nur vor sich selbst –, dass die Vorstellung, Rom mit seiner Geschäftigkeit und dem Gewusel auf den Straßen wenigstens für eine Weile zu entkommen, etwas Reizvolles besaß. Sie wusste zwar nicht, wohin sie gerne wollte, aber das spielte keine Rolle.
Denn wohin auch immer sie reisen mochte – nichts würde sie von den durch Mark und Bein gehenden Schreien der Männer erlösen, die auf so entsetzliche Weise im schrecklichen Licht ihres Traumes umgekommen waren.
2
Eine Woche später …
Der Dolmetscher wirkte nervös.
Tegan konnte nicht erkennen, aus welchem Grunde sich der junge Kasache gleich in die Hose machen würde – ob aufgrund der Informationen, die er gerade von dem argwöhnischen alten Mann erhielt, oder wegen des großen, finster blickenden Vampirs, der ungeduldig darauf wartete, diese beunruhigenden Neuigkeiten zu erfahren.
Tegans Augenbrauen zogen sich noch enger zusammen, und seine Fänge ließen seinen Gaumen kribbeln. Er war nicht in der Stimmung für Straßensperren oder sonstige Verzögerungen. Fast sieben Tage war er jetzt von seinem Zuhause in den Staaten und seiner geliebten Gefährtin weg. Seine Suche nach den vermissten Ordenskriegern hatte in Budapest begonnen, wo man das letzte Mal von ihnen gehört hatte. Dann hatte er unzählige Meilen unwegsamen Geländes hinter sich gebracht und war bis in die sibirische Taiga vorgedrungen, wohin der Geheimauftrag das Team geführt hatte und wo der Kontakt dann so plötzlich abgebrochen war.
Eine Mischung aus Bauchgefühl, Logik und verzweifeltem Rätselraten hatte ihn letzte Nacht tief ins benachbarte Kasachstan geführt. Die hellen Stunden des Tages hatte er in Petropawl, einer kleinen Stadt gleich auf der anderen Seite der Grenze, verbracht. Die Stadt verfügte über einen Bahnhof und eine Universität, und von daher gab es dort viele Menschen, die ihn mit dem versorgten, was er so dringend brauchte.
Als Gen-Eins-Vampir war Tegan darauf angewiesen, alle paar Tage Nahrung zu sich zu nehmen. Nach seiner mehrtägigen Wanderung durch die russische Wildnis war er halb verhungert, als er schließlich seine Fänge in die Kehle eines jungen Strolchs bohrte, der die blöde Idee gehabt hatte, ihn nach Sonnenuntergang am Bahnhof bestehlen zu wollen.
Erst nachdem Tegan sich mit frischem Blut aus der Halsschlagader des Burschen gestärkt hatte, bemerkte er die ungewöhnliche Waffe, die dessen Hand entglitten war. Der lange Dolch war viel zu gut gearbeitet, als dass er einem gewöhnlichen Straßenbanditen gehören könnte – vor allem so einem, der sich wahrscheinlich noch nie weit von der abgelegenen Stadt oder den kargen Steppen seiner Heimat entfernt hatte.
Nein, diese Klinge war keine gewöhnliche Waffe. Ein Künstler war da am Werk gewesen und hatte sich nicht mit langweiligem Stahl begnügt, sondern den Dolch aus Titanium geschmiedet.
Es war eine Waffe, wie Stammeskrieger sie besaßen.
Als Tegan das verzierte Heft sah, das extra für die Hand des Ordensmitglieds angepasst worden war, das den Dolch später benutzen sollte, überkam ihn auf einen Schlag die Erkenntnis – und damit einher ging eine kalte Furcht, die er nicht wahrhaben wollte.
Nicht ein einziger Krieger des Ordens würde je freiwillig seinen Dolch herausgeben. Und das galt in ganz besonderem Maße für den außergewöhnlichen Mann, der diesen hier verloren hatte.
Tegan hatte noch nicht einmal die Klinge aufheben müssen, um zu wissen, dass sie fast perfekt in seine große Hand passen würde.
Denn schließlich war diese Waffe für seinen Sohn angefertigt worden. Für Micah.
Wütend sah er jetzt den Strolch an, den er noch in Petropawl dazu gezwungen hatte, ihm als Dolmetscher zu Diensten zu sein. »Was sagt der alte Mann? Du hast gesagt, du hättest ihm den Dolch vor drei Tagen abgekauft. Wo zum Teufel hatte er ihn her?«
Die beiden Menschen zuckten unter seinem scharfen Tonfall zusammen. Das Schimmern seiner hervorgetretenen Fänge im trüben Licht der runden, zeltähnlichen Jurte war wohl für beide Männer nicht sonderlich beruhigend.
Sehr gut. Sein Geduldsfaden war schon zum Zerreißen gespannt gewesen, ehe er in diese trostlose Gegend aus flacher Grassteppe im Norden Kasachstans gekommen war. Jede weitere Sekunde, die man ihm die Wahrheit über Micahs Klinge vorenthielt, brachte seine Wut dem Punkt näher, wo sie überkochen würde.
Der grauhaarige Mann, der auf einem Teppich in der Mitte des von Kerzen erhellten Zeltes saß, war der Patriarch eines Clans von Herdennomaden, die zeitweilig in der Steppe ihr Lager aufschlugen. Sie hatten sich hier niedergelassen, um ihre Schafe und Rinder das bereits verdorrende Gras abfressen zu lassen, ehe der Herbst in einen harten Winter überging.
Das provisorische Dorf bestand aus weniger als einem Dutzend ähnlich aussehender Jurten. Vor der Jurte, in der Tegan sich jetzt gerade gegen schlechte Neuigkeiten wappnete, scharrte und schnaubte das Vieh nervös, denn es war sich instinktiv des Jägers in ihrer Mitte bewusst. Ein Jäger, der mit jeder Sekunde immer gefährlicher wurde.
Die beiden Menschen, die Tegan anstarrten, zeigten eine ähnlich große Furcht wie die Tiere.
»Der Dolch«, knurrte er. »Wo hat der alte Mann ihn her?«
Der Dolmetscher schluckte. »Er sagt, er stammt von einem Mann, der letzte Woche hier durchgezogen ist. Er war schwer verwundet und war zu Fuß allein unterwegs. Der alte Mann sagt, der Fremde wäre ein … einer von deiner Art gewesen.«
Tegan fluchte mit zusammengebissenen Zähnen. Er wollte nicht denken, dass der verwundete Stammesvampir sein Sohn gewesen sein könnte, aber die Alternative war auch nur ein schwacher Trost. Was mochte Micah widerfahren sein, das ihn von seinen Teamkollegen getrennt hatte? Er war ihr Anführer, ein hingebungsvoller Soldat, der seine Kameraden niemals und unter gar keinen Umständen im Stich ließe.
Genauso sicher war Tegan, dass sein Sohn niemals seinen Dolch jemandem aushändigen würde, es sei denn, er wäre zu schwach, um ihn zu halten … oder schlimmer.
Das war etwas, woran er gar nicht denken wollte.
»Sag dem alten Mann, dass ich noch mehr Informationen brauche. Hat der Durchreisende etwas gesagt, irgendetwas? Was für Verletzungen hatte er? Von wo kam er? Wie lange hat er sich hier im Lager aufgehalten?«
Der junge Kasache sah ihn mit seinen dunklen Augen ernst an, als er langsam den Kopf schüttelte. »Er hat alles gesagt, was er über den Fremden weiß. Sein Weg endete hier in der Nacht, als er ankam. Nicht viel später schloss er die Augen und hat sie nicht mehr geöffnet. Es tut mir … leid.«
Ein stechender Schmerz schoss durch Tegans Körper direkt in sein Herz. Er war aufgebrochen, um seinen vermissten Sohn und das Ordensteam zu finden, das Micah angeführt hatte. Er hatte sich geschworen, erst Ruhe zu geben, wenn er ihn gefunden hatte.
Schlimmer noch … er hatte Elise versprochen, dass ihrem Sohn nichts passieren würde. Es war ein Schwur gewesen, den er nicht nur ihr gegenüber geleistet hatte, sondern auch vor sich selbst, als er in ihre wunderschönen, angsterfüllten, lavendelfarbenen Augen geschaut hatte.
Jetzt lagen diese Worte wie Asche auf seiner Zunge.
Er war nicht bereit wahrzuhaben, was er da hörte. Allmächtiger, er würde nie bereit dazu sein.
»Was hat der alte Mann … hinterher getan? Was haben sie mit seiner Leiche gemacht?« Die Worte klangen, als würden sie gar nicht aus seinem Mund kommen – spröde Worte, die er kaum über die Lippen bekam.
Der Dolmetscher drehte sich wieder zu dem alten Nomaden um und redete in dessen Sprache mit ihm. Der Austausch dauerte länger, als man eigentlich hätte erwarten sollen – ein schnelles Hin und Her, bei dem der jüngere Mann immer verwirrter schien.
Tegan ließ die beiden nicht aus den Augen, gereizt, dass er bei der Unterhaltung außen vor war. »Was ist los? Was sagt er?«
Der Kasache sah Tegan mit gerunzelter Stirn an. »Es gibt keine Leiche. Der Fremde … er ist nicht gestorben.«
»Du hast doch gerade gesagt …«, knurrte Tegan, wurde aber unterbrochen.
»Jaja, ich weiß, was ich gesagt habe. Aber der Dialekt in dieser Gegend ist ein bisschen schwierig.« Er schüttelte den Kopf. »Der Fremde kam schwer verletzt hier an. Er war sehr schwach. Er brach zusammen und hat seitdem nicht wieder das Bewusstsein erlangt.«
»Du willst damit sagen, dass er noch lebt?«
Der Dolmetscher nickte. »Sie haben ihn hier in einer der Jurten im Lager untergebracht. Der alte Mann sagt, man hätte sich so gut wie möglich um ihn gekümmert, aber es ginge ihm stündlich schlechter. Sie sind nicht dazu in der Lage, ihm die Pflege angedeihen zu lassen, die er braucht.«
Hoffnung wallte in Tegan auf, doch er hielt sie im Zaum. Erst wenn er seinen Sohn mit eigenen Augen gesehen hatte, erst wenn er sich davon überzeugt hatte, dass es sich bei dem verwundeten Soldaten wirklich um Micah handelte, durfte seine Anspannung nachlassen. »Führ mich zu ihm. Sofort.«
Der Dolmetscher übersetzte den Befehl für den Nomaden. Mit einem ernsten Nicken kam der Hirte vom Teppich hoch. Gebeugt und langsam bedeutete er den Männern, die Jurte zu verlassen und ihm zu folgen.
Tegans Herz schlug ihm bis zum Hals, als er ungeduldig auf dem ausgetretenen Weg durchs Lager hinter den beiden Menschen herging. Ein paar Neugierige steckten ihre Köpfe aus den Zelten und sahen Tegan flüsternd und raunend hinterher.
Die menschlichen Mitbewohner dieses Planeten wussten seit mehr als zwanzig Jahren von der Existenz der Stammesvampire, hatten diese aber zumeist nicht gerade willkommen geheißen. Dass dieser abgelegene Clan einen Abkömmling seiner Art bei sich aufgenommen hatte, als dieser Hilfe brauchte, war für Tegan ein Wunder, mit dem er nie gerechnet hätte. Es war mehr als nur Überraschung, was er diesbezüglich empfand … es erfüllte ihn fast schon mit Demut.
Doch keins dieser Gefühle bereitete ihn auf das vor, was ihn im Innern der dunklen Jurte am anderen Ende des Lagerplatzes erwartete.
Als sie sich näherten, traf ihn der widerwärtige Gestank des nahenden Todes wie ein Vorschlaghammer mitten auf der Brust. Doch was er dann nach dem Betreten der Jurte sah, war ein noch schlimmerer Schlag. Die flachen und unregelmäßig keuchenden Atemzüge, die ihn empfingen, schnürten ihm den Atem ab. Der Anblick der großen, ausgezehrten Gestalt eines Stammesvampirs, der auf einem schmalen Feldbett in der Mitte des Zeltes lag, ließ kalte Furcht durch seinen Körper strömen.
Der alte Mann schaltete eine batteriebetriebene Lampe an, die auf einem kleinen Tischchen nahe dem Eingang stand. Der schwache Schein erhellte das Zelt, doch Tegans hoch entwickelter, außerirdischer Sehsinn brauchte kein Licht, um zu erkennen, dass er seinen Sohn vor sich hatte.
»Oh, verdammt.« Die Worte kamen mit einem erstickten Keuchen aus seinem Mund.
Er trat neben das schmale Bett und sah auf Micah hinunter. Furcht und der unbeschreibliche Schmerz eines Vaters zogen seine Brust zusammen.
»Sohn.« Das Wort hatte einen ganz rauen Klang. »Micah, kannst du mich hören?«
Keine Antwort. Die dunklen Wimpern, die auf aschfahlen Wangen ruhten, zuckten noch nicht einmal. Tegan griff nach Micahs großer Hand und umschloss die kühlen, schweren Finger mit seiner Wärme. Er fing an, sie zu reiben, um dadurch die Kälte zu vertreiben, während er um irgendein Zeichen flehte, dass sein Sohn davonkommen möge.
Ein Laken und ein dickes Fell bedeckten Micahs Körper, unter dem der starke, prächtige junge Krieger schlief, ohne sich zu rühren.
»Wie viele Tage befindet er sich schon in diesem Zustand?« Tegan stellte die Frage, ohne den Blick von dem einzigen Kind, das er hatte, abzuwenden. Jetzt, da er ihn vor Augen hatte, konnte er es nicht ertragen wegzuschauen, so bedrückend es auch sein mochte, eine solche Naturgewalt wie seinen Sohn von offensichtlich verheerenden Verletzungen niedergestreckt zu sehen.
Der alte Mann unterhielt sich mit dem jüngeren kurz in ihrer Sprache. »Das ist jetzt der vierte Tag«, erklärte der Dolmetscher dann. »Heute Abend geht es in die fünfte Nacht.«
Vier volle Tage. Kein Wunder, dass kaum noch etwas übrig war von Micah. Wahrscheinlich hatte er es nur seinen Erbanlagen der zweiten Generation von Stammesvampiren zu verdanken, dass er seinen schweren Verletzungen nicht längst erlegen war. Genau diese Erbanlagen würden es aber auch sein, die ihn endgültig erledigten, wenn er nicht endlich die richtige Pflege erhielt.
Oder das Blut, das sein Körper zum Heilen brauchte.
Tegan zog den Dolch seines Sohnes aus der Scheide. Dann drehte er den Kopf und sah den jüngeren der beiden Männer an. »Komm her.«
»Wa… was haben Sie damit vor?« Panik schwang in der gestammelten Frage mit. »Ich habe doch alles getan, worum Sie mich gebeten haben. Ich habe Sie hergebracht. Durch mich haben Sie die Antworten erhalten, die Sie wollten. Bitte … bitte, bringen Sie mich nicht um.«
»Ich sagte, komm her.«
Der Kasache trat zögernd näher und wirkte jetzt gar nicht mehr wie der großspurige Schläger aus der Stadt, sondern eher wie der verängstigte Feigling, der er in Wirklichkeit war. Sobald er sich Tegan auf Armeslänge genähert hatte, packte dieser ihn am Unterarm und zog ihn neben das Bett, auf dem Micah lag.
Er sah ihn mit aufblitzenden Fängen an. »Entspann dich. Ich werde dich nicht töten.«
Er schlitzte mit der Titaniumklinge das Handgelenk des Menschen auf. Blut trat aus der Wunde hervor – dunkelrotes Blut voller lebenserhaltender roter Blutkörperchen. Der junge Mann schrie auf, doch Tegan wusste, dass nur die Angst aus ihm sprach. Er hielt die offene Wunde über Micahs schlaffen Mund und wollte ihn dazu bringen, etwas von der Nahrung zu sich zu nehmen, die über seine Lippen und das kantige Kinn lief.
»Halt still«, befahl er dem sich windenden Menschen. Er würde seine Erinnerung an die gesamte Begegnung löschen, sobald Micah das zu sich genommen hatte, was er brauchte.
Wenn er es denn zu sich nähme.
»Na los, komm schon, mein Sohn. Trink«, murmelte Tegan. Er schob den Dolch zurück in die Scheide und öffnete mit seiner nun freien Hand Micahs Mund.
Es funktionierte nicht.
Das frische Blut sammelte sich auf Micahs Zunge, und nur ein paar wenige Tropfen rannen durch seinen Hals.
Wenn er nicht schlucken konnte, konnte er nicht trinken.
Und wenn er nicht trank, würde er sterben.
Aber egal was passierte – Tegan musste ihn hier rausholen.
Knurrend zog er das Handgelenk des Mannes an seinen Mund und verschloss die Wunde, indem er mit der Zunge kurz darüberfuhr. Die Blutung hörte sofort auf, und die Haut schloss sich fast auf der Stelle.
Der junge Kasache wich taumelnd vor ihm zurück und stotterte etwas in seiner Sprache, während er die sich schließende Wunde anstarrte.
Tegan stand auf und ging zu dem alten Mann, der Micah Unterschlupf gewährt und sich die letzten entscheidenden Tage und Nächte um ihn gekümmert hatte. Es lag eine gewisse Vorsicht in den dunklen Augen, als er Tegans Blick erwiderte, aber da war auch Verständnis, ja fast schon Mitgefühl auf dem faltigen Gesicht des alten Patriarchen zu erkennen. Es sprach von einem Verständnis, das keiner Übersetzung bedurfte.
Tegan streckte die Hand aus. »Danke, dass Sie sich um meinen Sohn gekümmert haben.«
Der alte Mann nahm die Hand, die Tegan ihm reichte, und sein Händedruck war überraschend fest, als er die Geste mit einem Nicken erwiderte.
Während der junge Kasache weiter sein Handgelenk untersuchte und am anderen Ende des Zeltes fast hyperventilierte, trat Tegan wieder an Micahs Bettstatt und holte das Satellitentelefon hervor, das er bei sich trug, seitdem er die Staaten verlassen hatte. Er würde Elise anrufen müssen, um sie wissen zu lassen, dass er ihren Sohn aufgespürt hatte.
Aber als Erstes musste er dafür sorgen, dass Micah nach Hause gebracht wurde.
Er gab den Code ein, der ihn mit einer sicheren Leitung im Hauptquartier des Ordens in Washington, D. C., verband.
»Ich hab ihn«, sagte er zu Lucan Thorne, dem Gründer des Ordens und Tegans ältestem Freund. »Ich hab Micah gefunden.«
Der tiefe Atemzug am anderen Ende der Leitung war voller Erleichterung. »Und die anderen vom Team?«
»Nur Micah. Er ist in schlechter Verfassung. Für die anderen sieht es nicht gut aus, Lucan.« Sein Blick ging zu Micah auf dem Feldbett, zu seinen schlaffen Lippen, an denen das Blut klebte, das er so dringend brauchte, aber von dem er kaum etwas zu sich genommen hatte. »Oh, verdammt, Lucan. Für meinen Sohn sieht es auch nicht gut aus.«
»Wir sind dran«, erwiderte Lucan. Seine tiefe Stimme klang ernst, war aber fest vor Entschlossenheit. »Wir haben bereits deine Koordinaten ausgemacht. Gideon organisiert gerade ein auf medizinische Evakuierungen spezialisiertes Team, um euch so schnell wie möglich zu holen.«
»Danke.«
»Dafür brauchst du mir nicht zu danken. Das solltest du mittlerweile wissen, Bruder.«
Ja, das tat er. Tegan brachte kein Wort mehr hervor. Er war nicht in der Lage auszusprechen, wie sehr er die beruhigenden Worte seines Freundes brauchte. Im Hintergrund hörte er Gideons Stimme mit seinem britischen Akzent und das Klicken seiner Finger, die etwas über die Computertastatur eingaben.
»Gideon sagt, Lazaro Archer hätte bereits auf den Notruf reagiert«, informierte Lucan ihn. »Er schickt, während wir hier reden, eine von seinen Einheiten aus Rom los.«
»Okay.« Tegan richtete seinen bekümmerten Blick erneut auf seinen Sohn. Er konnte den stockenden Atemzug nicht zurückhalten, der plötzlich in ihm aufstieg. »Und, Lucan? Sag Lazaro, dass er sich beeilen soll.«
3
Asche klebte ganz hinten in seiner ausgedörrten Kehle.
Micah versuchte zu schlucken, doch sein Kiefer fühlte sich so an, als wäre er eingerostet. Seine Zunge war geschwollen und sein Mund so trocken wie eine Wüste in der Mittagszeit. Er stöhnte und war schockiert, als er spürte, dass der leise Laut seine Brust tief im Innern vibrieren ließ.
Lebte er etwa noch?
Verdammt.
Schmerzen in der Lunge, als er keuchend Luft holte, ließen ihn die Augen aufreißen. Doch schon eine Sekunde später schloss er sie wieder, weil seine Netzhaut wie die Hölle brannte. Sie war immer noch von der Explosion gleißenden Lichts versengt, das aus dem Nichts gekommen war und den gespenstischen Wald stärker erhellt hatte als die Mittagssonne.
Er hatte immer noch seine gefallenen Teamkameraden vor seinem inneren Auge, als er auf der Suche nach ihnen zurückgestürmt war – oder eher dem bisschen, das von ihnen übrig geblieben war.
Alle fünf Stammeskrieger, die mit ihm in der Eliteeinheit des Ordens gedient hatten, waren tot.
Da waren nur noch Asche und geschmolzene Waffen nahe dem Epizentrum der schauerlichen Explosion.
Seine Männer wären – und waren – ihm, ihrem Anführer, in jedes egal wie gefährliche Gefecht gefolgt. Doch dann hatte Micah aus einem Impuls heraus sein Team weiter tief in die öden Regionen Sibiriens geführt und damit in eine Falle, mit der er nicht gerechnet hatte.
Er hätte nicht von der vorgegebenen Route abweichen sollen.
Sie hatten ihre Befehle gehabt und den Einsatz mit fehlerfreier Präzision durchgeführt. Als ihr Auftrag erledigt war, hätte er mit seinem Team zur Basis zurückkehren sollen. Doch er hatte plötzlich ein Kribbeln im Nacken gespürt, als würde der raue Wald ihm etwas zuraunen … ihn tiefer hineinlocken. Während er diesem Gefühl gefolgt war, waren sie schließlich zu diesem gespenstischen Wald gelangt, der nur aus verbrannten Bäumen bestand und sich über unzählige Meilen zu erstrecken schien.
Er kannte diesen Ort, obwohl er noch nie hier gewesen war. Es war verrückt. Himmel, vielleicht war er verrückt.
Dieser Gedanke war ihm gekommen, als er das weiße Reh erblickt hatte, das zwischen den verkohlten Baumstämmen aufgetaucht war. Er hatte es schon früher gesehen, doch dieses Mal war es real. Genau wie die Frau, die das ätherische Tier begleitete. Auch sie hatte wie eine Vision plötzlich in dieser trostlosen Landschaft Gestalt angenommen. Groß und schlank, aber trotzdem verführerisch weiblich, hatte ihr Anblick ihn dazu gebracht, abrupt stehen zu bleiben.
Er, der erfahrene Krieger, der disziplinierte Anführer, der sich seinen Rang durch hartes Training und seinen unbeirrbaren Fokus auf Befehle und Pflicht erworben hatte, hatte seine Männer verlassen, um ihr hinterherzulaufen, wobei Neugier nur ein Teil dessen gewesen war, was ihn zu ihr hinzog. Als er sie eingeholt hatte, war er wie ein verwirrter Idiot – nur gesteuert von animalischen Instinkten – vor der braunhaarigen Schönheit stehen geblieben, welche wie aus einem Fantasiereich kommend plötzlich in seiner Welt aufgetaucht war.
Seine Erstarrung hatte sich in dem Moment gelöst, als er ihre glühenden Hände sah und erkannte, was sie war.
Eine Atlantidin.
Ein Abkömmling der Unsterblichen, deren Königin Selene sowohl den Stammesvampiren als auch der Menschheit den Krieg erklärt hatte.
Micah und sein Team waren freiwillig an die vorderste Front des sich zuspitzenden Krieges vorgerückt, doch er hatte überhaupt nicht mit einem derartigen Hinterhalt gerechnet, in den sie mitten in der sibirischen Ödnis geraten waren.
Er dachte, es wäre alles nur ein Traum gewesen.
Er war inzwischen fast selbst überzeugt gewesen, dass alles nur ein schrecklicher, unaussprechlicher Traum wäre. Ein Albtraum voller Entsetzen, körperlicher Qualen … und Schuld.
Ein Albtraum, dem eine tiefe Besinnungslosigkeit gefolgt war, die von ihm Besitz ergriffen hatte und die eine Ewigkeit angehalten zu haben schien.
Jetzt, da seine Sinne langsam wieder zurückkehrten, erkannte er, dass alles noch viel schlimmer war als ein Albtraum.
Es war wirklich passiert.
Sein Team war tot.
Ihr Einsatz hatte in einer Katastrophe geendet.
Und er? Er würde lieber den Boden zusammen mit seinen Ordensbrüdern mit Asche bedecken, als zu leben und die Schuld daran zu tragen, so unverzeihlich versagt zu haben.
Er stöhnte wieder und öffnete die Lider millimeterweit, während er bei jedem Atemzug von dem Gefühl erfüllt war, heiße Dolche würden sich in seine Augäpfel bohren.
Vielleicht war das hier ja auch die Hölle. Vielleicht war er ja am Ende des Abgrunds angekommen, der ihn nach unten gezogen hatte, und hier würde er nun bis in alle Ewigkeit schmoren, um die Scham über sein Versagen und die Qualen immer wieder aufs Neue zu durchleben.
Er konnte, wenn überhaupt, nur verschwommen sehen, obwohl es dunkel und kühl in dem Raum war, in dem er lag. Schwache Erinnerungen an ein muffiges Zelt und den Geruch von Vieh und Lagerfeuern schienen fehl am Platz, während er versuchte, sich einen Eindruck von seiner Umgebung zu verschaffen.