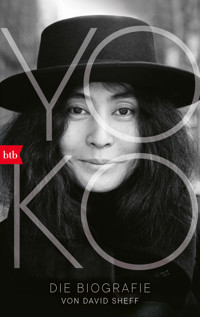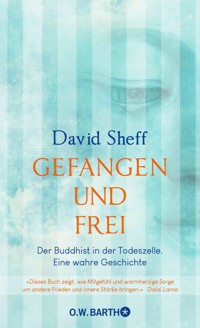
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: O.W. Barth eBook
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
"Dieses Buch zeigt lebhaft, dass selbst angesichts der größten Widrigkeiten, Mitgefühl und warmherzige Sorge um andere Frieden und innere Stärke bringen." Dalai Lama Der New-York-Times Bestsellerautor David Sheff beschreibt die wahre Geschichte eines zum Tode Verurteilten, der im Gefängnis zum Buddhisten wurde. Eine schreckliche Kindheit, die falschen Freunde und mehrere Straftaten – Jarvis Jay Masters Leben war geprägt von Hass und Gewalt. 1990 wird ihm ein Mord an einem Gefängniswärter angehängt, und er wird zum Tode verurteilt. Masters ist voller Wut, hat Panik-Attacken und weiß keinen Ausweg mehr. Bis er eines Tages den Rat bekommt, es mit Meditation zu versuchen. Zunächst zweifelt Masters an der Wirksamkeit des buddhistischen Weges und es graut ihm davor, die Augen im Gefängnis zu schließen. Doch eines Tages beginnt er dennoch zu meditieren und gewinnt eine völlig neue Sicht auf sein Leben. Bestsellerautor David Sheff beschreibt Masters tiefgreifende Transformation vom Straftäter zu einem praktizierenden Buddhisten, der Gewalt auf dem Gefängnishof verhindert und Gefangenen – und Wachen – hilft, einen Sinn in ihrem Leben zu finden. Die Lehre des Buddhismus von einer völlig neuen, tief bewegenden Seite. Die Reise eines Mannes, die tief berührt und klar macht: Du kannst frei sein, egal wo du bist. Dein Leben kann jeden Tag neu beginnen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 345
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
David Sheff
Gefangen und frei
Der Buddhist in der Todeszelle. Eine wahre Geschichte
Aus dem amerikanischen Englisch von Gerd Bausch
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
»Dieses Buch zeigt lebhaft, dass selbst angesichts der größten Widrigkeiten, Mitgefühl und warmherzige Sorge um andere Frieden und innere Stärke bringen.« Dalai Lama
Der New-York-Times Bestsellerautor David Sheff beschreibt die wahre Geschichte eines zum Tode Verurteilten, der im Gefängnis zum Buddhisten wurde.
Eine schreckliche Kindheit, die falschen Freunde und mehrere Straftaten – Jarvis Jay Masters Leben war geprägt von Hass und Gewalt. 1990 wird ihm ein Mord an einem Gefängniswärter angehängt, und er wird zum Tode verurteilt. Masters ist voller Wut, hat Panik-Attacken und weiß keinen Ausweg mehr. Bis er eines Tages den Rat bekommt, es mit Meditation zu versuchen. Zunächst zweifelt Masters an der Wirksamkeit des buddhistischen Weges und es graut ihm davor, die Augen im Gefängnis zu schließen. Doch eines Tages beginnt er dennoch zu meditieren und gewinnt eine völlig neue Sicht auf sein Leben.
Bestsellerautor David Sheff beschreibt Masters tiefgreifende Transformation vom Straftäter zu einem praktizierenden Buddhisten, der Gewalt auf dem Gefängnishof verhindert und Gefangenen – und Wachen – hilft, einen Sinn in ihrem Leben zu finden. Die Lehre des Buddhismus von einer völlig neuen, tief bewegenden Seite.
Die Reise eines Mannes, die tief berührt und klar macht: Du kannst frei sein, egal wo du bist. Dein Leben kann jeden Tag neu beginnen.
Inhaltsübersicht
Widmung
Einleitung
Teil 1 - Die Erste Edle Wahrheit: Leiden
Kapitel 1: Nutzlos geboren
Kapitel 2: Atmen, sitzen
Kapitel 3: Narben
Teil 2 - Die Zweite Edle Wahrheit: Die Ursache des Leidens
Kapitel 4: Verurteilt
Kapitel 5: Erwachen
Kapitel 6: Zuflucht
Kapitel 7: Der einzige Ausweg
Kapitel 8: Karma
Kapitel 9: Töte den Buddha
Teil 3 - Die Dritte Edle Wahrheit: Das Ende des Leidens
Kapitel 10: Verbindung
Kapitel 11: Vergeben
Kapitel 12: Ein anderer Weg
Kapitel 13: Krieger
Kapitel 14: Mitgefühl
Kapitel 15: Gras unter den Füßen
Kapitel 16: Präsenz
Kapitel 17: Der Klang des Lebens
Teil 4 - Die Vierte Edle Wahrheit: Der Weg aus dem Leiden
Kapitel 18: Hoffnung
Kapitel 19: Loslassen
Kapitel 20: Erleuchtung
Epilog: Mit einem offenen Herzen leben
Postscriptum
Danksagung
Für Pamela Krasney, die uns mit ihrer Zivilcourage in ihrem Kampf für eine Strafrechtsreform und die Abschaffung der Todesstrafe eine große Inspiration war.
Pamela half, die Welt zu einem besseren Ort für ihre Familie, Freundinnen und Freunde sowie zahllose andere zu machen.
»Setz einen Adler in den Käfig und er wird in die Stäbe beißen, ob sie nun von Eisen oder von Gold sind.«
Henrik Ibsen
Einleitung
Ich sitze auf einem schlichten Schalenstuhl aus Plastik einem Mann namens Jarvis Jay Masters gegenüber. Wir unterhalten uns über meine Idee, ein Buch über ihn zu schreiben, und ich möchte wissen, was er von ihr hält. Ich betone, dass ich, wenn ich mich wirklich darauf einlasse, nichts verheimlichen werde – weder seine guten noch seine schlechten Seiten.
»Man kann mich nicht übler darstellen, als man es bereits getan hat«, erwidert Masters, und ich nehme an, dass das für jemanden, den man wegen Mordes verurteilt hat, sicher zutrifft.
»Ich meine«, fügt er hinzu, »das sieht man schon daran, wo wir sind.«
Nämlich in einem Käfig, nicht größer als eine Abstellkammer, in einem der Besuchssäle des staatlichen Gefängnisses San Quentin, nördlich von San Francisco.
In dem Saal befinden sich viele weitere solcher Käfige, und ich folge Masters’ Blick, der zu ihnen schweift. In ihnen befinden sich andere wegen Mordes Verurteilte mit ihren Familien oder Anwälten: Ramón Bojórquez Salcido, Verurteilter in mehreren Mordfällen – unter ihnen seine Frau und seine Töchter –, sitzt mit seinem Anwalt in der Abteilung gegenüber. Nicht weit davon verspeist Richard Allen Davis, der ein zwölfjähriges Mädchen vergewaltigt hat, Doritos. Ganz am Ende, neben einem Regal mit Bibeln und Brettspielen, sitzt Scott Peterson, der wegen der Ermordung seiner im achten Monat schwangeren Frau inhaftiert ist, und unterhält sich mit seiner Schwester.
Petersen sieht entspannt und gesund aus, andere hingegen scheinen nervös, aufgeregt oder misslaunig zu sein. Und dann wiederum gibt es solche – zierliche, bebrillte, harmlos wirkende –, die eher wie Kassenbeamte oder, in einem Fall, wie John Oliver1 aussehen. Der Eindruck trügt, kommentiert Masters, der über die Jahre immer wieder erstaunt war, zu welchen Verbrechen selbst die lammfrommsten und höflichsten seiner wie er zum Tode verurteilten Mithäftlinge fähig gewesen waren.
»Manche von denen haben perfekte Tischmanieren und legen sich ordentlich Servietten auf den Schoß, aber in Wirklichkeit sind sie für wahre Massaker verantwortlich.«
2006 hatte mir meine Freundin Pamela Krasney, eine Aktivistin, die sich für Gefängnisreformen und auch in anderer Hinsicht für soziale Gerechtigkeit engagiert, von einem Mann erzählt, der, wie sie sagte, zu Unrecht wegen Mordes verurteilt worden war. Er sei anders als alle, die sie zuvor kennengelernt hatte, bewusster, weiser sowie einfühlsamer – und dies »trotz seiner Vergangenheit«. Sie hielt inne und verbesserte sich: »Nein, wegen seiner Vergangenheit.«
Pamelas Freundin, die bekannte buddhistische Nonne Pema Chödrön, hatte sie vor Jahren Jarvis vorgestellt, und seither besuchte sie ihn regelmäßig. Sie gehörte einer Unterstützergruppe an, den Jarvistas2, die sich zum Ziel gesetzt hat, seine Unschuld zu beweisen. Pamela berichtete des Weiteren, dass Masters Autor eines Buches sowie zahlreicher Artikel sei. Auch schreibe er Gedichte, von denen eines sogar mit einem PEN Award ausgezeichnet worden war. Er sei zum Buddhismus konvertiert und Schüler eines berühmten tibetischen Lamas namens Chagdud Tulku Rinpoche geworden. Dieser hatte einmal von ihm gesagt, er sei ein Bodhisattva, also jemand, »der an einem Ort des Leidens für die Überwindung des Leidens arbeitet«. Und tatsächlich war Pamela der Überzeugung, dass Masters in San Quentin einen sehr heilsamen Einfluss hatte, da er hier inmitten drohender Gewalt Buddhismus unterrichtete.
Von Pamela ermutigt, organisierte ich alles Nötige, um den Todestrakt besuchen zu können, der Abteilung von San Quentin, in dem die zum Tode Verurteilten einsitzen. An einem klaren Morgen, an dem ein eisiger Wind durch die Golden-Gate-Meerenge blies, fuhr ich die frühere Bay of Skulls, die Bucht der Totenköpfe, entlang. Auf dem Wasser wiegten weiße Segelboote wie Lotosblätter, Schlepper zogen Containerschiffe, und Luftkissenboote glitten vorbei. In einiger Entfernung glänzte die San Rafael Bridge in der Morgensonne. Im Gefängnis angekommen, kontrollierte man zuerst meine persönlichen Daten, woraufhin ich einen Metalldetektor passierte. Wie angewiesen, folgte ich einer gelben Linie, die man entlang der felsigen Uferböschung auf den Asphalt der Zufahrtsstraße gesprüht hatte, wobei mich das Wachpersonal von einem Wachturm aus, der etwas wie ein Leuchtturm wirkte, beobachtete.
Masters war damals im Isolationstrakt inhaftiert, der den unheilvollen Namen »Korrekturanstalt« trug und den man allgemein »das Loch« nannte. Ein Verwaltungsleiter von San Quentin hatte die Insassen dieser Abteilung einmal als »fiese und kranke Menschen« bezeichnet, wobei es die Gesellschaft lieber hätte, »sie würden nicht existierten«. Masters befand sich bereits seit zwei Jahrzehnten in diesem Teil des Gefängnisses.
Einmal im Gebäude angekommen, führte mich ein Mann zu einem Stuhl, der einem ziemlich verkratzten Fenster zugewandt war. Nach einigen Minuten wurde auf der anderen Seite eine Tür geöffnet, und ein Wärter führte Masters hinein. Er war hochgewachsen und perfekt rasiert, sein Haar sehr ordentlich gekämmt, und um seinen Hals hing eine Lesebrille.
Nachdem man ihn von seinen Handschellen befreit hatte, nahm er Platz, und wir setzten uns beide recht ramponierte Headsets auf. Durch die Sprechanlage klang seine Stimme dumpf, in etwa so, als unterhielten wir uns über ein Dosentelefon.
Masters hatte klare braune Augen, eine wohlklingende, sonore Stimme und eine beruhigende Ausstrahlung. All dies war selbst durch das getönte Glas nicht zu übersehen. Wir redeten über Pamela, Pema Chödrön, Schreiben, die neuesten Nachrichten und die jüngste Kontaktsperre, die wegen einer Messerstecherei im Gefängnis verhängt worden war. Ich befragte ihn zu Mithäftlingen, dem Wachpersonal und zu seiner buddhistischen Praxis. Er drückte sich präzise aus, war bedacht und humorvoll. Nach eineinhalb Stunden gab uns der Gefängnisbeamte ein Zeichen, dass die Besuchszeit vorüber sei, und führte Masters ab. Ich verließ das Gefängnisgebäude und gelangte an die kalte, frische Meeresluft der Bucht.
Ich dachte über den Besuch nach. Masters wirkte offen und ehrlich. Ich hatte einen Vorgeschmack dessen bekommen, weswegen ihn seine Freundinnen und Freunde als »einen unbeschreiblichen und ganz besonderen Menschen« bezeichnet hatten, auch wenn die Tatsache allein, dass er Charisma besaß, nicht bedeutete, dass er unschuldig war. Die Literatur birgt viele Beschreibungen von charismatischen Killern, wie etwa Truman Capotes Perry Smith (Capote begeisterte sich sogar für seinen Komplizen, den noch weit gnadenloseren Richard Hickock), Elmo Patrick von Schwester Helen Prejean und Robert Lee Willie sowie Gary Gilmore von Norman Mailer (Mailer porträtierte Letzteren als gefühllosen und unbarmherzigen Mann, der jedoch über einen scharfen Verstand, Witz und Eleganz verfügte).
War Masters ein Mörder? Seine Freunde beschworen, dass er unschuldig sei. Hatte man ihn verleumdet, wie es seine Anwälte behaupteten? Oder war er ein geschickter Manipulator, ein Hochstapler, der das Vertrauen gutherziger Menschen wie Pamela und Pema ausnutzte?
Selbst wenn Masters wirklich unschuldig sein sollte, wusste ich nicht, was ich von den Aussagen seiner Unterstützerinnen und Unterstützer halten sollte, wonach er ein Bodhisattva sei, der die Leben anderer verändert und einige sogar vor dem Tod bewahrt habe. Buddhisten gibt es in vielen Gefängnissen, genau wie Angehörige aller anderen Glaubensrichtungen. Und es gibt zahlreiche andere Gefängnisschreiberlinge und Poeten, die sich von den übrigen Häftlingen abheben. Doch unterschied sich Masters wirklich von seinen Mitgefangenen? Ich scheute mich genauso davor, ein wohlwollendes wie auch ein negatives Urteil zu fällen. Doch ganz ohne Frage war ich neugierig geworden, mehr über ihn zu erfahren.
In den darauffolgenden Jahren hielt mich Pamela hinsichtlich der Ereignisse in seinem Leben auf dem Laufenden. 2007, nach zwanzig Jahren Isolationshaft, wurde er in einen Bereich des Todestrakts verlegt, in dem die Haftbedingungen weniger streng waren. Im Jahr darauf heiratete er, wobei Pema die Hochzeitszeremonie leitete. 2009 bat mich Pamela, ein paar Zeilen für das Cover seines zweiten Buches zu verfassen. Sie berichtete mir ebenfalls von dem laufenden Berufungsverfahren. Für sie war es nur eine Frage der Zeit, bis er freigesprochen würde.
Schließlich starb Pamela 2015 an einer seltenen Stoffwechselkrankheit. Pema führte die buddhistische Bestattungszeremonie durch, bei der sie einen Brief von Jarvis vorlas. Die Gedenkfeier fand unweit von San Francisco in Mill Valley statt, das sich in unmittelbarer Nachbarschaft von San Quentin befindet. Als Pema seinen Nachruf vorlas, musste ich daran denken, dass er nur wenige Meilen entfernt in seiner Todeszelle saß. Auch dachte ich an Pamelas tiefe Verbindung und selbstloses Engagement für Jarvis und erinnerte mich an ihre Behauptung, dass er unzählige Menschen innerhalb und außerhalb der Gefängnismauern von San Quentin inspiriert und ihnen geholfen habe. Unmittelbar nach der Totenfeier beschloss ich, diesen Behauptungen nachzugehen.
Ich sprach mit vielen Menschen in und einigen außerhalb von San Quentin. Pema erzählte mir, dass sie durch Masters’ Buch Finding Freedom auf ihn aufmerksam geworden sei, woraufhin sie ihm geschrieben und ihn erstmals besucht habe. Im Laufe der Zeit entwickelte sich zwischen den beiden eine enge Freundschaft. Sie bewunderte seine Fähigkeit, Schwierigkeiten durchzustehen, die andere überfordert hätten, sowie die Freude, die er an diesem freudlosen Ort verbreitete. Seine Interpretation buddhistischer Lehren inspirierte sie, und seine Einsichten halfen ihr, ihr Verständnis von Dingen zu vertiefen, die sie eigentlich bereits gut zu kennen glaubte.
Ich las Briefe von Menschen, die sein Buch inspiriert hatte und die ihm von den Schicksalsschlägen berichteten, mit denen sie selbst konfrontiert waren – von missbräuchlichen Beziehungen, dem Verlust geliebter Menschen, Krankheit und Depression. Einige schrieben ihm von ihren Selbstmordversuchen. Masters antwortete ihnen allen, woraufhin diese sich schriftlich für den Trost, die Führung und die Hoffnung bedankten, die er ihnen hatte zukommen lassen.
Es gab Briefe von Teenagern, die eine schwierige Phase durchmachten und denen ihre Erzieher oder Lehrer deshalb Finding Freedom zu lesen gegeben hatten. Gymnasiallehrer schickten ganze Pakete voller Nachrichten ihrer Schülerinnen und Schüler, nachdem sie das Buchim Unterricht durchgenommen hatten. Eine Buchhändlerin in Watts erzählte mir, dass kein anderes Buch in ihrem Sortiment so oft gestohlen würde wie das seine.
Überaus bemerkenswert erschien mir, dass ich Berichte bestätigt fand, die besagten, dass Masters Mitgefangene verteidigt hatte, die besonders häufig Angriffen ausgesetzt waren, da sie homosexuell waren, man sie verdächtigte, Geheimnisse anderer verraten zu haben, oder die auf andere Weise mit den grausamen ungeschriebenen Gesetzen des Gefängnisses in Konflikt geraten waren. Noch außergewöhnlicher fand ich, dass er drohende Übergriffe von Häftlingen auf Gefängniswärter abgewendet hatte. Ich sprach mit Menschen, die berichteten, dass Masters sie von ihren Selbstmordabsichten abgebracht habe. Ein Gefängnisbediensteter erzählte mir, dass sein Sohn schwer krank sei, er sich früher andauernd mit seiner Frau gestritten, viel zu viel getrunken und seinen Job nicht gemocht habe. Auch seien die Gefangenen für ihn der reinste Abschaum gewesen, und er habe sie auch so behandelt. Außerdem hätte er Selbstmordabsichten gehabt. Dann lernte er Jarvis kennen.
Als der Beamte eines frühen Morgens draußen den Gang entlanglief, rief Jarvis nach ihm. Dieser erzählte mir später, er habe bemerkt, unter welch großer Anspannung der Mann stand und wie niedergeschlagen er wirkte, und wollte sichergehen, dass es ihm gut ginge. Der Wärter gehörte nicht zu denjenigen, die anderen einfach so ihr Privatleben anvertrauen, und schon gar nicht einem »Verbrecher«. Doch »irgendetwas an Masters«, wie er es ausdrückte, brachte ihn dazu, ihm von der Krankheit seines Sohnes und seinen Problemen zu Hause zu erzählen. Auf die erste kurze Unterhaltung folgten über Monate frühmorgendliche Gespräche an Masters’ Zellentür, die es dem Beamten ermöglichten, sich der Krankheit seines Sohnes zu stellen, seiner Frau zur Seite zu stehen und sich hinsichtlich seiner Alkoholprobleme helfen zu lassen. Er dachte nicht mehr daran, sich umzubringen, sondern begann, dem Leben, das er hatte, mit offenen Armen zu begegnen.
Der Beamte erzählte mir später, Masters habe ihm geholfen zu verstehen, dass er verzweifelten Menschen, die seine Unterstützung brauchten, diese auch zukommen lassen konnte, weswegen seine Arbeit für ihn Sinn zu machen begann. Er hatte nicht mehr den Eindruck, eine Herde zu beaufsichtigen, sondern sah seinen Beruf fortan als Möglichkeit, dem Leiden mit Mitgefühl zu begegnen. Seine Einstellung veränderte sich, als Masters ihm zeigte, dass »man die meisten Häftlinge einfach zu streng und ungerecht behandelte«, wie er mir erklärte. »Es sind einfach Menschen, manche von ihnen sind kaputter als andere, aber viele sind auch nicht mehr daneben als die Leute draußen. Sie alle hatten üble Leben – und sie alle haben ein Herz.«
Aufgrund dieser und ähnlicher Geschichten beschloss ich, meine Idee, ein Buch über Jarvis’ Leben zu schreiben, in die Tat umzusetzen.
In den vier Jahren, die seither vergangen sind, fuhr ich mehr als 150 Mal in den Todestrakt und nahm mehr als hundert Stunden Gespräche auf. Auch führte ich mit Masters unzählige lange Telefonate. Zu diesen mündlichen Zeugnissen kam noch die Lektüre dessen, was er geschrieben hatte – seiner Bücher, Briefe, Tagebücher und Kurzgeschichten –, doch hauptsächlich stützte ich mich auf die Schilderungen seiner Erinnerungen und Erlebnisse im Gefängnis. Für gewöhnlich sprach er frei heraus, wurde aber vorsichtig, wenn es um das Gefängnispersonal und andere Insassen ging, da er sie mit seinen Berichten nicht gefährden oder belasten wollte. Bezüglich seines eigenen Lebens nahm er hingegen kein Blatt vor den Mund. Er erzählte viel von der Gewalt, die er in seiner Vergangenheit erlebt hatte, und war den Tränen nahe, wenn er davon sprach, wie er seinerseits andere verletzt und ihnen Leid zugefügt hatte.
Ich wusste nicht immer gleich, ob ich Masters’ Erinnerungen trauen konnte, besonders wenn die Ereignisse bereits über fünfzig Jahre zurücklagen. Viele der Menschen, von denen dieses Buch handelt, sind entweder bereits tot, in Haft oder wollten nicht mit mir reden (wobei ich manche nicht von ihrer Überzeugung abbringen konnte, ich sei ein Polizist). Es überraschte mich nicht, dass sich nur wenige Wärter und Mithäftlinge mit mir treffen wollten. Die es taten, waren dazu nur unter der Bedingung bereit, dass sie anonym blieben. Da diejenigen Berichte von Masters, die ich überprüfen konnte, den Darstellungen der anderen entsprachen, kam ich schließlich zur Überzeugung, dass er sicherlich auch sonst die Wahrheit sprach.
Auch wenn es in den Hunderten von Stunden, die Masters und ich gemeinsam verbrachten, um die verschiedensten Themen ging, drehten sich die meisten Gespräche doch – Kurven, Spiralen oder auch Falltüren ähnelnd – um existenzielle Fragen: ob und wie Menschen ihre Eigenschaften sowie ihr Wesen ändern können, wie wir zur Linderung des Leidens beitragen und Sinn in unseren Leben finden können.
Als ich das Mosaik von Masters’ Reise schließlich zusammenfügte, sah ich, dass er die Antworten zu diesen Fragen durch Meditation und den Buddhismus gefunden hatte.
Ich selbst bin kein Buddhist, aber indem ich verstand, wie sein Glaube ihm geholfen hatte, wurde auch mir klar, wie die buddhistischen Lehren und Praktiken anderen helfen können – Gläubigen wie Atheisten gleichermaßen. Ich verstand, dass es möglich ist, sich zu verändern, und dass diese Veränderung schrittweise vor sich geht. Auf diesem Weg schreitet man nicht gradlinig voran, sondern zyklisch, und er ist schwierig. Gleichzeitig wurde mir etwas bewusst, das mir noch tiefgründiger erschien: dass sowohl dieser Prozess als auch sein Ziel nicht dem entsprechen, was sich viele von uns darunter vorstellen. Denn um voranzukommen, dürfen wir nicht vor dem Leiden davonlaufen, sondern müssen es vielmehr gänzlich annehmen.
Masters hat nie behauptet, »das Licht gesehen« zu haben oder eine Wiedergeburt eines Meisters zu sein. Er widerspricht denjenigen, die in ihm einen Lehrer sehen, und war geradezu bestürzt zu erfahren, dass manche von ihm sagen, er sei erleuchtet. »Ich weiß nicht einmal, was dieses Wort bedeutet«, entgegnete er, wobei er betonte, er sei »der Letzte«, den man als Botschafter des Buddhismus betrachten sollte. Stattdessen räumte er ein, dass seine Art, den Glauben zu praktizieren, auf wackeligen Füßen stünde und hauptsächlich auf die ganz konkreten Herausforderungen des alltäglichen Lebens in der Todeszelle zugeschnitten sei. Als Masters jedoch die größten inneren und äußeren Hindernisse überwunden hatte, gewann er ein Verständnis von Problematiken, mit denen viele von uns zu kämpfen haben, und mit der Zeit wurde mir klar, warum die Leute sagen, er habe sie inspiriert.
An einem Ort der unaufhörlichen Gewalt, der Verwirrung, des Wahnsinns und des Zorns durchquert Masters’ Geschichte die verwunschenen Höhlen und Nebenflüsse von Einsamkeit, Verzweiflung, Trauma und anderen Formen des Leids – ein Terrain, das wir alle nur zu gut kennen – und gelangt zu Heilung, Sinn und Weisheit. Immer wieder hat mich Masters’ inspirierende Kraft zutiefst berührt, und ich hoffe, auf den folgenden Seiten etwas davon teilen zu können.
Teil 1
Die Erste Edle Wahrheit: Leiden
»Verletze die Leute, verletze sie!«
»Warlock«, ein früherer Shot-caller3 der Gang Crips in einer GRIP4-Schulung im Staatsgefängnis San Quentin.
Kapitel 1
Nutzlos geboren
Im Frühjahr des Jahres 1986 wagte sich Melody Ermachild in das imposante, im 19. Jahrhundert erbaute Gebäude des Staatsgefängnisses San Quentin, um ihren neuen Klienten Jarvis Jay Masters zu treffen. Fünf Jahre zuvor hatte man den 24-jährigen Afroamerikaner aus Harbor City, Kalifornien, nach San Quentin gebracht, nachdem er wegen bewaffneten Überfalls in dreizehn Fällen zu zwanzig Jahren Haft verurteilt worden war. Bald darauf klagte man ihn außerdem wegen Beihilfe zum Mord an einem Gefängniswärter an, für den er angeblich die Tatwaffe – ein Messer – gefertigt hatte. Bereits während des laufenden Verfahrens verlegte man ihn in den Isolationstrakt des Gefängnisses. Wenn man ihn für schuldig befinden würde, drohte ihm die Todesstrafe.
Masters trug eine marineblaue Strickmütze, die er sich tief ins Gesicht gezogen hatte. Er lehnte sich mit verschränkten Armen in seinem Stuhl zurück und nahm von seiner Besucherin kaum Notiz. Diese erklärte ihm, sie sei eine Kriminalistin, die von seiner Verteidigung beauftragt worden sei, die Umstände, in denen er aufgewachsen war, ausführlich zu dokumentieren.
Falls er verurteilt würde, so hofften seine Anwälte, könne dies helfen, die Richter zu überzeugen, von der Todesstrafe Abstand zu nehmen. Für den Bericht müsse sie sowohl ihn als auch seine Familie, seine Pflegeeltern und viele andere, die ihn kannten, interviewen.
Als sie seine Familie erwähnte, brach Masters sein Schweigen. »Lassen Sie meine Verwandten aus dem Spiel«, brummte er. Seine Augen, bislang kalt und leer, begannen zu funkeln: »Sie haben nichts über mich zu sagen.«
Bis zum Ende des Treffens sagte er nichts mehr, und dieses missmutige Schweigen behielt er auch bei etwa einem Dutzend Folgebesuche aufrecht, während derer Melody eigentlich seinen Fall beleuchten und ihn dazu bringen wollte, sich ihr gegenüber zu öffnen.
Eines Morgens humpelte sie mit Krücken in die Besuchskabine. Sie war beim Bergsteigen gestürzt und hatte sich die Achillessehne gerissen.
Wie üblich packte sie ihre Ordner und Notizbücher aus, und wie gewohnt quittierte Masters dies mit seinem verächtlichen Schweigen.
Plötzlich rastete Melody aus: »Denken Sie, damit sei zu spaßen?«
Er war verblüfft.
»Sie wollen Sie umbringen«, sagte sie aufgebracht.
Sie hatte noch nie vor einem Klienten die Fassung verloren und entschuldigte sich umgehend.
»Es liegt nicht nur an meinem Knie«, erklärte sie. In ihrer Aufregung vergaß sie ihr üblicherweise professionelles Gebaren und vertraute ihm die Gründe für ihre Niedergeschlagenheit an: »Als Teenager bekam ich ein Baby, und man zwang mich, es zur Adoption freizugeben«, erklärte sie. »Darüber bin ich nie hinweggekommen. Jetzt, nach zwanzig Jahren, hörte ich erstmals wieder von meinem Sohn. Wir haben uns vor ein paar Tagen getroffen.«
Jarvis starrte sie an.
»Es war ein sehr schönes Treffen mit ihm. Aber gleichzeitig kam dabei einiges hoch, und ich habe viel geweint.«
Nach einer Pause fügte sie hinzu: »Ich habe viel über meine Kindheit nachgedacht. Mein Vater starb, als ich noch klein war. Meine Mutter war depressiv, und« – Melody hielt inne und atmete tief ein – »sie schlug uns. Später wurde ich schwanger, und meine Eltern warfen mich raus. Ich machte einen Ort für schwangere Jugendliche ausfindig, wo ich das Kind zur Welt brachte. Ich hatte Selbstmordfantasien. Oft.«
Zum ersten Mal brach Jarvis sein Schweigen: »Das ist wirklich gottverdammte Scheiße.« Treffender hätte er es nicht zusammenfassen können, und Melody musste lächeln.
Ihre Augen trafen sich kurz, doch dann schaute Jarvis schnell wieder weg.
Von jetzt an war Jarvis weniger feindselig. Manchmal sagte er wie zuvor kaum ein Wort, doch oft war er weniger verschlossen. Er begann, über ihre Fragen genau nachzudenken und sie ehrlich zu beantworten. Sie sprachen über seinen Fall und seine Vergangenheit, auch wenn ihre Gespräche manchmal schmerzhafte Erinnerungen hochbrachten und er deswegen wieder dichtmachte. Schließlich war er auch einverstanden, dass sie seine Familie befragte.
Melody flog nach Los Angeles, um seine Mutter Cynthia Campbell zu treffen, die Jarvis seit dem Tag seiner Verhaftung vor sieben Jahren – 1981 – nicht mehr gesehen hatte. Vor der Festnahme war er in eine Reihe von bewaffneten Raubüberfällen verwickelt gewesen. Als die Polizei nach ihm zu fahnden begann, versteckte sich Jarvis für jeweils ein paar Tage in den Wohnungen verschiedener Freunde. Eines Nachmittags, er besuchte gerade seine Schwester, hörte er Polizeifunk und wusste daher, dass sie kamen. Doch es war zu spät, es blieb keine Zeit, zu flüchten. Die Polizei forderte Jarvis per Megafon auf, mit erhobenen Händen nach draußen zu kommen.
Ein Beamter beugte Jarvis über die Motorhaube des Streifenwagens und fesselte seine Hände mit Handschellen auf den Rücken. Cynthia, die gerade in der Wohnung von Jarvis’ anderer Schwester gewesen war, rannte nach draußen. Weinend und schreiend griff sie den Beamten an, schlug auf ihn ein und kratzte ihn. Jarvis sah, wie ein anderer Polizist sie niederrang.
Als Melody Cynthia in ihrem etwas heruntergekommenen Wohnzimmer traf, wirkte sie gebrechlich und traurig. Ihr Gesicht spiegelte noch immer ihre frühere Schönheit, war jedoch von den Spuren jahrzehntelanger Sucht gezeichnet. Cynthias Ehrlichkeit beeindruckte Melody. Mit rauer Raucherinnenstimme erklärte sie, sie habe mit 16 Jahren das erste ihrer acht Kinder bekommen. »Jarvis hatte das Gefühl, ohne Mutter aufzuwachsen«, bekannte sie, »aber ich habe getan, was ich konnte.« Beim Abschied fragte Melody Cynthia, ob sie es sich vorstellen könne, Jarvis zu besuchen. »Ich glaube, es würde ihm guttun.« Cynthia war einverstanden.
Beim nächsten Besuch im Gefängnis bat Jarvis Melody, ihm bis ins kleinste Detail von dem Besuch zu erzählen. Während sie dies tat, stellte er sich seine Mutter vor. Er erinnerte sich daran, wie schön und sanftmütig sie sein konnte, aber auch an ihre Labilität und daran, dass sie oft nicht da war. Er erinnerte sich an Situationen, in denen sie beide gerade gemeinsam fernsahen und sie plötzlich aufstand und verschwand. Wenn er dann kurz darauf nach ihr schaute, fand er sie in der Toilette, abwesend und im Heroinrausch. Er versuchte sie dann aufzuwecken und ins Bett zu bringen. Jedes Mal fürchtete er, sie könne tot sein.
Er musste auch an all die Männer denken, die bei ihnen ein- und ausgingen. Wenn er einem dieser Fremden im Wohnzimmer begegnete, sagte seine Mutter diesem für gewöhnlich: »Gib Jarvis etwas Geld!« und dann zu ihm: »Geh runter und kauf dir ein paar Süßigkeiten!«
Obwohl er damals erst fünf Jahre alt war, erinnerte er sich auch noch sehr lebendig an den Tag, an dem die Polizei kam und das Elend vorfand, in dem er mit seinen Schwestern lebte. Sozialarbeiter brachten die Kinder daraufhin zum Jugendamt, wo sie voneinander getrennt wurden. Man führte Jarvis in einen kleinen Raum zu zwei freundlichen Frauen. Eine von ihnen hob ihn auf einen Tisch und zog ihm das Hemd aus. Mit Schrecken betrachteten sie die Blutergüsse und Narben, die seinen Körper bedeckten.
Jarvis schob seine Erinnerungen beiseite und freute sich stattdessen auf den Besuch seiner Mutter. Er überlegte sich, was ihm am wichtigsten war, ihr zu sagen: Wie sehr er sie vermisst hatte und wie sehr er sie liebte.
Jarvis setzte seine Mutter auf die Besucherliste und wartete ungeduldig auf ihr Kommen. Vergebens. Eines Morgens sah er durch die Stäbe seiner Zellentür, wie sich der Gefängniskaplan ihm näherte. Wie alle Häftlinge wusste er, dass dieser nicht einfach so auf einen Plausch vorbeikam: Sein Besuch bedeutete nichts Gutes.
Der Geistliche erklärte, eine seiner Schwestern hätte angerufen und ihn gebeten, ihm auszurichten, dass seine Mutter einen Herzinfarkt erlitten habe und daran gestorben sei.
Der Kaplan bekundete sein Beileid und verließ den Gang.
Jarvis begann zu zittern. Doch sein Schock verwandelte sich in Wut. Er schlug mit seinen Fäusten an die Zellenwand, bis sie bluteten.
Seine Verzweiflung über den Tod seiner Mutter dauerte Wochen. Er war außer sich, da man es ihm verwehrte, an ihrer Beerdigung teilzunehmen. Er ging in seiner Zelle auf und ab, weigerte sich, am Hofgang teilzunehmen, und beschimpfte einen Wärter wild, der ihn daraufhin gegen eine Wand stieß.
Melody interviewte Jarvis weiterhin für ihren Bericht und war stets sehr glücklich, wenn sie Jarvis Neuigkeiten bringen konnte, die seine Stimmung etwas aufheiterten: So sei sie mit seiner kleinen Schwester Carlette, die in Los Angeles lebte, in Kontakt. Sie habe vor, ihn zu besuchen.
Also schrieb Jarvis einen weiteren Namen auf seine Besucherliste. Doch diesmal war es nicht umsonst: An einem Morgen wurde er in den Besuchssaal gebracht, wo seine Schwester auf der anderen Seite der Plexiglasscheibe auf ihn wartete.
Als sie ihn sah, begann sie zu weinen. Schließlich nahm sie sich zusammen und brachte immerhin seinen Namen heraus: »Jarvis.« Sie starrte ihren Bruder an und wiederholte es noch einmal: »Jarvis.«
Dieser antwortete ohne sichtbare Emotionen. Er nickte ihr kaum merklich zu und sagte: »Was gibt’s, kleine Schwester?«
Sie fragte: »Geht es dir gut?«
»Ja, ganz in Ordnung«, sagte er ausdruckslos.
»Wie ist es dir hier drinnen ergangen? Bist du okay?«
Er zuckte mit den Achseln: »Was glaubst du?«
Sie wiederholte: »Geht es dir gut?«
»Yeah«, erwiderte er. »Es ist keine große Sache. Arschlöcher, die sich bekriegen, Messerstechereien.«
Sie wirkte verstört.
»Sorg dich nicht um mich, kleine Schwester«, sagte er. »Mit mir wird sich niemand anlegen.«
Carlette bemerkte, dass an der Schläfe und am Handgelenk ihres Bruders die Nummer 255 eintätowiert war, und fragte danach.
Als sie Kinder waren, wohnten sie in der 255. Straße in Harbor City.
Sie fragte: »Wie bist du auf diese Idee gekommen?«
»Das habe ich bei einem Gangmitglied gesehen, der in einem Sarg lag.«
Carlette war fassungslos.
Nachdem ein Wächter ihnen mitgeteilt hatte, dass ihnen noch fünf Minuten blieben, bat Jarvis Carlette, etwas Geld auf sein Gefängniskonto einzuzahlen, damit er sich Zigaretten kaufen könne.
Sie versprach es und verabschiedete sich.
Die Autofahrt von Los Angeles nach San Francisco war für Carlette sehr anstrengend und kostspielig, und dennoch kam sie schon einen Monat später wieder. Diesmal brachte sie ihren kleinen Sohn mit, der auf ihrem Schoß saß. Auch diesmal »erfreute« Jarvis sie mit seinen Gefängnisgeschichten. Es machte sie traurig, dass er so tat, als sei die Haft ein Witz, und es widerte sie sogar regelrecht an, als er sich damit brüstete, dass man ihn als Krieger in irgendeiner Revolution bewunderte und fürchtete.
Auch bei Carlettes drittem Besuch redete Jarvis wieder über den Rassenkrieg in San Quentin, in dem sich seine schwarzen Mithäftlinge gegen Angriffe von mexikanischen und weißen Gangs verteidigten, über miese Wärter, die Drogen und Waffen verkauften, sowie über Messerstechereien. All dies schilderte er so, als sei das Grauen amüsant.
Carlette brach in Tränen aus.
Jarvis starrte sie an. »Warum weinst du?«
»Und was ist mit uns?«, platzte es aus ihr heraus.
Er verstand nicht, was sie meinte.
»Du sprichst immer nur von deinem Leben, davon, dass du ein abgebrühtes Gangmitglied bist, ein Revolutionär und all so einen Mist. Aber du erkundigst dich nie nach uns. Warum besuche ich dich überhaupt? Was ist mit mir? Mit deinem Neffen? Weißt du, was er nach unserem letzten Besuch gesagt hat? ›Mama, ich will genauso werden wie Onkel Jay.‹ Was soll ich ihm auf so etwas antworten?«
Ihr Weinen wurde stärker, aber Jarvis rollte nur mit den Augen.
»Glaubst du, deine Gangkumpels werden dir nach ihrer Entlassung Geld schicken?«, fügte sie an. »Glaubst du, sie werden dir schreiben oder Fotos von ihren Kindern schicken? Denkst du wenigstens an uns? Wen willst du beeindrucken? Was stimmt mit dir nicht?«
Immer noch schluchzend, nahm sie ihren Sohn an der Hand und ging.
Jarvis war wütend. Was stimmte mit ihm nicht? Verdammt noch mal, die Frage war eher, was mit ihr nicht stimmte. Sie hatte keine Ahnung, wer er war. Seine Schwester war einfach dumm, und es war ihm egal, ob sie wiederkommen würde.
Die darauffolgende Nacht versuchte Jarvis, den Besuch zu vergessen, musste aber immer wieder an eine Sache denken, die Carlette gesagt hatte. Viele von denen, die er hier im Gefängnis kannte, saßen lebenslänglich, aber einige würden irgendwann freikommen. Würde er je wieder von ihnen hören? Würden sie ihm schreiben? Würden sie Geld oder Bilder ihrer Kinder schicken? Würden sie ihn besuchen?
Auf keinen Fall.
Was versuchte er zu beweisen? Wen versuchte er zu beeindrucken?
Und eine andere ihrer Fragen war noch schwerer beiseitezuschieben: »Was stimmt mit dir nicht?«
Er versuchte, das Gespräch zu vergessen, aber es gelang ihm nicht. Er kauerte sich in eine Ecke der Zelle. Er empfand etwas … aber er wusste nicht, was es war, außer, dass er es nicht spüren wollte.
Jarvis hatte oft über den Tod nachgedacht, schließlich war er ihm seit seiner frühen Kindheit überall begegnet. Er hatte sich vorgestellt, dass er irgendwann erschossen würde, wie viele der Jungs aus seiner Nachbarschaft. Dann wieder sah er sich – ähnlich wie in Gangsterfilmen – in eine Maschinengewehrsalve laufen. Manchmal wünschte er sich sogar den Tod. Er wäre eine Erlösung.
Während dieser langen Nacht begegnete er einem Gedanken, den er sich zu denken nie erlaubt hatte: Er wollte freikommen und wieder Kontakt zu seiner Familie aufnehmen, seiner Schwester ein großer Bruder und seinem Neffen ein Onkel sein. Er wollte leben.
Er legte ein Blatt Papier auf seine Betonpritsche, die er so als Tisch benutzte. Mit dem einzigen Schreibutensil, das hier drinnen erlaubt war, der Mine eines Kugelschreibers – schließlich hätte ein kompletter Kuli als Waffe genutzt werden können –, schrieb er einen Brief an Carlette. Er dankte ihr für ihre Hilfe, ihre Briefe und ihre Besuche. Er ließ sie wissen, dass er stolz darauf sei, was für eine Frau sie geworden war, sowie stolz auf ihren bezaubernden Sohn. Er entschuldigte sich dafür, dass er sich nie nach ihrem Leben erkundigt habe. Doch jetzt wolle er alles über sie wissen.
Er befürchtete, dass sie ihn möglicherweise nie mehr besuchen würde. Und noch immer konnte er ihre Frage »Was ist falsch mit dir?« nicht vergessen.
Jarvis war gerade einmal 19 Jahre alt, als er 1981 nach San Quentin kam. Bei seinem ersten Hofgang sah er, wie Männer auf Basketballplätzen spielten, deren Körbe keine Netze hatten. Andere Insassen stemmten Gewichte, saßen sich auf den Bänken gegenüber und spielten Brettspiele oder Karten; wieder andere fanden sich in Grüppchen zusammen und unterhielten sich. Ihm stach sofort ins Auge, dass die verschiedenen ethnischen Gruppen unter sich blieben.
Schließlich näherte sich ihm ein Fremder. Jarvis war zuerst misstrauisch. Doch als dieser den Namen Halifu erwähnte – einen Insassen, den er im Los Angeles County Jail kennengelernt hatte –, fasste er Vertrauen. Halifu war von imposanter Statur, sprach aber wie ein Professor. Er verstand sich als Revolutionär und erzählte Jarvis von der Geschichte der Unterdrückung der Afroamerikaner, zitierte W. E. B. Du Bois, Marcus Garvey, Angela Davis sowie Malcolm X und klärte Jarvis über die Black Panthers und eine Organisation namens Black Guerrilla Family auf. Halifu ließ ihn wissen, diese »BGF« sei u.a. von W. L. Nolen und George Jackson als Reaktion auf eine ganze Serie von Morden an afroamerikanischen Insassen in US-Gefängnissen gegründet worden. Er forderte Jarvis auf, sich der Revolution anzuschließen, und begann, ihn Askari zu nennen, was auf Suaheli »Soldat« bedeutet.
Als Halifu später erfuhr, dass Jarvis nach San Quentin verlegt worden war, schrieb er an seine dortigen »Kameraden«, darunter der Mann, der nun hier auf dem Hof auf ihn zukam. Der Gefangene, dessen Suaheli-Name »Fuma« war, hatte bereits der Black-Panther-Gruppe in San Quentin angehört, als George Jackson 1971 hier ermordet wurde. Fuma stellte Jarvis anderen »Revolutionären« vor. Unter ihnen waren Lehrer, deren Aufgabe es war, Anwärter, die der BGF beitreten wollten und die »Kezi« genannt wurden, auszubilden. Jarvis war interessiert und beschloss schließlich, an der Schulung teilzunehmen. Für den Unterricht der Kezi, zu dem etwa sechzig Männer kamen, wurde im Hof eine Tafel aufgebaut. Jenen, die nie eine Schule besucht hatten, brachte man lesen sowie schreiben bei, und sie alle informierte man ausführlich über die Geschichte des schwarzen Nationalismus und ihren Klassenkampf.
Diese politische Schulung lieferte Jarvis’ Wut eine Begründung und gab ihr ein Ziel. Sein Zorn und seine Entfremdung machten ihn für diese Radikalisierung empfänglich – und dafür, sich für dieses Ziel einzusetzen, das größer war als er selbst. Für junge Männer wie Jarvis war der familienartige Zusammenhalt der Black Guerrilla Family das Wichtigste, da die anderen Mitglieder sie wie Väter und Brüder aufnahmen.
Jarvis wusste genauso gut wie die anderen Kezi, dass nur eine Handvoll von ihnen in die BGF aufgenommen würden. »Viele werden gerufen, aber nur wenige werden erwählt«, erklärte man ihnen. Jarvis war fest entschlossen, zu diesen zu zählen. Er trainierte, übte mit Ausdauer und Einsatz und hatte schließlich nach zweijähriger Schulung 1983 Erfolg. Gemeinsam mit einigen anderen »Soldaten« übertrug man ihm in einer feierlichen Zeremonie die »brüderliche Mitgliedschaft« der Gang. Man überreichte ihnen einen Sticker mit einem kommunistischen Roten Stern, den sie von nun an auf ihrem Jackenaufschlag tragen sollten. Ein Anführer erklärte ihnen: »Es gibt neue Drachen unter uns, die in die Jamaa (Familie) aufgestiegen sind.«
Weitere zwei Jahre später – 1985 – sagte sich ein BGF-Mitglied von der Führung seiner Organisation los und plante ohne deren Wissen eine Reihe von Attentaten auf Gefängniswärter. Das erste Opfer war der 38-jährige Howell Dean Burchfield, ein früherer Unteroffizier, über den Gerüchte kursierten, er würde die mit der Black Guerrilla Family verfeindete Gang »Aryan Brotherhood«5 mit Waffen versorgen. Nach Aussage mehrerer BGF-Mitglieder wurde Jarvis nicht über die Pläne informiert, da er sich mit dem Attentäter überworfen hatte. Entsprechend war er nicht darüber im Bilde, was in der Nacht des 9. Juni des gleichen Jahres geschehen sollte. Burchfield war gerade auf der abendlichen Runde, um wie Hunderte Male zuvor die Insassen zu zählen. Plötzlich rief ein Häftling nach ihm und bat ihn um Feuer für seine Zigarette. Kaum war er nah genug, stach der Gefangene mit einem selbst gefertigten Messer auf ihn ein und verletzte die Lungenarterie. Als endlich Hilfe eintraf, war der Wärter bereits tot.
Noch in der gleichen Nacht und am darauffolgenden Tag wurden sämtliche Häftlinge, die man der Mittäterschaft verdächtigte, in den Isolationstrakt des C-Blocks im Südgebäude des Gefängnisses verlegt. Jarvis stand offenbar nicht unter Tatverdacht, denn man ließ ihn in Ruhe. Er behielt sogar sein Privileg, abends, wenn die anderen bereits in ihren Zellen eingeschlossen waren, als »tier tender« weiter draußen zu bleiben, um die Gänge zu kehren und zu putzen, die Abendessentabletts auszuliefern oder die Wände der Vorratsräume zu schrubben.
Sechs Monate später, Jarvis und einige Mithäftlinge schauten sich gerade ein Fußballmatch an, schrie plötzlich jemand, sie sollten auf den Nachrichtenkanal umschalten. Als sie dies taten, sahen sie Jarvis’ Gesicht neben dem zweier anderer Black-Guerrilla-Family-Mitglieder. Der Nachrichtensprecher kommentierte, man habe endlich alle Beteiligten des Mordes am Gefängniswärter in San Quentin identifiziert.
Am nächsten Morgen wurde Jarvis in den Isolationstrakt verlegt. Kurz darauf informierte ihn ein Gefängnisbediensteter, dass man ihn beschuldigte, am Burchfield-Mord beteiligt gewesen zu sein. Jarvis verdächtigte das abtrünnige Gangmitglied, das das Attentat geplant hatte, ihn verleumdet zu haben, denn Jarvis galt als loyaler Soldat, der nie den BGF-Ehrencodex brechen würde, wonach man unter keinen Umständen über illegale Handlungen anderer Mitglieder der Organisation sprechen durfte. Seine Loyalität hatte einen hohen Preis: Er wurde für eine Tat »mit besonderen Umständen« angeklagt – das Töten eines Gefängnisbeamten. Und das konnte zu seiner Hinrichtung führen.
Das Verfahren begann 1989. An den Verhandlungstagen zog Jarvis statt der üblichen Gefängnisjeans einen orangefarbenen Overall an. Man legte ihm Handschellen sowie Fußfesseln an, schlang eine Kette um seine Hüften und brachte ihn aus seiner Zelle in einen Wagen des California Department of Corrections, der ihn in das von Frank Lloyd Wright entworfene Marin County Civic Center brachte. In dem Gerichtsgebäude mit einer kunstvollen blauen Kuppel nahm er in einem holzgetäfelten Gerichtssaal neben seinen Anwälten Platz.
In Vorverhandlungen reichten Jarvis’ Anwälte eine Reihe von Anträgen zu seinen Gunsten ein, aber die Richterin des Obersten Gerichtshofs von Marin County, Beverly Savitt, lehnte die meisten von ihnen ab. Dann folgte die Auswahl der Geschworenen, die ebenfalls ungünstig ausfiel. Die Anwälte hatten auch mit ihren Einwänden gegen die Nominierung dieser Geschworenen wenig Erfolg, und so waren am Ende bis auf einen alle von ihnen weiß, und alle waren Befürworter der Todesstrafe.
Jarvis kauerte auf seinem Stuhl, während Richter und Zeugen so über ihn sprachen, als sei er nicht anwesend. Er blickte zur Richterin und glaubte, in ihrem Gesicht manchmal Güte und fast mütterliche Fürsorge zu erkennen. Doch dann wiederum schaute sie durch ihn hindurch, so als sei er gar nicht im Raum. Es war, wie er später Melody berichtete, als triebe die Jury »einen Nagel nach dem anderen in meinen Sarg«.
Kapitel 2
Atmen, sitzen
Nachdem Melody nach monatelanger Arbeit einen ersten Entwurf des Strafmilderungsreports fertig hatte, brachte sie Jarvis ein Exemplar, das er noch am gleichen Abend las. Der Bericht brachte ihn in Rage. Voller Wut schrieb er Melody einen gehässigen Brief: »Wenn Sie mich treffen, sind Sie immer freundlich, aber Sie schreiben über mich so, als wäre ich ein Hund. Die Polizei hätte im Grunde nichts Schlimmeres schreiben können.« Er schloss mit den Worten, dass er sie nie wiedersehen wollte.
Jarvis konnte es nicht fassen, dass er ihr getraut hatte. Wie oft sollte er noch den immer gleichen Fehler machen, bis er endlich verstehen würde, dass er niemandem trauen konnte?
Immer noch voller Zorn nahm er sich den Bericht am nächsten Tag noch einmal vor. Je mehr er las, umso schlechter fühlte er sich – aufgebrachter, wütender und gekränkter. Als er bereits in der Mitte des Schriftsatzes war, kam ihm eine furchtbare Erkenntnis: Melody hatte ihm nicht den Rücken gekehrt, sie war nicht gegen ihn, sondern hatte einfach nur ihre Arbeit gemacht. Ihr Report stellte sein Leben wahrheitsgetreu dar. Und genau diese Wahrheit hatte ihn wütend gemacht.
In dem Bericht stand, seine Mutter sei eine Prostituierte gewesen, zu der die Männer ins Haus kamen, und sie habe ihn vernachlässigt. Melody verschwieg auch nicht die Gewalt seines Vaters, der nicht nur Cynthia geschlagen, sondern sogar einmal versuchte hatte, das Haus anzuzünden, in dem sich die Kinder befanden. Melody schilderte, dass sein Vater sie verlassen und Stiefvater Otis sie geschlagen hatte, und dokumentierte ebenso die andauernden körperlichen Misshandlungen, die Jarvis in den darauffolgenden Jahren in Pflegeheimen und staatlichen Institutionen über sich ergehen lassen musste.
Und wo war er bei alledem? Er war passiv, versteckte sich, hatte Angst.
Auch wenn er sein ganzes Leben lang versucht hatte, das Gegenteil zu beweisen – Melodys Bericht zeigte unmissverständlich, dass er ein Opfer war.
Jarvis saß auf seinem Bett, ihm war schwindelig und übel. Und dann musste er an den zornigen Brief denken, den er Melody geschickt hatte.
Sofort begann er einen zweiten Brief. »Ich neige dazu, zu schnell zu reagieren«, schrieb er ihr, »und damit habe ich in meinem Leben den größten Schaden angerichtet … und es komplett vergeigt. Es tut mir leid.«
»Ich habe großes Vertrauen in Sie, Jarvis«, antwortete Melody. »Sie werden immer mehr Ihr wahres Selbst entdecken und Ihr Herz öffnen. Und ich weiß, dass Sie wieder stinksauer auf mich sein werden – schließlich kommen harte Zeiten auf Sie zu. Es ist ein schwieriger und beängstigender Fall. Aber wenn Sie dranbleiben, werde ich es auch tun. Ich werde Sie nicht im Stich lassen.«