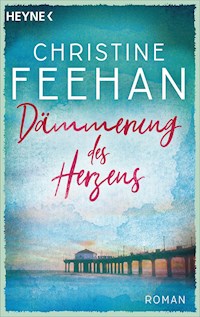9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Karpatianer
- Sprache: Deutsch
Dem Tod knapp entronnen, lebt der Karpatianer Manolito de la Cruz in einem wahren Albtraum. Stimmen verfolgen ihn, und er wird von einem unnatürlichen Blutdurst geplagt. Die Einzige, die ihm helfen kann, ist seine Seelengefährtin. Er weiß, dass er die ihm bestimmte Frau bereits gefunden hat, kann sich aber weder an ihren Namen noch an ihr Aussehen erinnern. Erst eine Begegnung im brasilianischen Dschungel gibt ihm Hoffnung, dem Sturz in die Dunkelheit zu entgehen. Aber die selbstbewusste MaryAnn möchte mit der Schattenwelt der Karpatianer nichts zu tun haben. Und sie verbirgt ein dunkles Geheimnis ...
»In dieser Geschichte knistert es vom Anfang bis zum Ende!« Romantic Times
Dunkel, gefährlich und extrem heiß - Gefangene deiner Dunkelheit ist der 18. Band der umfangreichen NEW YORK TIMES und SPIEGEL-Bestsellerserie Die Karpatianer.
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 653
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Inhalt
Cover
Grußwort des Verlags
Über dieses Buch
Titel
Widmung
Danksagung
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
Über die Autorin
Weitere Titel der Autorin
Impressum
Liebe Leserin, lieber Leser,
herzlichen Dank, dass du dich für ein Buch von beHEARTBEAT entschieden hast. Die Bücher in unserem Programm haben wir mit viel Liebe ausgewählt und mit Leidenschaft lektoriert. Denn wir möchten, dass du bei jedem beHEARTBEAT-Buch dieses unbeschreibliche Herzklopfen verspürst.
Wir freuen uns, wenn du Teil der beHEARTBEAT-Community werden möchtest und deine Liebe fürs Lesen mit uns und anderen Leserinnen und Lesern teilst. Du findest uns unter be-heartbeat.de oder auf Instagram und Facebook.
Du möchtest nie wieder neue Bücher aus unserem Programm, Gewinnspiele und Preis-Aktionen verpassen? Dann melde dich für unseren kostenlosen Newsletter an: be-heartbeat.de/newsletter
Viel Freude beim Lesen und Verlieben!
Dein beHEARTBEAT-Team
Über dieses Buch
Dem Tod knapp entronnen, lebt der Karpatianer Manolito de la Cruz in einem wahren Albtraum. Stimmen verfolgen ihn, und er wird von einem unnatürlichen Blutdurst geplagt. Die Einzige, die ihm helfen kann, ist seine Seelengefährtin. Er weiß, dass er die ihm bestimmte Frau bereits gefunden hat, kann sich aber weder an ihren Namen noch an ihr Aussehen erinnern. Erst eine Begegnung im brasilianischen Dschungel gibt ihm Hoffnung, dem Sturz in die Dunkelheit zu entgehen. Aber die selbstbewusste MaryAnn möchte mit der Schattenwelt der Karpatianer nichts zu tun haben. Und sie verbirgt ein dunkles Geheimnis …
eBooks von beHEARTBEAT – Herzklopfen garantiert.
CHRISTINE FEEHAN
Gefangenedeiner Dunkelheit
Aus dem amerikanischen Englischvon Ulrike Moreno
Für Jaunnie Ginn,
Danksagung
Wie bei allen Werken hat man sehr vielen Leuten zu danken. Cheryl Wilson und Kathi Firzlaff, die bemerkenswert viel Zeit damit verbracht haben, mir bei den Details zu helfen. Brian Feehan für die langen Nächte, die du aufgeblieben bist, um mir Gelegenheit zu geben, die Story mit dir durchzusprechen. Domini, du warst erstaunlich, als du am Ende mit mir gearbeitet hast, bis wir den Roman zum Abschluss brachten. Dir, Tina, danke ich dafür, dass du all die Kleinigkeiten erledigt hast, damit ich meine Arbeit tun konnte. Aber vor allem danke ich meinem Ehemann, der Liebe meines Lebens, für sein Verständnis und die große Unterstützung, die er mir in allem war.
1. Kapitel
Manolito De La Cruz schlug das Herz bis zum Hals, als er tief unter der dunklen Erde erwachte, das Gesicht verschmiert von blutig roten Tränen, und überwältigt von Kummer, der ihm das Herz zusammenkrampfte. Der verzweifelte Schrei einer Frau hallte in seiner Seele wider, zerrte an ihm, tadelte ihn und zog ihn vom Rande eines tiefen Abgrunds weg. Und er stand kurz davor, zu verhungern.
Jede Faser seines Körpers schrie nach Blut. Der Hunger danach hielt ihn in seinen erbarmungslosen Klauen, ein roter Dunst legte sich vor seine Augen, und sein Puls hämmerte von dem unaufschiebbaren Drang nach Nahrung. Verzweifelt suchte er die Gegend über seiner Ruhestätte nach der Anwesenheit von Feinden ab, und als er keinen finden konnte, drang er durch die fruchtbare schwarze Erde über ihm ins helle Tageslicht empor.
Sein Herz dröhnte ihm in den Ohren, und sein Schädel brummte, als er inmitten von dichtem Gesträuch und undurchdringlicher Vegetation landete, wo er sich zunächst einmal sehr wachsam umsah. Für einen Moment war alles irgendwie verkehrt – Affen kreischten, Vögel tschilpten warnend, er hörte das Husten eines größeren Raubtiers und sogar das Rascheln der Eidechsen im Unterholz. Er dürfte eigentlich gar nicht hier sein. Im Regenwald. Zu Hause.
Manolito schüttelte den Kopf, um Klarheit zu erlangen. Das Letzte, woran er sich noch deutlich erinnerte, war, dass er sich vor eine schwangere Karpatianerin geworfen hatte und die Mutter und ihr ungeborenes Kind vor einer Mörderin geschützt hatte. Die karpatianische Frau war Shea Dubrinsky, die Gefährtin von Jacques, des Bruders des Prinzen der Karpatianer. Aber das war in den Karpaten gewesen und nicht in Südamerika, wo Manolito inzwischen zu Hause war.
In Gedanken ließ er die Bilder noch einmal Revue passieren. Auf einer Weihnachtsparty hatten Sheas Wehen eingesetzt, was ausgesprochen ungünstig gewesen war. Denn wie hatten sie inmitten eines solchen Trubels Frauen und Kinder schützen sollen? Manolito hatte die Gefahr gespürt, den Feind, der sich durch die Menge an Shea herangepirscht hatte. Aber er war zerstreut gewesen, abgelenkt und geblendet von den Farben, Geräuschen und Emotionen, die von allen Seiten auf ihn eingestürmt waren. Wie war das möglich? Uralte karpatianische Jäger kannten keine Emotionen, und sie sahen auch keine Farben, sondern nur Schattierungen von Grau und Schwarz – und trotzdem erinnerte sich Manolito noch ganz deutlich, dass Sheas Haare rot gewesen waren. Leuchtend rot.
Seine Erinnerungen verflogen, als ein solch heftiger Schmerz ihn übermannte, dass er sich vor Qualen krümmte. Schwäche überkam ihn, die ihn in die Knie zwang, ihm den Magen verkrampfte und eine Welle der Übelkeit in ihm aufsteigen ließ. Feuer brannte durch seinen Körper wie geschmolzenes Gift. Karpatianer kannten keine Krankheiten; an einem menschlichen Leiden konnte er also nicht erkrankt sein. Was ihn quälte, war von einem Feind verursacht worden.
Wer hat mir das angetan? Angriffslustig bleckte Manolito seine weißen Zähne, die scharf und tödlich waren, während er sich mit wilden Blicken umsah. Wie war er hierhergekommen? Während er auf allen vieren in der feuchten, warmen Erde kniete, versuchte er zu ordnen, was er wusste.
Ein weiterer schwindelerregender Schmerz durchzuckte seine Schläfen und verdunkelte den Rand seines Gesichtsfeldes. Er hielt sich die Augen zu, um sie vor den Blitzen zu schützen, die wie Flugkörpergeschosse auf ihn zujagten, aber sie zu schließen, verschlimmerte die Wirkung höchstens noch. »Ich bin Manuel De La Cruz«, stieß er zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor, in einem Versuch, seinen Verstand wieder zum Arbeiten zu bringen … und sich zu erinnern. »Ich habe einen älteren und drei jüngere Brüder. Sie nennen mich Manolito, um mich zu veräppeln, weil meine Schultern breiter sind als ihre und ich mehr Muskeln habe und sie mich deswegen wie einen kleinen Jungen dastehen lassen wollen. Sie würden mich aber nie im Stich lassen, wenn sie wüssten, dass ich sie brauche.«
Sie hätten mich nicht im Stich gelassen. Auf gar keinen Fall … Nicht seine Brüder. Sie waren einander alle treu ergeben – waren all diese Jahrhunderte zusammen gewesen und würden es auch immer bleiben.
Er versuchte, den Schmerz in den Hintergrund zu verdrängen, um der Wahrheit auf den Grund zu kommen. Warum war er im Regenwald, wo er doch eigentlich in den Karpaten sein müsste? Warum war er von seinem Volk im Stich gelassen worden? Von seinen Brüdern? Er schüttelte ablehnend den Kopf, was ihn jedoch teuer zu stehen kam, da der Schmerz sich dadurch noch verschärfte und regelrechte Stacheln seinen Schädel zu durchbohren schienen.
Er erschauderte, als die Schatten näher krochen, ihn umzingelten und Formen annahmen. Blätter raschelten, und das Buschwerk bewegte sich, als würde es von unsichtbaren Händen berührt. Eidechsen flitzten aus dem verrottenden Unterholz und rannten davon, als hätte ihnen irgendetwas Angst gemacht.
Manolito zog sich ins Gebüsch zurück und blickte sich wieder misstrauisch um. Diesmal suchte er nicht nur auf der Erde, sondern auch unterhalb von ihr die nähere Umgebung ab. Er sah jedoch nur Schatten und nichts aus Fleisch und Blut, das auf einen nahen Feind hinwies. Er musste sich zusammennehmen und herausfinden, was hier vorging, bevor die Falle zuschnappte – denn er war sich absolut sicher, dass es hier irgendwo eine Falle gab und er drauf und dran war hineinzutappen.
Während seiner Zeit als Vampirjäger war Manolito viele Male verwundet und vergiftet worden, und dennoch hatte er überlebt, weil er stets seinen Verstand benutzt hatte. Er war mit allen Wassern gewaschen, vorsichtig und sehr intelligent. Kein Vampir oder Magier würde ihn bezwingen, ob er nun krank war oder nicht. Und falls dies alles Halluzinationen waren, musste er einen Weg finden, den Bann zu brechen, um sich zu schützen.
Dunkle, böse Schatten bewegten sich durch seinen Kopf. Manolito ließ seinen Blick über die üppige Vegetation des Dschungels gleiten, doch statt eines einladenden Zuhauses sah er nur die gleichen, sich langsam bewegenden Schatten, die ihre gierigen Klauen nach ihm ausstreckten. Dinge bewegten sich, Banshees heulten, und fremdartige Kreaturen versammelten sich in dem Buschwerk und am Boden.
Das ergab keinen Sinn, nicht für jemanden von seiner Art. Die Nacht hätte ihn willkommen heißen, ihn trösten und in ihren wundervollen Frieden einhüllen sollen. Die Nacht hatte immer ihm und seiner Spezies gehört. Jeder Atemzug, den er tat, hätte ihn mit Informationen überfluten müssen, doch stattdessen spielte sein Verstand ihm Streiche und ließ ihn Dinge sehen, die nicht da sein konnten. Er konnte eine unheimliche Sinfonie von Stimmen hören, die ihn riefen und immer lauter wurden, bis ihm schier der Kopf platzte von dem Gestöhne und den jämmerlichen Schreien. Knochige Finger streiften seine Haut, Spinnenbeine krabbelten über ihn, sodass er wild die Arme schwenkte, sich auf Brust und Rücken schlug und verzweifelt versuchte, die unsichtbaren Netze abzustreifen, die an seiner Haut zu kleben schienen.
Wieder erschauderte er und zwang sich, ganz tief durchzuatmen. Was er sah und fühlte, konnten eigentlich nur von einem sehr mächtigen Vampir erzeugte Halluzinationen sein. Und falls es so war, konnte er seine Brüder nicht um Hilfe rufen, bis er wusste, ob er nicht nur der Köder war, um auch sie in das Netz hineinzuziehen.
Er presste beide Hände an seine Schläfen und zwang sich, sich zu konzentrieren. Er würde sich erinnern. Er war ein alter, mächtiger Karpatianer, der von dem früheren Prinzen Vlad auf Vampirjagd geschickt worden war. Vlads Sohn Mikhail hatte schon Jahrhunderte zuvor die Führung ihres Volkes übernommen. Manolito konnte spüren, wie sich das Bild zusammenfügte, als seine Erinnerungen nach und nach zurückkehrten. Er war weit entfernt gewesen von seinem Zuhause in Südamerika, weil er von dem Prinzen zu einer Versammlung in den Karpaten gerufen worden war, einer Feier des Lebens, zu Ehren von Jacques’ Gefährtin, die ein Kind zur Welt brachte. Doch nun schien er in einem ihm vertrauten Teil des Regenwaldes zu sein. War es möglich, dass er das nur träumte? Er hatte noch nie geträumt, soweit er sich erinnern konnte. Wenn ein karpatianischer Mann Ruhe in der Erde suchte, stellte er die Tätigkeit seiner Lungen und seines Herzens ein und schlief wie ein Toter. Wie konnte er da träumen?
Wieder riskierte er einen Blick auf seine Umgebung. Sein Magen verkrampfte sich, da die grellen Farben ihn blendeten und ihm Kopfschmerzen und Übelkeit verursachten. Nach Jahrhunderten, in denen seine Augen immer nur Schwarz, Weiß und Grautöne gesehen hatten, enthielt der Dschungel um ihn herum nun viel zu aggressive Farben mit seinen leuchtenden Grüntönen und einer wahren Orgie farbenfroher Blumen zwischen den Schlingpflanzen, die sich an den Bäumen emporrankten. Sein Herz sprengte ihm fast die Rippen, und seine Augen brannten. Blutstropfen rannen ihm wie Tränen über das Gesicht, als er die Augen zusammenkniff und versuchte, seine Benommenheit und das Schwindelgefühl unter Kontrolle zu bringen, während er den Regenwald betrachtete.
Gefühle stürmten auf ihn ein. Er schmeckte Furcht auf seiner Zunge, was er nicht mehr erlebt hatte, seit er ein Knabe gewesen war. Was ging hier vor? Manolito bemühte sich, Ordnung in das ungewohnte Durcheinander in seinem Kopf zu bringen, alles Überflüssige daraus zu entfernen und sich auf das zu konzentrieren, was er von seiner Vergangenheit noch wusste. Er hatte sich gerade noch rechtzeitig vor eine menschliche, von einem Dämon besessene Frau geworfen, als sie ein vergiftetes Messer nach Jacques’ und Sheas ungeborenem Kind geschleudert hatte. Noch immer spürte er den Schock beim Eindringen der Klinge, das Zerreißen seines Fleischs unter der gezackten Schneide, die seine Organe durchschnitten und ihm den Bauch aufgerissen hatte. Feuer hatte sein Innerstes in Brand gesetzt und sich sehr schnell verbreitet, als das Gift sich einen Weg durch seinen Kreislauf gebahnt hatte.
Sein Blut floss in Strömen, und das Licht verblasste schnell. Er hörte aufgeregte Stimmen, spürte, wie seine Brüder nach ihm griffen, um ihn auf der Erde festzuhalten. Das hatte er sehr deutlich in Erinnerung, die Stimmen seiner Brüder, die ihn anflehten – nein, ihm befahlen, bei ihnen zu bleiben. Aber er hatte sich in einem dunklen Reich befunden, in dem Banshees heulten und Schatten aufzuckten und nach ihm griffen. Skelette. Dunkle spitze Zähne. Klauen mit scharfen Krallen. Spinnen und Kakerlaken. Zischelnde Schlangen. Die Skelette kamen immer näher, bis …
Manolito verschloss sein Bewusstsein vor seiner Umgebung und auch sämtliche allgemeine Kommunikationspfade, um zu verhindern, dass irgendjemand seine eigenen Ängste schüren konnte. Es mussten Halluzinationen sein, die durch das Gift an jener Messerklinge verursacht worden waren. Denn obwohl er seinen Geist vor jedem weiteren Eindringen verschlossen hatte, war irgendetwas Böses dort bereits präsent.
Feuer umringte ihn, prasselnde Flammen flammten gierig auf und streckten sich wie obszöne Zungen nach ihm aus. Aus der Feuersbrunst traten Frauen, Frauen, die er im Laufe der Jahrhunderte benutzt hatte, um sich zu nähren, und die schon lange tot waren für die Welt. Sie begannen, ihn von allen Seiten zu bedrängen. Mit ausgestreckten Armen und weit aufgerissenen Mündern beugten sie sich zu ihm vor und ließen ihn durch eng anliegende, tief ausgeschnittene Kleider ihre freizügig dargebotenen Reize sehen. Sie lächelten und winkten ihm mit großen, erwartungsvollen Augen, und das Blut, das seitlich an ihrem Nacken hinunterlief, war so … verlockend, dass der Hunger in Manolito sich verschärfte und ihn schier rasend werden ließ vor Hunger.
Die Frauen, die das zu spüren schienen, riefen ihn und versuchten, ihn in ihren Bann zu ziehen, indem sie stöhnten, sich wie in sexueller Ekstase wanden und sich auf anzüglichste Weise selbst berührten.
»Nimm mich, Manolito«, lockte eine.
»Ich gehöre dir«, rief eine andere und streckte bittend ihre Hände nach ihm aus.
Der Hunger zwang ihn aufzustehen. Er konnte schon die köstliche warme Flüssigkeit auf seiner Zunge spüren und war verzweifelt bemüht, sein inneres Gleichgewicht wiederherzustellen. Dazu brauchte er Blut, und diese Frauen würden es ihm geben. Manolito lächelte sie an, mit diesem langsamen, verführerischen Lächeln, das der Beutenahme stets vorausging. Als er einen Schritt vortrat, stolperte er, und seine innere Anspannung verschärfte sich zu einem schmerzhaften Stechen in seinem Magen. Er konnte sich gerade noch mit einer Hand auf dem Boden abstützen, bevor er fiel. Aber der Boden bewegte sich, und plötzlich konnte er die Gesichter der Frauen in der Erde und dem verfaulenden Laub sehen. Die fruchtbare schwarze Erde verlagerte sich, bis Manolito umringt war von diesen Gesichtern, deren Augen ihn mit anklagenden Blicken maßen.
»Du hast mich getötet. Mich umgebracht.« Die vorwurfsvollen Worte waren leise, aber eindringlich, die Münder wie in sprachlosem Entsetzen aufgerissen.
»Du hast meine Liebe genommen, alles, was ich zu geben hatte, und mich dann verlassen«, beschuldigte ihn eine andere Stimme.
»Du schuldest mir deine Seele«, erklärte eine dritte.
Manolito wich mit einem warnenden Fauchen vor ihnen zurück. »Ich habe euch nie berührt, außer um mich an euch zu nähren.« Aber er hatte sie dazu gebracht zu glauben, er hätte es getan. Er und seine Brüder suggerierten den Frauen, sie seien verführt worden, doch in Wahrheit hatten sie ihre Gefährtinnen des Lebens niemals hintergangen – selbst wenn sie sie noch nicht gefunden hatten. In all den Jahrhunderten nicht. Das war eine ihrer geheiligten Regeln. Und Manolito hatte auch nie eine Unschuldige angerührt. Die Frauen, von deren Blut er sich genährt hatte, waren alle leicht zu durchschauen gewesen und ihre Gier nach seinem Namen und seiner Macht nur allzu offensichtlich. Er hatte die Beziehungen zu ihnen sorgfältig gepflegt und sie in ihren Fantasien ermutigt, sie aber niemals körperlich berührt, außer um ihr Blut zu sich zu nehmen.
Er schüttelte den Kopf, als das Heulen lauter, die gespenstischen Erscheinungen hartnäckiger und ihre Augen vor grimmiger Entschlossenheit noch schmaler wurden. Er straffte seine Schultern und sah die Frauen mit ruhiger Bestimmtheit an. »Ich lebe von Blut und habe mir genommen, was mir von euch angeboten wurde. Aber ich habe niemanden getötet. Also geht wieder und nehmt eure Beschuldigungen mit. Ich habe weder meine Ehre noch meine Familie oder mein Volk je verraten.«
Er hatte viele Sünden zu verantworten, viele schlimme Taten befleckten seine Seele, doch nicht das, was diese wollüstigen Frauen mit ihren gierigen Mündern ihm vorwarfen. Er fletschte die Zähne, hob stolz den Kopf und blickte ihnen ruhig in die kalten Augen. Seine Ehre war intakt. Man konnte ihm vieles nachsagen. Sie konnten ihn in tausend anderen Dingen richten und etwas zu bemängeln finden, aber er hatte nie eine Unschuldige angerührt. Und er hatte auch keiner Frau erlaubt zu denken, er würde sich vielleicht in sie verlieben. Er hatte treu auf seine Gefährtin des Lebens gewartet, obwohl er wusste, dass die Möglichkeiten, sie zu finden, sehr gering waren. Ungeachtet dessen, was die Welt über ihn denken mochte, hatte es keine anderen Frauen für ihn gegeben. Und so würde es auch bleiben. Ganz gleich, was seine anderen Fehler waren, seine Gefährtin, die Frau, die ihm bestimmt war, würde er niemals hintergehen. Weder mit Worten noch mit Taten, ja nicht einmal im Geiste.
Auch wenn er fast schon nicht mehr daran glaubte, dass sie je geboren werden würde.
»Geht mir aus den Augen. Ihr seid zu mir gekommen, weil ihr Geld und Macht wolltet. Es war keine Liebe eurerseits, kein wahres Interesse außer dem, Reichtum und Ansehen zu erlangen. Ich habe euch Erinnerungen zurückgelassen, auch wenn es falsche waren, im Austausch für euer Leben spendendes Blut. Euch wurde nichts zuleide getan, und im Grund habt ihr sogar unter meinem Schutz gestanden. Ich schulde euch nichts, schon gar nicht meine Seele. Und ich werde mich auch nicht von Kreaturen wie euch verurteilen lassen.«
Die Frauen schrien auf, als die Schatten sich verlängerten und schwarze, wie Kettenglieder aussehende Streifen über ihre Körper warfen. Arme streckten sich nach ihm aus, aus deren Fingernägeln lange Krallen wuchsen, und Rauch begann, ihre sich windenden Gestalten zu umnebeln.
Manolito schüttelte den Kopf und blieb fest in seiner Entschlossenheit, seine vermeintlichen Missetaten zu leugnen. Er war Karpatianer und brauchte eben Blut zum Überleben – so einfach war das. Er hatte die Gebote seines Prinzen befolgt und andere Spezies beschützt. Und obwohl es stimmte, dass er getötet hatte und sich mit seinen Fähigkeiten und seiner Intelligenz anderen oft überlegen gefühlt hatte, hatte er den Platz für seine Gefährtin immer freigehalten und sich diesen einen Funken Menschlichkeit bewahrt, für den Fall, dass er sie doch noch finden sollte.
Er dachte nicht daran, sich verurteilen zu lassen von diesen Frauen mit ihrem raffinierten Lächeln und makellosen Körpern, die nur so freizügig zur Schau gestellt wurden, um sich einen reichen Mann zu angeln, nicht aus Liebe, sondern nur aus purer Habgier – und trotzdem spürte er, wie Kummer ihn erfasste. Grausamer, überwältigender Kummer bestürmte ihn und stahl sich in sein Herz und seine Seele, sodass er sich müde und verloren fühlte und sich nur noch nach dem süßen Trost und dem Vergessen der Erde sehnte.
Um ihn herum wurde das Heulen lauter, doch unter den Schatten wirkten die Formen und Farben der Gesichter verschwommener. Einige Frauen zerrten an ihren Kleidern und flüsterten ihm einladende Worte zu.
Manolito funkelte sie nur böse an. »Ich habe kein Interesse an euren Reizen.«
Fühl mich. Berühr mich, und du wirst wieder etwas empfinden. Meine Haut ist zart. Ich kann dir den Himmel auf Erden zeigen. Du brauchst mir nur noch einmal deinen Körper zu überlassen, dann wirst von mir so viel Blut bekommen, wie du willst.
Schatten bewegten sich überall um ihn, und die Frauen krochen aus dem Blattwerk und den Schlingpflanzen hervor, stiegen aus der Erde selbst empor und streckten verführerisch lächelnd ihre Hände nach ihm aus.
Manolito empfand etwas … aber es war ein derartiger Abscheu, dass er die Zähne bleckte und den Kopf schüttelte. »Ich würde sie nie betrügen«, sagte er. »Eher würde ich verhungern.« Was er sagte, klang wie ein Fauchen, ein warnendes Knurren, das tief aus seiner Kehle kam, und es war ihm völlig ernst damit.
»Ein solcher Tod würde zur ewig währenden Qual.« Die Stimmen waren jetzt nicht mehr so verführerisch, sondern eher verzweifelt, quengelig und mehr nervös als anklagend.
»Dann sei es so. Ich werde keinen Verrat an ihr begehen.«
»Das hast du schon getan!«, schrie eine der Frauen. »Du hast ihr ein Stück ihres Herzens gestohlen. Du hast es ihr gestohlen und kannst es ihr nicht mehr zurückgeben.«
Manolito durchforschte sein unvollständiges Gedächtnis. Für einen Moment nahm er den Anflug eines Duftes wahr, eines Duftes nach etwas Sauberem und Frischem zwischen all dem Verfall und dem Verwesungsgeruch um ihn herum. Er konnte sie auf seiner Zunge spüren. Sein Herz schlug wieder stark und regelmäßig. Alles in ihm entkrampfte sich. Seine Gefährtin existierte!
Er atmete tief ein und wieder aus, um die aufdringlichen Schatten zu vertreiben, aber ein sogar noch tieferer Schmerz durchzuckte ihn. »Sollte ich tatsächlich eine solche Verfehlung gegen sie begangen haben, werde ich tun, was immer sie auch will.« Hatte er sich so an ihr versündigt, dass sie ihn verlassen hatte? War das der Grund für diesen merkwürdigen Kummer, der ihm das Herz so schwer machte?
Die Gesichter um ihn herum lösten sich auf, als die Gestalten noch mehr verschwammen, bis sie nur noch heulende Schatten waren und endlich auch die Übelkeit in seinem Magen nachließ, obwohl sein Hunger inzwischen so groß war, dass er ihn von innen her geradezu zerfraß.
Er hatte eine Gefährtin. An diese Gewissheit klammerte er sich nun. Eine schöne, vollkommene Frau, die dazu geboren war, seine Gefährtin des Lebens zu sein. Geboren für ihn. Für ihn allein … Seine Raubtierinstinkte erwachten schnell und scharf. Ein Knurren entrang sich seiner Brust, und der allgegenwärtige Hunger bohrte und nagte immer unerbittlicher an seinen Eingeweiden, um seinen Forderungen Nachdruck zu verleihen. Manolito hatte Jahrhunderte ohne Farben gelebt, eine lange, emotionslose Zeit, die sich immer weiter ausgedehnt hatte, bis sich der Dämon erhoben hatte und er nicht mehr die Kraft oder den Wunsch gehabt hatte, dagegen anzukämpfen. Er war so nahe daran gewesen, sich der Finsternis zu überlassen! Das Töten war zu etwas Alltäglichem und die bloße Nahrungsaufnahme immer schwieriger geworden. Jedes Mal, wenn er seine Zähne in lebendiges Fleisch geschlagen und das pulsierende Leben in Venen gefühlt hatte, hatte er sich gefragt, ob dies der Moment sein würde, in dem er seine Seele endgültig verlor.
Manolito erschauderte, als die Stimmen in seinem Kopf wieder lauter wurden und selbst die Geräusche des Dschungels übertönten. Ein stechender Schmerz erwachte hinter seinen Augen, der zu einem unerträglichen Brennen wurde. Waren es die Farben? Sie, seine Gefährtin, hatte ihn wieder Farben sehen lassen. Wo war sie? Hatte sie ihn verlassen? Die Fragen stürmten schnell und laut auf ihn ein und vermischten sich mit den Stimmen, bis er versucht war, seinen Kopf gegen den nächsten Baum zu schlagen. Sein Gehirn schien ebenso in Flammen zu stehen wie jedes andere Organ in seinem Körper.
Vampirblut? Es brannte wie Säure. Manolito wusste das, weil er Hunderte, ja, vielleicht sogar Tausende von Vampiren gejagt und getötet hatte. Einige waren Jugendfreunde von ihm gewesen, und er konnte sie in seinem Kopf jetzt schreien hören. In Ketten liegend und verbrannt. Von endlosem Kummer und Verzweiflung zerfressen. Das Herz zersprang ihm fast in seiner Brust, und er ließ sich wieder auf der fruchtbaren Erde nieder, in der er gelegen hatte, und versuchte, sich darüber klar zu werden, was real und was Halluzination waren. Als er die Augen schloss, befand er sich in einer Grube, umgeben von Schatten und roten Augen, die ihn hungrig anstarrten.
Vielleicht war es nur eine Illusion. Alles. Wo er war. Die leuchtenden Farben. Die Schatten. Vielleicht war sein Wunsch nach einer Gefährtin des Lebens so stark, dass er sich in seiner Fantasie eine erschaffen hatte. Oder schlimmer noch – ein Vampir hatte eine für ihn erschaffen.
Manolito. Du bist zu früh aufgewacht. Du solltest noch ein paar Wochen länger in der Erde ruhen. Gregory sagte, wir sollten dafür sorgen, dass du dich nicht zu früh erhebst.
Manolito riss die Augen auf und sah sich misstrauisch um. Die Stimme hatte den gleichen Klang wie die seines jüngsten Bruders Riordan, war aber verzerrt und langsam und jedes Wort so stark gedehnt, dass sie, statt ihm vertraut zu erscheinen, geradezu dämonisch klang. Manolito schüttelte den Kopf und versuchte aufzustehen. Aber sein sonst so geschmeidiger und kräftiger Körper fühlte sich ganz eigenartig ungelenk und fremd an, als er auf die Knie zurückfiel, weil er nicht die Kraft hatte zu stehen. Sein Magen zog sich zusammen, und Übelkeit stieg wieder in ihm auf. Das Brennen verbreitete sich in seinem Kreislauf.
Riordan. Ich weiß nicht, was mit mir geschieht. Er benutzte den Kommunikationsweg, auf dem nur er und sein jüngster Bruder sich verständigten. Und er war sehr sorgfältig darauf bedacht, nichts von seiner Energie von diesem Pfad abweichen zu lassen. Denn sollte dies hier eine raffinierte Falle sein, wollte er Riordan nicht mit hineinziehen. Dazu liebte er seinen Bruder viel zu sehr.
Bei dem Gedanken stockte ihm das Herz.
Liebe.
Er empfand Liebe für seine Brüder! Und eine so überwältigende, reale und intensive Liebe, dass es ihm den Atem raubte, als hätte sich das Gefühl im Laufe der Jahrhunderte hinter einer stabilen Barriere, wo er es nicht erreichen konnte, angesammelt und immer mehr gefestigt. Es gab nur einen Menschen auf der Welt, der wieder Gefühle in ihm wecken konnte. Die Frau, auf die er Jahrhunderte gewartet hatte.
Seine Gefährtin des Lebens.
Er presste seine Hand ganz fest auf seine Brust. Jetzt konnte kein Zweifel mehr bestehen, dass sie real war. Die Fähigkeit, Farben zu sehen, Gefühle zu verspüren: All die Sinne, die er in den ersten zweihundert Jahren seines Lebens verloren hatte, waren ihm zurückgegeben worden. Von ihr.
Aber warum konnte er sich dann nicht an die wichtigste Frau in seinem Leben erinnern? Warum konnte er sie sich nicht vorstellen? Und warum waren sie getrennt? Wo war sie?
Du musst wieder unter die Erde, Manolito. Du kannst noch nicht zurück. Du hast einen langen Weg vom Baum der Seelen hinter dir. Aber deine Reise ist noch nicht beendet. Du musst dir noch mehr Zeit lassen.
Manolito zog sich augenblicklich aus der Reichweite seines Bruders zurück. Es war der richtige Verständigungsweg, und auch die Stimme wäre dieselbe, wenn sie nicht so langsam wäre. Aber die Worte … die Erklärung war völlig falsch gewesen. Es musste so sein. Man konnte nicht zum Baum der Seelen gehen, solange man nicht tot war. Und er war nicht tot. Sein Herz pochte laut – zu laut. Und auch der Schmerz in seinem Körper war real. Er war vergiftet worden. Das Brennen verriet ihm, dass sich das Gift noch immer in seinem Kreislauf befand. Doch wie konnte das sein, wenn er richtig behandelt worden war? Gregori war der größte Heiler, den das karpatianische Volk je gekannt hatte. Er hätte nicht zugelassen, dass Gift in Manolitos Körper zurückblieb, egal, wie viel er selbst dabei riskierte.
Manolito zog sein Hemd hoch und starrte auf die Narben an seiner Brust. Karpatianer behielten fast nie Narben zurück. Die Wunde befand sich über seinem Herzen und war von einer hässlichen, ausgezackten Narbe bedeckt, die Bände sprach. Es war ein tödlicher Messerstich gewesen.
Konnte das wahr sein? War er gestorben und in die Welt der Lebenden zurückgeholt worden? Von einer solchen Leistung hatte er noch nie gehört. Gerüchte über solche Dinge gab es natürlich viele, aber er hatte nicht gewusst, dass es tatsächlich möglich war. Und was war mit seiner Gefährtin? Sie würde ihn doch begleitet haben auf der Reise. Panik vermischte sich mit seiner Verwirrung und dem Kummer, der ihm so schwer zu schaffen machte.
Manolito.
Riordans Stimme klang jetzt fordernder, war jedoch nach wie vor verzerrt und langsam.
Manolito riss den Kopf hoch und begann zu zittern. Die Schatten fingen wieder an, sich zu bewegen, und huschten durch die Bäume und das Gesträuch. Jeder Muskel in seinem Körper verkrampfte sich vor innerer Erregung. Was nun? Diesmal spürte er die Gefahr, als Schatten um ihn herum Gestalt annahmen und ihn einzukreisen begannen. Dutzende von ihnen, Hunderte, ja, Tausende sogar, sodass keine Möglichkeit zur Flucht bestand. Rote Augen funkelten ihn voller Hass und Bosheit an. Sie schwankten, als wären ihre Körper zu transparent und dünn, um der leichten Brise standzuhalten, die das Blätterdach über ihnen bewegte. Sie waren Vampire, jeder Einzelne von ihnen.
Manolito erkannte sie. Einige waren nach karpatianischen Maßstäben noch verhältnismäßig jung und andere schon sehr alt. Manche waren Jugendfreunde, andere Lehrer und Mentoren. Er hatte jeden Einzelnen von ihnen ohne Mitleid oder Schuldgefühl getötet. Er hätte es schnell, brutal und auf jede nur mögliche Art getan.
Einer zeigte anklagend mit dem Finger auf ihn, ein anderer zischte und fauchte wütend. Ihre tief in den Höhlen liegenden Augen waren gar keine Augen mehr, sondern nur noch glühende, blutige Flecken puren Hasses.
»Du bist wie wir. Du gehörst zu uns. Schließ dich uns an«, rief einer.
»Du hältst dich für etwas Besseres. Aber sieh uns doch mal an! Du hast wieder und wieder getötet, wie eine Maschine, ohne Rücksicht auf die Folgen.«
»Wie sicher du dir immer warst! Und dabei hast du die ganze Zeit über deine Brüder umgebracht.«
Für einen Moment schlug Manolito das Herz so hart gegen die Rippen, dass es ihm schier die Brust zu sprengen drohte. Schmerz bedrückte ihn, und Schuldgefühle quälten ihn. Er hatte getötet. Und er hatte nichts dabei gespürt, als er einen Vampir nach dem anderen gejagt und mit seinem überlegenen Verstand und seiner Intelligenz bekämpft hatte. Sie zu jagen und zu töten war notwendig. Wie er selbst darüber dachte, spielte keine Rolle. Es musste getan werden.
Er richtete sich zu seiner vollen Größe auf und zwang sich, gerade zu stehen, als sein Magen sich wieder vor Anspannung verkrampfte. Sein Körper fühlte sich anders an, bleierner irgendwie und schwerfälliger. Als er sein Gewicht von einem Fuß auf den anderen verlagerte, spürte er, wie er zu zittern anfing.
»Du hast dein Schicksal selbst gewählt, Toter. Ich war nur das Werkzeug der Gerechtigkeit.«
Die Köpfe auf den langen, spindeldürren Hälsen wurden zurückgeworfen, und Geheul zerriss die Luft. Über ihnen flogen Vögel aus den Bäumen auf und ergriffen die Flucht vor dem grauenhaften Lärm des immer lauter werdenden Gekreisches. Das Geräusch erschütterte auch Manolito bis ins Mark und schien sein Innerstes in eine geleeartige Masse zu verwandeln. Ein Vampirtrick, dessen war er sich ganz sicher. Im Grunde seines Herzens wusste er, dass sein Leben verwirkt war – sie waren zu viele, um sie zu töten –, aber er würde wenigstens so viele mitnehmen, wie er konnte, um die Welt ein für alle Mal von diesen gefährlichen und gewissenlosen Kreaturen zu befreien.
Der Magier muss einen Weg gefunden haben, die Toten wiederzuerwecken, teilte er Riordan im Geiste mit, damit er die Information an ihren ältesten Bruder weitergab. Zacarias würde dem Prinzen eine Warnung schicken, dass ganze Armeen von Untoten sich wieder einmal gegen sie erheben würden.
Bist du sicher?
Ich habe diese hier schon vor Jahrhunderten getötet, und trotzdem umzingeln sie mich mit ihren anklagenden Augen und winken mir, als gehörte ich zu ihnen.
Irgendwo in großer Ferne schnappte Riordan entsetzt nach Luft und hörte sich zum ersten Mal wie Manolitos geliebter Bruder an. Du darfst dich nicht dazu entschließen, ihnen deine Seele zu überlassen! Wir sind so nahe daran, Bruder, so kurz davor. Ich habe meine Gefährtin des Lebens gefunden und Rafael die seine. Es ist nur noch eine Frage der Zeit für dich. Du musst noch aushalten. Ich komme zu dir.
Manolito fauchte empört und warf den Kopf zurück, um in wilder Rage aufzubrüllen. Schwindler! Du bist nicht mein Bruder.
Manolito! Was sagst du da? Natürlich bin ich dein Bruder. Du bist krank. Ich komme zu dir, so schnell ich kann. Wenn die Vampire dich hinters Licht führen …
Wie du? Du hast einen schweren Fehler gemacht, du Scheusal. Ich habe schon eine Gefährtin des Lebens und muss ihr bereits begegnet sein. Ich sehe eure abscheulichen Erscheinungen in Farbe. Sie umringen mich mit blutbefleckten Zähnen und ihren schwarzen, verschrumpften und verdorrten Herzen.
Du hast keine Gefährtin, sagte Riordan entschieden. Du hast nur von ihr geträumt.
Du kannst mich mit deiner Arglist nicht in die Falle locken. Geh zu deinem Marionettenspieler und sag ihm, dass ich nicht so leicht zu fassen bin. Manolito brach sofort die Kommunikation ab und blockierte alle privaten und öffentlichen Zugänge zu seinem Geist.
Dann fuhr er herum zu seinen Feinden, all den Gesichtern aus seiner Vergangenheit. Es waren so viele, dass er wusste, was ihn erwartete: der Tod. »Dann kommt und tanzt mit mir, wie ihr es so oft getan habt«, forderte er sie auf und winkte ihnen mit einem Finger.
Die am nächsten vor ihm stehenden Vampire heulten auf, Speichel rann ihnen über die Gesichter, und die Löcher, die sie anstelle von Augen hatten, glühten auf vor Hass. »Schließ dich uns an, Bruder. Du bist einer von uns.«
Sie schwankten, als sie sich in dem seltsamen, tranceähnlichen Rhythmus der Untoten in seine Richtung zu bewegen begannen. Er hörte, wie sie ihn riefen, aber das Geräusch war mehr in seinem Kopf als außerhalb davon. Ihr Gewisper und Gemurmel vernebelte ihm das Gehirn. Manolito schüttelte den Kopf, um Klarheit zu gewinnen, doch die Geräusche blieben.
Die Vampire kamen näher, und jetzt konnte er schon das Rascheln von zerlumpter Kleidung hören, zerfetzt und grau vom Alter, die seine Haut streifte. Wieder schreckte ihn das Gefühl von Insekten auf, die über seine Haut krabbelten. Er fuhr herum und versuchte, den Feind im Blick zu behalten, während die Stimmen immer lauter und klarer wurden.
»Komm zu uns. Fühl wieder etwas. Du bist so ausgehungert, dass wir das Stocken deines Herzens spüren können. Du brauchst frisches Blut. Mit Adrenalin versetztes ist das Beste. Du kannst es fühlen.«
»Schließ dich uns an!«, beschworen sie ihn, und ihre Stimmen wurden lauter und lauter und schwollen zu einer gewaltigen Welle an, die Manolito von allen Seiten überschwemmte.
»Frisches Blut. Du brauchst es, um zu überleben. Nur ein wenig. Ein Schlückchen. Und dann diese wundervolle Furcht … Lass deine Opfer Furcht verspüren, und der Rausch ist wie nichts, was du je zuvor empfunden hast.«
Die Versuchung verschärfte Manolitos Hunger, bis er nicht mehr in der Lage war, über den roten Dunst in seinem Gehirn hinauszudenken.
»Sieh dich doch an, Bruder – sieh dir dein Gesicht an!«
Er fand sich auf dem Boden wieder, auf Händen und Füßen, als hätten sie ihn gestoßen, aber er hatte keinen Stoß gespürt. Seine Gesichtshaut war so straff, dass jeder seiner Knochen darunter sichtbar war. Sein Mund war protestierend aufgerissen, doch nicht nur seine Schneidezähne, sondern auch seine Eckzähne waren lang und scharf geworden vor Erwartung.
Er hörte einen Herzschlag, stark und ruhig, der ihn lockte und rief. Ihm lief das Wasser im Mund zusammen. Er war verzweifelt – so hungrig, dass er nichts anderes tun konnte, als auf die Jagd zu gehen. Er musste eine Beute finden. Musste in einen weichen, warmen Hals beißen, bis das heiße Blut in seinen Mund quoll, seine Organe und Zellgewebe durchflutete und ihm die enorme Kraft und Macht seiner Spezies zurückgab. Er konnte an nichts anderes mehr denken als an das furchtbare Ansteigen des Hungers, der, einer Flutwelle gleich, in ihm aufwallte, um ihn zu überrollen.
Der Herzschlag wurde lauter, und er wandte langsam den Kopf, als eine Frau auf ihn zugestoßen wurde. Sie sah verängstigt aus … und unschuldig. Ihre Augen waren dunkel vor Entsetzen. Manolito konnte das Adrenalin riechen, das in ihren Adern brodelte.
»Schließ dich uns an … Schließ dich uns an …«, wisperten die Stimmen, bis das Geräusch zu einem hypnotischen Gesang anschwoll.
Er brauchte gutes, frisches Blut zum Überleben. Er verdiente es zu leben. Was war sie schon? Schwach und furchtsam. Konnte sie die menschliche Rasse vor den Ungeheuern retten, die sich ihrer bemächtigten? Die Menschen glaubten nicht an ihre Existenz. Und wenn sie von Manolito wüssten, würden sie …
»Dich töten«, zischte einer der Vampire.
»Dich foltern«, fügte ein anderer hinzu. »Sieh doch nur, was sie dir angetan haben. Du verhungerst. Wer hat dir geholfen? Deine Brüder? Menschen? Wir haben dir heißes Blut gebracht, um dich zu stärken – und am Leben zu erhalten?«
»Nimm sie, Bruder, und schließe dich uns an.«
Wieder stießen sie die Frau nach vorn. Sie schrie auf, stolperte und fiel gegen Manolito. Sie fühlte sich warm und lebendig an seinem kalten Körper an. Ihr Herz schlug wie wild und verlockte ihn, wie nichts anderes es vermochte. Der Puls an ihrem Nacken zuckte, und er roch die Furcht, die sie beherrschte, und konnte das Blut durch ihre Adern rauschen hören, heiß und süß und Leben spendend.
Er konnte nicht sprechen, um sie zu beschwichtigen; sein Mund war zu voll von seinen sich verlängernden Zähnen und seine Kehle zu eng von dem Bedürfnis, seine Lippen an ihren warmen Hals zu pressen. Er zog sie noch näher, bis ihr viel kleinerer Körper fast verschluckt wurde von seinem. Ihr Herz begann, im Rhythmus seines eigenen zu schlagen. Die Luft entwich in einem gequälten Aufstöhnen ihren Lungen.
Manolito war sich der immer näher kommenden Vampire bewusst, des Schlurfens ihrer Füße, der dunklen Höhlen ihrer vor Erwartung aufgerissenen Münder, aus denen Speichelfäden rannen, und der unverhohlenen Schadenfreude in ihren mitleidlosen Augen. Stille breitete sich aus, nur das schwere Atmen des verängstigten Mädchens und sein dröhnender Herzschlag waren noch zu hören. Manolito beugte seinen Kopf noch weiter vor, angelockt von dem Geruch von Blut.
Er war völlig ausgehungert. Ohne Blut würde er außerstande sein, sich zu verteidigen. Er brauchte es. Er verdiente es. Er hatte Jahrhunderte damit verbracht, Menschen zu verteidigen – Menschen, die verabscheuten, was er war, Menschen, die seine Spezies fürchteten …
Manolito schloss die Augen und zwang sich, das Geräusch dieses süßen, verlockenden Herzschlags aus seinem Bewusstsein auszublenden. Das Gewisper war in seinem Kopf. In seinem Kopf. Er fuhr herum und schob das Mädchen hinter sich. »Ich werde es nicht tun! Sie ist unschuldig und wird nicht auf diese Art missbraucht werden.« Weil sein Hunger viel zu groß war und er dann vielleicht nicht mehr aufhören würde. Er würde gegen sie alle kämpfen müssen, doch das Mädchen konnte er vielleicht noch retten.
Aber hinter ihm schlang die junge Frau ihre Arme um seinen Nacken, presste ihren üppigen weiblichen Körper an seinen und ließ ihre Hände zu seiner Brust hinuntergleiten, zu seinem Bauch und tiefer, bis sie streichelnd ihre Finger um ihn schloss und neben Hunger auch noch Lust in ihm entfachte. »So unschuldig bin ich gar nicht, Manolito. Ich gehöre dir, mit Leib und Seele. Ich bin dein. Du brauchst mich nur zu kosten. Ich kann das alles vergehen lassen.«
Mit einem wütenden Fauchen fuhr Manolito herum und stieß die junge Frau von sich weg. »Geh! Geh zu deinen Freunden und halt dich von mir fern!«
Sie lachte, bewegte obszön die Hüften und berührte sich. »Du brauchst mich.«
»Ich brauche meine Gefährtin. Sie wird zu mir kommen und mir alles geben, was ich benötige.«
Das Gesicht der Frau veränderte sich, ihr Lachen verblasste, und sie raufte sich frustriert die Haare. »Du kannst diesem Ort nicht entkommen. Du bist einer von uns. Du hast sie hintergangen und verdienst es hierzubleiben.«
Davon wusste er nichts – und er erinnerte sich auch an nichts. Aber alle Verlockungen der Welt würden ihn nicht umstimmen können. Wenn er jahrhundertelang ohne Stärkung auskommen und die ganze damit verbundene Qual ertragen musste, dann sei es eben so, doch er würde seine Gefährtin nicht verraten. »Du hättest besser daran getan, mich zu verleiten, jemand anderen zu verraten«, sagte er zu der Frau. »Nur meine Gefährtin kann mich als ihrer unwürdig befinden. So steht es geschrieben in unseren Gesetzen. Nur sie kann mich verurteilen.«
Er musste irgendetwas Schreckliches getan haben. Dies war nun schon der zweite Vorwurf dieser Art, und die Tatsache, dass seine Gefährtin nicht an seiner Seite kämpfte, war sehr aufschlussreich. Er konnte sie nicht zu sich rufen, weil er sich an zu wenig erinnerte – und ganz gewiss an keine Sünde, die er gegen sie begangen hatte. Er erinnerte sich an ihre Stimme, die weich und melodiös war wie die eines Engels – nur dass sie sagte, sie wolle nichts mit einem karpatianischen Mann zu tun haben.
Sein Herz schlug schneller. Hatte sie ihn zurückgewiesen, als er sie für sich beansprucht hatte? Und hatte er sie dann ohne ihre Einwilligung an sich gebunden? Das wurde in seiner Gesellschaft akzeptiert, zum Schutz des Mannes, wenn die Frau nicht willig war. Das war kein Verrat. Was konnte er also verbrochen haben? Er hätte seine Gefährtin mit seinem Leben beschützt, wie er Jacques’ Gefährtin beschützt hatte, mit seinem Leben und noch viel mehr, falls möglich.
Er war an einem Ort, wo über ihn gerichtet wurde, und bislang schien er nicht gut abzuschneiden, und vielleicht lag das ja daran, dass er sich nicht erinnerte? Er hob den Kopf und bleckte seine Zähne vor Hunderten, ja vielleicht sogar Tausenden von karpatianischen Männern, die sich dafür entschieden hatten, ihre Seelen aufzugeben und die Dunkelheit zu suchen. Sie hatten ihre eigene Spezies dezimiert und eine Gesellschaft und Lebensweise beinahe zerstört, und alles nur für den flüchtigen Rausch, etwas zu fühlen, statt sich ihre Ehre zu bewahren – und an der Hoffnung auf eine Gefährtin festzuhalten.
»Ich unterwerfe mich nicht eurer Rechtsprechung. Ich werde nie zu euch gehören. Ich mag meine Seele befleckt haben, vielleicht sogar ohne Aussicht auf Erlösung, aber ich werde weder sie noch meine Ehre je freiwillig aufgeben, so wie ihr es getan habt. Ich mag alles sein, was ihr mir vorwerft, doch ich werde meiner Gefährtin des Lebens gegenübertreten, nicht euch, und sie entscheiden lassen, ob meine Sünden mir vergeben werden können.«
Die Vampire zischten wütend, und dürre Finger zeigten wieder anklagend auf ihn, aber sie griffen ihn nicht an. Das ergab keinen Sinn – so zahlreich wie sie waren, hätten sie ihn mühelos vernichten können –, doch ihre Gestalten schwankten und begannen sich langsam aufzulösen, sodass es schwierig war, die Untoten von den normalen Schatten in der Dunkelheit des Regenwaldes zu unterscheiden.
Ein Prickeln lief über Manolitos Nacken, und er fuhr herum. Die Vampire zogen sich tiefer ins Dickicht zurück und verschwanden zwischen den dicht belaubten Pflanzen. Sein Magen brannte, und sein Körper schrie nach Nahrung, doch seine Verwirrung war größer noch als je zuvor. Die Vampire hatten ihn in eine Falle gelockt. Er war umgeben von Gefahr, das konnte er an der ungewohnten Stille ringsum merken. Nicht das kleinste Anzeichen von Leben war zu hören. Kein Geflatter von Flügeln, kein Rascheln im Unterholz. Er hob den Kopf und schnupperte die Luft. Sie war still, ganz still, und dennoch war da etwas …
Es war mehr sein Instinkt als ein Geräusch, was Manolito warnte. Noch immer auf den Knien, fuhr er herum und riss abwehrend die Hände hoch, als der große Jaguar ihn ansprang.
2. Kapitel
Eine klinische Depression war heimtückisch, das sich an einen Menschen heranschlich und ihn überfiel, bevor er es merkte und auf der Hut davor sein konnte. MaryAnn Delaney wischte sich Tränen vom Gesicht, als sie die Liste von Symptomen durchging. »Traurigkeit«. Kreuz das an. Vielleicht sogar gleich zweimal.
Traurigkeit war nicht das Wort, mit dem sie die furchtbare Leere in sich beschreiben würde, die sie nicht überwinden konnte, aber es stand in ihrem Buch, und deshalb würde sie es der wachsenden Liste ihrer Symptome hinzufügen. Sie war so gottverdammt traurig, dass sie nicht aufhören konnte zu weinen. Und »Appetitlosigkeit« konnte sie auch ankreuzen, da der bloße Gedanke an Essen ihr schon Übelkeit verursachte. Und sie hatte auch nicht mehr schlafen können, seit …
Sie schloss die Augen und stöhnte. Manolito De La Cruz war ein Fremder. Sie hatte kaum ein Wort mit ihm gewechselt, doch als sie seinen Tod – seine Ermordung – mit angesehen hatte, war sie innerlich zerbrochen. Sie schien sogar mehr um ihn zu trauern als seine eigene Familie. MaryAnn wusste, dass sie sehr betroffen waren, doch sie ließen sich überhaupt nur selten ein Gefühl anmerken, und sie sprachen auch so gut wie nie von ihm. Sie hatten seine sterblichen Überreste im selben privaten Jet zurückgebracht, mit dem sie später auch zu ihrer Ranch in Brasilien zurückgeflogen waren, aber sie hatten ihn nicht mitgenommen zu der Ranch.
Stattdessen war die Maschine – mit MaryAnn an Bord – auf einer privaten tropischen Insel irgendwo im Amazonasbecken gelandet. Und anstatt Manolito eine anständige Beerdigung zuteilwerden zu lassen, hatten seine Brüder seinen Leichnam an irgendeinen geheimen Ort im Regenwald gebracht. MaryAnn konnte sich nicht einmal hinausschleichen und sein Grab besuchen. Wie verzweifelt und absurd war das? Mitten in der Nacht das Grab eines Fremden besuchen zu wollen, weil sie seinen Tod nicht überwinden konnte?
Wurde sie langsam auch noch paranoid, oder war sie zu Recht besorgt darüber, dass man sie zu einer Insel gebracht hatte, die nie jemand erwähnt hatte, als sie mit ihrer besten Freundin Destiny in den Karpaten gewesen war? Juliette und Riordan hatten sie gebeten zu kommen, um sich Juliettes jüngerer Schwester anzunehmen, die ein Opfer sexueller Gewalt geworden war, und sie hatten oft über die Ranch gesprochen, aber nie über ein Ferienhaus auf einer privaten Insel. Das Haus war von undurchdringlichem Regenwald umgeben. MaryAnn bezweifelte, dass sie ohne eine Landkarte und einen Führer auch nur zur Start-und-Lande-Bahn zurückfinden würde.
Sie war Psychologin, Herrgott noch mal, und trotzdem konnte sie nicht die nötige Disziplin aufbringen, um ihre wachsende Verzweiflung, ihre bösen Vorahnungen oder den schrecklichen, unerklärlichen Kummer über Manolitos Tod zu überwinden. Sie brauchte Hilfe. Als Psychologin wusste sie das, doch ihr Kummer wuchs und wuchs und setzte ihr gefährliche und beängstigende Gedanken in den Kopf. Sie wollte morgens nicht mehr aufstehen, und sie wollte auch weder das feudale Haus noch den üppigen Dschungel, der es umgab, erforschen. Sie wollte nicht einmal mehr in ein Flugzeug steigen und in ihr geliebtes Seattle zurückkehren. Sie wollte nur noch Manolito De La Cruz’ Grab finden und zu ihm hineinkriechen.
Was in Herrgotts Namen war nur los mit ihr? Normalerweise war sie ein Mensch, der an die Philosophie des halb vollen Glases glaubte. Sie war optimistisch genug, um an buchstäblich jeder Situation noch etwas Humorvolles oder Schönes finden zu können, doch seit jener Nacht, in der sie mit Destiny an der karpatianischen Feier teilgenommen hatte, war sie so deprimiert, dass sie kaum noch funktionieren konnte.
Zu Anfang hatte sie es noch geschafft, das zu verbergen. Alle waren so beschäftigt gewesen mit ihren Vorbereitungen für die Heimreise, dass sie gar nicht bemerkt hatten, wie still sie gewesen war. Und wenn doch, hatten sie es vielleicht für Schüchternheit gehalten. MaryAnn hatte sich bereit erklärt, nach Brasilien mitzukommen, in der Hoffnung, Juliettes jüngerer Schwester helfen zu können, bevor sie erkannt hatte, in welch großen emotionalen Schwierigkeiten sie selbst steckte. Sie hätte etwas sagen sollen, doch sie hatte nach wie vor geglaubt, der Kummer würde nachlassen. MaryAnn war mit der Familie De La Cruz in deren privatem Jet gereist – mit Manolitos Sarg darin. Während des Fluges hatten die De La Cruz’ geschlafen, wie sie es tagsüber immer taten, und sie hatte allein neben dem Sarg gesessen und geweint. Geweint, bis ihre Kehle wund gewesen war und ihre Augen gebrannt hatten. Es war ihr völlig unverständlich, aber sie schien einfach nicht damit aufhören zu können.
Ein Klopfen an der Tür schreckte sie aus ihren Gedanken auf und ließ ihr Herz gleich schneller schlagen. Sie hatte hier eine Aufgabe, und die Familie De La Cruz erwartete von ihr, dass sie sie auch erfüllte. Der Gedanke, jemand anderem helfen zu wollen, wo sie selbst nicht einmal die Energie aufbringen konnte aufzustehen, war beängstigend.
»MaryAnn?« Juliettes Stimme klang erstaunt und auch ein bisschen alarmiert. »Mach die Tür auf. Riordan ist bei mir, und wir müssen dringend mit dir reden.«
Oh nein. Sie wollte mit niemandem reden. Juliette hatte bestimmt ihre jüngere Schwester ausfindig gemacht, die sich aller Wahrscheinlichkeit nach irgendwo im Dschungel versteckt hatte. Karpatianer, Vampire und Jaguarmenschen – manchmal kam MaryAnn sich ein bisschen vor wie Dorothy im Zauberer von Oz. »Ich bin noch ganz verschlafen«, log sie. Sie konnte gar nicht schlafen, selbst wenn ihr Leben davon abgehangen hätte. Sie konnte nur weinen. Und sich fürchten. Egal, wie sehr sie sich auch bemühte, ihre Ängste und bösen Ahnungen zu überwinden, sie ließen sich einfach nicht aus ihrem Kopf verbannen.
Juliette rüttelte an der Tür. »Es tut mir leid, dich stören zu müssen, MaryAnn, doch es ist etwas sehr Wichtiges. Wir müssen dringend mit dir reden.«
MaryAnn seufzte. Das war nun schon das zweite Mal, das Juliette das Wort »dringend« benutzte. Irgendetwas war passiert. Sie musste sich zusammenreißen, sich das Gesicht waschen, die Zähne putzen und ihr Haar einigermaßen in Ordnung bringen. Sie setzte sich auf und wischte schnell wieder die Tränen ab, die ihr über das Gesicht liefen. Riordan und Juliette waren beide Karpatianer und konnten ihre Gedanken lesen, wenn sie wollten, aber sie wusste, dass das als schlechtes Benehmen galt, wenn man unter dem Schutz der Karpatianer stand, und war sehr froh über ihre Diskretion.
»Nur einen Moment noch, Juliette. Ich hatte geschlafen.«
Sie würden merken, dass das eine Lüge war. Sie mochten zwar nicht ihre Gedanken lesen, aber sie konnten nicht umhin, die Wellen des Schmerzes zu spüren, die von ihr ausgingen und das ganze Haus erfüllten.
MaryAnn wankte zu dem Spiegel hinüber und starrte voller Entsetzen ihr Gesicht an. Es gab keine Möglichkeit, so schnell die Spuren ihrer Tränen zu verbergen. Und an ihrem Haar war schon gar nichts mehr zu retten. Es war lang, lang genug, wenn sie es glatt zog, um ihr bis zur Taille zu reichen, aber sie hatte nicht daran gedacht, es zu Zöpfen zu flechten, und die Feuchtigkeit hatte es zu einer unbezähmbaren Mähne aufgebauscht. Sie sah unmöglich aus mit diesem störrischen Haar und ihren vom Weinen geröteten Augen.
»MaryAnn!« Juliette rüttelte wieder an der Tür. »Tut mir leid, doch wir kommen jetzt rein. Es handelt sich wirklich um einen Notfall, sonst würden wir das nicht tun.«
MaryAnn atmete tief ein und setzte sich mit abgewandtem Gesicht auf den Rand des Bettes, als sie zur Tür hereinkamen. Es half MaryAnn nicht gerade, sich besser zu fühlen, dass Juliette eine wahre Schönheit war mit ihren Katzenaugen und dem perfekten Haar oder dass Riordan groß und breitschultrig wie seine Brüder und geradezu sündhaft gut aussehend war. MaryAnn war sehr verlegen, nicht nur ihrer Haare wegen, die so grässlich kraus und feucht geworden waren, sondern vor allem, weil sie diesen furchtbaren, für sie schon lebensbedrohlichen Kummer nicht beherrschen konnte. Sie war eine starke Frau, und trotzdem machte nichts mehr Sinn für sie, seit sie den Mord an Manolito mit angesehen hatte.
Juliette glitt durch den Raum auf das Bett zu, und wieder bewunderte MaryAnn die Kraft und Anmut ihres Körpers, die wie ihr konzentrierter, stets wachsamer Blick an ihre Jaguarherkunft erinnerten. »Du scheinst nicht ganz auf dem Damm zu sein, meine Liebe.«
MaryAnn bemühte sich um ein Lächeln. »Das liegt nur daran, dass ich schon so lange von zu Hause fort bin. Ich bin eher ein Stadtmädchen, und das hier ist alles noch so neu für mich.«
»Als wir in den Karpaten waren, hast du da meinen Bruder Manolito kennengelernt?« Riordan beobachtete sie mit kühlem, abschätzendem Blick.
MaryAnn konnte den Druck seiner unausgesprochenen Fragen in ihrem Kopf spüren. Er hatte ihr einen gedanklichen Anstoß gegeben. Ihr Verdacht war also begründet. Irgendetwas stimmte hier nicht. Sie fühlte, wie das Blut aus ihren Wangen wich. Sie hatte diesen Leuten vertraut, und jetzt saß sie hier in der Falle und war verwundbar wie noch nie zuvor. Die De La Cruz’ verfügten über Fähigkeiten, die nur wenige Menschen nachvollziehen konnten. MaryAnns Mund war mit einem Mal wie ausgedörrt, und sie presste die Lippen zusammen und drückte eine Hand an ihre Brust, wo eine gewisse Stelle pochte und brannte, während sie beharrlich schwieg.
Juliette warf ihrem Lebensgefährten einen vernichtenden Blick zu. »Es ist wichtig, MaryAnn. Manolito ist in Schwierigkeiten, und wir brauchen schnellstens Informationen. Riordan liebt seinen Bruder und benutzte eine Abkürzung, um zu dir vorzudringen, die für unsere Spezies sehr nützlich, anderen gegenüber allerdings nicht sehr respektvoll ist. Das tut mir leid.«
MaryAnn sah blinzelnd zu ihr auf und spürte, wie ihr trotz ihrer Entschlossenheit wieder die Tränen kamen. »Er ist tot. Ich habe ihn sterben sehen. Und ich konnte spüren, wie sich das Gift in ihm ausbreitete, und auch den letzten Atemzug, den Manolito tat. Ich hörte einige der anderen Gäste sagen, dass nicht einmal mehr Gregori ihn von den Toten zurückholen könne. Und ihr habt seinen Leichnam im Flugzeug mit zurückgebracht.« Es auch nur laut auszusprechen, war schon schwierig. Sie brachte es nicht über sich, auch noch hinzuzufügen: ›In einem Sarg.‹ Nicht, wenn ihr Herz sich wie ein Stein in ihrer Brust anfühlte.
»Wir sind Karpatianer, MaryAnn, und nicht so leicht zu töten.«
»Ich sah ihn sterben. Ich fühlte, wie er starb.« Sie hatte geschrien. Tief in ihrem Innersten, wo es niemand hören konnte, hatte sie protestierend aufgeschrien und versucht, Manolito auf der Erde festzuhalten. Sie wusste nicht, warum ein Fremder ihr so wichtig war, nur dass er so edel, so durch und durch heroisch gewesen war, sich zwischen die tödliche Gefahr und eine schwangere Frau zu werfen. Und außerdem hatte sie ein Gerücht gehört, dass er schon einmal genau das Gleiche bei dem Prinzen der Karpatianer getan hatte. Selbstlos und ohne an seine eigene Sicherheit zu denken, hatte er sich auch für Mikhail Dubrinsky aufgeopfert. Und keinen der Karpatianer hatte das gekümmert. Sie waren zu der schwangeren Frau geeilt und hatten den gefallenen Krieger liegen lassen.
Juliette warf ihrem Lebensgefährten einen weiteren langen, vielsagenden Blick zu. »Du hast gespürt, wie Manolito starb?«
»Ja.« MaryAnns Hand glitt zu ihrer Kehle hinauf, denn für einen Moment fiel es ihr schwer zu atmen. »Ich habe seinen letzten Atemzug gespürt.« In ihrer eigenen Kehle und in ihren Lungen. »Und dann hörte sein Herz zu schlagen auf.« Ihr eigenes Herz hatte im selben Moment gestockt, als könnte es ohne den Rhythmus des seinen nicht mehr weiterschlagen. Sie befeuchtete sich die Lippen. »Er starb, und alle waren viel mehr besorgt um die schwangere Frau. Sie schien allen so wichtig zu sein, aber Manolito starb. Ich verstehe euch nicht. Und auch diesen Ort verstehe ich nicht.«
Sie strich sich ihr störrisches Haar aus dem Gesicht und wiegte sich langsam hin und her. »Ich muss nach Hause. Ich weiß, dass ich versprochen hatte, mit deiner Schwester zu arbeiten, aber die Hitze hier macht mich ganz krank.«
»Ich glaube nicht, dass es die Hitze ist, MaryAnn«, wandte Juliette ein. »Ich halte es für viel wahrscheinlicher, dass dein Unwohlsein eine Reaktion auf das ist, was Manolito zugestoßen ist. Du bist deprimiert und trauerst um ihn, obwohl du ihn kaum kanntest.«
»Das ergibt doch keinen Sinn!«
Juliette seufzte. »Ich weiß, dass es so scheint, doch warst du je allein mit ihm?«
Mary Ann schüttelte den Kopf. »Ich habe ihn ein paarmal in der Menge auf dem Fest gesehen.« Er hatte so gut ausgesehen, dass es unmöglich gewesen war, ihn nicht zu sehen. Sie hielt sich für eine sehr vernünftige Frau, aber der Mann hatte ihr schier den Atem geraubt. Sie hatte sich in Gedanken sogar scharf zurechtgewiesen, als sie gemerkt hatte, dass sie ihn wie ein verliebter Teenager anstarrte. Sie wusste, dass Karpatianer nur einen Partner hatten. Er hätte sie vielleicht als Nahrungsquelle benutzt, doch auf mehr bestand keine Hoffnung.
Außerdem könnte sie ohnehin nicht mit einem Mann wie Manolito De La Cruz leben. Er war herrisch und arrogant, ein uralter Karpatianer, den Jahrhunderte des Lebens in Südamerika auf schlimmstmögliche Weise geprägt und, was seine Verhaltensweise anging, in eine Art Neandertaler verwandelt hatten. Sie dagegen war eine sehr emanzipierte Frau aus dem gehobenen Mittelstand der Vereinigten Staaten und hatte zu viele misshandelte Frauen gesehen, um auch nur daran zu denken, sich mit jemandem einzulassen, der eine so autoritäre Einstellung Frauen gegenüber hatte. Doch obwohl sie all das wusste und sich im Klaren darüber war, dass Manolito De La Cruz der letzte Mann auf Erden war, mit dem sie eine Beziehung haben könnte, hatte sie trotzdem immer wieder zu ihm hinsehen müssen.
»Du warst nie allein mit ihm? Nicht einmal für kurze Zeit?«, beharrte Juliette und sah ihr diesmal prüfend in die Augen.
MaryAnn konnte winzige rote Flammen in den Tiefen ihrer türkisfarbenen Augen sehen. Katzenaugen. Eine Jägerin im Körper einer schönen Frau. Hinter Juliette stand ihr Gefährte, dessen Eleganz und Kultiviertheit das Raubtier in ihm nicht verbergen konnten.
MaryAnn verspürte wieder einen geistigen Befehl, nicht von Juliette, sondern von Riordan, der wieder einmal ihre Barrieren zu durchdringen versuchte, um an ihre Erinnerungen heranzukommen. »Hör auf damit!«, sagte sie, ihre Stimme scharf von jäher Wut. »Ich will nach Hause.« Sie traute keinem von diesen Leuten.
Sie blickte sich in dem verschwenderischen Luxus ihres Zimmers um und wusste, dass sie in einem goldenen Käfig saß. Die panische Angst, die in ihr aufstieg, machte ihr beinahe jedes Denken unmöglich. »Ich kann nicht atmen«, sagte sie und drängte sich an Juliette vorbei in Richtung Badezimmer. Sie konnte die Killer in ihnen sehen, die Ungeheuer, die hinter ihrer glatten, zivilisierten Fassade lauerten. Sie hatten geschworen, sie zu beschützen, aber sie hatten sie hierhergebracht, an diesen heißen, gefängnisähnlichen Ort, der weit entfernt von jeder Hilfe war, und nun begannen sie, sich an sie heranzupirschen. Sie brauchte Hilfe, und alle, die sie darum hätte bitten können, waren viel zu weit entfernt.
Juliette hob ihre Hand, und ein ärgerlicher Ausdruck erschien auf ihrem Gesicht. Wir machen ihr Angst, Riordan. Hör auf, sie zu bedrängen. Hör auf ihr Herz. Sie ist sehr verängstigt, viel mehr, als normal wäre. Könnte es nicht sein, dass sich das, was Manolito befallen hat, auch auf sie auswirkt?
Riordan schwieg einen Moment. MaryAnn war ihm immer wie eine starke, mutige Frau erschienen. Und obwohl er sie nicht besonders gut kannte, schien sie sich tatsächlich anders zu verhalten als gewöhnlich. Wenn sie seine Gefährtin ist, wäre das möglich, Juliette. Aber wie könnte sie das sein? Warum hat er nicht seinen Anspruch auf sie geltend gemacht und sie unter den Schutz seiner Familie gestellt? Das ergibt doch alles keinen Sinn, Juliette. Er hätte noch nicht erwachen dürfen. Gregori hat ihn auf der Erde festgehalten, und als wir ihn hierherbrachten, haben wir ihn zu dem heilenden Erdreich im Regenwald gebracht, und Zacarias hat dafür gesorgt, dass er unter der Erde blieb. Ich kenne keine Mächtigeren als die beiden. Wie ist es also möglich, dass Manolito vor der Zeit erwacht ist?
Könnte die Verbindung zwischen Gefährten des Lebens stärker sein als ein Befehl des Heilers oder von dem Oberhaupt unserer Familie?
Riordan rieb sich das Kinn. Die Wahrheit war, dass er keine Ahnung hatte, ob das möglich war.
Auf jeden Fall hat sie eine Höllenangst, und wir müssen etwas unternehmen. Juliette tat einen tiefen, beruhigenden Atemzug. »MaryAnn, ich kann sehen, dass du vollkommen durcheinander bist. Ich werde Riordan bitten, das Zimmer zu verlassen, und dann kannst du mir erzählen, was dich so belastet.«
Ohne sie zu beachten, rannte MaryAnn die letzten Stufen zu dem großen Badezimmer hinauf, schlug die Tür hinter sich zu und schloss sie ab. Dann trat sie vor das Waschbecken und drehte das Wasser auf, in der Hoffnung, dass das Geräusch Juliette davon abhalten würde, ihr zu folgen. Ihr Gesicht mit kaltem Wasser zu befeuchten, half ihr, ein wenig Klarheit zu erlangen, obwohl sie vor Angst zitterte, wenn sie daran dachte, was sie vor sich hatte. Es würde nicht leicht werden, den Karpatianern zu entkommen. Sie war völlig wehrlos gegen sie, aber Gregori, der Heiler der Karpatianer und Beschützer des Prinzen, war derjenige gewesen, der sie unter seinen Schutz gestellt und ihr ein paar Schutzvorkehrungen gezeigt hatte. Sie musste sie einfach nur treffen und nicht in Panik geraten, bis sie den Weg zu der Start-und-Lande-Bahn gefunden hatte.
Sie hatte schon immer einen sechsten Sinn für Gefahr gehabt, doch das hier hatte sie nicht kommen sehen. Jetzt wuchs und wuchs die Angst in ihr und begann, sich in nacktes Entsetzen zu verwandeln. Sie konnte diesen Leuten nicht vertrauen. Sie waren ganz und gar nicht das, was sie zu sein schienen. Alles war vollkommen verkehrt. Das riesige Anwesen mit all seiner Schönheit war nur dazu gedacht, Unvorsichtige in den Machtbereich dieser Ungeheuer zu locken. Sie hätte sie alle gleich durchschauen müssen. Gregori hätte sie durchschauen müssen. Oder war das Ganze eine riesige Verschwörung, in die alle involviert waren?