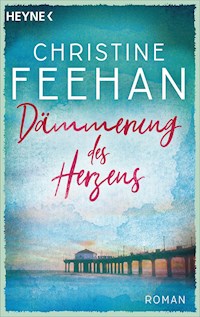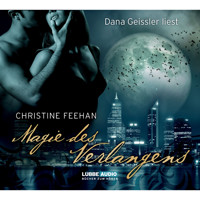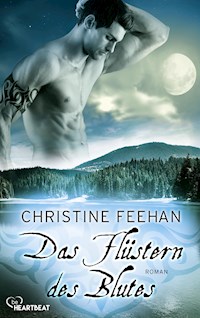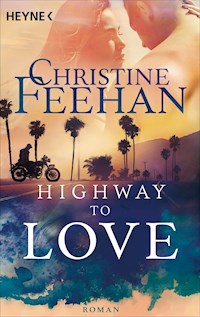9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Karpatianer
- Sprache: Deutsch
Ein Hass, so kalt wie Eis.
Eine Liebe, so heiß wie Lava.
Lebendig begraben in den Tiefen eines Vulkans: Jahrhundertelang gab es für den Karpatianer Dax nichts außer Hitze und Dunkelheit - und Hass! Sein Erzfeind teilte sein feuriges Grab. Doch nun ist er wieder erwacht und Dax muss alles daransetzen, ihn erneut zu stoppen. Denn diesmal steht nicht nur sein eigenes Leben und das unzähliger unschuldiger Menschen auf dem Spiel, sondern auch das seiner Seelengefährtin, der einen Frau, die ihn durch ihre Liebe von dem seelenzerfressenden Hunger seiner Art befreien könnte ...
»Diese außergewöhnliche Geschichte ist voll von Kämpfen, Hass und Leidenschaft.« Romantic Times
Dunkel, gefährlich und extrem heiß - Gefangene der Flammen ist der 23. Band der umfangreichen NEW YORK TIMES und SPIEGEL-Bestsellerserie Die Karpatianer.
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 703
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Inhalt
Cover
Grußwort des Verlags
Über dieses Buch
Titel
Widmung
Staffel
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Danksagungen
Über die Autorin
Weitere Titel der Autorin
Impressum
Liebe Leserin, lieber Leser,
herzlichen Dank, dass du dich für ein Buch von beHEARTBEAT entschieden hast. Die Bücher in unserem Programm haben wir mit viel Liebe ausgewählt und mit Leidenschaft lektoriert. Denn wir möchten, dass du bei jedem beHEARTBEAT-Buch dieses unbeschreibliche Herzklopfen verspürst.
Wir freuen uns, wenn du Teil der beHEARTBEAT-Community werden möchtest und deine Liebe fürs Lesen mit uns und anderen Leserinnen und Lesern teilst. Du findest uns unter be-heartbeat.de oder auf Instagram und Facebook.
Du möchtest nie wieder neue Bücher aus unserem Programm, Gewinnspiele und Preis-Aktionen verpassen? Dann melde dich für unseren kostenlosen Newsletter an: be-heartbeat.de/newsletter
Viel Freude beim Lesen und Verlieben!
Dein beHEARTBEAT-Team
Über dieses Buch
Lebendig begraben in den Tiefen eines Vulkans: Jahrhundertelang gab es für den Karpatianer Dax nichts außer Hitze und Dunkelheit – und Hass! Sein Erzfeind teilte sein feuriges Grab. Doch nun ist er wieder erwacht und Dax muss alles daransetzen, ihn erneut zu stoppen. Denn diesmal steht nicht nur sein eigenes Leben und das unzähliger unschuldiger Menschen auf dem Spiel, sondern auch das seiner Seelengefährtin, der einen Frau, die ihn durch ihre Liebe von dem seelenzerfressenden Hunger seiner Art befreien könnte …
eBooks von beHEARTBEAT – Herzklopfen garantiert.
CHRISTINE FEEHAN
Gefangeneder Flammen
Aus dem amerikanischen Englischvon Ulrike Moreno
Für drei erstaunliche Menschen,die sich einsetzten, als ich sie am meisten brauchte:Brian Feehan, Domini Stottsberryund Cheryl Wilson.Alles Liebe und vielen Dank!
Kapitel 1
Ich habe kein Problem damit, sieben Tage ohne jede Privatsphäre auf einem kleinen Boot zu sein, wo die Sonne mich in eine Hummerkrabbe verwandelt und ich von Moskitos aufgefressen werde. Das macht mir wirklich überhaupt nichts aus«, erklärte Riley Parker ihrer Mutter. »Aber ich schwöre dir, wenn ich noch eine einzige Beschwerde oder sexuelle Anspielungen von Mr. Ich-bin-so-heiß-dass-jede-Frau-vor-mir-niederknien-müsste höre, schmeiße ich den Idioten über Bord! Ich finde es richtig gruselig, wie der Kerl sich andauernd die Lippen leckt und sagt, ihm gefiele der Gedanke eines kleinen Zwischenspiels mit Mutter und Tochter.«
Riley warf einen hasserfüllten Blick auf Don Weston, den Idioten. Sie hatte viele selbstverliebte Widerlinge kennengelernt, während sie in Sprachwissenschaften promoviert hatte, und noch so manchen anderen an der University of California, an der sie heute lehrte, doch der hier schoss den Vogel ab. Er war ein Bär von einem Mann, mit breiten Schultern, gewölbtem Brustkorb und einem blasierten, großtuerischen Wesen, das Riley zur Weißglut trieb. Selbst wenn sie nicht schon so genervt gewesen wäre, hätte die Gegenwart dieses widerlichen Menschen das in ihr bewirkt. Und das Schlimmste war, dass ihre Mutter im Moment so verletzlich war, dass Riley extreme Beschützerinstinkte entwickelte und sie Weston wegen seiner ständigen sexuellen Anspielungen und schmutzigen Witze in Gegenwart ihrer Mutter am liebsten über Bord geworfen hätte.
Annabel Parker, eine renommierte Gartenbauingenieurin und berühmt für ihre Bemühungen, Tausende von Hektar durch Kahlschlag verlorenen brasilianischen Regenwaldes wiederherzustellen, sah ihre Tochter an. »Doch leider, Schatz, befinden wir uns in Piranha-Territorium«, sagte sie mit zwinkernden braunen Augen und einem amüsierten Lächeln um die Lippen.
»Genau das ist der Punkt, Mom«, gab Riley mit einem vielsagenden Blick in Westons Richtung zurück.
Das einzig Positive an der Anwesenheit dieses Scheusals war, dass die Planung seines Todes sie von den kalten Schauern ablenkte, die sie immer wieder neu durchrieselten und ihr die Nackenhaare sträubten.
Ihre Mutter und sie unternahmen alle fünf Jahre diese Fahrt den Amazonas hinauf, doch dieses Mal hatte Riley von dem Moment an, als sie im Dorf eingetroffen waren und ihren üblichen Führer krank angetroffen hatten, das Gefühl gehabt, als hinge eine dunkle Wolke über dieser Reise. Selbst jetzt schien eine seltsame Schwere, eine Atmosphäre der Gefahr, ihnen den Fluss hinauf zu folgen. Riley hatte versucht, das Gefühl mit einem Schulterzucken abzutun, aber es blieb und lastete auf ihr wie ein erdrückendes Gewicht, sodass es ihr immer wieder eiskalt über den Rücken lief und hässliche Vorahnungen sie nachts wach hielten.
»Vielleicht könnte ich ihm ja versehentlich die Hand abschneiden, wenn er über Bord geht …«, fuhr sie mit einem unheilvollen Lächeln fort. Ihre Studenten hätten den Mann warnen können, auf der Hut zu sein, wenn sie so lächelte. Es verhieß nie etwas Gutes, dieses Lächeln, doch jetzt verblasste es ein wenig, als sie auf das trübe Wasser hinunterblickte und die silbrigen Fische sah, die das Boot umschwärmten. Spielten ihre Augen ihr einen Streich? Es sah fast so aus, als folgten die Piranhas ihrem Boot. Doch Piranhas folgten keinen Booten, sondern kümmerten sich um ihre eigenen Angelegenheiten …
Riley warf einen verstohlenen Blick zu ihrem Führer, der mit den beiden Trägern, Raul und Capa, tuschelte und seine Schützlinge ignorierte – so ganz anders als der vertraute Dorfbewohner, der sie für gewöhnlich flussaufwärts begleitete. Die drei wirkten sehr beklommen, während sie schier unaufhörlich in das Wasser starrten. Auch sie schienen aufmerksamer als normalerweise zu sein wegen des Schwarms fleischfressender Fische, der das Boot umringte. Sei nicht albern!, ermahnte Riley sich. Sie hatte schon viele Male den gleichen Trip gemacht, ohne wegen der einheimischen Fauna die Nerven zu verlieren. Es war ihre überbordende Fantasie, mehr nicht. Trotzdem … Die Piranhas schienen überall um ihr Boot herum zu sein, doch seltsamerweise konnte sie in dem Wasser um das andere, vor ihnen dahintuckernde Boot überhaupt nichts Silbriges ausmachen.
»Du skrupelloses Ding«, rügte Annabel sie leise lachend und lenkte Rileys Aufmerksamkeit wieder auf Don Westons lästige Präsenz.
»Ich mag es nicht, wie er uns ansieht«, maulte sie. Die Luftfeuchtigkeit war so hoch, dass ihr Hemd an ihr klebte wie eine zweite Haut und ihre üppigen Kurven sogar noch betonte. Sie wagte nicht einmal, ihre Hände zu erheben, um ihr dichtes, zu einem Zopf geflochtenes Haar aus dem Nacken zu schieben, denn sonst dachte dieser Macho womöglich noch, sie versuchte, ihn zu reizen. »Ich würde diesem Rindvieh wirklich am liebsten eine reinhauen. Er glotzt meine Brüste an, als hätte er noch nie welche gesehen, was schon schlimm genug ist, aber wenn er deine anstarrt …«
»Vielleicht hat er ja wirklich noch nie Brüste gesehen, Schatz«, sagte Annabel leise.
Riley musste ein Lachen unterdrücken. Ihre Mutter konnte einem den schönsten Wutanfall mit ihrem Humor verderben. »Tja, wenn er noch nie welche gesehen hat, dann aus gutem Grund. Er ist ein Widerling.«
Hinter ihnen klatschte sich Weston auf den Nacken und stieß mit einem wütenden Zischen den Atem aus. »Diese verdammten Moskitos! Wo zum Teufel ist das Insektenspray, Mack?«
Riley beherrschte sich, um nicht die Augen zu verdrehen. Was sie anging, waren Don Weston und die anderen beiden Ingenieure, die ihn begleiteten, Lügner – oder zumindest zwei der drei. Sie behaupteten, sich im Dschungel auszukennen, doch es war klar, dass weder Weston noch Mack Shelton, sein ständiger Begleiter, auch nur den Schimmer einer Ahnung hatten. Sowohl Riley als auch ihre Mutter hatten versucht, Weston und seinen Freunden klarzumachen, dass ihr kostbares Insektenspray ihnen hier nichts nützen würde. Die Männer schwitzten stark, wodurch das Insektenmittel ebenso schnell wieder abgespült wurde, wie sie es auftragen konnten, und ihre Haut nur klebrig machte und zum Jucken brachte. Sich zu kratzen verstärkte das Jucken und forderte Entzündungen heraus. In der Feuchtigkeit des Regenwaldes konnte sich schon die kleinste Wunde schnell entzünden.
Auch Shelton, ein stämmiger Mann mit braun gebrannter Haut und ausgeprägten Muskeln, schlug jetzt fluchend nach seinem Nacken und seiner Brust. »Du hast es über Bord geworfen, du Blödmann, nachdem du es aufgebraucht hattest!«
Shelton war etwas freundlicher als die anderen beiden Ingenieure und nicht ganz so ekelhaft wie Weston, doch anstatt sich bei ihm sicherer zu fühlen, brachte seine Nähe Rileys Haut sogar zum Kribbeln. Vielleicht war das so, weil sein Lächeln seine Augen nie erreichte und er ständig alles und jeden an Bord beobachtete. Riley hatte das Gefühl, dass Weston diesen Mann gewaltig unterschätzte. Don Weston hielt sich offensichtlich für den Leiter ihrer Bergexpedition, aber Mack Shelton ließ sich von niemandem herumkommandieren.
»Wir hätten uns nicht mit ihnen zusammentun sollen«, sagte Riley leise zu ihrer Mutter. Normalerweise unternahmen Annabel und sie die Reise zu dem Vulkan allein, doch bei ihrer Ankunft in dem Dorf, in dem ihr langjähriger Führer lebte, war dieser zu krank gewesen, um zu reisen. Und mitten im Amazonas ganz allein auf sich gestellt, ohne einen Führer, um sie zu ihrem Zielort zu begleiten, hatten Riley und ihre Mutter beschlossen, sich mit drei anderen Gruppen zusammenzutun, die flussaufwärts reisten.
Don Weston und die beiden anderen Bergbauingenieure waren in dem Dorf gewesen, um eine Expedition in die peruanischen Anden vorzubereiten, wo sie nach potenziellen neuen Minen für die Firma, bei der sie beschäftigt waren, suchen wollten. Zwei Männer, die eine angeblich ausgestorbene Pflanze erforschten, waren aus Europa eingetroffen und hatten ebenfalls einen Führer gesucht, weil auch sie zu einem Berg in den Anden wollten. Des Weiteren waren ein Archäologe und seine zwei Doktoranden dorthin unterwegs, um Gerüchten über eine verlorene Stadt der Wolkenmenschen – oder auch Chachapoyas – nachzugehen. Sie alle hatten beschlossen, sich zusammenzutun und gemeinsam flussaufwärts zu fahren. Damals war Riley die Idee vernünftig erschienen, doch heute, eine Woche nach der Abreise, bereute sie die Entscheidung sehr.
Zwei der Führer, der Archäologe und seine Studenten, drei Träger und der Großteil ihrer Vorräte befanden sich in dem Boot unmittelbar vor ihrem. Annabel, Riley, die Forscher und drei Bergbauingenieure reisten mit einem ihrer Führer, Pedro, und den zwei Trägern Raul und Capa in dem zweiten Boot.
Mit acht Fremden auf so engem Raum festzusitzen gab Riley kein Gefühl der Sicherheit. Sie wünschte, sie wären wenigstens schon halbwegs auf dem Berg, wo sie alle ihrer Wege gehen würden, jede Gruppe mit ihrem eigenen Führer.
Annabel zuckte mit den Schultern. »Es ist ein bisschen zu spät für Bedenken. Wir haben den Entschluss gefasst, zusammen zu reisen, und jetzt haben wir sie eben am Hals. Machen wir das Beste daraus!«
Das war ihre Mutter, ruhig wie stets angesichts eines sich zusammenbrauenden Gewitters. Riley war keine Hellseherin, aber das brauchte sie auch nicht zu sein, um vorauszusehen, dass es Ärger geben würde. Das Gefühl wurde von Stunde zu Stunde stärker. Sie warf einen Blick auf ihre Mutter, die wie immer gelassen wirkte. Riley käme sich ein bisschen dumm vor, wenn sie ihre Besorgnis in Worte fassen würde, obwohl Annabel doch schon so viele andere Dinge im Kopf hatte.
Weston, der noch immer wegen des weggeworfenen Insektensprays herummeckerte, zeigte Shelton den Mittelfinger. »Die Dose war leer. Es müssen noch mehr da sein.«
»Sie war nicht leer«, stellte Mack Shelton angewidert fest. »Du wolltest bloß diesem Kaiman was an den Kopf werfen.«
»Und deine Zielgenauigkeit war nicht besser als dein dämliches Geplapper«, warf Ben Charger, der dritte Ingenieur, ein.
Ben war der stillste von allen. Er hörte nie auf, sich mit ruhelosen Augen umzublicken. Riley war sich noch nicht schlüssig über ihn. Rein äußerlich war er der Unauffälligste der drei Ingenieure, von durchschnittlicher Größe, durchschnittlichem Gewicht und mit einem ebenso durchschnittlichen, unscheinbaren Gesicht. Nichts an ihm fiel auf. Er bewegte sich auf leisen Sohlen, schien immer irgendwie aus dem Nichts heraus aufzutauchen und beobachtete wie Mack Shelton alles und jeden, als erwartete er Schwierigkeiten. Riley glaubte nicht, dass er ein Partner von Weston und Shelton war. Die anderen beiden hockten stets zusammen und kannten sich anscheinend schon länger, während Charger mehr ein Einzelgänger zu sein schien. Riley war sich nicht einmal sicher, dass er die beiden Männer mochte.
Am linken Ufer bemerkte sie eine sich schnell dahinbewegende Wolke, die manchmal in allen Regenbogenfarben schillerte und dann wieder nur perlmuttfarben war, während sie sich immer mehr zusammenballte und eine Decke aus lebenden Insekten bildete.
»Verpiss dich, Charger!«, fauchte Weston.
»Und du pass auf, was du sagst!«, riet Ben Charger mit so leiser Stimme, dass Don Weston zurücktrat und sogar ein bisschen blass wurde.
Sein Blick glitt über das Boot und fiel auf Riley, die er dabei ertappte, dass sie ihn beobachtete. »Warum kommst du nicht herüber – oder besser noch deine Mommy –, um mir den Schweiß abzulecken? Vielleicht hilft das ja.« Er streckte ihr die Zunge heraus, wahrscheinlich in der Hoffnung, sexy zu erscheinen, aber es brachte ihm nur einen Mundvoll Insekten ein und endete damit, dass er hustete und fluchend Ungeziefer ausspuckte.
Für einen schrecklichen Moment, als er ihre Mutter »Mommy« nannte und seinen ekelhaften Vorschlag machte, war Riley drauf und dran gewesen, sich auf ihn zu stürzen und ihn tatsächlich über Bord zu stoßen. Doch dann hörte sie das leise Kichern ihrer Mutter, und ihre Wut verflog, weil nun auch ihr Humor die Oberhand gewann. »Im Ernst?«, fragte sie und brach in schallendes Gelächter aus. »Bist du wirklich so eingebildet, dass du nicht weißt, dass ich eher einem Affen den Schweiß ablecken würde? Du bist einfach nur eklig, Weston.«
Aus dem Augenwinkel sah sie, dass die perlmuttfarbene Wolke von Insekten näher kam und sich verbreiterte, als die Tiere wie in geschlossener Formation über das Wasser flogen. Rileys Magen krampfte sich vor Furcht zusammen, und sie zwang sich, ganz tief durchzuatmen. Sie war nicht der Typ, der leicht erschrak, nicht einmal früher, als sie noch ein Kind gewesen war. Aber das hier …
Weston grinste lüstern. »Ha! Ich merk’s, wenn eine Frau mich will, und du, Süße, kannst nicht aufhören, mich anzusehen. Und wie du angezogen bist! Das tust du doch auch nur, um mich anzumachen.« Dann ließ er wie eine Schlange seine Zunge hin- und herschnellen und sah in dem Moment auch tatsächlich wie eine aus.
»Lass sie verdammt noch mal in Ruhe, Weston!«, blaffte Jubal Sanders ihn verärgert an. »Wirst du es denn niemals leid, dich selbst zu hören?«
Jubal, einer der beiden Pflanzenforscher, sah nicht aus wie jemand, der viel Zeit in einem Labor verbrachte. Er wirkte sogar ausgesprochen fit und war eindeutig ein Mann, der das Leben in der freien Natur gewöhnt war. Außerdem strahlte er großes Selbstvertrauen aus und bewegte sich wie ein Mann, der sich in jeder Situation behaupten konnte.
Gary Jansen, sein Reisegefährte, war schon mehr der Typ Laborratte, kleiner und schlanker, aber ebenfalls sehr muskulös, stark und durchtrainiert, soweit Riley gesehen hatte. Er trug eine schwarz gerahmte Lesebrille, schien sich jedoch mindestens genauso gut mit dem Leben im Freien auszukennen wie Jubal. Zu Beginn der Reise waren die beiden Forscher ausschließlich für sich geblieben, doch seit dem vierten Tag etwa war Jubal den Frauen gegenüber fürsorglich geworden und behielt sie im Auge, wann immer die Ingenieure in der Nähe waren. Er sprach nicht viel, aber es gab offensichtlich nichts, was ihm entging.
Obwohl eine andere Frau sich von seiner beschützerischen Haltung vielleicht geschmeichelt fühlen würde, dachte Riley nicht einmal daran, einem Mann zu vertrauen, der sein Leben angeblich in einem Labor verbrachte, sich jedoch mit der Geschmeidigkeit eines erfahrenen Kämpfers bewegte. Gary und er trugen offenbar auch Waffen. Sie hatten irgendetwas vor, und was immer es auch war – Riley und ihre Mutter hatten genug eigene Probleme, ohne sich auch noch in die anderer Leute hineinziehen zu lassen.
»Spiel hier nicht den Helden!«, fauchte Weston Jubal an. »Damit kriegst du das Mädchen nicht.« Er zwinkerte Riley zu. »Sie will einen richtigen Mann.«
Riley spürte, wie wieder Wut in ihr hochkochte, und fuhr herum, um Weston böse anzufunkeln, aber ihre Mutter legte beruhigend eine Hand auf ihre und flüsterte ihr zu:
»Lass nur, Schatz! Er fühlt sich hier bloß wie ein Fisch auf dem Trockenen, der Arme.«
Riley atmete tief durch. Ihre Mutter hatte recht. Zu diesem Zeitpunkt ihrer Reise würde sie nicht mit Aggression auf sexuelle Belästigung reagieren, egal, was für ein Dreckskerl dieser Weston war. Die letzten paar Tage, bis sie alle ihrer Wege gingen, würde sie es doch wohl schaffen, ihn zu ignorieren.
»Und dabei dachte ich, er wäre so erfahren«, antwortete Riley ihrer Mutter ebenso leise. »Sie behaupten, Bergbauingenieure zu sein, die schon unzählige Male in den Anden waren, doch ich wette, dass sie bisher nur über die Berge geflogen sind und das als ›Expedition in den Regenwald‹ bezeichneten. Wahrscheinlich haben sie überhaupt nichts mit Bergbau zu tun.«
Ihre Mutter nickte zustimmend, und ein Anflug von Belustigung erschien in ihren Augen. »Wenn sie das hier schlimm finden, dann warte nur, bis wir im Dschungel sind! Sie werden nachts aus ihren Hängematten fallen und morgens vergessen, in ihren Stiefeln nachzusehen, ob giftige Insekten sich darin verkrochen haben.«
Trotz ihres Ärgers musste Riley bei der Vorstellung grinsen. Die drei Ingenieure kamen angeblich von einem privaten Unternehmen, das nach vielversprechenden Mineralvorkommen in den an Bodenschätzen reichen Anden suchte. Sie hatte jedoch nicht den Eindruck, dass irgendeiner der drei sich im Dschungel auskannte, und sie brachten ihren Führern auch nicht viel Respekt entgegen. Alle drei beklagten sich, doch Weston war der Schlimmste und Unangenehmste mit seinen ständigen sexuellen Anspielungen. Und wenn er einmal nicht herummeckerte oder lüstern nach ihr oder ihrer Mutter schielte, blaffte er die Führer und Träger an, als wären sie seine Bediensteten.
»Ich habe dich fernab von hier aufgezogen, Riley. In einigen Ländern haben Männer eine andere Einstellung zu Frauen und betrachten uns leider nicht als Gleichgestellte. Offensichtlich wurde er in dem Glauben erzogen, dass Frauen Objekte sind, und da wir allein hier draußen sind und nicht von einem Dutzend Familienmitgliedern begleitet werden, sind wir in seinen Augen wahrscheinlich leichte Beute.« Annabel zuckte mit den Schultern, aber ihre Belustigung verblasste, und ein ernster Ausdruck trat in ihre dunklen Augen. »Trag immer diesen Dolch bei dir, Schatz, nur zur Sicherheit! Du kannst ja damit umgehen und verstehst dich zu behaupten.«
Ein Schauder überfiel Riley. Es war das erste Mal seit Beginn der Reise, dass Annabel ihre Befürchtungen erkennen ließ, dass irgendetwas nicht in Ordnung war. Das brachte Rileys eigene Besorgnis, die sie als übertrieben abgetan hatte, gleich wieder ins Reich der Wirklichkeit zurück. Ihre Mutter war praktisch veranlagt und stets ruhig und gelassen. Wenn sie glaubte, irgendetwas stimmte nicht, dann war es auch so.
Der Ruf eines Vogels aus dem Dickicht an der Uferbank drang laut und klar zu ihnen herüber. Um ihre plötzlich sehr bedrückt wirkende Mutter aufzuheitern, legte Riley die Hände um den Mund und ahmte den Ruf nach. Aber es brachte ihr nicht das entzückte Lachen ein, das sie sich erhofft hatte. Annabel lächelte nur ein wenig und tätschelte ihr die Hand.
»Es ist richtig unheimlich, wie du das machst.« Don Weston hatte aufgehört, sich mit den Insekten herumzuschlagen, und starrte Riley jetzt an wie eine Zirkusattraktion. »Kannst du alle Geräusche nachahmen?«
Trotz ihrer Abneigung gegen den Mann zuckte sie mit den Schultern. »Die meisten. Einige Menschen haben ein fotografisches Gedächtnis für alles, was sie sehen oder lesen, während ich eins habe, das ich ›phonographisches‹ Gedächtnis nenne. Ich kann mich an praktisch jedes Geräusch erinnern, das ich höre, und es nachahmen. Das ist einer der Gründe, warum ich Sprachwissenschaften studiert habe.«
»Eine bemerkenswerte Fähigkeit!«, warf Gary Jansen ein.
»Ja, nicht?« Annabel schlang einen Arm um Rileys Taille. »Als sie noch klein war, pflegte sie das Zirpen von Grillen zu imitieren, nur um mich wie verrückt im Haus herumlaufen zu sehen, um sie zu suchen. Und gnade Gott ihrem Vater, wenn ihm in ihrer Gegenwart ein Ausdruck entschlüpfte, der nicht für ihre Ohren bestimmt war! Sie konnte ihn perfekt nachahmen, mit der richtigen Stimmlage und allem Drum und Dran.«
Riley, der ganz schwer ums Herz wurde angesichts des Kummers und der Liebe in der Stimme ihrer Mutter, zwang sich zu einem leisen Lachen. »Ich konnte auch sehr gut meine Lehrer nachahmen, vor allem die, die ich nicht besonders mochte«, sagte sie mit einem mutwilligen kleinen Lächeln. »Ich konnte aus der Schule anrufen und Mom vorschwärmen, was für eine großartige Schülerin ich war.« Nun lachte ihre Mutter doch, und es zu hören erfüllte Riley mit Erleichterung.
Für Riley war Annabel eine schöne Frau. Sie war mittelgroß und schlank, hatte welliges, dunkles Haar und noch dunklere Augen, eine makellose Haut und ein Lächeln, das auf alle in ihrer Umgebung eine ansteckende Wirkung hatte. Riley war viel größer und hatte glattes, blauschwarzes Haar, das fast über Nacht nachwuchs, egal, wie oft sie es auch schnitt. Dazu hatte sie eine kurvenreiche Figur, ein Gesicht mit hohen Wangenknochen und heller, nahezu durchsichtiger Haut und große Augen, deren Farbe fast unmöglich zu bestimmen war – grün, braun, Florentiner Gold. Ihre Mutter pflegte zu sagen, bei ihr schlüge das Blut einer seit Langem verstorbenen Vorfahrin durch.
Soviel sie wusste, war ihre Mutter noch nie im Leben krank gewesen. Sie hatte keine Falten, und Riley hatte auch noch niemals ein graues Haar auf ihrem Kopf gesehen. Doch nun entdeckte sie zum ersten Mal Schwäche in den Augen ihrer Mutter, was fast so beunruhigend war wie die elektrisch aufgeladene Luft, die einen herannahenden Sturm ankündigte. Rileys Vater war erst zwei Wochen zuvor verstorben, und in ihrer Familie überlebten Mann und Frau ihren Partner nie sehr lange. Deswegen war Riley fest entschlossen, ihrer Mutter nicht mehr von der Seite zu weichen. Sie konnte bereits spüren, dass Annabel sich innerlich immer mehr zurückzog und von Tag zu Tag bedrückter wurde. Doch das bestärkte Riley nur noch in ihrer Entschlossenheit, sie nicht zu verlieren. Nicht an Kummer und auch an nichts anderes, was auch immer sie auf diesem Trip verfolgen mochte.
Am frühen Morgen waren sie auf einen Nebenfluss des Amazonas abgebogen, den sie nun zu ihrem Zielort hinauffuhren, und zwischen den von Schilf überwucherten Ufern wurden die allgegenwärtigen Insekten von Minute zu Minute mehr. Ganze Wolken von Moskitos griffen sie schier unablässig an. Immer mehr flogen auf das Boot zu, als röchen sie frisches Blut. Weston und Shelton drehten fast durch, schlugen auf jedes Fleckchen unbedeckter Haut ein und fluchten wie die Berserker. Erst nach einer Weile, nachdem sie wieder mal Insekten geschluckt hatten, erinnerten sie sich daran, den Mund zu halten. Ben Charger und die beiden Botaniker dagegen folgten dem Beispiel ihres Führers und der Träger und ertrugen den Ansturm der Insekten stoisch.
Die Einheimischen in ihrer Gruppe machten sich nicht einmal die Mühe, nach dem Getier zu schlagen, als die perlmuttartige Wolke auf sie herunterkam. Riley konnte das Boot vor ihnen sehen, das dem Ufer sogar noch näher war, doch soweit sie erkennen konnte, hatte die Insektenplage dieses Boot bisher verschont. Hinter ihr stieß Annabel einen erschrockenen kleinen Schrei aus, und als Riley herumfuhr, sah sie, dass ihre Mutter vollkommen eingehüllt war von der Wolke von Insekten. Sie hatten von allen anderen abgelassen, nur Annabel war von oben bis unten bedeckt mit etwas, das wie winzige Schneeflocken aussah.
La Manta Blanca. Winzig kleine Mücken, die manche auch Moskitos nannten. Riley hatte sich nie besonders für sie interessiert, doch ihre Stiche schon oft genug zu spüren bekommen. Sie brannten wie Feuer, und das Jucken danach machte einen schier verrückt, aber wenn man sich die Haut aufkratzte, infizierten die offenen kleinen Wunden sich sehr leicht. Riley riss eine Decke von einer der Bänke, warf sie über ihre Mutter, zog Annabel auf den Boden und rollte sie herum, in dem Versuch, die winzigen Insekten zu zerquetschen.
»Weg mit der Decke!«, rief Gary Jansen. »So erwischst du sie nicht alle.«
Er zog die Wolldecke weg und hockte sich neben Annabel. Die Hände vors Gesicht geschlagen, rollte sie sich hin und her, um die Insekten loszuwerden, die an jedem Stückchen nackter Haut, in ihrem Haar und auch an ihren Kleidern hingen. Viele waren durch Rileys schnelle Reaktion bereits zerquetscht. Sie fuhr fort, nach ihnen zu schlagen, um ihre Mutter vor weiteren Bissen zu bewahren.
Jubal füllte einen Eimer Wasser, leerte ihn über Annabel und strich mit den Händen über ihren Körper, um die Biester von ihr abzulösen. Die Träger schleppten sofort noch mehr Eimer herbei, um sie über Annabel auszuleeren, während Gary, Jubal und Riley die durchnässten Insekten mit der Decke von ihr abschabten. Schließlich kniete sich auch Ben neben sie und half mit, die letzten Insekten von ihr abzuklauben.
Annabel zitterte heftig, gab jedoch keinen Laut von sich. Ihre Haut wurde leuchtend rot, als tausend winzige Stiche zu dicken Blasen anschwollen. Gary kramte in einer Tasche, die er bei sich hatte, und nahm ein Glasfläschchen heraus. Mit der klaren Flüssigkeit darin begann er, die Stiche einzureiben, was keine leichte Sache war, da es so unendlich viele waren. Jubal hielt Annabels Arme fest, damit sie sich nicht kratzen konnte, als der unerträgliche Juckreiz auf ihren ganzen Körper übergriff.
Riley hielt die Hand ihrer Mutter und versuchte, sie mit sinnlosem Gerede zu beruhigen. Ihre bösen Ahnungen kehrten schlagartig zurück. Die winzigen Mücken hatten sich geradewegs auf Annabel gestürzt. Dabei gab es normalerweise niemanden, der besser auf den Regenwald eingestellt war als ihre Mutter. Pflanzen wuchsen üppig und in Hülle und Fülle in ihrer Nähe. Sie flüsterte mit ihnen, und sie schienen zurückzuflüstern und sie zu akzeptieren, als wäre sie die Mutter Erde selbst. Wenn Annabel daheim in Kalifornien durch ihren Garten ging, war Riley nahezu sicher, die Pflanzen direkt vor ihr wachsen sehen zu können. Wenn der Wald begann, sie anzugreifen, musste irgendetwas sehr im Argen liegen.
Annabel umklammerte Rileys Hand, als die beiden Forscher sie aufhoben und ihr zu ihrem Schlafbereich hinüberhalfen, der durch aufgehängte Laken und Moskitonetze eine gewisse Ungestörtheit bot.
Riley bedankte sich bei den Botanikern und war sich der bestürzten Stille an Bord nur allzu gut bewusst. Sie war nicht die Einzige, der aufgefallen war, dass der Schwarm der weißen Stechmücken nur ihre Mutter und niemand anderen angegriffen hatte. Selbst die inzwischen von ihr abgefallenen Moskitos hatten sich wieder aufgerappelt und krochen auf sie zu, als wären sie darauf programmiert.
»Reib die Stiche damit ein!«, riet Gary Jansen Riley und reichte ihr das Fläschchen. »Ich kann noch mehr herstellen, wenn wir erst einmal im Dschungel sind. Es wird den Juckreiz lindern.«
Riley bedankte sich für das Mittel, und die beiden Botaniker wechselten über ihren Kopf hinweg einen Blick, der ihr Herz gleich wieder schneller schlagen ließ. Sie wussten etwas. Dieser Blick war bedeutungsvoll gewesen. Sie schmeckte Angst in ihrem Mund und wandte schnell den Blick ab.
Annabel rang sich ein halbherziges Lächeln ab und dankte den beiden Männern, die sich zurückzogen, um den Frauen die nötige Privatsphäre zu geben.
»Ist alles in Ordnung mit dir, Mom?«, fragte Riley, sobald sie allein waren.
Ihre Mutter griff nach ihrer Hand. »Hör mir zu, Riley! Und stell jetzt bitte keine Fragen! Was auch immer geschieht, selbst wenn mir etwas zustößt, du musst auf den Berg hinauf und das Ritual vollenden. Du kennst jedes Wort und jeden Schritt. Führ das Ritual genauso aus, wie du es gelernt hast! Du wirst spüren, wie die Erde sich durch dich bewegt, und …«
»Dir wird schon nichts passieren, Mom«, widersprach Riley, deren Furcht nun blanker Panik wich. Die Augen ihrer Mutter spiegelten einen inneren Aufruhr wider, irgendein instinktives Wissen um eine Gefahr, das Riley fehlte – und zudem noch eine furchtbare Verletzlichkeit, die Riley bei Annabel noch nie gesehen hatte. Die Eheleute in ihrer Familie überlebten nie sehr lange den Verlust ihres Partners, doch Riley war fest entschlossen, dass ihre Mutter die Ausnahme sein würde. Sie hatte Annabel mit Argusaugen beobachtet, seit ihr Vater, Daniel Parker, nach einem Herzanfall im Krankenhaus verstorben war. Annabel hatte um ihn getrauert, doch bis jetzt hatte sie weder mutlos noch schicksalsergeben gewirkt. »Hör auf, so zu reden, du machst mir Angst, Mom!«
Annabel setzte sich mühsam auf. »Ich werde dir die nötigen Informationen geben, Riley, wie meine Mutter sie einst mir gab und ihre Mutter ihr. Falls ich nicht zu dem Berg gelange, fällt dir die Bürde zu. Du bist Teil eines uralten Geschlechts, und uns wurde eine Verpflichtung auferlegt, die seit Jahrhunderten von der Mutter an die Tochter weitergegeben wurde. Meine Mom brachte mich zu diesem Berg, genau wie ihre eigene Mutter sie hinbrachte. Und ich habe dich dorthin geführt. Du bist ein Kind des Nebelwaldes, Riley, und geboren, wo auch ich das Licht der Welt erblickte. Du hast deinen ersten Atemzug auf diesem Berg getan, ihn in deine Lunge eingesogen und mit ihm den Wald und alles, was mit lebendigen, wachsenden Dingen zusammenhängt.«
Wieder erschauerte Annabel und griff nach dem Fläschchen, das Riley in der Hand hielt. Mit zitternden Händen zog sie ihren Rock hoch. Noch viele der winzigen Stechmücken hingen an ihrem Bauch, und Annabel versuchte, sie mit zitternden Fingern abzustreifen. Riley öffnete das Fläschchen und begann, die lindernde Tinktur auf die Stiche aufzutragen.
»Als meine Mutter mir all diese Dinge sagte, dachte ich, sie übertriebe, und machte mich über sie lustig«, fuhr Annabel fort. »Nicht in ihrer Gegenwart natürlich, aber ich hielt meine Mom für sehr alt und abergläubisch. Natürlich hatte ich die Geschichten von den Bergen schon gehört. Wir lebten in Peru, und einige der älteren Leute in unserem Dorf sprachen noch immer von dem großen Unheil, das vor den Inkas kam und nicht vertrieben werden konnte, nicht einmal von ihren besten Kriegern. Es waren schreckliche, beängstigende Geschichten, die über Generationen weitergegeben worden waren. Ich dachte, sie seien vor allem deshalb weitererzählt worden, um den Kindern Angst einzujagen und sie davon abzuhalten, sich zu weit von der Sicherheit des Dorfes zu entfernen. Doch nach dem Tod meiner Mutter wurde ich eines Besseren belehrt. Irgendetwas ist dort oben in dem Berg, Riley – etwas durch und durch Böses. Und es ist unsere Aufgabe, es darin festzuhalten.«
Riley hätte gern geglaubt, dass es die Schmerzen waren, die ihre Mutter fantasieren ließen, aber ihre Augen waren klar – und das Schlimmste war die Furcht darin. Annabel meinte selbst jedes ihrer Worte ernst, und sie war nie der Typ gewesen, der zu Hirngespinsten neigte. Um ihre Mutter zu beruhigen, nickte Riley, auch wenn sie nicht wirklich diesen Unsinn über etwas Böses innerhalb eines Berges glaubte.
»Dir wird es bald besser gehen«, versprach sie. »Wir sind schon auf früheren Reisen von der Manta Blanca gestochen worden. Sie ist nicht giftig. Dir wird nichts geschehen, Mom.« Riley wollte einfach, dass es so war. »Es war nur ein seltsamer Zwischenfall. Wir wissen, dass alles Mögliche im Regenwald passieren kann …«
»Nein, Riley.« Annabel ergriff wieder die Hand ihrer Tochter und hielt sie fest. »All die Verzögerungen … all die Probleme seit unserer Ankunft … Irgendetwas ist im Gange. Das Böse in dem Berg versucht mit voller Absicht, mich aufzuhalten. Es ist schon dicht unter der Oberfläche und verursacht Unfälle und Krankheit. Wir müssen realistisch sein, Riley.« Wieder erschauderte sie heftig.
Riley durchwühlte ihren Rucksack und förderte ein Päckchen Tabletten zutage. »Das ist ein Antihistaminikum, Mom. Nimm zwei davon. Wahrscheinlich schläfst du davon ein, aber zumindest wird das Jucken für eine Weile aufhören.«
Annabel nickte und schluckte die Tabletten mit etwas Wasser. »Vertrau niemandem, Riley! Jeder dieser Männer könnte unser Feind sein. Wir müssen so bald wie möglich unserer eigenen Wege gehen.«
Riley biss sich auf die Lippe und schwieg, weil sie Zeit brauchte, um nachzudenken. Sie war fünfundzwanzig Jahre alt und bereits viermal in den Anden gewesen, ihre Geburt in dem dortigen Nebelwald nicht mitgezählt. Dies war die fünfte Reise, an die sie sich erinnerte. Der Marsch durch den Regenwald war sehr strapaziös gewesen, doch sie hatte niemals solche Angst empfunden wie diesmal. Es war zu spät, um umzukehren, und nach dem zu urteilen, was ihre Mutter sagte, hatten sie auch keine andere Wahl. Sie würde Annabel zur Ruhe kommen lassen, und dann mussten sie miteinander reden. Riley hatte noch so viele offene Fragen zu dem Warum und Weshalb dieser Reise zu den Anden.
Sowie ihre Mutter eingeschlafen zu sein schien, schlüpfte Riley um das Laken herum, das ihnen als Vorhang diente, aufs Deck hinaus. Raul, der Träger, warf ihr einen Blick zu und wandte sich schnell wieder ab. Die Anwesenheit der beiden Frauen an Bord schien ihm Unbehagen zu bereiten. Eine Gänsehaut kroch über Rileys Arme. Sie rieb sie weg und ging an der Reling entlang, um ein wenig Abstand zwischen sich und die anderen Passagiere zu bringen. Sie brauchte einfach ein wenig Raum für sich.
Aber es war nicht genug Platz auf dem Boot, um ein stilles Eckchen zu finden. Jubal und Gary, die beiden Botaniker, saßen an einer der weniger geschützten Stellen, und nach ihrem Gesichtsausdruck zu urteilen, waren sie nicht besonders gut gelaunt. Riley machte einen großen Bogen um sie, der sie jedoch dummerweise zu Ben Charger führte, dem dritten Ingenieur, über den sie sich noch nicht ganz schlüssig war. Er war immer höflich zu ihrer Mutter und ihr, und wie Jubal und Gary schien auch er eine beschützerische Ader für sie zu entdecken.
Ben nickte ihr zu. »Geht es deiner Mom besser?«
»Ich glaube schon«, antwortete Riley mit einem unsicheren Lächeln. »Ich habe ihr ein Antihistaminikum gegeben. Damit und mit der Tinktur von Gary wird der Juckreiz hoffentlich ein wenig nachlassen. Diese Mücken sind böse kleine Biester.«
»Sie muss etwas an sich gehabt haben, was sie angelockt hat«, meinte Ben. »Ein Parfum vielleicht?«
Riley wusste, dass ihre Mutter nie Parfum benutzte, aber es war eine gute Erklärung, und deshalb nickte sie langsam. »Es war ein so bizarrer Angriff, dass ich daran noch gar nicht gedacht hatte.«
Ben sah ihr so aufmerksam und prüfend ins Gesicht, dass sie ganz nervös wurde unter seinem Blick. »Ich habe gehört, dass du und deine Mom nicht zum ersten Mal hier seid. Habt ihr so etwas wie das schon mal erlebt?«
Riley schüttelte den Kopf, froh, dass sie die Wahrheit sagen konnte. »Noch nie.«
»Warum kommt ihr eigentlich an so einen gefährlichen Ort?«, fragte Ben neugierig. Wieder war sein Blick völlig unbewegt und wich nicht von ihrem Gesicht. Er starrte sie an, als verhörte er sie. »Soviel ich weiß, sind nicht einmal die Führer je auf diesem Berg gewesen. Sie mussten sich die Wegbeschreibung von ein paar anderen aus dem Dorf besorgen. Was für ein merkwürdiges Reiseziel für Frauen! Es gibt ja nicht mal Dörfer auf dem Berg, also bist du gewiss nicht wegen Sprachforschungen hier.«
Riley schenkte ihm ein schwaches Lächeln. »Mutters Arbeit als Gartenbauingenieurin und Kämpferin für den Schutz der Regenwälder führt uns an alle möglichen Orte. Aber wir kommen auch hierher, weil wir Nachfahren der Wolkenmenschen sind und meine Mutter möchte, dass wir so viel wie möglich über diese uralte Kultur lernen, damit sie nicht in Vergessenheit gerät.« Sie presste die Lippen zusammen und legte verteidigend eine Hand an ihre Brust. »Das klingt gemein. Ich liebe den Regenwald, und die Reisen mit meiner Mutter machen mir großen Spaß. Ich wurde sogar im Nebelwald geboren, und deshalb glaube ich, dass meine Mom es für eine schöne Tradition hält, alle paar Jahre wieder herzukommen.« Sie warf einen Blick zu dem Führer und senkte die Stimme. »Da wir uns jedoch nicht sicher waren, dass diese Männer den Weg tatsächlich kennen, hielten wir es für sicherer, uns mit euch anderen zusammenzutun.«
»Ich bin hier noch nie gewesen«, gab Ben zu. »Zwar war ich schon in vielen Regenwäldern, aber noch nie in der Nähe dieses Berges. Ich weiß nicht, warum Don sagte, wir wären alle schon mal hier gewesen. Er bildet sich gern ein, über alles genau Bescheid zu wissen. Ist der Dschungel so gefährlich, wie die Leute behaupten?«
Riley nickte. »Sehr wenige Menschen haben diesen Gipfel je bestiegen. Es ist ein Vulkan, und obwohl er seit über fünfhundert Jahren nicht mehr ausgebrochen ist, habe ich manchmal den Verdacht, dass er drauf und dran ist zu erwachen, wenn auch hauptsächlich wegen des Geredes der Einheimischen darüber. Es gibt eine Geschichte über diesen Berg, die von verschiedenen einheimischen Stämmen weitergegeben wurde, und darum meiden ihn die meisten. Es ist schwer, einen Führer zu finden, der bereit ist, einen dorthinauf zu bringen.« Sie runzelte die Stirn. »Und der Berg hat auch wirklich etwas Abschreckendes. Je höher man steigt, desto stärker wird das Unwohlsein, das einen beschleicht.«
Ben fuhr sich in einer nervösen Geste mit den Händen durch das Haar. »Diese ganze Seite des Regenwaldes scheint von Legenden und Mythen heimgesucht zu sein. Niemand will mit Außenseitern darüber reden, und all diese Geschichten scheinen mit irgendeiner Kreatur zusammenzuhängen, die sich vom Fleisch und Blut der Lebenden ernährt.«
Riley zuckte mit den Schultern. »Das ist verständlich. Praktisch alles hier im Regenwald ist auf dein Blut aus. Ich habe die Gerüchte natürlich auch gehört, und unser Führer sagte uns, es wären weder die Inkas noch die Spanier gewesen, die das Volk der Wolkenmenschen vernichteten. Die Einheimischen und ihre Nachkommen munkeln über etwas von Grund auf Böses, das nachts Menschen mordete, ihnen das Blut aussaugte und Familien entzweite. Die Wolkenmenschen waren gnadenlos im Kampf und friedfertig in ihrem Privatleben, doch angeblich unterlagen sie einer nach dem anderen oder flohen vor den Inkas aus dem Dorf. Als die Inkas kamen, um die Waldbewohner zu unterwerfen, waren die meisten der Krieger offenbar schon tot. Gerüchten zufolge erlitten die Inkas, die hier lebten, übrigens das gleiche Schicksal. Ihre tapfersten Krieger starben als Erste.«
»Das steht so aber nicht in den Geschichtsbüchern«, meinte Ben.
Trotzdem hatte Riley das Gefühl, dass er nicht überrascht war und auch diese Version, die man sich hinter vorgehaltener Hand erzählte, schon kannte. Natürlich gab es viele solcher Erzählungen, und eine war beängstigender als die andere. Geschichten von blutleeren Körpern und den Foltern und Qualen, die die Opfer vor ihrer Ermordung ausgestanden hatten.
»Sprichst du von Vampiren?«
Riley blinzelte, erstaunt darüber, wie beiläufig er diese Frage eingeworfen hatte. Zu beiläufig. Ben Charger war mit gewichtigeren Zielen als der Suche nach Bodenschätzen in diese bisher noch kaum erforschte Region gekommen. Alte Legenden? Wollte er vielleicht darüber schreiben? Was auch immer seine Gründe waren, Riley war sicher, dass sie mit Bergbau nichts zu tun hatten. Unwillkürlich runzelte sie die Stirn, als sie darüber nachdachte. Könnte das viel besprochene Böse ein Vampir sein? Der Mythos des Vampirs schien in allen alten Kulturen existiert zu haben.
»Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich habe nie gehört, dass das Wesen als Vampir bezeichnet wurde, doch die Sprache hat sich über die Jahre so verändert, dass in der Übersetzung einiges verloren gegangen ist. Möglich wäre es, denke ich. Vampirfledermäuse spielen eine wichtige Rolle in der Kultur der Inkas und auch für die Chachapoyas. Zumindest aufgrund dessen, was meine Mutter mir erzählt hat und was ich selbst darüber erfahren konnte. Es gibt nicht viele Anhaltspunkte.«
»Faszinierend«, sagte Ben. »Bei Gelegenheit würde ich gern mehr darüber hören. Alte Kulturen interessieren mich, und hier, in diesem Teil des Regenwaldes, scheinen die Stämme und Geschichten sehr geheimnisumwoben zu sein, was mich noch viel neugieriger macht. Ich bin so etwas wie ein Amateurschriftsteller und nehme jede Gelegenheit wahr, wenn ich eine neue Region erforsche, so viel wie möglich über alte Mythen herauszufinden. Und wohin ich auch gehe, mir fällt immer wieder auf, dass bestimmte legendäre Kreaturen sich überall auf der Welt in die Kulturen eingeschlichen haben. Erstaunlich, nicht?«
Als Riley hinter sich ein Geräusch vernahm, drehte sie sich um und sah, dass ihre Mutter in der Nähe stand, das Gesicht geschwollen von Insektenstichen. Da sie sich unbeobachtet wähnte, ruhten Annabels Augen wachsam und sehr argwöhnisch auf Ben. Riley starrte sie verwundert an. Ihre Mutter war die offenherzigste und liebenswürdigste Frau, die Riley kannte. An ihr war kein Arg, kein Misstrauen. In der Regel teilte sie gern ihre Informationen und war so ungezwungen im Umgang mit anderen, dass die meisten Menschen sich zu ihr hingezogen fühlten. Riley hatte immer das Gefühl, ihre Mutter beschützen zu müssen, weil sie so vertrauensvoll war.
Annabel blinzelte, und der misstrauische Blick verschwand und wich einem Lächeln für Ben Carver. Riley kam es ein bisschen so vor, als geriete ihre Welt ins Schwanken. Nichts, niemand – nicht einmal ihre Mutter – erschien ihr noch vertraut. »Du solltest dich hinlegen, Mom. So viele Stiche können dich krank machen.«
Annabel schüttelte den Kopf. »Mir geht es gut. Die Tinktur, die Gary mir gegeben hat, ist großartig. Sie hat mir den Juckreiz genommen, und du weißt, dass die Stiche nicht giftig sind. Gary und sein Freund müssen sich sehr gut mit den Eigenschaften von Pflanzen auskennen, denn die Tinktur hilft wirklich.«
Ben blickte zu den beiden Männern hinüber. Obwohl beide offensichtlich Amerikaner waren, waren sie von irgendwo in Europa angereist, um nach einer sagenhaften Pflanze mit außergewöhnlichen Heilkräften zu suchen, die angeblich hoch in den Anden wuchs. Nach seinem Gesichtsausdruck zu urteilen, schien Ben beide Männer für ein wenig verrückt zu halten.
Annabel nahm Rileys Hand, und nachdem sie Ben noch einmal zugenickt hatten, traten sie an die Reling im Mittelteil des Bootes, wo sie im Moment allein waren.
Der Fluss verschmälerte sich allmählich, sodass an einigen Stellen die riesigen Wurzelsysteme der Bäume am Ufer das Boot schon streiften. Reihen um Reihen großer Fledermäuse hingen schaukelnd in den Bäumen und boten ein unheimliches Bild, wie sie so mit dem Kopf nach unten in dem dichten Blattwerk baumelten. Obwohl der Anblick nichts Neues war für Riley, fand sie ihn heute aus irgendeinem Grund beunruhigend. Es war fast so, als lägen die Fledermäuse auf der Lauer und warteten auf die Dunkelheit, um sich auf die Jagd zu machen – dieses Mal nach menschlicher Beute. Riley erschauderte ein wenig über ihre eigene überrege Fantasie.
Sie ließ sich von der Nervosität anstecken, die durch die Beengtheit des Bootes hervorgerufen wurde. Dabei müsste sie es doch wirklich besser wissen. Die Fledermäuse waren groß und eindeutig Vampirfledermäuse, die sich von Warmblütern ernährten, doch sie bezweifelte, dass ihr Hunger personenbezogen war, und sie warteten ganz bestimmt nicht auf das Vorbeikommen einer Bootsladung argloser Menschen.
Als sie spürte, dass sie beobachtete wurde, drehte Riley sich um und sah, dass Don Weston sie mal wieder anstarrte. Er grinste und machte eine Bewegung, als schösse er mit einem imaginären Gewehr auf die regungslosen Tiere. Riley wandte sich ab. Westons Bedürfnis, stets im Mittelpunkt zu stehen, ging ihr auf die Nerven. Aber seine Reaktion auf die Fledermäuse kam ihrem eigenen Gefühl ein bisschen zu nahe – und sie wollte absolut nichts mit diesem Mann gemeinsam haben.
So wandte sie sich wieder ihrer Mutter zu, nahm deren Hand und drückte sie. Am Morgen hatten sie den Hauptstrom verlassen und über einen Nebenfluss die Reise zu den abgelegensten Teilen Perus angetreten. Inzwischen war der Dschungel so dicht ans Wasser vorgerückt, dass Bäume und Äste manchmal fast die Seiten der beiden Boote zerkratzten, die flussaufwärts tuckerten. Der Wald war in ständiger Bewegung, beinahe so, als folgten ihnen die Tiere. Affen starrten sie aus großen, runden Augen an, und farbenfrohe Aras zogen kreischend ihre Kreise über den Köpfen der Bootsinsassen.
Sie drangen immer tiefer in die Welt des Regenwaldes ein, dieses üppigen Dschungels voller Geheimnisse, der sich mehr und mehr verdichtete und von Minute zu Minute gefährlicher wurde. Der Fluss wurde sogar noch schmaler, und die Luft war still und schwer von intensiven Gerüchen. Riley erkannte die Anzeichen. Bald würde der Fluss nicht mehr befahrbar sein, und sie würden das Boot verlassen und den Weg zu Fuß fortsetzen müssen. Im Gegensatz zu anderen Bereichen des Dschungels, wo das Gehen leicht war, weil ohne genügend Licht nur sehr wenig auf dem Waldboden wachsen und gedeihen konnte, war das Unterholz in diesem Abschnitt hier sehr dicht. Riley war schon viel gereist, aber die Gerüche und die Stille dieses Ortes waren etwas, was sie nirgendwo sonst auf Erden fand. Anders als bei ihren früheren Besuchen fühlte sie sich dieses Mal jedoch ein bisschen eingeengt.
»He, Mack«, rief Don dem anderen Ingenieur zu. »Was zum Teufel ist denn jetzt schon wieder los? Ich könnte schwören, dass der Dschungel lebt!« Er stieß ein nervöses Lachen aus, als er auf die Äste zeigte, die sich in merkwürdiger Weise vorzubeugen und nach ihnen zu greifen schienen, wenn das Boot an ihnen vorbeikam.
Alle drehten sich zu der am nächsten liegenden Uferbank um, als sich dort eine große grüne Welle auftürmte und ihnen folgte. Ein Zittern ging durch Äste und Zweige, Blätter entfalteten sich und reckten sich über das Wasser, als versuchten sie, die Gruppe am Weiterfahren zu hindern. Das erste Boot war unbeschadet vorbeigekommen, doch kaum näherte sich das zweite dem Ufer, griffen die Blätter und Pflanzen nach den Bootsinsassen. Die Bewegung war so unheimlich, als wäre der Dschungel wirklich zum Leben erwacht, wie Don gesagt hatte.
Riley erschrak. Sie hatte das Phänomen schon oft gesehen. Ihre Mutter zog Pflanzen an, wohin sie ging. Es ließ sich einfach nicht vermeiden. Die Anziehungskraft in Riley war nie ganz so stark gewesen, aber die dichte Vegetation an beiden Uferbänken begrüßte sie mit offenen Armen und wuchs sogar ein paar Zentimeter bei dem Versuch, sie zu berühren. Es war nie gut, im Regenwald und in Gegenwart der Träger und Führer zu viel Aufmerksamkeit zu erregen, doch heute fühlte Riley sich noch mehr als sonst genötigt, ihre Mutter zu beschützen. Schnell trat sie zwischen Annabel und das Ufer, umklammerte mit beiden Händen die Reling und starrte mit großen, ungläubigen Augen auf die sich schnell entfaltenden Pflanzen.
»Du liebe Güte!«, fügte sie dem allgemeinen Gemurmel hinzu. »Das ist ja kaum zu glauben.«
»Es ist unheimlich«, sagte Mack und trat von der Reling zurück.
Die Träger und der Führer starrten die sich zum Fluss ausstreckenden Pflanzen und Bäume an, um dann geradewegs Annabel anzusehen. Sie tuschelten miteinander, und Riley konnte noch andere Blicke auf sich und ihre Mutter gerichtet spüren. Auch Gary und Jubal schauten Annabel an. Nur die drei Ingenieure starrten weiter in den Regenwald, der sie buchstäblich umhüllte.
Die beiden Boote setzten ihren Weg flussaufwärts fort und begannen, sich dem Berg zu nähern. Schwarze Kaimane, riesige »Dinosaurier« aus ferner Vergangenheit, sonnten sich an den Ufern und hielten hungrig die kleinen Boote im Auge, die in ihr Territorium eindrangen. Ganze Wolken von Insekten, Moskitos und andere blutsaugende Biester, stürzten sich auf jeden Zentimeter unbedeckter Haut und verfingen sich in Haaren und sogar in Zähnen. Es blieb einem nichts anderes übrig, als es zu ertragen. Das dunkle Wasser unter ihnen wurde seichter, was ihr Vorankommen verlangsamte, und zweimal kam das Boot ruckartig zum Stehen und musste mühsam unter Wasser von dem Schilf befreit werden, das sich in Motor und Schiffsschraube verheddert hatte. Diese unerwarteten Stöße rissen jeden an Bord von den Füßen und schleuderten ihn zu Boden.
Weston rappelte sich fluchend auf und stakste zur Reling, um ins Wasser zu spucken. »Das ist ja lächerlich! Hättest du nicht einen anderen Weg finden können?«, blaffte er Pedro, ihren Führer, an.
Der Mann warf ihm einen angespannten Blick zu. »Es gibt keinen leichten Weg zu dem Ort, an den Sie wollen.«
Weston hockte sich auf die Reling und zeigte dem Führer seinen Mittelfinger. »Ich glaube, du versuchst bloß, mehr Geld herauszuschinden, aber das kannst du vergessen, Freundchen.«
Pedro sagte etwas in seiner Sprache zu den beiden Trägern.
Den soll der Dschungel fressen!, verstand Riley und konnte es den Männern nicht einmal verübeln.
Der Führer und die Träger lachten.
Weston zündete sich eine Zigarette an und starrte finster auf das dunkle Wasser. Das Boot schlingerte wieder, und während noch alle verzweifelt versuchten, nicht den Halt zu verlieren, machte es einen großen Satz. Weston fiel nach vorn und hing einen erschreckenden Moment lang an der Reling. Alle sprangen auf, um ihm zu helfen, als er, mit dem Oberkörper nach unten, schon halb im Wasser hing.
Riley packte ihn am Gürtel, Annabel beugte sich über die Reling und griff nach seinen Armen. Sowie Annabels Hände Westons Unterarme berührten, kam Leben in das Wasser, und es begann zu brodeln wie ein Kessel voller silbrig glitzernder Fische und trüber roter Flecken.
»Mom!«, schrie Riley und griff nach ihrer Mutter, ohne Weston loszulassen. Aber sein Gewicht zog alle drei nach vorn.
Die anderen eilten herbei, als Annabel noch weiter auf das dunkle, von Schilf durchzogene Wasser zurutschte, das jetzt von den in wilde Raserei geratenen Piranhas zu kochen schien. Da jedoch kein Blut im Wasser war, war der ganze Aufruhr unerklärlich. Zu Rileys Entsetzen begannen die Fische aus dem Wasser zu springen – Hunderte von schmalen Körpern mit abgestumpften Köpfen schossen wie Raketen in die Höhe, und die dreieckigen Kiefer mit den rasiermesserscharfen Zähnen schnappten mit schauderhaft klickenden Geräuschen auf und zu.
Obwohl es reichlich Geschichten über Piranhas im Beuterausch gab, wusste Riley, dass Angriffe auf Menschen eher selten vorkamen. Bei mehreren Gelegenheiten war sie sogar schon mit ihnen herumgeschwommen. Dieses bizarre Verhalten war also außergewöhnlich, genauso unnatürlich und beunruhigend wie der Angriff der Manta Blanca. Und ebenso wie die Stechmücken schienen die Piranhas es nicht auf Don Weston, sondern auf Annabel abgesehen zu haben.
Es war Jubal, der sie packte, über die Reling zurückriss und buchstäblich auf Gary warf. Dann ergriff er Weston und zog auch ihn an Deck zurück. Statt ihm jedoch dankbar zu sein, schlug der Ingenieur nach Jubals Händen und ließ sich fluchend auf das Deck fallen, wo er schwer atmend sitzen blieb. Pedro und die beiden Träger starrte er dabei so wütend an, als hätten die drei Männer ganz bewusst versucht, ihn zu ermorden.
Sowohl der Führer als auch die Träger taxierten Annabel mit einem Blick, der Riley wünschen ließ, sie hätte eine Waffe bei sich. Bevor irgendjemand etwas sagen konnte, lief das Boot beinahe auf Grund, und die beiden Einheimischen machten sich wieder an die Arbeit. Währenddessen neigte sich ein Ast über ihnen herab, und eine Schlange fiel aufs Deck, wo sie mit einem dumpfen Aufprall direkt vor Westons Stiefeln landete.
»Nicht bewegen!«, zischte Jubal, als die Schlange den Ingenieur anstarrte. »Diese Art ist ungeheuer giftig.«
Pedro, der Führer, fuhr herum, um die stets bereitliegende Machete zu holen. Bevor er jedoch einen Schritt machen konnte, wirbelte die Schlange herum und warf sich auf Riley. Als sie entsetzt zurückwich, prallte sie gegen ihre Mutter, und die Schlange fuhr blitzschnell zwischen Rileys Beinen hindurch, um an Annabel heranzukommen. Gary Jansen riss Rileys Mutter von den Füßen, drehte sich mit ihr und hielt sie hoch, während Jubal Riley beiseitestieß, die Hand hob und dem Führer etwas zuschrie.
Pedro warf ihm die Machete zu, Jubal fing sie auf und schlug der Viper mit einer gut gezielten Bewegung den Kopf ab. Ein kurzes Schweigen entstand, als Gary Annabel wieder aufs Deck herunterließ und die schwankende Frau stützte.
»Danke«, sagte Riley atemlos zu den beiden Forschern und versuchte nicht mal zu verbergen, wie sehr ihr der Schreck in die Knochen gefahren war.
Ihre Mutter blickte sie mit kummervollen Augen an, und Rileys Welt zerbrach. Capa, Raul und Pedro starrten Annabel mit dem gleichen Ausdruck an wie die Giftschlange, als sie aufs Deck gefallen war. Riley und ihre Mutter steckten in echten Schwierigkeiten, falls der Führer und die Träger eine feindselige Haltung ihnen gegenüber einnahmen. Riley griff nach Annabels Hand und drückte sie ganz fest.
Kapitel 2
Die Nächte im Dschungel waren die Hölle. Gleich bei Sonnenuntergang begann das Gebrumme. Es war nicht so, als wären die Insekten verstummt, aber sie waren nur noch wie ein permanentes Hintergrundgeräusch, das Riley relativ gut verdrängen konnte. Nein, dieses Gebrumme war etwas völlig anderes – ein leises, beharrliches Gewisper im Niederfrequenzbereich, das einem durch und durch ging. Riley war schon in ihrer allerersten Nacht im Regenwald von diesem eigenartigen Geräusch erwacht.
Seltsamerweise konnte sie das leise, irritierende Summen nicht näher bestimmen, und sie konnte auch nicht sagen, ob es sich außerhalb oder innerhalb ihres Kopfes befand. Bei mehreren anderen – einschließlich ihrer Mutter – hatte sie beobachtet, dass sie sich die Schläfen rieben, als hätten sie Kopfweh, und sie befürchtete, dass dieses gleiche niederfrequente Gewisper, das sich nicht bestimmen ließ, sie alle auf heimtückische Weise heimsuchte und die Gefahr der Reise noch erhöhte. Tagsüber war das Gewisper nicht mehr da, doch die Nachwirkungen blieben.
Seit Betreten des Regenwaldes hatte Riley das Gefühl, dass ihre Sinne sich geschärft hatten und gewissermaßen Überstunden machten. Sie bemerkte jeden noch so kleinen, argwöhnischen Blick auf ihre Mutter. Jubal Sanders und Gary Jansen waren bis an die Zähne bewaffnet, und Riley beneidete sie darum. Die beiden schritten schweigend dahin, blieben für sich und beobachteten alle anderen. Riley schloss aus ihrem Verhalten, dass sie sehr viel mehr über die Vorgänge hier wussten, als sie zu erkennen gaben.
Don Weston und sein Freund Mack Shelton waren Dummköpfe, soweit sie sehen konnte. Keiner hatte je den Trip durch den Regenwald gemacht, und sie fürchteten sich anscheinend vor allem. Trotzdem plusterten sie sich auf, meckerten herum und tyrannisierten die Träger und den Führer, wenn sie nicht gerade Riley anglotzten oder das zunehmende Misstrauen innerhalb der Gruppe schürten.
Ben Charger dagegen schien sich sehr viel besser mit dem Regenwald und den darin lebenden Eingeborenen auszukennen. Nach gründlichen Recherchen war er sehr gut vorbereitet nach Peru gekommen. Er mochte weder Weston noch Shelton, doch er musste mit ihnen zusammenarbeiten und war offensichtlich alles andere als erfreut darüber. Um ihnen aus dem Weg zu gehen, verbrachte er viel Zeit mit den Führern und Trägern, stellte ihnen viele Fragen und versuchte, von ihnen zu lernen. Ihm konnte Riley beim besten Willen nichts vorwerfen. Vielleicht hatte sie inzwischen aber auch schon Angst vor allen.
Der Archäologe und seine Doktoranden waren sehr aufgeregt und schienen nichts von der Anspannung im Lager wahrzunehmen, obwohl Riley bemerkte, dass sie sich bei Nacht ein bisschen unwohl fühlten und so nahe wie möglich an das Feuer setzten. Sie schienen ehrgeizig, freundlich und sehr auf ihre Aufgabe konzentriert zu sein. Dr. Henry Patton, Todd Dillon und Marty Shepherd waren wesentlich interessierter an den Ruinen, von denen sie gehört hatten, als an der Frage, ob Frauen in ihrer Reisegruppe Unglück brachten oder nicht. Sie wirkten jung und arglos, sogar der Professor, der schon Ende fünfzig war und völlig in seiner akademischen Welt aufging.
Riley taten die drei Archäologen ein bisschen leid, weil sie so unerfahren waren, und sie war dankbarer denn je, dass sie sich dazu entschieden hatte, moderne statt toter Sprachen zu studieren. Sie reiste, sprach und lebte viel zu gern, um in einem Elfenbeinturm zu sitzen und verstaubte Bücher zu wälzen. Natürlich hatte sie auch alte Sprachen studiert, doch hauptsächlich als Einstiegsfenster zu der Entwicklung von Sprachen und deren Auswirkungen auf verschiedene Kulturen.
Sie blickte zu Raul und Capa hinüber, den beiden Trägern, die auf demselben Boot wie sie flussaufwärts gereist waren. Es gefiel ihr nicht, wie sie miteinander tuschelten und immer wieder verstohlene Blicke zu Annabels Hängematte hinüberwarfen. Vielleicht machte dieses fürchterliche Gebrumme in ihrem Kopf sie genauso paranoid wie alle anderen, doch an Schlaf war jedenfalls nicht zu denken. Riley musste sich nicht nur wegen der Männer im Lager Sorgen machen; auch die Insekten, Fledermäuse und alle anderen nachtaktiven Kreaturen schienen es auf ihre Mutter abgesehen zu haben.
Vier ganze Nächte hatte Riley schon kein Auge zugetan, weil sie auf ihre Mutter aufgepasst hatte, und der Schlafmangel machte sich bemerkbar und zerrte an ihren Nerven, sodass es ihr jetzt schier unmöglich war, Westons abfällige, misstrauische Präsenz zu tolerieren. Sie wollte die Probleme nicht noch verschärfen, indem sie hässlich zu ihm war, aber sie war ganz eindeutig schon kurz davor. Das Lagerfeuer brannte hell, und direkt außerhalb des Rings aus Licht hustete ein Jaguar. Er schien ihnen zu folgen, doch als die Führer am Morgen nach Spuren gesucht hatten, hatten sie keine finden können. Es war unmöglich, von diesem knurrenden, bellenden Raubtierhusten unberührt zu bleiben.
Als genügte das alles noch nicht, konnte sie nun auch noch das leise Flattern von Flügeln über Annabels Kopf hören. Vampirfledermäuse landeten in den Bäumen, streiften die Blätter und füllten die Äste, bis der Baum ächzte unter dem Gewicht der vielen großen Tiere. Riley schluckte und drehte sich langsam zu dem Lagerfeuer um. Die Träger und Führer starrten auf den Baum voller Fledermäuse. Inzwischen wirkten die Viecher auf alle regelrecht unheimlich.
Pedro, der Führer, und Raul und Capa, die beiden Träger, rückten ein wenig in die Schatten. Alle drei ergriffen ihre Macheten, und der Ausdruck auf ihren Gesichtern, den der flackernde Feuerschein ihr offenbarte, machte Riley Angst. Für einen erschreckenden Moment erschienen ihr die Männer mindestens genauso bedrohlich wie die Fledermäuse. Riley schluckte wieder und setzte sich dann langsam auf. Sie hatte die Stiefel angelassen, da sie wusste, dass sie ihre Mutter beschützen musste.
Annabel schlief unruhig und stöhnte hin und wieder. Sie hatte immer ein hervorragendes Gehör gehabt, sogar im Schlaf. Eine über den Boden schleichende Katze hatte sie wecken können, doch seit sie den Regenwald betreten hatten, schien sie sehr erschöpft und schwach zu sein. Nachts wälzte sie sich in ihrer Hängematte herum, und manchmal weinte sie und drückte die Hände an den Kopf. Nicht einmal, als die Fledermäuse sich zu Boden fallen ließen und sie umringten, indem sie auf makabre Weise auf ihren Flügeln voranmarschierten, öffnete Annabel die Augen.
Riley hatte ihre Verteidigung sorgfältig vorbereitet und außer Taschenlampen auch leicht entzündliche Fackeln bereitliegen, und sie war sogar so weit gegangen, einen Ring aus Feuer um den Schlafbereich ihrer Mutter zu entzünden. Als sie ihr Moskitonetz aufhakte, sah sie Raul in ihre Richtung schleichen. Er ging geduckt und hielt sich in den Schatten, aber sie konnte ihn genau erkennen, wie er von einem dunklen Fleck zum nächsten schlich, als wäre er auf der Pirsch nach Beute. Riley warf einen schnellen Blick auf ihre schlafende Mutter, weil sie befürchtete, dass Annabel das beabsichtigte Opfer des Trägers war.
Mit wild klopfendem Herzen und dem bitteren Geschmack von Furcht im Mund, glitt Riley aus ihrer Hängematte und zog ihr Messer. Es gegen eine Machete einzusetzen, besonders eine, die von einem Mann geführt wurde, der damit umzugehen wusste, war Wahnsinn, doch ebenso wie die Fledermäuse würde auch er Riley umbringen müssen, um an Annabel heranzukommen. Und er würde nicht nur Bekanntschaft mit ihrem Messer machen, falls er ihre Mutter angriff. Riley nahm eine der Fackeln und hielt sie in das Feuer, das sie zum Schutz gegen die Fledermäuse angezündet hatte.
Sie würde den Kerl umbringen, falls nötig. Der Gedanke war ihr unerträglich, aber sie stählte sich und ging im Kopf noch einmal jede Bewegung durch. Galle stieg in ihrer Kehle auf, doch sie war wild entschlossen. Nichts und niemand würde ihrer Mutter etwas antun. Riley hatte ihren Entschluss gefasst, und nichts würde sie daran hindern können, nicht einmal das Wissen, dass das, was sie im Begriff war zu tun, als vorsätzlicher Mord betrachtet werden könnte.
Raul schlich näher. Sie konnte schon seinen Schweiß riechen, einen Geruch, der irgendwie nicht normal und sehr »befremdlich« für sie war. Nach ein paar tiefen, stärkenden Atemzügen bewegte sie sich auf Zehenspitzen auf die Hängematte ihrer Mutter zu und brachte sich sorgfältig in Position. Der Boden unter ihr bewegte sich, als erhöbe er sich, um jedem ihrer Schritte zu begegnen. Noch nie war sie sich des Herzschlags der Erde so bewusst gewesen. Kein Laub raschelte, kein Zweig knackte. Ihre Füße schienen genau zu wissen, wohin sie treten mussten, um zu verhindern, dass sie Geräusche verursachte, sich einen Knöchel verstauchte oder auf dem unebenen Boden hinfiel.
Vor der Hängematte ihrer Mutter baute sich Riley an einer Stelle auf, wo sie leicht an Annabel herankommen konnte, um einen Angriff auf sie abzuwehren. Eine Bewegung in ihrer Nähe brachte ihren Puls zum Rasen. Der Schatten eines Mannes tauchte vor der Hängematte auf, den sie ohne die plötzlich hoch auflodernden Flammen des Lagerfeuers nie gesehen hätte. So lautlos verstand sich Jubal Sanders zu bewegen. Riley fuhr schnell zu ihm herum, doch er war schon an ihr vorbeigeschlüpft, um sich am Kopfende von Annabels Hängematte zu platzieren. Hätte er ihre Mutter umbringen wollen, wäre sie bereits tot, so nahe war er ihr ohne Rileys Wissen schon gekommen.
Ohne auch nur hinsehen zu müssen, wusste sie, dass Gary Jansen am Fußende der Hängematte stand. Riley war die letzten vier Tage im denkbar beschwerlichsten Dschungel unterwegs gewesen und wusste daher, wie lautlos und mühelos er sich durch das unwegsame Gebiet bewegte. Doch es überraschte sie noch immer, da er eigentlich mehr wie der typische zerstreute, aber offenbar brillante Professor wirkte, der mehr in einem Laborkittel daheim war als im Dschungel. Man konnte nicht mit ihm reden, ohne festzustellen, wie überaus intelligent er war, und dennoch bewegte er sich mit der gleichen Leichtigkeit durch den Dschungel wie Jubal, und er war auch genauso gut bewaffnet und vermutlich ebenso geschickt im Umgang mit den Waffen. Riley war froh, dass diese beiden Männer beschlossen hatten, ihr zu helfen, Annabel zu schützen.