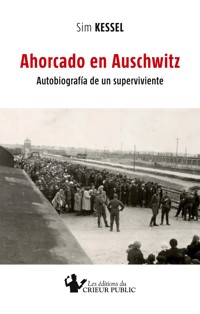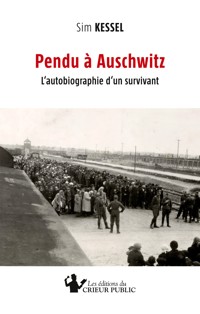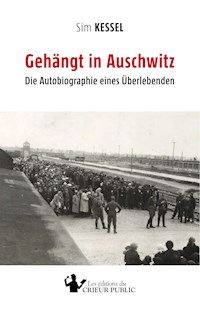
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Sim Kessel, der junge Franzose, Jude und Berufsboxer, schrieb 1969 seine Autobiographie über die Jahre 1940-45. Er beschrieb, wie er gegen jede Wahrscheinlichkeit in Auschwitz und anderen Konzentrations- und Vernichtungslagern des NS-Regimes überlebte. 1940 trat er unmittelbar nach seiner Demobilisierung als Soldat der französischen Widerstandsbewegung gegen die deutsche Besatzung Frankreichs, der Résistance, bei. Zwei Jahre später wurde er von der Gestapo verhaftet. Trotz Folter gestand er nichts von seiner Untergrundarbeit. Als Jude wurde er nach Drancy bei Paris überführt, dort inhaftiert und in der Folge in das Konzentrationslager Auschwitz deportiert. Unter den entsetzlichen Bedingungen der nationalsozialistischen Vernichtungslager, als Nummer 130 665, entlud er in Birkenau Baumaterial und arbeitete in den Minen von Jawarzno. Völlig ausgelaugt und krank rettete ihn ein schlichter bürokratischer Irrtum ein erstes Mal vor der Gaskammer. Im Jahr 1943 versuchte die Lager-Gestapo neuerlich, ihm ein Geständnis seiner Widerstandsaktivitäten abzupressen. Er wurde gefoltert, man riß ihm einen Finger aus. Ein zweites Mal wurde er vor der Gaskammer gerettet, diesmal von einem SS-Mann, der auch Boxer war. Paris war seit drei Monaten befreit, als er zu fliehen versuchte. Die Flucht misslang, er wurde vor 25.000 Deportierten gehängt. Das Seil riß. Das bedeutete Ermordung durch Nackenschuss. Aber der Henker, der ihn erschießen sollte, war ebenfalls ein Boxer und rettete ihn in letzter Minute. Am 18. Januar 1945 wurde Auschwitz evakuiert. Es folgte der Todesmarsch, in Tagesetappen von dreißig bis vierzig Kilometern, dreizehn Tage lang, ins KZ Mauthausen, dann ins Lager Gusen 2. Am Morgen des 7. Mai 1945 waren die Deportierten plötzlich allein im verlassenen Lager, die Deutschen waren vor der US-Armee geflohen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 282
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorwort der Söhne von Sim Kessel
Vorwort des Autors
Kapitel I.— Verhaftung
Kapitel II.— Die Zeit der Folter
Kapitel III.— Drancy
Kapitel IV.— Fahrt in die Dunkelheit
Kapitel V.— Nacht und Nebel
Kapitel VI.— Arbeit macht frei
Kapitel VII.— Bergarbeiter in Jaworzno
Kapitel VIII.— Auschwitz
Kapitel IX.— Politische Abteilung
Kapitel X.— Flucht
Kapitel XI.— Unterm Galgen
Kapitel XII.— Häftling im Untergrund
Kapitel XIII.— Exodus
Kapitel XIV.— Mauthausen
Kapitel XV.— Gusen II
Kapitel XVI.— Befreiung
VORWORT DER SÖHNE VON SIM KESSEL
130 660. Dies war die Nummer, die die Nazis unserem Vater bei seiner Ankunft in Auschwitz auf den linken Unterarm tätowierten.
Wie Vieh, das vom Züchter mit einem Brandzeichen versehen wird. Wie Sklaven, die vom Besitzer mit glühendem Eisen gebrandmarkt werden. Diese Nummer war die Eintrittskarte in die Hölle der Untermenschen. Die Kreaturen, die aus den verriegelten Eisenbahnwaggons wankten, wo sie tagelang ohne Wasser, ohne Nahrung, ohne Latrinen eingepfercht gewesen waren, standen aus Sicht der Nazis tiefer als Vieh. Bevor die Peiniger ihre Opfer niedermetzelten, ließen sie sich alles nur Erdenkliche einfallen, um sie zu erniedrigen, sie zu terrorisieren, sie ihrer Menschlichkeit zu berauben, ihre Kraft zum Widerstand zu zertrümmern, ihre Denkfähigkeit zu zerstören, ihre Hoffnung zu zerbrechen, sie zum Abschaum der Erde zu machen. Die Nazis wollten die Schatten ihrer Schatten zermalmen. Die apokalyptische Vernichtung des Anderen, derer, die als andersartig empfunden wurden.
Mehr noch als in ihrer kalten Industrialisierung, in ihrer akribischen Organisation waren die nationalsozialistischen Vernichtungslager hierin einzigartig in der Geschichte der Menschheit. Auch wenn die Geschichte seit 1945 weitere Kriegsverbrechen hervorbrachte, weitere Massaker an Unschuldigen, weitere Massenvernichtungen, weitere Genozide, beispielsweise in Kambodscha oder in Ruanda, so bleibt Auschwitz doch im Bereich des Unsagbaren, des Unerklärbaren, bleibt Inbegriff des Schlimmsten, was der Mensch je gegen den Menschen ersonnen hat. Wie konnten jene, die dieser Unmenschlichkeit entkommen sind, überleben? Unser Vater, der ehemalige Box-Champion, wog bei seiner Rückkehr nach Paris 36 kg. Wie lernten diese Menschen nach ihrer Heimkehr wieder zu leben? Wie lernten sie, nächtelang ganze Horden von Albträumen zu verjagen? Wie wehrten sie sich gegen die anbrandende Schlaflosigkeit? Wie lernten sie, die Erinnerung an jene zu ertragen, die hilflos unter Schlägen zusammengebrochen waren? Oder gar an jene, die sich nackt und frierend hatten in langen Schlangen anstellen müssen, um in die Gaskammern zu gehen?
Unser Vater sprach wenig über diese entsetzliche Reise nach Dachau, Birkenau, Auschwitz. Wie die meisten Überlebenden meinte er, man würde ihm nicht glauben, man würde denken, er übertreibe. Nach dem Krieg wollten die Menschen, die Bomben, Hunger, Entbehrungen und Verluste erlitten hatten, nichts mehr von Deportationen hören, und schon gar nichts von Todeslagern. Jenen, die die Kraft fanden, aus Treue zu ihren toten und unbegrabenen Kameraden über ihre Erlebnisse in der Deportation zu sprechen, gab man zu verstehen, dass dies störend sei. Man müsse nun doch etwas Neues angehen, ein neues Kapitel aufschlagen, man müsse endlich vergessen. Diese sechs Millionen Toten vergessen, deren einziger Fehler meist darin bestanden hatte, dass sie waren, was sie waren, in manchen Fällen freilich auch, dass sie Widerstand geleistet hatten gegen den Nationalsozialismus. Man sollte auch vergessen, wie brave Familienväter zu Handlangern einer Todesmaschinerie hatten werden können, die einen Teil der Menschheit ausrotten wollte.
Unser Vater sprach wenig darüber, aber sein Körper legte Zeugnis ab. Wenn er im Sommer seine Hemdsärmel aufkrempelte, war es uns nicht möglich, unter den blonden Härchen diese grünen, dicken Ziffern nicht zu sehen, die in seine Haut gebrannt worden waren. Auch die Narbe, die jene Stelle markierte, an der sein linker Mittelfinger gesessen hatte, bevor er ihm von der Gestapo ausgerissen worden war, erinnerte uns an die Qualen, die man Sim Kessel zugefügt hatte als sie versuchten ihn zu zwingen die Namen seiner Gefährten in der Résistance preiszugeben.
Das Datum der Befreiung der Lager gab Anlass zu dem einzigen Verstoß gegen diese Familienkultur der Verschwiegenheit und der Scham. Statt seinen Geburtstag oder den Vatertag zu feiern, wollte Sim, dass seine Frau und seine beiden Söhne mit ihm jenen Tag feierten, an dem die Überlebenden von Auschwitz befreit worden waren, die Letzten, die den Todesmarsch überstanden hatten, zu dem die Nazis die Geschundenen gezwungen hatten. „An diesem Tag“, sagte er, „wurde ich zum zweiten Mal geboren“. Und als seinen zweiten Geburtstag feierten wir jedes Jahr mit ihm diesen Tag voll Ergriffenheit.
Nachdem unser Vater wieder leben gelernt hatte – dank seiner Eltern, dank einiger Freunde, dank unserer Mutter, und trotz der Gleichgültigkeit, die den Deportierten damals entgegenschlug –, fand er in sich wieder die Quelle jener Kraft, die ihm bereits zuvor das Überleben ermöglicht hatte. Und doch sagte er uns, dass er sich manchmal – erschöpft, entkräftet, verzweifelt, schmerzgepeinigt, entsetzt durch den Anblick der Leichen der Deportierten – in den elektrischen Zaun hätte werfen mögen, um, wie andere es getan hatten, im Tod Befreiung zu finden.
Er hatte sein Leben weitergelebt, als sei nichts gewesen. Aber zwanzig Jahre später empörte er sich gegen diesen Schweigezwang. Er musste das tun, für sich selbst und mehr noch für das Gedächtnis der Millionen Toten. Man musste die Stimme erheben, man musste berichten, was geschehen war, man musste es den nachfolgenden Generationen erzählen, damit, mit Bertolt Brecht gesprochen, der Schoß endlich unfruchtbar werde, aus dem das kroch.
So beschloss unser Vater, dieses Buch zu schreiben und Zeugnis abzulegen. Es erschien in Paris und erhielt 1970 den Prix littéraire de la Résistance, danach wurde das Buch ins Englische übersetzt und fand Verbreitung in Großbritannien und in den Vereinigten Staaten. Ein halbes Jahrhundert später schlug uns der Verleger Kay H. Kohlhepp vor, eine deutschsprachige Ausgabe zu veröffentlichen, vor allem gedacht für Schüler und Schülerinnen. Wir waren sofort bereit, dieses schöne Projekt zu unterstützen. Denn es hätte unserem Vater gefallen.
Zum ersten Mal in ihrer Geschichte leben die Länder Europas nun seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs in Frieden, sie, die seit jeher immer wieder Krieg geführt hatten. Aber wenn in den Völkern Europas wieder Ideologien des Hasses auftauchen und das, was als andersartig empfunden wird, wieder zum Ziel von Drohungen wird, reicht Friede nicht aus. Antisemitismus, Rassismus, übersteigerte Nationalismen, Ideologien des Hasses und religiöse Totalitarismen sind in unterschiedlichem Maße leider wieder präsent. Was man nach Auschwitz für unmöglich hielt, wird wieder vorstellbar. Antisemitische Graffitis auf Schaufenstern, geschändete Gräber, Morde an Frauen und Männern, die erschossen wurden, weil sie jüdisch waren, rassistische Aggressionen, das Massaker an den Zeichnern der Satirezeitschrift Charlie Hebdo, gemeine Attentate, ständige Drohungen gegen Intellektuelle, die für absolute Gewissensfreiheit eintreten, zeigen uns, dass der Hass zurückgekehrt ist. Die vielgestaltige Unmenschlichkeit erhebt ihre Fratze und streckt ihre Krallen.
Freilich wissen wir, dass wir diese Unmenschlichkeit nie gänzlich ausrotten können, dass wir immer weiter gegen Ignoranz kämpfen müssen, gegen das Bestreben, die Menschen am selbständigen Denken zu hindern, gegen menschliche Raserei. Dennoch müssen wir wie Sisyphos unermüdlich in jeder Generation die Erinnerung weitertragen, wir müssen die Welt zu verstehen trachten und die Unmenschlichkeit so weit wie nur möglich zurückdrängen. «Man muss immer auf den Menschen setzen“, sagte unser Vater, der guten Grund gehabt hätte, an dessen Vertrauenswürdigkeit zu zweifeln.
Diese Übersetzung, die sich vorrangig an deutschsprachige Jugendliche richtet, ist ein Symbol dafür. Sie will ein bescheidener Beitrag sein im Kampf für die Prinzipien der Aufklärung und einer weltumspannenden Geschwisterlichkeit.
Didier-David und Patrick Kessel Paris, am 25. Mai 2019
VORWORT DES AUTORS
Im Dezember 1944 wurde ich in Auschwitz gehängt.
Die Umstände, die mir das Leben gerettet haben, sind außergewöhnlich, vielleicht sogar einmalig. Denn wenn es auch manchmal vorgekommen sein mag, dass das Seil riss oder der Knoten sich löste, so wurde dem Verurteilten doch gewöhnlich nur ein Aufschub von wenigen Stunden gewährt. Die SS verzieh nicht. Alle, die die gestreifte Gefängniskleidung von Auschwitz trugen, waren zum Tode verurteilt. Jeder, der überlebte, überlebte durch ein Wunder. Allenfalls ließe sich sagen, dass die Häftlinge, die als letzte ankamen, das Martyrium eher überstanden, weil die Dauer des Aufenthalts im Lager ihre Widerstandskraft noch nicht erschöpfen konnte. Erst in den letzten Kriegsmonaten verhaftet zu werden, stellte eine gewisse Überlebenschance für sie dar. Doch nur ganz wenige überlebten, wie ich es tat, ganze dreiundzwanzig Monate Lagerhaft – und dabei zähle ich die vorhergehenden Gefängnisaufenthalte nicht mit.
Die Überlebensdauer in Auschwitz oder einem seiner Nebenlager betrug im Durchschnitt höchstens drei Monate. Auschwitz war nicht das einzige Instrument des Völkermords. Auch die anderen Lager trugen dazu bei. Keines jedoch in diesem Tempo.
Drei Monate reichten, um einen Menschen all seiner Reserven zu berauben. Danach war das Überleben purer Zufall. Es ergab sich aus einer Verkettung glücklicher Umstände, die jeweils eine Atempause von wenigen Tagen oder Wochen gewährten.
Ich wurde also hundertmal gerettet, entkam einem tödlichen Schlag oder erhielt von unerwarteter Seite Hilfe. Wir waren aus der Welt ausradiert und konnten auf keine der Sicherheiten zählen, die von Gesetz oder menschlichem Erfindungsreichtum geschaffen werden.
Darum können wir uns nichts darauf einbilden, Auschwitz lebend verlassen zu haben. In dieser Hölle haben nicht die Besseren überlebt. Intelligenz, Mut, Bildung, Lebenskraft oder leidenschaftliche Lebensfreude waren machtlos. Kaum lässt sich behaupten, dass es den Geschicktesten oder den Skrupellosesten unter uns gelegentlich gelang, die Situation zu ihren Gunsten zu wenden. Das gemeinsame Elend ließ alle Unterschiede verschwinden, löschte die Werte aus, brach den Willen. Selbst diejenigen, die sich über einen „Druckposten“ freuen konnten – eine Erleichterung, in deren Genuss man meist zufällig und fast immer nur vorübergehend gelangte – blieben der schlechten Laune eines Soldaten oder der mörderischen Raserei eines Kapos ausgeliefert.
Ich schrieb den Bericht meiner KZ-Erlebnisse nicht nieder, um Vorteil daraus zu ziehen. Wenn ich den Ehrgeiz hätte, mich hervorzutun, würde ich eher – und mit größerer Berechtigung – von den beiden Jahren vor meiner Verhaftung sprechen, als ich in Paris der Résistance angehörte. An diese beiden Jahre nämlich denke ich mit größter Befriedigung zurück. Sie reichen aus, um ein Menschenleben zu rechtfertigen.
In den Lagern herrschten überall dieselben Vorschriften und was in dem einem geschah, geschah auch in allen anderen. Nur das Ausmaß der Vernichtung war verschieden.
Und dennoch halte ich es für nützlich, Zeugnis abzulegen. Fünfundzwanzig Jahre1 nach der Befreiung der Gefangenen von Auschwitz ist der Prozess gegen ihre Peiniger noch nicht beendet. Noch in jüngster Zeit wurden manche Täter freigesprochen, andere erhielten sehr milde Urteile. In jedem einzelnen Fall gab es eine jahrelange Untersuchung.
Sorgfältig wurden die Beweise ihrer Verbrechen gesammelt. Alle, die Auschwitz überlebt haben, wissen, dass das gesamte Wachpersonal dort ohne Ausnahme schuldig und gleichermaßen niederträchtig war, selbst wenn man die unablässig vorgebrachte Entschuldigung, die Täter hätten ja nur ihre Pflicht getan und Befehlen gehorcht, vorbehaltlos akzeptieren würde.
Ich halte es für nützlich, dass dies gesagt wird, wie ich es für nützlich halte, an die Qualen der Opfer zu erinnern. Diese Erinnerung verlöscht bereits. Fünfundzwanzig Jahre danach entdecke ich, dass junge Leute niemals von den Lagern gehört haben. Ich entdecke auch, dass viele nicht daran glauben. Gerne wird behauptet, die Fakten seien übertrieben worden, es sei eine allen Gefangenen eigene Schwäche, das in der Gefangenschaft erduldete Leiden zu übertreiben, im Übrigen habe die SS nur nach den Gesetzen des Kriegs gehandelt und was sich da in Deutschland ereignet hat, sei überall und zu allen Zeiten in gleicher Weise geschehen.
Solche Aussagen, die andere Deportierte gehört haben, wie auch ich sie gehört habe, und die in bestimmten Veröffentlichungen zu finden sind, machen wütend. Und doch: die Überlebenden, die dagegen Einspruch erheben könnten, melden sich kaum zu Wort. Weit davon entfernt, die Narben ihrer Wunden zu zeigen, sind sie nur bestrebt, möglichst nicht mehr darunter zu leiden.
Zudem sind es nicht die Aussagen der Unwissenden und Skeptiker, die am meisten empören. Da sind auch noch diejenigen, die freiwilliges Schweigen einfordern, diejenigen, die protestieren, die sich darüber beklagen, dass man ihre Ruhe störe, dass man sie den Geruch des Todes atmen ließe, diejenigen, die gemessen erklären, dass es sich nicht schicke, eine gewiss bedauerliche, aber auf immer begrabene Vergangenheit aufzurühren, diejenigen, die darauf hinweisen, dass eine solche Exhumierung ebenso unheilvoll wie unpassend sei. Unheilvoll, weil die Menschheit nichts dabei gewinne, wenn Rachsucht und Hass wiederbelebt würden. Unpassend, weil die Deutschen ihre Reue ja unter Beweis gestellt und den Weg der Versöhnung eingeschlagen hätten.
Niemals habe ich Deutschland und den Nationalsozialismus gleichgesetzt, nie ließ ich gelten, dass das deutsche Volk an sich kriminell sei. Da ich Rassismus verurteile, wäre es doch seltsam, wenn ich behaupten würde, die Deutschen seien eine eigene Rasse. Wenn ich mich dem barbarischen Prinzip der Kollektivschuld verweigere, versage ich mir auch, allen die Last des Verbrechens aufzubürden, das einige begangen haben. Ich lernte Deutsche kennen, die gut und menschlich waren und ich lernte Franzosen kennen, die Mörder waren. Es gibt keine Rassen und keine Nationen, die von Natur aus pervers sind. Es gibt nur einzelne Menschen, die die Barbarei zum Ideal erheben und die Gewalt zur Tugend. Dass diese Menschen in Deutschland mehr Macht erlangten als in anderen Ländern, ist nur ein Zufall der Geschichte. In anderen Ländern gibt es vergleichbare Bestrebungen, und nichts beweist oder garantiert, dass es sie nicht immer wieder geben wird.
Für jeden aufrichtigen Menschen, der in üblicher Weise über Informationen verfügt, ist es ganz klar, dass das Prinzip der Rassendiskriminierung wissenschaftlich absurd ist; dass der Glaube an eine Rassenhierarchie unhaltbar ist; dass die systematische Zerstörung von Millionen von Menschen, die man für „minderwertig“ erklärt – Juden, Russen, Polen und Zigeuner 2– ein monströses Verbrechen darstellt. Und doch konnte dieses Verbrechen im 20. Jahrhundert begangen werden. Die irrsinnige Philosophie fand sogar in wissenschaftlichen Kreisen Anhänger. Der Plan der methodischen Vernichtung wurde von zivilisierten Menschen entwickelt und umgesetzt. Nichts erlaubt uns zu behaupten, dass diese Ideologie verschwunden sei oder jetzt gerade verschwinde. Ganz im Gegenteil. Der Nationalsozialismus hinterließ Spuren. Er verpestet weiterhin Gedankenwelten. Um das Gift auszuscheiden, braucht es Zeit und Mühe.
Die Jahre vergingen, ohne dass ich die Gelegenheit und die Kraft fand, meine Erinnerungen zu sammeln. Zunächst musste ich ins Leben zurückkehren. Drei Jahre täglicher Folter lassen nicht nur körperliche Spuren zurück. Man muss abwarten, bis der Geist seinen Frieden wiederfindet, bis das Urteil sich klärt, bis der Wille sich wieder anspannt. Lange machte ich es wie alle Überlebenden, ich kämpfte gegen den quälenden Zwang der Erinnerung. Ich weiß aus Erfahrung, dass dieser Zwang unerträglich ist. Er verbietet jedes Ausruhen, bevölkert die Nächte mit Alpträumen. Wenn zwei ehemalige Deportierte sich treffen, vermeiden sie es einträchtig, die Vergangenheit aufzurühren.
Eine andere Schwierigkeit, die mich lange zurückhielt, ist, dass man einen solchen Bericht nicht nur auf eigene Erinnerungen gründen darf. Niemand, der nach Auschwitz deportiert wurde, konnte Notizen machen und diese aufbewahren. Es war verboten zu schreiben. Im Übrigen hatte man, selbst wenn man über die Mittel verfügt hätte, weder Zeit noch Lust dazu. Ich habe daher Ereignisse rekonstruiert, datiert und objektiviert, die ich zwar erlebt habe, denen ich damals aber keinen Einlass in mein Denken zu geben vermochte.
Man wird mir nicht vorwerfen können, unglaubwürdig zu sein. Oder unaufrichtig. Doch in vielerlei Hinsicht wäre ich gern genauer gewesen. Ich war so genau, wie ich nur konnte. Ich befragte andere Deportierte. In mühsamer Arbeit trat ich mit den wenigen Auschwitz-Überlebenden in Paris und anderswo in Kontakt, um sie zu bitten, ein Datum oder ein Faktum zu bestätigen. So sehr zweifelt man auf lange Sicht an sich selbst und so unglaublich ist das Geschehen selbst!
Diese Skrupel muss man verstehen. In den Lumpen des Deportierten war ich nicht der aufmerksame Zeuge, der alles sehen, alles zusammentragen, alles bewahren wollte. Ich war ein gehetztes Tier, das nur irgendwie zu überleben versuchte, und der Umstand, dass ich ständig Schläge, Hunger, Kälte, Krankheit, Ungeziefer aushalten musste, ließ mir keinen Raum für Beobachtung und Reflexion. Was mir Tag für Tag begegnete, nahm ich passiv in mich auf, ohne zu versuchen, es zu verstehen. Es war schon viel, wenn man auch nur ein Minimum von Energie aufbringen konnte, um durchzuhalten und weiter zu hoffen. Jene, die diese Kraft nicht besaßen und in Apathie versanken, starben, noch bevor sie jenen Grad an körperlicher Zerrüttung erreicht hatten, der sie in die Gaskammer führte, sie starben, weil sie so einfach nicht leben wollten.
Viele dieser Toten waren meine Freunde. Einige von ihnen verschieden in meinen Armen. Ihnen widme ich diese Seiten.3
1 Sim Kessel veröffentlichte die französischsprachige Originalfassung seiner Autobiographie im Jahr 1970. Grundsätzliche Anmerkung: Alle Fußnoten sind Erläuterungen, die von der Übersetzerin und vom Herausgeber eingefügt wurden, sie stammen nicht von Sim Kessel.
2 Sim Kessel verwendet im Jahr 1970 noch den Begriff „Zigeuner“, der heute üblicherweise keine Verwendung mehr findet, da er als rassistisch eingestuft wird. Die Textstelle zeigt, dass Sim Kessel den Begriff nicht in rassistischer Form verwendet.
3 Anmerkung des Verlages: Sim Kessel hat die Veröffentlichung der deutschen Fassung seines Werkes nicht mehr erlebt. Die hier – mit Zustimmung seiner Söhne – eingefügte Unterschrift von Sim Kessel stammt aus einem französisch-sprachigen Exemplar, welches er signiert hatte.
KAPITEL I
VERHAFTUNG
Ich wurde am 14. Juli 1942 in Dijon verhaftet. Ich war beinah 23 Jahre alt. Es war mein erster Kontakt mit der Gestapo.
Ich hätte bei einer Razzia verhaftet werden können oder man hätte mich einfach zu Hause abholen können. Tatsächlich gehörte ich einem Pariser Résistance-Netzwerk an und die Polizisten nahmen mich fest, als ich von einer Mission zurückkehrte, bei der es um eine Waffenlieferung ging.
Ich war am 20. Dezember 1940 in Paris der Résistance beigetreten. Auslösend dafür war, dass ich, als ich untätig auf der Straße herumlungerte, zufällig einen Freund aus Kindheitstagen wiedertraf. Vor kurzem war ich aus der Armee entlassen worden und nun wusste ich nicht, was ich mit mir anfangen sollte. Vom Krieg hatte ich nur das lange Stillsitzen an der Westfront kennengelernt, gefolgt von wilder Flucht. Wie hunderttausende andere Soldaten hatte ich praktisch keine Gelegenheit gehabt, zu kämpfen. Ich litt darunter. Mit dem Feuer und der Leichtfertigkeit der Jugend wollte ich nun den Kampf fortführen. Ich begriff nicht, wie gefährlich dieses Unterfangen war. Ich wusste, dass die Menschen meiner Rasse in ganz besonderem Maße Zielscheibe der Verfolgung waren. Die Besatzer machten kein Hehl daraus. Doch niemals hatte ich versucht, zu fliehen oder meine Familie in Sicherheit zu bringen. Sobald ich aber die ersten Flugblätter sah und Radio London hörte, beschloss ich, mich am geheimen Krieg zu beteiligen. Ich war ein Pariser Kind. Herangewachsen auf dem Pflaster der Großstadt, konnte ich mir kein anderes Kampfgebiet vorstellen.
Als ich die Gelegenheit erhielt, einer Résistance-Gruppe beizutreten, war ich sofort Feuer und Flamme.
Beinah zwei Jahre lang lernte ich das gefahrvolle Leben der Untergrundkämpfer kennen. Ich werde hier nicht von meinen Heldentaten erzählen, auch nicht von dem unglaublichen Plan, der mich mit einer Bombe in der Aktentasche in die Räume der Kommandantur an der Place de l‘Opéra führte. Eine Bombe, die übrigens nicht explodierte. Wenn ich mich an diesen Coup erinnere, so frage ich mich, ob meine Kameraden und ich nicht von einer Art Tollheit getrieben waren. Eine Erschießung von Geiseln hatte uns auf die Idee gebracht. Wir waren Neulinge, hatten noch keine Erfahrung mit Kampfaktionen, waren bestrebt, nicht als Feiglinge dazustehen, und beflügelt von der vagen und absurden Hoffnung, dass sogar der Feind, wenn er uns fasste, unseren Mut anerkennen würde.
Als ich am 14. Juli 1942 verhaftet wurde, hatte ich eben mit einem Koffer voller Maschinenpistolen die Demarkationslinie überschritten. Diese Waffen stammten aus einem Geheimlager, das mein Bataillon zur Zeit des Waffenstillstands vergraben hatte, damit es nicht in die Hände des Feindes fiel. Ich wusste genau, wo es sich befand. Bereits zum zweiten Mal war mir gelungen, die Demarkationslinie in beide Richtungen zu überqueren. Das Depot lag nämlich südlich dieser Linie, in Neuville-sur-Ain. Ein am Übergang postierter Komplize hatte mir jedes Mal bei dem nächtlichen Unternehmen geholfen.
Am 12. Juli war ich morgens in Chalon-sur-Saône eingetroffen, wo ich eine Fahrkarte nach Paris kaufen wollte. Ich verhielt mich ruhig und ungezwungen, wie jemand, der nach einem Ausflug aufs Land, wo er sich mit Lebensmitteln versorgt hat, nun im „Butterzug“ nach Paris zurückkehrt. Der Koffer voller Waffen hing schwer an meinem Arm, mein Herz schlug heftig. Kaum hatte ich meine Fahrkarte aus den Händen eines gleichgültigen Bediensteten entgegengenommen, als ich durch die Scheibe des Schalters im Durchgang zum Bahnsteig einen Kontrolleur der deutschen Gendarmerie bemerkte, erkennbar am Abzeichen auf seiner Brust, begleitet von zwei Männern im Zivil, die der Gestapo angehörten. Ich täuschte mich gewiss nicht. Ich hatte genug Erfahrung, um zu ermessen, wie gefährlich eine Kontrolle im Zug wäre. Ich konnte nicht umkehren, ohne die Aufmerksamkeit der Polizisten auf mich zu lenken. Also ging ich auf den Bahnsteig und war ganz erfüllt von dem Bestreben, meine Last irgendwo abzustellen. Ich suchte die Gepäckaufbewahrung, hielt meinen Koffer einem Bediensteten hin, der sein Gewicht zu beurteilen schien, indem er ihn mehrfach in der Hand wog, er sagte aber nichts. Ich erhielt einen Schein für die Gepäcksaufbewahrung, steckte ihn in die Tasche und entfernte mich.
Ich wagte es nicht, den Bahnhof auf dem Weg zu verlassen, auf dem ich ihn betreten hatte. Ich wandte mich zum Bahnhofsbuffet und setzte mich. Die graugrünen Uniformen, die man überall sah, ließen meinen Wunsch, einen Ausgang zu suchen, verstummen; plötzlich packte mich die Angst. Meine Beine trugen mich kaum mehr. Ich trank einen Kaffee, zumindest den Aufguss aus gerösteter Gerste, den man als solchen bezeichnete.
Ein Eisenbahner an einem anderen Tisch trank ebenfalls Kaffee. Er beobachtete mich. Ich sehe noch immer sein geschwärztes Gesicht und seine aufmerksamen Augen vor mir. Er hatte verstanden, dass ich gehetzt war, verängstigt und zudem nicht ausreichend gestählt, um meine Bestürzung völlig zu beherrschen. Draußen, auf dem Bahnsteig, war eine beunruhigende Bewegung wahrnehmbar. Soldaten liefen die Züge entlang.
Der Eisenbahner näherte sich mir, mit einem Schimmer von Freundschaft in den Augen. Dieselbe Einfühlung, die es ihm erlaubte, das Entsetzen des Verfolgten zu erahnen, ließ mich seine Absicht, mein Retter zu sein, verstehen. Vielleicht hätte er gezögert, wenn er meine „terroristischen“ Fähigkeiten geargwöhnt hätte. Er musste mich für einen Flüchtling halten, der die Demarkationslinie zu überqueren versuchte. Jedenfalls nahm er ohne Zögern das Risiko auf sich, mich als Arbeiter verkleidet aus dem Bahnhof hinauszubringen. Beinah ohne Worte einigten wir uns darauf, miteinander wegzugehen, ich mit seiner Werkzeugkiste in der Hand und seiner Schirm-Kappe auf dem Kopf, zwei Arbeiter, die ihr Tagwerk beendet haben.
„Nicht laufen! Wir gehen nach draußen.“
Und schon gingen wir ruhigen Schrittes die Gleise entlang. Als wir zu einem Wachposten kamen, spürte er mein Zusammenzucken und nahm mich am Arm. Ich hatte mich noch nicht von meinem Schrecken erholt.
„Keine Angst.“
Tatsächlich nahm der Wachposten keine Notiz von uns. Mein Retter führte mich durch die Weichen bis zum Güterbahnhof. Ich verließ den Bahnhof, immer noch an seiner Seite, wir gelangten bald in ein ruhiges Viertel mit Reihenhäuschen und kleinen Gärten. Er zeigte mir in einiger Entfernung ein Einfamilienhaus.
„Hier wohne ich. Aber ich kann dich nicht bei mir aufnehmen. Wenn die Deutschen die Züge kontrollieren, werden sie auch die Häuser der Eisenbahner durchsuchen. Geh da weiter, nach dreihundert Metern kommst du aufs Land.
Ich glaubte mich gerettet. Naiv beruhigt, weil ich einige Distanz zwischen die Deutschen und mich gebracht hatte, drückte ich ihm die Hand und ging – nicht aufs Land, sondern in Richtung Stadt, weil ich in meiner Einfalt bereits daran dachte, die Demarkationslinie ein weiteres Mal zu überqueren, um eine weitere Waffenladung zu holen. Ich konnte nicht ermessen, wie groß die Gefahr war, da ich keine Ahnung davon hatte, über welche Möglichkeiten die Polizei verfügte. Als ich den Busbahnhof erreichte, begriff ich rasch. Die Autobusse wurden vor der Abfahrt ebenso streng kontrolliert wie die Züge. Durch die Scheibe des Cafés, das ich betreten hatte, sah ich, wie deutsche Autos mit großer Geschwindigkeit vorfuhren und Gendarmen in die Busse einstiegen, um die Papiere der Reisenden zu überprüfen. Es blieb mir nichts mehr übrig, als mich, von Angst gepackt, wieder davonzumachen. Ich begriff, dass der Koffer mit den Pistolen entdeckt worden war und die Polizei meine Personenbeschreibung besaß. Die folgenden Ereignisse sollten mir diese Vermutung bestätigen.
Ich weiß immer noch nicht, ob der Bedienstete in der Gepäckaufbewahrung auf das abnorme Gewicht des Gegenstands, den ich hinterlegt hatte, aufmerksam gemacht und mich damit denunziert hat, oder ob er sich damit zufriedengab, eine Beschreibung von mir zu liefern, nachdem der Koffer entdeckt worden war. Ich war recht leicht wiederzuerkennen: blondes Haar, blaue Augen, Boxernase.
Ich musste fliehen und vermied dabei die Hauptstraßen. Zufall oder Instinkt führte mich zu dem Viertel in der Nähe des Bahnhofs, das ich kaum eine Stunde zuvor verlassen hatte. Ich hoffte, dort wieder den Mechaniker zu treffen, der mich gerettet hatte. Ich kannte sonst niemanden in Chalon-sur-Saône. Ich hatte das Gefühl, in die Falle gegangen zu sein, gefangen in einer feindseligen Stadt, in der ich mich nicht orientieren konnte. Züge und Autobusse, die mich hätten von hier wegbringen können, durfte ich nicht benutzen, die Straßen hinaus aufs Land waren vielleicht gesperrt. Es blieb mir nur mehr die Möglichkeit, mich hier vor Ort zu verstecken und darauf zu warten, dass die Überwachung gelockert würde.
Ich hatte das Glück, meinen Eisenbahner wiederzutreffen, der nach seiner Frühschicht nach Hause zurückkehrte. Ich hatte zwei endlose Stunden in einem von Gestrüpp überwucherten Gärtchen verbracht und als ich es verließ, war ich mit meiner Geduld am Ende, war bereit, alles zu versuchen. Mein Versteck, das schon unsicher gewesen war, als die Straße noch verlassen dalag, wurde, je mehr Leute dort auf ihrem Heimweg von der Arbeit vorbeigingen, einfach lächerlich. Ich sah, wie der Mann seinen Schlüssel hervorzog und seine Tür öffnete. Er hatte sie kaum hinter sich geschlossen, als ich anläutete. Er öffnete mir.
Ich war entschlossen, alles auf eine Karte zu setzen. Übrigens hatte ich ja gar keine andere Wahl. Die Notwendigkeit, mich zu verstecken, war gewichtiger als jede andere Überlegung. In dem kleinen Speisezimmer, in dem ich meinem Gastgeber gegenübersaß, vertraute ich mich ihm an, erzählte ihm meine Geschichte, sprach über die Résistance. Ich wollte ihn überzeugen, bemühte mich, ihn zu rühren. Er hörte mir zu, die klaren Augen auf mich gerichtet. Ich hatte noch nicht geendet, als seine Frau heimkam, auch sie kam von der Arbeit. Ich musste sie überzeugen, da sie ja über mein Schicksal entscheiden würde. Sie erhob keine Einwände, merkte aber an, dass dies äußerst gefährlich sei. Mehr als ein Mal hatten die Deutschen das Haus schon durchsucht. Das Paar hatte einen Sohn, der in Kriegsgefangenschaft war, und eine in Lyon verheiratete Tochter. Alle beide wussten, was die Résistance war, hörten Radio London. In der tapferen und harten Welt der Eisenbahner erweckte die Arbeit im Untergrund Sympathie, traf auf geheimes Einverständnis und auf Opferbereitschaft. Man wies mir ein kleines Zimmer im Haus zu. Dort verbrachte ich den Tag, die Nacht, den nächsten Tag.
Zu Mittag warnte mich mein Gastgeber, dass die Suche weitergeführt werde. Alle Eisenbahner waren befragt worden. Möglicherweise würden die Häuser der Eisenbahner durchsucht. Ich wollte mich in der Nacht davonmachen.
Ich begriff, welche Gefahr ich für meine Gastgeber darstellte. Hatte ich denn das Recht, Leben oder Freiheit anderer Menschen aufs Spiel zu setzen?
Am Abend des 13. Juli, gegen zehn Uhr, befand ich mich auf einer wenig frequentierten Straße, die aus der Stadt hinausführte. Der Eisenbahner hatte mich selbst dorthin geführt, nachdem er zuvor festgestellt hatte, dass es keine Sperre gab. Ich drückte ihm die Hand. Mir standen Tränen in den Augen und ich glaube, er weinte auch. Er wünschte mir viel Glück und verschwand.
Ich ging mehrere Stunden durch die Nacht. Ein Lastwagen tauchte auf und rollte sehr langsam in dieselbe Richtung wie ich. Seine Langsamkeit beruhigte mich, es konnte sich nur um ein Zivilfahrzeug eines Händlers handeln, der über alle Zeit der Welt verfügte. Ich hielt es auf. Ein Fahrer, an dessen Gesicht ich mich kaum mehr erinnern kann – im Schatten der Kabine war es übrigens kaum zu erkennen –, forderte mich auf, mich neben ihn zu setzen und brachte mich nach Dijon. Weiter fuhr er nicht. ich weiß nicht mehr, was wir miteinander sprachen. Der Mann schien nicht überrascht zu sein, auf der Landstraße einen Burschen zu treffen, der um ein Uhr morgens ein Auto anhielt. Übrigens sprach er wenig. Er setzte mich, kaum, dass der Morgen graute, an der Stadteinfahrt ab und fuhr davon.
Ich flüchtete mich zunächst einmal in eins jener sehr früh geöffneten Cafés, wo die Menschen sich einfinden, die im Morgengrauen zu arbeiten beginnen. Ich wartete dort darauf, dass die Geschäfte öffneten, dann schlenderte ich durch die Straßen. Ich sah einen Friseur, der das Gitter vor seinem Geschäft hinaufkurbelte, trat bei ihm ein, ließ mich rasieren, ließ mir die Haare schneiden. Ich erinnere mich an das Gefühl von Sicherheit, das ich empfand, während der Friseur sich mit mir beschäftigte. Die Gefahr schien vorbei. Mein mitteilsames, fröhliches Naturell gewann wieder die Oberhand. Ich plauderte lustig mit dem Friseur. Nach diesen angstvollen Tagen und schlaflosen Nächten glaubte ich ein normales Leben wiedergefunden zu haben.
Als ich den Laden verließ, wusste ich nicht, was ich tun sollte. Ich musste möglichst rasch zurück nach Paris, aber wie? An der ersten Kreuzung sah ich mich plötzlich von drei Männern in Zivil umringt.
„Ihre Papiere!“
Keine Möglichkeit, ihnen zu entwischen. Ich erblasste. Ich zog zögernd meine Brieftasche heraus. Meine Papiere waren echt. Ich hatte nicht daran gedacht, mir eine falsche Identität zuzulegen. Wozu auch?
„Sie sind aus Paris? Was machen Sie in Dijon?“
Der raue Akzent des Mannes ließ keinen Zweifel. Ich versuchte stammelnd irgendetwas zu erklären. Sie ließen mir keine Zeit dazu.
„Mitkommen!“
Ich protestierte halbherzig. Sie zerrten mich mit. Unter der Jacke des Mannes, der mich befragt hatte, tauchte der Kolben einer Pistole auf. Ein Wagen wartete in hundert Metern Entfernung. Sie mussten aus ihm ausgestiegen sein, als sie mich bemerkten. Ich stieg ein, unter Stößen und Püffen, weil ich mich zu wehren versuchte. Der Wagen fuhr los. Ich weiß nicht mehr, wie lange die Fahrt dauerte oder vor welchem Gebäude wir stehenblieben. Ich versuchte, mir ein Verteidigungssystem auszudenken. Man ließ mich eine Treppe hinaufsteigen, einen Gang entlang gehen und dann wurde ich in eine Zelle gesteckt.
Ich hörte, wie sich der Schlüssel im Schloss drehte. Dort ließ man mich, ohne Essen, ohne Trinken, den ganzen Tag und die ganze Nacht.
KAPITEL II
DIE ZEIT DER FOLTER
Was sich bei meinen Vernehmungen abspielte, wissen alle Résistance-Kämpfer, die in deutscher Gefangenschaft waren. Die Gestapo hat die „peinliche Befragung“ gewiss nicht erfunden. Sie hat sie nicht vervollkommnet. Aber sie verlieh der Folter einen besonderen Stil. Der deutsche Folterer war in der Mehrzahl der Fälle ein Sadist, der als solcher ausgewählt oder dazu ausgebildet worden war. Wer immer es mit Leuten von der Gestapo oder der SS zu tun bekam, begriff dies. Sie schlugen, um Geständnisse zu bekommen, was ihnen nicht besser und nicht schlechter gelang als irgendwelchen anderen Polizisten, aber vor allem und noch viel mehr schlugen sie aus Freude am Schlagen. Niemals sah ich bei ihnen die kleinste Regung des Mitleids oder auch nur den Schatten eines Skrupels. Sie ergötzten sich am Leiden ihres Opfers, strengten ihren Verstand an, um ihr Opfer zu erniedrigen und entwürdigen, krümmten sich vor Lachen, wenn sie mit Faustschlägen die Würde eines Menschen zerbrochen hatten, wenn sie ihn gezwungen hatten, auf dem Boden zu kriechen und zu winseln. Hitlers Deutschland hatte tausende solcher Peiniger herangebildet. Man stelle sich vor, was das Deutsche Reich mit dieser Armee in einer unterjochten Welt angestellt hätte…
Am Tag nach meiner Gefangennahme überstellte man mich nach Chalon-sur-Saône, also an den Schauplatz meiner mutmaßlichen Heldentaten. Wenn die Gestapo nämlich auch überzeugt war, dass ich der „Terrorist“ mit dem Koffer war, so hatte sie doch keinen Beweis dafür. Ich hielt kühn die Behauptung aufrecht, ich sei ein Jude auf der Flucht in die freie Zone und ich sei, direkt aus Paris kommend, in Dijon ausgestiegen, um jemanden zu finden, der mich über die Demarkationslinie schleusen könnte. Man hatte mich durchsucht, ohne Ergebnis. Ich hatte darauf geachtet, die Fahrkarte, die ich am Bahnhof von Chalon gekauft hatte, sowie den Gepäckschein verschwinden zu lassen. Die relativ hohen Geldbeträge, die ich bei mir trug, waren dazu angetan, die Behauptung glaubwürdig erscheinen zu lassen, ich wolle mich freiwillig ins Exil begeben: Geld war nötig, um über die Grenze zu gelangen.
Man glaubte mir nicht. Zu viele Indizien sprachen gegen mich und die Polizei verstand es gut, sich meine Gefangennahme zunutze zu machen und mich zum Reden zu bringen. Ich würde doch keine Pistolen nur zum eigenen Gebrauch transportieren; ich musste einer Gruppe angehören. Das Hauptinteresse bestand also darin, von mir Namen und Adressen zu bekommen, um einige Ketten-Denunziationen auszulösen. Mehr brauchte es nicht, um ein Netzwerk völlig zu zerstören.
In unserem Widerstandsnetzwerk wussten wir, was Folter bedeuten konnte und welche Gefahren für alle Gruppenmitglieder die Gefangennahme eines einzigen Gruppenmitglieds mit sich brachte. Die bereits erlittenen Verluste waren schwerwiegend. Wir hatten daher seit langem versucht, diese Gefahren zu beschränken, indem wir die Berührungspunkte zwischen uns auf ein Minimum reduzierten. Ich kannte nur wenige Kameraden. Zudem war vereinbart, dass immer, wenn einer von uns von einer gefährlichen Mission nicht zurückkehrte, die anderen nach einer gewissen Frist zwingend ihren Wohnort und ihre Identität wechseln mussten. Bevor ich nach Neuville-sur-Ain aufgebrochen war, hatten wir die Sicherheitsfrist für dieses Mal auf drei Tage festgelegt. Da diese Frist verstrichen war, hatte ich einige Ursache anzunehmen, dass meine Kameraden sich versteckt hatten.