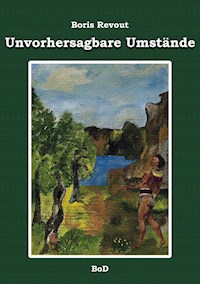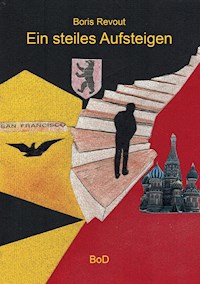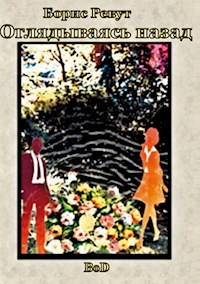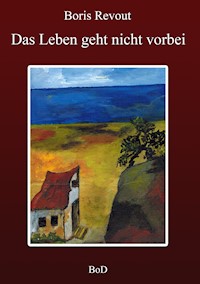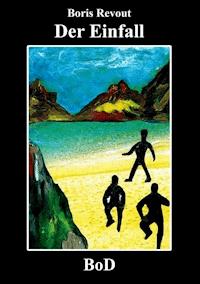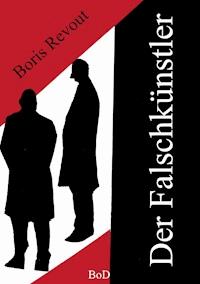Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Die Geschichte der Pharmazie begann vor mindestens 5000 Jahren, wenn sie vollständig den heidnischen Opferpriester zugeteilt worden war. Uns, den Menschen des 21. Jh. sind viele rätselhaften Erscheinungen der Natur gut bekannt. Gleichzeitig verbleiben unzählige Fragen, die mit unserer Gesundheit und Pharmazie verbunden sind immer noch wie einem Buch mit sieben Siegeln. Das vorliegende Buch versucht, einige alte und neue Geheimnisse dieses Bereiches aufzuklären. Es handelt sich dabei auch um den Zusammenhang der Pharmazie mit unserer Gesundheit, Ernährung, Psyche. Es zeigt, warum wir seit Jahrtausende eine starke Neigung zum Alkohol und Betäubungsmittel haben sollten. Es erklärt, wie wir mit den kleinsten Wesen der Welt umgehen müssen, um davon richtig profitieren zu können.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 595
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Auf dem Umschlag das Gemälde von Natalie Revout
Inhaltsverzeichnis
Mythologie der Apotheke
Heiliger Krieg gegen Dämonen
Mit den alten Arzneien richtig umgehen
Die suchterzeugenden Drogen
Weitere Entwicklung der Pharmazie
Eine Arznei ist immer mit dem Risiko verbunden
Das Placebo
Pharmakologische Ansichten Paracelsus
Erfahrung und Arzneimittelkunde
Chemische Wurzeln der Pharmazie
Verordnungen der Arzneieinnahme
Die heiligen Zahlen
Arznei wirkt auf Organismus, Organismus wirkt auf Arznei
Wo man die Heilpflanzen sucht
Durchbrüche vormoderner Pharmazie
Im Marsch gesetzte Pharmaindustrie
Umhüllung von Arzneimitteln
Wie man richtig die Arzneien aufbewahren sollte
Philosophie der Apotheke
Körperbestandteile, deren Krankheiten und Arzneien
Zentralnervensystem
Hirnschaden
Das vegetative Nervensystem
Wie Bakterien mit den Antibiotika umgehen
Wie man seine Abwehrkräfte verbessern kann
Hormone
Das Blut
Das Lymphsystem
Die Milz
Das Knochenmark
Enzyme
Der Magen
Der Dünndarm
Der Dickdarm
Ernährung und Verdauung
Wie sich die Kleinsten in unser Leben einmischen
Viren
Wie man mit dem Bauch denken kann
Der Mund
Das Gebiss
Die Speiseröhre
Pharmakologie des Essens und Nichtessens
Die Leber
Die Niere
Die Lunge
Das Herz und der Blutkreislauf
Die Muskulatur
Die Haut
Das Haar
Das Auge
Das Ohr
Die Nase
Der Kehlkopf
Die Wirbelsäule und Knochen
Die Gelenke
Das Immunsystem
Das Fasten
Apotheke der Nebenwirkungen
Pharmazeutische Bedeutung der Lebensmittel
Kehrseite der Münze
Arzneimittel und Alkohol
Geheimnisse der Homöopathie
Das Doping
Epilog
Mythologie der Apotheke
Seit jeher verbarg die menschliche Gesundheit etwas besonders Geheimnisvolles in sich, was man anders als Gottesgnade oder - strafe nicht erklären könnte. Natürlich war die Kenntnis darüber von Anfang an den Gottesdienern hingegeben worden. Diese Schamanen und Priester besaßen die Kunst des Umgangs mit den Göttern, die ihnen auch die Wahrheit über das Wohlbefinden jedes Sterblichen mitzuteilen fähig waren. Aus diesem Grund war auch die älteste Form der Medizin ihre magische Abart. In allen alten Hochkulturen des Orients gab es sogar Zeiten, in denen die Magie das ganze Leben beherrschte. So schilderte der römische Gelehrte Cajus Plinius Sec. (auch Plinius der Ältere genannt) seine magischen Denkweisen in seinem Werk „Historia Naturalis“. Seine zentrale Auffassung bestand darin, dass menschliche Gesundheit ständig von übernatürlichen Wesen und Kräften beeinflusst worden war. Diese bösen Geister und Dämonen übten ihr Unwesen durch Zauberei und Magie, was üblicherweise zu schweren Krankheiten führen sollte.
Um der schweren Herrschaft von außerirdischen Kräften entgegenzuwirken, brauchte man etwas mehr als die einfachen natürlichen Heilmethoden. Das darauf entwickelte System fasste zahlreiche Zaubersprüche, Beschwörungen, Weihegaben und Sühneriten sowie Gebetsübungen um. Nur damit könnte ein Sterblicher diese gefährlichen Drohungen der übernatürlichen Wesen aufhalten und abwehren. In Wirklichkeit wurden aber alle solchen Praktiken von echten Heilhandlungen begleitet werden, die vor allem mit der Zufuhr von Arzneien verbunden waren. Der Sinn, den man der heilenden Wirkung der Arznei zuschrieb, wechselte sich aber stark. Manchmal passierte es deswegen, weil die Arznei selbst zu einem Zaubertrank mit magischer Kraft umgestaltet worden war.
Neben gut bekannten Pflanzen mit „göttlichen“ Eigenschaften sollten auch bestimmte Metalle ungewöhnliche heilenden Fähigkeiten erweisen. Wenn es traditionell verständlich war, schien eine Verehrung den organischen Ausscheidungen gegenüber ziemlich seltsam. Allerdings war ein gut angeordnetes System, wo jedem Kot und Harn von Menschen und Tieren das Kurieren gewisser Erkrankungen zugeschrieben worden war, hochgeschätzt. Das Vorkommen der Krankheit wurde nach dieser Ansicht von außen an den Menschen hineindringen und den Organismus mit gefährlichen fremden Substanzen verunreinigt. Die richtige Behandlung besteht darin, die krankmachenden Dinge mit allen möglichen Mittel zu entfernen und beseitigen. Zu diesem Zweck suchte man beharrlich nach bestimmten Heilmittel, die vermeintlich das Böse aus jeder Wunde zu entfernen verhalf. Der Mechanismus solchen Genesungseffekts war egal. Es konnte Abführpulver aus Pflanzenwurzeln sein oder ein Saphirstein, der mit seiner göttlichen Anziehungskraft das Gift aus dem Leib vertreiben konnte. Der leidende Patient glaubte aufrichtig an die große Macht aller gegebenen Mittel und ihre antidämonischen Kräfte und wenn der Arzt sich gleichzeitig zu heiligen zählte (wie z.B. die Heilige Hildegard von Bingen), war das Kurieren ursprünglich gewährleistet worden. Eine umfangreiche Palette der Arzneien schloss damals ziemlich ungewöhnliche Mitteln wie Wolfszähne, Maulwurfskrallen, Krebsaugen oder getrocknete Schwalben. Um die Wirkung dieser „heiligen Medikamenten“ zu verstärken, sollte man zusätzlich an einer Menge Vorschriften festhalten. Magische „Heilkunst“ erfand immer neue Prinzipien, die eine besondere Wirkung, etwa durch Unterschiedlichkeit oder Abneigung erweisen sollten, die man wahrscheinlich nur bei einer himmlischen Vorsehung erfahren konnte. Die mittelalterliche Lehre der Magie behauptete, dass Herr Gott mehrere irdischen Wesen umsichtig mit dem Ziel schöpfte, Menschen auf ihr äußeres Aussehen hinzuweisen. So bedeutete die Form einer Pflanze, die einem menschlichen Organ ähnelte, dass dieses Gewächs gerade für die ärztliche Behandlung des Organs geeignet sein sollte. Solche ziemlich umstrittene Methode der Suche nach neuen Heilmitteln bekam in einem Zeitabschnitt eine allgemeine Anerkennung, denn sie entsprach vollständig den religiösen Überzeugungen der Mehrheit der Bevölkerung. Dieser Denkweise entspricht auch die Einstellung der edlen Gegenstände und Gesinnung. Edle Sachen sollten „unbedingt“ auch gegen böse Geister der Krankheit effizient wirken. Man verehrte seit Jahrtausenden edle Metalle, vor allem Gold, und glaubte, dass es mehrere Krankheitserreger mit seinem Zauber zu beseitigen vermochte. Ähnlicher Weise dachten die Ärzte, die ihren Patienten heilende Amulette aus Edelsteinen zu tragen empfahlen. Die antike Humoralpathologie ging davon aus, dass alle Krankheiten auf die fehlerhafte Zusammensetzung des Blutes und anderer Körpersäfte zurückzuführen seien. Griechische und römische Gelehrte waren dabei der Auffassung, dass die Krankheit ein ausschließlich körperlicher Vorgang war. Keine Ausnahme sollten auch die Geisteskrankheiten erweisen. Besessenheit, Melancholie oder Zwerchfellnervenentzündung galten als Folgeerscheinungen abnormer körperlichen Veränderungen. Besondere Aufmerksamkeit wurde zum Zustand des Bluts, Schleims, Harns, Schweißes oder der Galle angezogen, die man wie Kennzeichen der Gesundheit und Krankheit aufnehmen sollte. Schon in der Lehre Empedokles (5 Jh. v. Chr.) wurde ein vier Elementes System vorgeschlagen worden, das vier Elemente (Feuer, Wasser, Luft, Erde) umfasste. Es gab auch ein anderes System, das auch vier Elemente beinhaltete: Wärme, Kälte, Feuchte und Trockenheit. Die Entwicklung einer Krankheit sah man dabei wie eine gefährliche Unausgewogenheit dieser Elemente wegen einer schwachen Mischung der genannten Körpersäfte. In einer Zeitspanne zwischen 3. und 1. Jh. v. Chr. vertraute man nicht besonders wissenschaftlichen Hypothesen und Theorien. Viel einfacher wäre es, auf eigene praktische Ergebnisse zu verlassen. Nur die von Zeno gegründete um 300 v. Chr. Philosophieschule Stoa konnte stolz auf ihre theoretischen Studien sein. Medizinhistoriker zählen Galen zu größten Fachmediziner der Antik, der in zweiter Hälfte des 2. Jh. mit seiner Lehre ein gut errichtetes Gebäude der zeitgenössischen Medizin schaffte, die bis ins 18. Jh. über professionelle Ärzte weltweit herrschte. In Fortsetzung der Humoralpathologie hielte Galen die vier „echten“ Elementqualitäten: warm, kalt, feucht, trocken für die bedeutendsten Urkräfte. Die nächsten vier Dinge worden den ersten zugeordnet worden, indem das Feuer heiß und trocken war, die Erde – kalt und trocken, die Luft – warm und feucht und das Wasser – kalt und feucht. Das Verhalten dieser vier Qualitäten wurde auch für die Mischung der Qualitäten in den Säften und in den Körperteilen angemessen. Auf diesen Grund sollten sie auch in den Arzneien wirksam bleiben. Man erkannte die vier Qualitäten durch seine Sinne. Wenn irgendwelches Heilmittel Wärme enthält, ähnelt es einigermaßen das Feuer, unterscheidet sich allerdings davon quantitativ. In den Arzneimischungen sind sie grundsätzlich verdeckt, kombiniert und nur potenziell enthalten. Das Gleiche gilt auch für die Krankheiten, die gewöhnlich aus dem Übermaß an Wärme, Kälte, Feuchte und Trockenheit in den Geweben entstehen. Insgesamt sind neun fehlerhaften Zusammensetzungen der Körpersäfte im Sinne der Kombinationen von warm und feucht, kalt und feucht, warm und trocken, kalt und trocken usw. vorstellbar. Galen maß eine große Bedeutung seiner Lehre der Säfte nicht zufällig bei. Denn auch sie beruhte sich auf einem Übermaß des einen oder anderen Saftes (Schleim, Blut, gelbe und schwarze Galle) und einer daraus entstandenen Störung der Ausgewogenheit der Qualitäten. Jede von diesen Änderungen konnte zur Pulsabwandlung führen, was für Galen ein Kennzeichen der anbrechenden Erkrankung sein sollte. In diesem Falle könnten alle Organe inklusiv Herz, Gehirn, Leber, Lunge ihre gesunde Qualität allmählich verlieren. Galen konnte auch bei mehreren Krankheiten auch anatomische Abweichungen von Normen des Baus, der Größe und Lage der Organe sowie deren Änderungen infolge der Verletzung oder Zerstörung eines Organs nicht ausschließen. Er nutzte folgerichtig diese drei theoretischen Bestandteile für seine praktische Behandlung mit der Absicht, ein gutes Verhältnis von warm und kalt, feucht und trocken in allen Teilen des Organismus zu erhalten. Sie sorgten dafür, Fehlschläge zu verhüten und bei schon vorhandenen Störungen des Mischverhältnisses der genannten vier Qualitäten eine vorige ausgeglichene Mischung wiederherzustellen.
Er verbreitete erheblich die frühere Palette der Arzneien, die er gewöhnlich in großen Mengen und komplizierten Mischungen verschrieb. Typischerweise bekamen auch diese merkwürdigen Formen der Rezeptschreibung mit deren Kombinationskunst in folgenden Jahrhunderten eine vollkommene und allgemeine Anerkennung bei Ärzten. Darüber hinaus rief diese Besonderheit Galenischer Methode eine Neigung hervor, immer mehr Behandlungsvarianten und Medikamente auszuprobieren. Auf diesen Grund wurde es später zur Normalität geworden, in Rezepten bis zu 20 einzelnen Bestandteilen einzuschreiben. Wenn moderne Ärzte und Medizinstudenten die Möglichkeit haben, solche Rezepte durchzulesen, setzen sie sich in Erstaunen. Denn neben der Vielfalt der Mittel mit unterschiedlicher Wirkung schließen sie mehrere Substanzen aus der sogenannten Dreckapotheke ein, die reich mit menschlichen und tierischen Kot und Harn vertreten war. Es wächst bei diesen zeitgenössischen Fachmedizinern den inneren Widerstand auf, irgendwelche aus den umstrittenen Erwägungen vorkommende Arzneien anzuwenden. Gleichzeitig sollten auch moderne Mediziner bestätigen, dass der Hauptgedanke Galens in Bezug auf Wirkungen der Medikamente und ihren Mischungen standhaft bleibt. Obwohl es ziemlich vage aussah, irgendwas Konkretes über das Übermaß an Wärme, Kälte, Feuchtigkeit und Trockenheit zu urteilen, war es klargeworden, dass es in einem krankhaftveränderten Körperteil stattfand. Daraus ergab sich nach dem Prinzip des Gegenteils das Behandlungsmittel, das durch Kraft seiner Qualität die Verschiebung im Gleichgewicht der gesunden Kennzeichen wiederherstellte. Man erinnerte sich dabei ständig an die berühmte Hippokrates Formel: „Das Entgegengesetzte heilt das Entgegengesetzte“. Man gab demnach bei Kälte erwärmende Mittel wie Pfeffer oder Senf, oder kühlte mit dem Mohn gegen die Wärme. Galen wusste aber, dass der Mohn nicht nur stark zu kühlen, sondern zugleich zu trocknen vermochte. Ähnlicher Weise gab es viele Arzneien, die ganz verschiedene Eigenschaften in unterschiedlich vertretenden Ausmaßen besaßen. Um diese Unterschiede einigermaßen zu berücksichtigen, schlug Galen vor, bestimmte Grade der Qualitäten anzuwenden. So sprach er von einem Medikament, dessen Wärme im 1, 2 oder 3. Grade waren. Mithilfe solches Systems der Abschätzung schaffte Galen die Möglichkeit, zwischen elementar wirkenden Arzneien, die nur eine Qualität erwiesen und solchen, die einen besonderen Gehalt an Wärme, Kälte, Trockenheit oder Feuchtigkeit hatten, zu unterscheiden. In seinem Vorrat der Heilmittel habe er auch kombiniert wirkende Arzneien mit gemischten Eigenschaften. So kannte man in beiden Gruppen solche Medikamente, die bestimmte Qualitäten in hohem oder in schwachem Grade enthielten. Das Werk des griechischen Gelehrten wurde vernehmlich von der arabischen Medizin übernommen. Avicenna, der die erste Hälfte des 2. Jh. n. Chr. praktizierte, schätzte hoch die Lehre von Qualitäten Galens. Körpersäfte besaßen bei ihm wie bei Galen eine untergeordnete Position. Auch der andere Araber, Abu Mansur, nutzte in seiner sachlichen Redeweise die galenische Terminologie, indem er der Berberin kalte und trockene Eigenschaften in der Mitte des 2. Grades zuschrieb, während dem Lavendel – heiße und trockene am Ende des 2. Grades, der Brenn-Nessel – heiße am Anfang des 3. Grades und trockene in der Mitte des 1. Grades und dem Mohn – kalte und trockene am Ende des 3. Grades aufwies. Nach einigen Jahrhunderten wurde galenische Lehre von seltenen Gelehrten kritisiert worden (unter anderen von Paracelsus), was aber keinen bemerkenswerten Einfluss auf die allgemeine Meinung der europäischen und orientalischen Mediziner haben sollte. Mehrere praktische Ärzte betätigten sich damit, eine feinere Präzisierung der Qualitäten und deren Graden zu erreichen. Gerade auf diesem Wege sahen sie den Fortschritt der neuen Medizin. Irgendwelche radikale Änderungen ihres Metiers waren noch nicht in Sicht. Für eine genaue Diagnose war eine notwendige Ausrüstung noch nicht erfunden. Deswegen nutzte man weiter wie in galenischen Zeiten den Spürsinn wie die sicherste Methode. Dabei war eine mehrjährige Erfahrung des Mediziners von großem Wert, weil ein alter Arzt viel mehr unsichtigen Merkmalen und Kleinigkeiten zu bemerken fähig war. Und für Jüngeren war es ein echtes Gelingen, eine Stelle bei dem Alten zu bekommen, um dessen Erfahrung zu übernehmen versuchen. Neben einer fast kultisch geleisteten Auswahl der wärmenden (wobei man immer öfter Lorbeer, Fenchel, Pfeffer, Petersilie, Rosmarin und Scilla nutzte) und kühlenden (wobei vornehmlich Rosenwasser und Nachtschatten zum Einsatz gebracht worden waren) Arzneien, empfahlen die Mediziner häufig abführende Mittel sowie Aderlass. Im Grunde genommen waren diese zwei Letzten schon Hippokrates gut bekannt und sollte nach seiner Auffassung den Säfte Strom des erkrankten Organs von ihm abzusondern und die Krankheitsursache von dort nach außen abzuleiten. Als eine effiziente Reinigungsmaßnahme des kranken Organismus sollten auch Brech- und Niesmittel verordnet werden, die nicht nur bei leiblichen Schwächen, sondern auch bei mehreren psychischen Erkrankungen empfohlen worden war. Aus heutiger Sicht scheinen diese Reinigungsmethoden eher brutal, besonders, wenn als die wichtigsten und unersetzlichen Komponenten des Verfahrens Quecksilberverbindungen zum Einsatz gebracht werden sollten. So sah eine typische Behandlung der Syphilis etwas folgendermaßen aus. Man schloss den Kranken für die Zeit bis zu 30 Tagen in eine heiße Backstube ein und schmierte ihn täglich am ganzen Körper von Kopf bis zu den Füßen mit einer Quecksilbersalbe ein. Eine enorme Erhitzung sorgte dafür, dass der Kranke badete sich buchstäblich in eigenem Schweiß. Der Betroffene sollte dabei mit ungeheuren Qualen rechnen, wo die Flauheit, Zahnschmerz (der totale Zahnausfall begleitete) und entzündete Gaumen, Schlund und Zunge nicht die schlimmsten waren. Speichelstrom aus dem Mund stank so abscheulich, dass die Türschwelle zur Backstube kaum jemand zu übertreten wagte.
Allerdings könnten die absolut unerträglichen Leiden keine endgültige Genesung gewährleisten. Nur ein Prozent von Kranken konnte durch diese grausame Maßnahme wieder gesund sein, bei übrigen kam die heimtückische Erkrankung wieder zurück. Eine besondere Eigenheit der Medizin dieser „dunklen“ Zeitspanne bestand darin, dass man keine Angst vor den extrem giftigen Substanzen haben konnte. Der Arzt war in seiner Art fast ein Geistlicher, dem alle unweigerlich glaubten, als ob er allein den Weg zum Heilung wusste. Andererseits verfügte die damalige Medizin tatsächlich nicht über die Mehrheit der schweren Krankheiten, was die ärztliche Verantwortung stark herabsetzen sollte.
Man muss aber auch damit rechnen, dass die Humoralpathologie, die die Hauptrolle den Körpersäften zuschrieb, ihre führende Position nicht reibungslos erwarb. Eigentlich stammte diese Säfte Lehre von großen griechischen Arzt und Denker Hippokrates ab, dessen Werk sich aus seinen eigenen Ideen und Erfahrungen seiner Schuler und Nachfolger zusammensetzte. Diese gemeinsamen Texte bekamen den Namen des Corpus Hippocraticum. Sie waren auf dem ionischen Dialekt geschrieben und entsprachen dem allgemeinen Bestreben einer Medizin, die sich auf der vernunftgemäßen Naturbeobachtung basierte. Ihre Leser waren teils Ärzte, teils medizinische Laien. Manche Schriften haben aufklärungs- und polemischen Charakter, andere gaben in knapper, listenartiger Form Therapieanweisungen, einige enthalten Aufzeichnungen von Krankengeschichten, wieder andere sollten dem Arzt beim Erstellen von Prognosen helfen. Es war bemerkenswert, dass viele der Schriften die Entstehung von Krankheiten aus dem Ungleichgewicht von Körpersäften (Blut, Schleim, gelbe und schwarze Galle, zum Teil auch Wasser) erklärten. Die Therapie nahm der Arzt durch Verordnung von Lebensumstellung, Diät, Bewegungstherapie, Arzneimitteln und Anwendung operativer Eingriffe vor. Auf der hippokratischen Säfte Lehre waren standhaft zahllose Behandlungsmaßnahmen begründet, insbesondere die bis in die frühe Neuzeit übliche Anwendung von mehreren Arten Aderlässen, Schröpfköpfen und Abführmitteln. Eine gesundheitsbringende Diätbehandlung war für Hippokrates selbst sowie für seine Schüler besonders wichtig. Als gute Medikamente dienten ihnen weiße Rüben, Gerste, Nieswurz, Wolfsmilch, Mohnsamen, Meerzwiebeln, Sellerie und andere in Griechenland heimische Gewächse und Pflanzenteile. Seit seiner Zeit nannte man die Drogenkunde die älteste aller Wissenschaften. Auch unsere zeitgenössischen Historiker teilen die Meinung, dass gerade aus dieser Lehre der Pflanzen die beschreibenden Naturwissenschaften, die Botanik und die Zoologie hervorgegangen hatten. Und diese Drogenkunde selbst wandelte sich allmählich in Pharmazie um. Nicht zuletzt war es ein Verdienst von besten Schüler Aristoteles, Theophrast, der Botanik mühsam im 4. Jh. v. Chr. als Wissenschaft begründete. Von ihm stammte eine Äußerung, die später allgemein bekannt worden war: „Dass aber jedes Gewächs seinen eigenen Boden liebt und seine eigene Luftmischung, ist daraus klar, dass es Gewächse gibt, die an verschiedenen Orten entweder gar nicht fortkommen, oder, wenn sie gepflanzt werden, nicht weiter gedeihen, keine Früchte tragen und im Ganzen schlecht geraten. Alle aber werden schöner und stärker, wenn sie auf ihrem eigentümlichen Boden wachsen. Auch die wild wachsenden Pflanzen haben jede ihren angemessenen Standort, wie auch die zahmen.“
Schon in 1. Jh. v. Chr. wurde in Rom eine großzügige ärztliche Schule der Methodiker etabliert, deren Begründer Asklepiades war. Seine große Nachfolger Thessalos von Tralleis und Soranus von Ephesos waren die ersten, die die atomistischen Vorstellungen in der Heilkunst zu nutzen versuchten. Nach ihrer Auffassung entstand die Krankheit durch die Störung der Atomen Bewegung in den Hohlgängen und Poren der Gewebe. Gerade diese Poren waren für den gesunden Stoffwechsel zuständig und die Aufgabe der Heilkunst bestand vor allem darin, den ursprünglichen Zustand der Poren wiederherzustellen. Diese Schule war so volkstümlich, dass sie sogar von römischen Kaisern verehrt worden war. Nach dieser Lehre sollte ein Arzneimittel zu einer Entspannung und Erweckung von Poren führen. Auf diesen Grund wurde es sinnvoll gewesen, krampflösende und erregungsfördernde Medikamente wie Gallapfel, Eicheln, Allaun oder Laxantien zu verschreiben. Zum Verdienst dieser Schule gehört auch die Entdeckung einer unspezifischen Reiztherapie, durch die die eigenen Abwehrkräfte des Organismus gesteigert werden sollten. Die wichtige Bedeutung dieser heilenden Methode wird auch heute aufrechterhalten. Denn die Verstärkung des Immunsystems gehört zu wichtigsten Prinzipien des Gesundheitswesens. Doch die Anhänger Galens kämpften gegen die Methodiker so erfolgreich, dass die Haupteinstellungen von Methodiker bis zu 17. Jh. niedergeschlagen worden waren. Böse Zungen sagten, dass Galen anscheinend Thessalos um dessen Berühmtheit beneidete. Eine Wiedergeburt erlebte die methodische Lehre gerade in 17. Jh. durch Prospero Alpinus. Zu den Nachteilen dieser Richtung gehörte aber eine Entgegenstellung der festen Geweben, wo vermeintlich die lebenswichtigen Vorgänge des Organismus stattfanden, und der Körpersäfte, die bei Methodiker eine wesentlich untergeordnete Rolle spielen sollten. Allerdings erweisen sowie feste als auch flüssige Teile des Körpers ein gesamtes System, das man nur einheitlich begreifen konnte. Diese natürliche Einstellung bekam nur im 18. Jh. eine allgemeine Anerkennung, vor allem dank den Auffassungen Friedrich Hoffmann, die auch seine Ansicht auf Krampf und Schlafheit der Gewebe und ihre Behandlung einschlossen. Er nutzte erfolgreich entweder beruhigende oder stärkende Mittel aus, um diese Krankheitsbilder zu verbessern. Für die Öffnung der verstopften Poren im Gehirn und Nerven wendete er gewöhnlich Lavendel, Majoran und Origanum. Gleichzeitig dämpfte er eine zu schnelle Bewegung der Nervenflüssigkeit durch Maiglöckchen, Primel, Lindenblüte, Moschus und Kampfer. Er nutzte auch die schweißtreibenden Mittel für die Milderung der Zähigkeit von Körpersäften und Förderung der Blutströme, z.B. mithilfe der Auszüge von Korallen oder mit dem Theriak, dem wichtigsten opiumhaltigen Allheilmittel des Mittelalters. Harntreibende Arzneien öffneten die Poren und Kanälchen der Nieren und Hoffmann wendete weit umfassend die Petersilie, Sellerie, den Wacholder, Spargel oder Anis. Außerdem versuchte Hoffmann ständig, die Ursachen der Leiden zu beseitigen.
Heiliger Krieg gegen Dämonen
Nach den verheerenden Zeiten der Hexenjagd, die schon Anfangs des 12 Jh. in Gang gesetzt worden war und über fünf Jahrhunderten dauerte, wurde nur in der Mitte des 17 Jh. eine Entscheidung getroffen, dass die feste Überzeugung, die besagte: „Zwischen Satan und den Hexen eine Verschwörung gäbe, um die christliche Welt zu stürzen“, nicht in der Tat stattfand. Nach einer langen Überprüfung war sie als grundlos befunden. Menschheit bezahlte dafür einen teuren Preis, den man mit einer Million gefolterten und getöteten abschätzen sollte. Im Grunde genommen war es nicht besonders schwer, irgendwas Teuflisches den Hexen zuzuschreiben. Denn sie befassten sich immer geheimnisvoll mit Zauberei. Ihre Beschwörungssprüche könnten bestimmt einen Verdacht der dunklen Magie erregen, was sicher nur von Dämonen stammen konnte. Die nachfolgende „Logik“ wurde schon gut begründet: sie sollten in deren höllischen Salben und Tinkturen „unbedingt“ gekochten Gliedern von Kindern benutzen, besonders solcher, die noch nicht getauft worden waren. „Natürlich“ machten diese Dämonen das Gleiche, indem sie die armen Kinder die Gnade der Taufe und der Erlösung zu berauben pflegten. Und wenn die Rede nicht von Kindern, sondern von Tieren war, machte es gar keinen Unterschied, denn diese tierischen Wesen waren nur Behälter bösen Dämonen. Man konnte auch sorglos die „Zeugen“ heraussuchen, die angeblich mit deren eigenen Augen gesehen haben, wie die betroffene Hexe nach ihrer Freveltat davon ausgeflogen war, mit dem Besen oder ohne, egal. Menschliches Auge gewöhnte sich seit Jahrtausenden gut, sich zu täuschen. Es sah nicht selten gerade das, was es sehen wollte. So beschrieb der große italienische Arzt und Wissenschaftler der 16 Jh. Della Porta einige Bestandteile der Hexensalben, die anscheinend Kinderfett, Aconitum, Belladonna, Fledermausblut und Ruß eingeschlossen hatte. Es gab auch eine Überzeugung, dass eine Aufeinanderfolge der Hinzufügung der Komponenten, ihre präzise Menge sowie Zaubersprüche sehr wichtige Rolle für die Wirksamkeit des „Teufelskrauts“ spielen sollten. Die alten Alchemie Betreiber suchten aber nach natürlichen Ursachen der heimlichen Hexerei. Die Hexen selbst sollten bestimmt etwas Seltsames besitzen, indem sie von Natur trübsinnig oder traurig, nicht tief gläubig, kurz gesagt, alle Voraussetzungen besitzen, um sich mit den Dämonen in Kontakt zu bringen. Ihre schwermütige Veranlagung sollte vermeintlich alle dunklen Kräfte verursachen, die ihre Verfolgung und Verbrennung auf Scheiterhaufen rechtfertigen sollten. Nicht zufällig sollten sich die Hexen (üblicherweise schon nicht junge Frauen) an Betäubungsmittel wenden. Ein schlafhervorrufendes Mittel ließ ihnen nicht mehr bei Sinnen zu bleiben sowie gleichzeitig unruhig machte. Die unsichtbaren bösartigen Wesen, die diese armen Hexen unter deren Obhut nahmen, eröffneten ihnen sowohl die Geheimnisse der Hexerei als auch die Rätsel der heilenden Mischungen. Nach der Wirkung der gewissen teuflischen Salben bekam man gleichsam die Fähigkeit zu fliegen, die ihren dämonischen Ursprung bestätigen sollten. In der Tat waren diese Hexen eher die Opfer einer weit verbreiteten Kampagne der Hexenverfolgung, deren Durchführung von Anfang an einen verbrecherischen Sinn hatte. Alle Beschuldigungen der Inquisitoren sowie das Beweismaterial waren frei erfunden und von falschen Zeugen bestätigt worden. Man konnte daran zweifeln, ob bei den meisten Beschuldigten irgendwelche Salben oder Mischungen überhaupt vorhanden waren. Im Grunde genommen war diese Menschenjagd auf so weitem Ausmaß veranstaltet worden, dass es für die Ermittlungen in jedem Einzelfall keine Möglichkeit existierte.
Die gerichtlichen Urteile waren schon im Voraus vorbereitet worden und die armen Beschuldigten hatten keine Chance, sich zu retten. Die vorderste Front des Kampfes gegen die Feinde und Verderbers des Christentums wurde zweifellos gewonnen, obwohl es nicht wirklich bewiesen wurde, dass diese tödlichen Gegner überhaupt vorhanden waren. Sonst zeigten sich die Leistungsfähigkeit der Salben und vielen Mischungen, den man noch vor wenigen Jahren ein riesiges teuflisches Potential zugeschrieben habe, absolut enttäuschend, um über irgendwelche dämonische Beteiligung zu sprechen. Der große Sieg wandelte sich in eine Kleinigkeit um. Ein mächtiger Bösewicht konnte kaum über wenigen Giftpflanzen herrschen. Im Unterschied zur Wissenschaft, die immer bestimmte materiellen Wurzeln der Arzneiwirkung herauszufinden suchte, wollten die Geistlichen mit der heiligen Inquisition, darin gewisse teuflisch-höllischen Begleiterscheinungen durchsehen, die ihre kultischen Hypothesen angeblich bestätigen sollten. Eine religiösdogmatische Weltanschauung versuchte kaum, eine abenteuerliche Reise in die Ungewissheit, die nichts Ermutigendes versprach, zu unterfangen. Es war ein Vorrecht weniger Ärzte und Naturkundler, die sich ständig nach der Wahrheitsjagd befanden. Ideologisch gesehen war die Lage des Klerus ständig vorteilhaft, denn er besaß eine ewige göttliche Lehre, die bereit war, alle möglichen Naturerscheinungen ursprünglich zu erläutern. Darüber hinaus sprach sie auf die Sprache der göttlichen Moral, was für die Wissenschaft unzugänglich war. Denn die Moral spielte keine entscheidende Rolle in der Natur. Das heißt, der Klerus konnte immer, die Gelehrten für ein unmoralisches Verhalten anklagen. Ein moderner Westlicher konnte vielleicht darüber triumphieren, dass der Fortschritt die religiöse Rückständigkeit endgültig besiegte. Allerdings war es wahrscheinlich ein Pyrrhussieg. Weil die größten Errungenschaften der Forschung manchmal den zerstörerischen Kräften den Weg ebneten, die die Menschheit zu vernichten drohten. Deswegen sollte man eine Schlussfolgerung herausziehen, dass die kirchliche Morallehre auch für moderne Wissenschaft von Bedeutung sein sollte. Sonst wagt der sogenannte Fortschritt, dass Leben auf unserem Planeten auszurotten.
Mit den alten Arzneien richtig umgehen
Die erste ausführliche Beschreibung der Heilpflanzen fand sich im Werk von Griechen Pedanios Dioskorides aus dem 1 Jh. n. Chr. namens „De materia medica“. Dort sammelten sich die hunderte Erwähnungen über den Nachtschatten, die Judenkirsche, Alraune und das Bilsenkraut. Dioskorides begleitete als Militärarzt römische Truppen und suchte ständig nach neuen Heilpflanzen, die ihm bei seinem Dienst helfen könnten. Die Eroberung neuen Ländern erteilte ihm die Möglichkeit, eine Vielfalt unbekannten Pflanzen kennen zu lernen und eine persönliche Sammlung zusammenzusetzen. Fast anderthalb Tausend Jahre war sein Werk das einzelne Lehrbuch für die Ärzte und Quacksalber europaweit. Nur im Jahre 1623 veröffentlichte der Schweizer Caspar Bauhin das Buch „Pinax“, das sich an mehrere Fundstücke Dioskorides erinnerte, einige zusätzlichen Pflanzen, z.B. Mirabilis und Paris eingeschlossen hatte. Später wurde es festgestellt, dass die Familie Solanaceae über 600 Arten und 43 Gattungen enthalten sollte, die sich weltweit zu verbreiten vermochte, meistens aber in Tropenländern. Alle Vertreter dieser Familie beinhalten einen Stoff mit starker narkotischer Wirkung. Weil diese Stoffe sich nicht proportional in unterschiedlichen Organen sammeln, könnten sie auch eine kleinere oder größere Vergiftung verursachen. Die Knollen vielen Pflanzen aus dieser Familie nutzte man seit alten Zeiten wie Nahrung für Menschen und Haustiere. Einige Arten, z.B. Mandragora, erwiesen eigenartige Eigenschaften, indem sie eine menschenähnliche Wurzel besetzen sowie die Blätter, die unmittelbar der Wurzel zu entspringen scheinen. Sie wurde seit undenklicher Zeit wie eine Zauberkraft verehrt, man schrieb ihr die Fähigkeit eines Aphrodisiakums zu. Solche Wunderpflanze sollte anscheinend mit großen magischen Kräften versehen sein oder sie versprach, das nahliegende Unglück abzuwenden. Die andere Abart Mandragora hieß Podophyllum (Fuß Blatt), sie zählte auch zu der Familie Sauerdorngewächsen. Es gab eine Menge von rätselhaften Beschwörungssprüchen und kultischen Ritualen, die die heilenden Kräfte dieses Gewächs entfesseln ließen. So versuchte man, unterschiedliche Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes, Lungen und Nieren sowie mehrere Geschwüre auszukurieren. Darüber hinaus war sie erfolgreich wie ein Gegengift bei Schlangenbissen angewendet. Einige Ärzte nutzten sie auch gegen Frauenkrankheiten.
Tollkirsche (auch Belladonna genannt) wurde schon bei uns bekannten Theophrast, dem besten Schüler Aristoteles, erwähnt. In seinen Grundlagen der Botanik beschrieb er ausführlich diese ausdauernde strauchartige Gift- und Heilpflanze, die schon im Altertum als „Schwarze Mandragora“ bekannt war. Es gab auch ihre anderen Namen, z.B. „Atropa“, nach der todbringenden Parze Atropos aus der griechischen Mythologie genannt. Schon in nicht großen Mengen konnte sie eine Betäubung und Geistesverwirrung auslösen, die üblicherweise mit der Vergiftung begleitet werden. Solch gefährliche Begleiterscheinung forderte von der Wissenschaft eine präzise Bestimmung der Normal- sowie Maximaldosis, die man bei der Behandlung anwenden dürfte. Ein weit verbreitetes Maß an dieser Pflanze auf Wiesen und Weiden konnte auch bedrohliche Lebensgefahr für die Zucht- und Milchtiere erweisen. Bei der Bestimmung der wirklich heilenden Dosis musste man ständig den Pupillendurchmesser sowie die Pulsfrequenz und Körpertemperatur analysieren. Bei Selbstversuchen sollte man sich ständig Rechenschaft über die Gedächtnis- und Konzentrationsschwäche und Halluzinationen ablegen. Noch in 16. und 17. Jh. wurden in der Pharmazie keine Arzneien aus der Tollkirsche zielgerichtet ins Innere hinein angewendet worden, obwohl sie oft als zusammengesetzten Salben zum Einsatz gebracht worden waren. Es bedeutet, dass die Kenntnis über ihre feinen Wirkungen war weit nicht ausreichend, um einen gewagten Entschluss zu fassen. Allerdings wurden einzelne außenordentliche Fälle bekannt, wenn die betroffenen Ärzte gezwungen worden, das Risiko auf sich zu übernehmen. Ein davon fand im Jahre 1694 bei einer Behandlung der Krebsgeschwülste statt. Dabei wurde aufgeklärt worden, dass der kräftigste Wirkstoff sich möglicherweise in der Wurzel befand. Nach mehr als hundert Jahren wurde diese Vermutung wissenschaftlich bestätigt. Bezeichnend war dabei, dass die allgemeine Aufmerksamkeit mehreren Drogen aus der Tollkirsche gegenüber sank allmählich seit der Mitte 19. Jh. Nur Atropin erweckte immer größeres Interesse seit diesem Zeitabschnitt. Gleichzeitig wurden häufiger die absichtlichen Selbstmordfälle, die durch erhöhte Dosen des Atropins begingen worden waren. Eine mangelnde Kenntnis der Botanik war auch nicht selten der Grund schweren Vergiftungen durch den Verzehr von Beeren Tollkirsche. Es wurden auch einige seltsame Fälle bekannt, die zu einer Massenvergiftung durch den Verzehr vom Honig. Eine chemische Analyse des verdächtigen Honigs ergab über 25% Tollkirschenanteile. Die Ursache des Unglücks bestand darin, dass es in unmittelbarer Nähe ein großes Ackerfeld lag, das stark mit Tollkirschen bepflanzt worden war. Interessanterweise konzentrierte sich das Gift ausschließlich im Honig, so dass die Bienen selbst absolut nicht geschadet worden waren. Die Homöopathie nutzt erfolgreich die Tollkirsche seit langem für die Behandlung des weiten Spektrums von gefährlichen Erkrankungen, von Husten und Fieber, Blähungen und Magen-Darm-Schmerzen bis zu schauernden Onkologie, psychiatrische und Frauenkrankheiten.
Bilsenkraut zählt sich auch zu den ältesten Heilmitteln. Seine Samen wurden in einer erheblichen Menge bei den archäologischen Ausgrabungen der neolythischen Erdschichten in der Schweiz aufgedeckt worden. Die weiteren Aufgrabungen aus späteren Epochen ließen feststellen, dass schon die Urmenschen das Kraut wahrscheinlich als Arzneimittel nutzten. Vielleicht wussten auch die alten Römer seine heilenden Fähigkeiten, wenn sie ihre Krieger mit diesem Kraut zu kurieren pflegten. Die Überresteform des Krauts ließ aber vermuten, dass es als eine Salbe angewendet worden war. Der berühmte Papyrus Ebers aus dem alten Ägypten, der neben dem Papyrus Edwin Smith zu den ältesten noch erhaltenen Texten im Allgemeinen und mit medizinischen Texten im Besonderen zählte (1600 v. Chr.), erwähnte Bilsenkraut mehrfach als effizientes Heilmittel bei äußeren und inneren Erkrankungen. Schon damals wussten heimische Ärzte seine Wirkung als Schlafmittel. Eine sachliche Erforschung der Heilpflanzen in Illias und Odyssee zeigte, dass das Bilsenkraut wahrscheinlich Homer bekannt war. Leibärzte mehreren römischen Kaiser wendeten wohlwollend Ausgusse und Salben dieses Heilkrauts gegen viele Beschwerden ihrer erhabenen Patienten an. In Abwesenheit der speziellen Lehrbücher und notwendigen Erfahrung war ein ahnendes Erfassen gewöhnlich die einzelne Möglichkeit, ein geeignetes Mittel für die Rettung des allmächtigen Throninhabers herauszufinden. Mit einer wesentlichen Vergiftungskraft dieser Pflanze war diese hoch verantwortungsvolle Beschäftigung ständig mit einem großen Risiko verbunden. Eine betäubende Wirkung des Bilsenkrauts wurde auch bei alten Griechen und Römer bewusst. Ihre Gelehrten versuchten auch, diese nicht einfach erklärbare Wirkung vor allem auf Nutztieren zu beobachten.
Darauf wurde ihnen verständlich geworden, dass die Tiere ähnlicher Weise wie Menschen auf solche Pflanzen reagieren sollten. Später nutzte man diese Besonderheit der Pflanze für die Jagd und Fischerei, was den Fang stark zu erleichtern versprach. Ein ziemlich eigenartiges Heilmittel bekam man aus dem gepressten Samen Öl des Bilsenkrauts. Nach der Mischung des Öls mit dem Wachs machte man daraus Kerzen. Dann richtete man den Rauch der Kerze auf eine schmerzende Stelle, z.B. auf einen Zahn, was den Schmerz bald stillen könnte. In mittelalterlichen medizinischen Vorschriften konnte man kaum eine Erkrankung finden, die mit bestimmten Bestandteilen des Bilsenkrauts nicht vollständig kuriert werden könnte. Sogar in erster Hälfte des vorigen Jahrhunderts war es ein bedeutendstes Heilmittel gegen vielen unterschiedlichen Spasmen, Schmerzen, Augenbeschwerden, Husten, Tuberkulose, Neuralgien, Rheuma, Gicht, Krebs, Magen-Darm-Leiden und mehreren anderen Krankheiten im Einsatz. Seine narkotische Wirkung schätzte man im Altertum nicht weniger als Opium oder Mandragora.
Salben waren keineswegs die Erfindung der „Hexen“ des Mittelalters. Schon die ältesten Kulturvölker Europas und Asiens verwendeten Salben als Arzneiform für dermatologische Zwecke und in der Kosmetik. Beim Durchlesen der Salbenvorschriften des Mittelalters fällt vor allem die große Zahl der Salben Kompositionen auf. Wenn die Salben in Art und Konsistenz den heutigen auch nahe verwandt sind, so ist die Vielfalt der Salbengrundlagen doch ein Zeichen dafür, dass weniger nach guten Grundlagen gesucht wurde, sondern, dass man durch Herbeiziehen der ausgefallensten Fettgrundlagen selbst therapeutische Effekte hervorzurufen versuchte. Nach heutiger Definition sind Salben Gele von plastischer Verformbarkeit, die zur lokalen medikamentösen oder kosmetischen Anwendung auf der gesunden, verletzten oder kranke Haut oder Schleimhaut der Körperöffnungen bestimmt sind, das heißt streichfähige Zubereitungen zur Anwendung durch Auftragen oder Einreiben. Im Gegensatz zu Cremes (Salben besonders weicher Konsistenz, die größere Mengen Wasser enthalten) und Pasten (Salben, in denen pulverförmige Bestandteile meist in größerer Menge suspendiert sind) sind Salben im engeren Sinne Wasserfreie Zubereitungen.
Die suchterzeugenden Drogen
Der einfachen Völker, die unseren Planet vor tausenden Jahren behausten, sollen wir neben nützlich wichtigen Heilpflanzen auch eine Reihe Erregender- und Rauschpflanzen verdanken, unter anderen Tee, Kaffee, Kakao, Kolanuss, Mate. Sie alle wurden von Menschen seit geraumer Zeit als Genussmittel gebraucht werden. Erstaunlicherweise stellten die primitiven Stämme heraus, dass gerade diese seltenen Gewächse zu einer Art Vergnügen zu bringen fähig werden. Es passierte unbefangen ohne pharmazeutisches Wissen und durchaus ohne irgendwelche Kenntnis der Zusammenhänge, dass Koffein und ähnliche Alkaloide beinhalteten. Wie konnte es in unterschiedlichen Regionen der Erde fast gleichzeitig stattfinden, wenn die Kommunikation noch nicht entdeckt worden war. Es gab aber auch solche Wunderpflanzen, die ein glückliches Gefühl mitbringen ließen, wenn man in einer glücklichen Euphorie und göttlicher Heiterkeit schwebte. Solche ungewöhnlichen Empfindungen waren so angenehm, dass die Eingeborenen bereit waren, diesen Zustand ewig zu genießen. Es war ein ersehnter Ausweg aus dem grausamen Alltag, wo der Mensch ständig von den Klima- und Raubtiere Gefahren umringt worden war. Diese „heiligen“ Substanzen ähnelten sich einigermaßen an Götter, die aus der reellen Welt entgehen ließen, um sich in den Raum der Einbildung zu versetzten. Außerdem schenkten diese pflanzlichen Erzeugungen neue Kräfte und Euphorie, um eine neue Arbeit anzufangen. Eigentlich erweist sich heutige Drogensucht wie eine weitere Entwicklung dieser ursprünglichen Leidenschaft. Historisch gesehen waren die riesigen tropischen und subtropischen Regionen an diese drogenerzeugenden Pflanzen besonders reich.
Wenn die Gesamtzahl der rauschgifthaltigen Gewächse rund gerechnet 60 zählt, fallen 90% auf Mittelamerika zusammen. Der Grund dafür war wahrscheinlich die meist günstigen Klima- und Bodenbedingungen. Diese Begleiterscheinungen sorgten dafür, dass die hiesige Bevölkerung eine lange Tradition der Anwendung dieser rauscherregenden Stoffe haben sollten. Darüber hinaus wurden sie über alle anderen Arzneimitteln verehrt worden. Früher dienten sie effizient auch gegen mehrere andere Beschwerden, weil sie eine beruhigende und schmerzstillende Wirkung haben konnten. Und der Schmerz war immer ein auffallendes Kennzeichen der Krankheit. Deswegen galt eine Erkrankung ohne Schmerz als völlig kurierte. Es war kein Zufall, dass die Naturvölker diese euphoriebringenden Pflanzen zum Mittelpunkt ihres Glaubens an Götter machten. So war eine Opferung dieser Pflanzen das teuerste Geschenk den Göttern, die zweifellos ein Glück mitbringen sollte. Zahlreiche indianischen Stammen lebten und leben noch im magischen Denken. In diesem Sinne treffen sie manchmal sogar die westlichen Dichter und Erfinder über, die ihre „ewigen“ Werke ausschließlich in einem Begeisterungszustande schöpfen. Auch für diese westlichen Talente bleibt der Gebrauch rauscherregenden Substanzen (einschließlich Alkohol) höher als durchschnittlich bei der Bevölkerung. Wie konnte es zustande kommen, dass Menschen aus unterschiedlichen Kultur- und Ausbildungskreisen sich absolut wesensgleich den Drogen gegenüber verhalten? Und wie scharf sind die Grenzen zwischen der Welt des Magischen und der Welt der wissenschaftlichen Rationalität gezogen? Die Geschichte der Coca und Kokain, Mohn und Opium, Peyote und Meskulin erstrecken sich tief in die menschliche Vergangenheit. Sie wurden eng mit den rituellen und kulturellen Traditionen der alten Völker verbunden worden.
Gleichzeitig spielte sie eine wesentliche Rolle als heilende Mittel bei diesen alten Völkern. Medizinisch gesehen wurde auch die Geschichte der Chemie und Pharmakologie durch die Isolierung, Analyse und nachfolgende organische Synthese dieser Substanzen geprägt. So wurde die erste Entdeckung eines Wirkungsprinzips durch die Isolation des Morphins sowie die Entdeckung eines Anästhetikums (Kokain) oder den Beginn der Erforschung der Modellpsychose (Meskalin aus dem Peyote-Kaktus) geprägt. Alle frühe Forschung der drei Pflanzen begann in Deutschland, wo auch die ersten Isolierungen der Hauptbestandteile gemacht worden waren. Das erste synthetische Rauschgift war vom schweizerischen Chemiker Albert Hofmann 1938 hergestellt worden. Sein Ziel damals war die Entwicklung eines anregenden Medikaments fürs Kreislaufsystem. Sein Forschungsobjekt war zuerst das Mutterkorn, ein Pilzparasit auf dem Getreide, der zu Vergiftungen bei Verbraucher führen konnte. Im Rahmen dieser Untersuchung gelang es ihm, eine chemische Verbindung zu bekommen, die später unter der Abkürzung LSD weltberühmt wurde. Hofmann probierte die Substanz auf sich selbst und stellte eine starke halluzinogene Wirkung heraus. Nach dem Zweiten Weltkrieg beherrschte LSD neben Heroin und Haschisch die weltweite Drogenszene. Auf amerikanischen Kontinent spielte Coca lange Zeit die ähnliche Rolle.
Die alten Indianer aus den heutigen Bolivien verehrten Coca wie eine heilige Pflanze, die anscheinend das Geschenk der Mama Coca, der Mutter Coca gewesen war. Sie nannten sie der Strauch der Erde mit den Blättern des Himmels. Mit einer einheimischen Poesie krönten sie die Königin Coca mit den aufstrebenden Blättern. Ihre Vorfahren hatten nur den Pflanzen den Titel „heilige“ zugeschrieben, die menschliche Psyche zu ändern fähig waren. Nach ihrer Auffassung sollten sie das Heilige oder Göttliche im menschlichen Bewusstsein enthüllen, wenn man sie einnimmt. Im Grunde genommen wirken alle psychisch aktiven chemischen Substanzen unterschiedlich, indem sie in allen verschiedenen Bereichen des Nervensystems üblicherweise andere Reaktionen auslösen. Für die alten Indianer war dieser Aspekt kaum wichtig, weil sie genau hoch alle solchen Substanzen zu verehren pflegten, sei sie Coca, Mohn, Zauberpilze, Alkohol oder Tabak. Viel wichtiger für diesen Eingeborenen war, dass alle solchen Pflanzen in traditioneller Kultur, vor allem Mythen und Legenden ihren Ursprung haben sollten. Die heiligen Pflanzen, die von Schamanen gepriesen und verbreitet worden waren, worden immer bestimmten Gottheiten zugeordnet oder geweiht. So war der Coca Strauch der Liebesgöttin (Mama Coca). Die Geistlichen versahen sie mit den besonders wertvollen Adjektiven wie wunderschöne, verführerische oder wohltätige und nicht nur Liebes-, sondern auch Erdgöttin, Mutter Erde und jene Göttin konnte nicht immer schöpferisch, aber auch zerstörerisch werden. Bei den archäologischen Aufgrabungen wurden nicht selten die Überreste der Coca Pflanzen gefunden, die älteste von ihnen zählte zu Zeit 1900 v. Chr. und befand sich in einem Ort nördlich von Lima in Peru. Eine nachfolgende Analyse bestätigte, dass der Fund zu Blätter Coca in Priem gehörte. Andere Funde aus den späteren Zeiten zeugten davon, dass die Cola Pflanze wahrscheinlich aus der menschlich gepflegten Zucht stammten, die unter einer künstlichen Bewässerung gemacht worden war: denn Strauche waren größer und mit viel höherem Inhalt der Alkaloide gefüllt. Bemerkenswert blieb die Aktivität dieser chemischen Substanzen während so ungeheuer langer Zeit unversehrt. Einheimischen Legenden zufolge nutzten die Vorfahren heutigen indianischen Einwohner seit mehreren Jahrtausenden Coca Blätter gegen unzählige Menge von Beschwerden, was die Lebenserwartung der Bevölkerung auf ziemlich hohem Niveau erhalten ließe. Unter anderen Entdeckungen, die spanischen Konquistadoren nach Columbus Seefahrt nach Europa mitbrachte, waren auch die Coca Pflanzen, die sich gut in bestimmten südlichen Regionen des amerikanischen Kontinents neuen Klima- und Bodenverhältnissen anzupassen vermochten. Es waren aber nur einzelne Versuche, die kaum für große Plantagen führen könnten. Heute haben Forscher gute technischen Möglichkeiten, Coca in einem ausreichenden Ausmaß zu kultivieren. Ein internationales Abkommen auf Verzicht der Verbreitung Drogen Produktion und Verkauf lässt aber dieser Forschungsrichtung nicht stattfinden. Kulturelle Tradition der Indianer zählt den Coca Strauch zu größten Entheogenen (das heißt Stoffen, die imstande sind, eine göttliche Begeisterung zu erregen) der Welt. Sie nennen ihn „einfach“ „Geist-Pflanze“ oder sogar „Pflanzenlehrer“, der dem Menschen eine Chance gibt, das tiefste Wesen des Universums zu begreifen. Mit ihm wurden zahlreiche Mythen verbunden. Einer davon erzählt die Entstehungsgeschichte der Tukano. Das in 24 Stämme gegliederte Indianervolk der Tukano lebt im Nordwesten Amazonen von Feldbau, Jagd und Fischerei. Seine gesamte Zahl ist nicht mehr als 10 000 Einwohner. Diesem Mythus zufolge stammen die ersten Vorfahren des Volkes von einer Anakonda Schlange, indem die Verwandlung im Himmel von „jenseits der Milchstraße“ stattfand. Der Fluss der Sterne wurde im Strom der Wasser gespiegelt. Im Folgenden wurde der erste Schamane geboren, dem Götter die Heilpflanzen beschert haben, unter anderen auch den Coca Strauch, der für den Geistlichen die Quelle der Weisheit werden sollte. Andere Legende berichtete, dass Menschen einst Coca entdeckten, als sie ihre eigenartige Auswirkung auf die weidenden Lamas beobachteten. Bei Inka Volk wurde es für die Bevölkerung verboten, Coca zu nutzen, weil sie ausschließlich für die königlichen Personen prädestiniert worden war. Allmählich änderte sich ihre Rolle wie das Gewächs der Auserwählten, indem sie immer mehr zu einem kultischen Gegenstand der Bevölkerung worden war. Sie war schon in mehreren Ritualen angewendet und als Opfergabe den Göttern sehr populär geworden. Ihre ermunternden Kräfte wurden häufig sogar für die benötigte intensive Arbeitsbeschleunigung benutzt worden. Schamanen allein behandelten damit unterschiedliche Erkrankungen. Man kaute ihre Blätter bei feierlichen Ereignissen, um die allgemeine Stimmung zu verbessern. Nach einer gewissen Aufbereitung wandelten sich diese Blätter in eine köstliche und gefahrlose Nahrung um. Eine deutliche Erhöhung des Nährwertes wurde bei einigen indianischen Stammen durch die Vermischung mit dem Maniokmehl erreicht. Beachtenswert war der deutsche Chemiker Albert Niemann der erste, der Coca Blätter analysierte und schon im Jahre 1860 die Hauptsubstanz daraus absonderte. Er hatte sie Cocain genannt, unter denen sie weltberühmt worden war. Im 20. Jh. ersannen ihm Konsumenten die Decknamen „Koks“ oder „weißer Schnee“, die sie mit Vergnügen geschnupft oder gelöst getrunken hatten. Jahrzehnte danach wurde Cocain auch als Anästhetikum in medizinischer Praxis allgemein benutzt worden. Allerdings war Coca weit nicht das einzelne Rauschgift, das man in Südamerika zum Einsatz brachte. Ganz im Gegenteil gab es eine Reihe solcher „Wundergewächse“, die von alters her in hohem Ansehen standen. So genossen die Bewohner der Anden- und Amazonasgebieten im nordwestlichen Südamerika gewisse Lianen, aus denen sie rauscherregende Getränke zubereiteten. Diese Schlingpflanzen bekamen von ihnen den Namen Caapi. Ein Vergleich mit anderen bekannten Pflanzen dieses Typs zeugte davon, dass diese Art die bizarrste narkotische Wirkung von allen amerikanischen Gewächsen hatte. Man empfindet beim Gebrauch eine Mattigkeit mit einem nach innen gerichteten Denken sowie farbige Gesichtshalluzinationen, wenn alles in einem bläulichen Lichtschein dargestellt wird, der manchmal in rote flammende Erscheinungen übergeht und bei hoher Dosierung zu erschreckenden und beklemmten Visionen führt. Ähnliche (aber schwächere) Wirkung hatte auch ein Stoff aus der Rinde eines Baumes der Gattung Virola im Quellgebiet des Orinoco. Das blutrote Harz der Rinde erzeugte einen Rauschzustand, der durch farbige Gewichtswahrnehmungen und Sinnestäuschungen gekennzeichnet wurde, dem ein unruhiger Schlaf folgte. Solche Zustände konnten unter Umständen mit dem Tode enden.
Im Unterschied zu amerikanischen Indianer bevorzugten Chinesen lange Zeit das Opium, das in dieses große Land aus Arabien, Persien und Indien geliefert worden war. Es war damals ein nationales Rauschgift. Dieser Umstand war aber ziemlich seltsam, denn sowie Haschisch als auch Opium konnten in großer Menge in China kultiviert werden. Nicht weniger absonderlich schien die Tatsache, dass im Orient Haschisch vorwiegend populär war, obwohl die Opiumquelle, der Schlafmohn, seit tausende Jahren dort gut gediehe. Das Gleiche galt auch für die Nomaden Nordafrikas, die die Steppenraute hoch wie ein Heilmittel schätzten, keine Ahnung aber über deren rauscherregenden Eigenschaften hatten. Deswegen war bei ihnen traditionell Haschisch im Gebrauch. Seit 60-er Jahren des 20. Jh. steigt gradlinig die Zahl von Rauschgiftkonsumenten an und der Anteil der Todesfälle infolge Drogenabhängigkeit wächst entsprechend dieser Zahl.
Der ständige Gebrauch des Haschisch war ursprünglich in der islamischen Welt weit verbreitet. Auf arabischer Sprache bedeutete das Wort ein besonderes Kraut, das eine seelische Verwandlung verursachen konnte. Es kam aus Indien vor, was von seiner Erwähnung in Schriftsammlung Ayur Veda, die vermutlich in Persien entstand und in Sanskrit abgefasst wurde, bestätigt worden war. Dort wurde dem Hanf eine starke Wirkung zugewiesen worden. Auf jeden Fall wusste schon Herodot im 5. Jh. v. Chr., dass die Skythen, ein persisches Reitervolk, Hanfkörner nahmen und auf die glühenden Steine fallen ließen. Sie atmeten die entstehenden Dämpfte ein und heulten vor Freude über den Dampf. Das Gleiche fand man auch bei Pomponius Mela aus dem 1. Jh. n. Chr. in dessen Chorographia und zwar, dass die Skythen Hanfkörner verbrannten und nach dem Einatmen des Rauches in eine fröhliche Trunkenheit verfielen. Im Laufe des langen Mittelalters breitete sich das Haschischrauchen und -essen in der orientalischen Welt immer weiter aus. Gleichzeitig verordneten arabische Ärzte das Haschisch gegen Durchfall, Hämorrhoiden und Tripper. Als Rauschmittel wurde er seit 16. Jh. in Indien, Ägypten und Italien verwendet. Zu gleicher Zeit gelangte das Haschisch durch die Spanier nach Amerika, wo er massenhaft angebaut worden war.
Das Opium gelang in die chinesische Medizin schon im 1. Jh. n. Chr., das zuerst gegen Dysenterie angewendet worden war. Das Rauchen von Opium war in China aber viel später verbreitet worden, vor allem durch die Verordnung des letzten Kaisers der Ming-Dynastie Hwai Tschun, der das Tabakrauchen im 17. Jh. verbot und einen Ersatz zugunsten Opiumpfeife leistete. Von dieser Zeit an ging diese Genussform von China über Persien und Indien in den Orient, was ihren Siegeszug erweisen sollte. Im 18. Jh. versuchte der Kaiser Yung Ching ein Verbot gegen den Opiumverkauf und -rauchen herauszugeben, was aber keine Wirkung auf die Bevölkerung haben sollte. Es dauerte über hundert Jahren und brachte schließlich die Opiumkriege hervor. Nur mithilfe britischer Kolonialkräfte wurde einen Vertrag abgeschlossen, in dem der Opiumhandel in China legalisiert worden war. Erst 1906 entschloss sich China offiziell, den Mohnanbau aufzuhören. Zurzeit waren schon über 20 Millionen Chinesen süchtig. Obwohl mit einem weiteren Übereinkommen mit den Großbritannien der englische Import des Opiums eingestellt wurde, setzte sich illegale Produktion und Handel noch viele Jahre fort. Eine medizinische Anwendung Opiums fand im westlichen Europa jahrhundertelang eine erhebliche Verwendung, vor allem als Schmerzmittel. Die berühmten Dichter und Denker (wie Plinius und Vergil) priesen das Opium hoch nicht nur als schmerzstillenden Stoff, sondern als „eine echte Gotteshand“ oder als „geheiligten Lebensanker“. Ärzte verschrieben abgesondertes aus dem Opium Morphin wie einem wertvollen Medikament bei mehreren Beschwerden. Dieses Ansehen der allheilenden Arznei blieb beim Morphin bis zur Mitte des 19. Jh. ungeschwächt erhalten, wenn eine seinen unerwünschten Nebenwirkungen, neben anderen Sucht, Abhängigkeit und Persönlichkeitsstörungen aufgedeckt worden waren. Schon nach wenigen Injektionen entstand eine deutliche Angewöhnung, die der Betroffene kaum allein entgehen konnte. Das Problem löste bei der Forschung eine dringende Notwendigkeit aus, neue schmerzlindernde Medikamente herauszufinden, die solche gefährlichen und heimtückischen Nebenwirkungen nicht haben konnten. Es war der Gegenstand der langen Bemühungen vielen Chemiker in dieser Richtung. Bemerkenswert war bei diesen Studien ein zudringlicher Gedanke, dass die Ausgangssubstanz dabei das Morphin selbst sein sollte. So experimentierten Gelehrten mit diesem „verführerischen“ Molekül, indem sie es mit verschiedenen chemischen Gruppen zu versehen suchten. Einmal waren sie tatsächlich findig geworden, im Sinne, dass ihnen eine neue Weltberühmtheit zu schaffen gelang. So stellte es sich heraus, dass bei der Reaktion vom Morphin mit der Essigsäure ein Erzeugnis entstand, das noch viel stärker gegen Schmerz wirken sollte. Auf diesen Grund bewahrten die alten Apothekenkataloge den Namen dieser Arznei „Heroin“ auf. Es wurde beim Heroin über 40 nützlichen Wirkungen (unter anderen gegen Hochblutdruck, Herzen- und Lungenleiden) gefunden, die das neue Mittel heilen konnte. Sein Hauptnachteil bestand darin, dass es eine noch vielfach kräftigere Angewöhnung und Abhängigkeit als Morphin auslösen sollte. Noch heute verdienen illegale Kartelle Milliarden Dollar vom Verkauf des Heroins, dessen Verbreitung in allen Industrieländern verboten ist. Zu einem natürlichen Derivat Morphins gehört Kodein, das auch eine bedeutende Anwendung als Schmerz- und hustenstillendes Mittel bekommen hatte. Im Unterschied zum Morphin besaß Kodein aber viel kleineres Sucht- und Abhängigkeitspotenzial. Trotzdem ist seine Anwendung streng rezeptpflichtig und der Freihandel ist strikt verboten. Jeder Konsument muss eindeutig verstehen, dass all Rauschgiftdrogen die Gesundheit stark gefährden sollen. Deswegen drohen bei einem Missbrauch nicht nur die Sucht- oder Angewöhnungsgefahr, sondern auch große körperlichen und seelischen Schaden. Seit Jahrtausenden bekannten bei Indianer und anderen Naturvölker Pflanzen, die in großen Mengen Rauschgift beinhalteten und deswegen für die Prophezeiungen benutzt worden waren, sorgten gewöhnlich für die phantastischen Halluzinationen, Bewusstseinsstörungen, Gedankenflucht, Euphorie, Ekstasen und ähnliche Gehirnfunktionsdefekte. Das heißt, schon einmalige Einnahme kann (besonders bei dazu neigenden sowie abgeschwächten Personen) zu irreversiblen organischen Änderungen des Nervensystems und mehreren Organen und Geweben führen. Die Wichtigkeit der Untersuchung dieser zerstörerischen Verfahren wurde in den 70-er Jahren des vorigen Jahrhunderts nachgewiesen. Zuerst wurde durch Goldstein die Existenz von gewissen Opiatrezeptoren im Gehirn bestimmt worden. Danach waren auch körpereigene Opiate aufgedeckt, die nicht nur schmerzstillend, sondern auch stimmungsverbessert wirken sollten. Diese Substanzen, die später den Namen Endorphine bekommen haben, zeigten ihre hohe Aktivität aber in solchen kleinen Mengen, die von jeder Sucht und Anhängigkeit verschonen lassen. Einer der bekannten Vertreter dieser Klasse chemischer Substanzen ist das β-Endorphin, ein körpereigenes Neuropeptid, das in Neuronen sowohl des Zentral-(ZNS), als auch Vegetativnervensystems (VNS) gefunden worden war. Es erfüllt im menschlichen Organismus die Funktion des Wettkämpfers von Opiaten, also des Morphins, Heroins u.a. für die Rezeptorstellen. Es war erstmal 1973 im Hypophysen Extrakt des Kamels entdeckt. Zahlreiche unabhängige Tierversuche sowie klinische Studien ließen eine Schlussfolgerung ziehen, dass es akute und chronische Schmerzen lindern kann. Eigentlich wird die Absonderung dieses Hormons durch den Stress und Schmerz angeregt. Man nennt Endorphine auch Glückhormone, denn sie regen neben schmerzstillende Wirkung das angenehme Verhalten (auch das Sexuelle) an, erhöhen die Körpertemperatur, das Hungergefühl und verstärken das Abwehrsystem. In manchen Fällen empfindet sich man sogar euphorisch. Es gibt bestimmte Methode der Heilkunst (etwa Massage, Akupunktur oder Meditation), die die Ausschüttung der Endorphine stark beeinflussen können.
Weitere Entwicklung der Pharmazie
Außer diesen wichtigen Verfahren der organischen Synthese, der natürlichen und künstlichen Opiaten, chemisch Neuropeptide genannt, wurde Anfang des 20. Jh. die Erforschung von anderen Arten der körpereigenen Stoffe unternommen worden, die zu Entdeckung des Stresshormons Adrenalins geführt hatten. Es war physiologisch im Nebennieren Mark gebildet und ins Blut ausgeschüttet worden. Eine Isolierung der Substanz und die Erforschung deren Eigenschaften, ließ schließlich feststellen, dass das Adrenalin gleichzeitig für die Erhöhung der Herzfrequenz, des Blutdruckes sowie für die Erweiterung der Bronchiolen (feineren Verzweigungen der Bronchen) sorgte. Es förderte auch den Fettabbau und Entstehung einer Menge Energie durch diesen Abbau und Biosynthese von Glucose. Es regulierte die körperliche Durchblutung und die Funktionen des Magen-Darm-Traktes. Auch im Zentralnervensystem spielte es eine große Rolle, indem es die Nervensignalübertragung anregte. Adrenalin-Rezeptoren haben dabei eine große Bedeutung. Nach der Synthese Adrenalins durch deutschen Chemiker Friedrich Stolz und Erforschung seiner biochemischen Reaktionen wurde es als Medikament gegen Herz-Kreislauf-Stillstand, anaphylaktischen Schock (erworbene Allergie) und andere schweren Zustände angewendet. Außerdem bekamen Ärzte nach der Synthese reiner Wirkstoffe erstmal die Möglichkeit, mit präzisen Arzneien anstatt unterschiedliche Mischungen zu arbeiten. Diese Errungenschaft gab allen Patienten der Welt eine Chance, individuell bestimmte Dosen vom Heilmittel zu kriegen, in Tabletten- oder Pillenform, die eine dauernde Aufbewahrung ohne Qualitätsänderung gewährleisten sollten. Schon in der Mitte des 19. Jh. wurde die Methode der Injektionsspritze erfunden, was den schnellsten Weg der Arznei zum kranken Organ öffnete, die darauf Millionen Leben retten ließe. Darüber hinaus ermöglichten diese hervorragenden Fortschritte, alle neuen Arzneien auf Tiermodellen zu überprüfen bevor sie Menschen zu verschreiben. Man konnte dieses Ereignis wie die Gründung neuen Forschungsgebiets der experimentellen Pharmakologie vorstellen, ohne die das ganze moderne Pharmawesen unerreichbar sein sollte. Im 20. Jh. entdeckten Forscher eine Vielfalt von solchen Wirksubstanzen, die in extrem kleinen Dosen einen großen heilenden Effekt zu bekommen förderten. Es wurde auch gezeigt, dass mehrere natürlichen Stoffe, die seit geraumer Zeit für die tödlichen Gifte gehalten worden waren, zeigten in extrem geringen Mengen erstaunlich heilende Wirkung gegen schwere Erkrankungen. Noch häufiger dienten sie selbst überhaupt nicht wie Drogen, sondern sie reizten solche körpereigenen Moleküle an, die für die Abwehrkräfte des Organismus zu sorgen vermochten. Das größte Kunststück der gesamten gegenwärtigen Medizin besteht darin, in einem riesigen Massengeschäft, das heutiges Gesundheitswesen erweist, eine individuelle Therapie für jeden Patienten herauszufinden. Denn die schädlichen Nebenwirkungen, die bei allen guten Arzneimitteln vorhanden sind, verursachen nicht selten größere Probleme für den Kranken als die Krankheit selbst. Seltsamerweise gelten noch jetzt die prophetischen Worten Hippokrates, die vor über 2400 Jahren geäußert worden waren, dass der Arzt den Patienten und nicht die Krankheit auskurieren sollte. Stattdessen beschäftigen sich häufig mehrere seine Nachfolger eher mit den Daten, die im Computer gespeichert worden waren und sehen hinter diesen Zahlen und Analysenergebnissen einen gewissen abstrakten Menschen. Dieses Modellwesen braucht sicher nicht das, was ein lebendiger Mensch mit seinen Namen, Alter und Eigenschaften braucht. Als ein Beispiel dieser Schlussfolgerung kann man den Fall eines alten Patienten nennen, der ein starkes Medikament bekam, das für seine toxischen Nebenwirkungen bekannt war, in sehr geringen Dosen bekam. Im Allgemeinen entsprach alles der Standartbehandlung, allerdings ging es bei diesem Individuum schief, weil sein Organismus sogar diese geringen Dosen nicht rechtzeitig auszuscheiden fähig war. Deswegen häuften sich diese kleinen Mengen allmählich an, um später eine erhebliche giftige Wirkung zu zeigen. Nur durch eine leistungsfähige Dialysemethode konnte sich der alte Mann schließlich retten.
Eine Arznei ist immer mit dem Risiko verbunden
Was in der Pharmakologie Forschung unvermeidlich passieren sollte, betraf das Risiko, das wie einem verhängnisvollen Damoklesschwert die Erfinder verfolgen sollte. Fast jede neue Synthese oder Isolierung einer Substanz, die eine Revolution in dem Pharmawesen zu vollziehen versprach, verbarg irgendwelche unter der Wasseroberfläche befindliche Steine, die die Entdeckungsfreude stark zu verderben drohte. Es sah so aus, als ob die mächtigen Kräfte der Natur sich dafür an den Herausforderer rächen wollten. Die Betroffenen waren bereit, sogar das griechische Wort „Pharmakon“, das gleichermaßen Heil- und Giftstoffe enthielte, buchstäblich zu verstehen. In diesem Sinne war eine gramvolle Geschichte des Thalidomids besonders aufschlussreich. Ende der 1950er/Anfang der 1960er-Jahre verkündeten Pharmachemiker diese Substanz wie einem Allheilmittel gegen Schlaflosigkeit und Unruhe. Ärzte verordneten das „Wunder“ unverzüglich wahllos bei allen Fällen. Schwangere Frauen waren keine Ausnahme. Es dauerte bis aus mehreren Orten der Erde dringende Botschaften gesendet wurden, dass Hunderte Kinder mit Missbildungen zur Welt kamen. In wenigen Stunden verwandelte sich das Wunder in einen globalen Skandal. Der Arzneistoff, der unter den Markennamen Contergan und Softenon millionenfach verkauft wurde, war eine strukturelle Abwandlung der Barbiturate, deren Vertreter Veronal und Luminal für einen langen Schlaf der westlichen Bewohner seit Mitte des 20. Jh. sorgten. Man schrieb auch dem Contergan einen vielseitigen Ruf zu. So sollte es auch das Wachstum der bösartigen Tumoren hemmen, Entzündungen heilen oder die Blutgefäße, die für die Nahrung der Tumoren verantwortlich waren, aushungern lassen. Die letzte Richtung entwickelte sich weiter und zeigte schon ihre Effizienz gegen schwere Lepraformen sowie für die Behandlung des multiplen Myeloms. Gleichzeitig bleiben die Erfinder dieser Arznei für mehrere tausende Opfer – Contergan geschädigte Kinder – unverzeihlich. Die Fachleute behaupten, dass auch besonders harmlose Medikamenten unter bestimmten Umständen zu schmerzhaften und unangenehmen Veranlassungen führen können. Auf diesen Grund sollte Pharmaforschung auf eine wichtige Frage beantworten und zwar: unter welchen Bedingungen ein und derselbe Stoff heilend oder schädlich wirken kann, bzw. wie groß die Spanne zwischen der heilenden und toxischen Dosis sein sollte, damit keine unerwünschten Nebenwirkungen sich einstellen? Neben den Tierversuchen, die häufig nur eine weit entfernte Ähnlichkeit mit reellen menschlichen Organismen zeigen konnten, untersuchte man seit Mitte des 18. Jh. bei großen Studien die Wirkung der Impfung und anderen Methoden der Arzneieinnahme gleichzeitig an mehreren Menschen. Obwohl solche nützliche Maßnahme üblicherweise ausführlich vorbereitet worden war, sollten die Veranstalter sich Rechenschaft darüber ablegen, dass dort ausschließlich gesunde Personen teilnahmen, was keine zuverlässigen Kenntnisse für die kranken oder abgeschwächten Individuen erweisen konnten.
Das Placebo
Wissenschaftlich verlässlich begründete Studien wurden aber nur im 20. Jh. begonnen, die immer im Vergleich zu Scheinmitteln geprüft worden waren. Außerdem beobachteten einige Ärzte schon im 18 Jh. eine effiziente Wirkung der Ersatzmedizin, die den Patienten gegeben wurde, um ihnen zu gefallen und um sie zufrieden zu stellen. Man nannte diese Erscheinung „Placebo“, was etwa „ich werde gefallen“ bedeuten sollte. Eine persönliche Wahrnehmung der Arzneiwirkung sowie der Ergebnisse von Pharmatherapie hängt ziemlich stark von dem Einfluss von vielseitigen psychischen und sozialen Umständen ab, die sich auch in Placebo Erscheinungen widerspiegeln lassen. Eine tiefe Erforschung des Placebo-Phänomens lässt nicht nur die Rolle der mehreren psychologischen Bedingungen für die Heilwirkung der Arznei aufklären, sondern sie fördert das Verständnis menschlicher psychischen Funktionen. Der engere Sinn des Placebos wie einem Scheinarzneimittel, das keinen Arzneistoff enthält und somit auch keine durch einen solchen Stoff verursachte pharmakologische Wirkung haben konnte, spiegelt kaum ausreichend das Wesen der Erscheinung. Zu ihr sollten alle Änderungen hinzählen, die beim Patienten nach der Einnahme der Arznei und auch nach einer Einspritzung, einem Einsalben oder nach jeder Imitationsprozedur (Physiotherapie, Psychotherapie usw.) passieren, die zur Besserung seines Zustandes führen lassen. Placebo Anwendung wurde schon zu verpflichtenden Verfahren bei den Studien an neuen heilenden Substanzen geworden. Schon heute kann man behaupten, dass diese Methode in mehr als 60% allen Fällen erheblich helfen konnte. Bei mehreren Erkrankungen trafen Placebo Verfahren sogar gut etablierte Medikamente über, die jahrzehntelang für die Besten gehalten worden waren. Es ist nicht mehr eine Begleiterscheinung, wie es viele Ärzte noch vor zwanzig Jahren darzustellen versuchten. Sie teilten dabei eine Meinung, dass ihm nur wenige Personen anfällig sind, die sich beängstigend und beunruhigt befanden und leicht eingeflößt werden konnten. Später wurde es eindeutig nachgewiesen, dass das Placebo jedem Menschen eigentümlich sein sollte. Es kann seine Gültigkeit nur beim Schlaf oder unter einer Narkose verlieren. Fachleute sind heute einig geworden, dass das Placebo eine besonders komplizierte vererbliche psychobiologische Erscheinung ist, die in allen Situationen vorkommt, die mit dem Kurieren verbunden wird. Man nennt dabei eine Vielfalt der Kennzeichen, die eine therapeutische Prozedur oder ihre Imitation begleiten – pharmazeutische Formen und Methoden deren Einreichen, bestimmte vorgetäuschte chirurgischen Eingriffe, Akupunkteur usw. sowie eine gewisse Verhaltensweise des Arztes und Personals, Aufmerksamkeit, Mitgefühl und Unterstützung dem Patienten gegenüber u. a. Man beobachtete bemerkenswerte Änderungen beim Placebo auf neurologischem, zellulärem und biochemischem Niveau. So hinderte z.B. das Naloxon die Entwicklung eines schmerzstillenden Placebos. Das Naloxon ist ein Opioid-Gegenspieler, der üblicherweise bei Überdosierung von Morphium und anderen opiumähnlichen Substanzen zum Einsatz gekommen wird. In diesem Falle lagerte sich Naloxon an den Opioiden-Rezeptoren an. Physiologisch gesehen änderte sich der Zustand des Rezeptors dadurch, dass Naloxon sich fehlerhaft daran anlagerte, als ob dort tatsächlich Opioiden vorhanden waren. Dieses Beispiel zeigt zweifellos, dass bei der Placebo Anwendung reelle Änderungen im Organismus vonstattengehen. Mehrere solche Änderungen wurden schon mithilfe moderner Tomographie nachgewiesen worden. Diese wichtigen Untersuchungen zeugten davon, dass das Placebo imstande wird, unter bestimmten Umständen und als eine Reaktion auf den äußeren Einfluss, eigene Ressourcen und Kräfte zu mobilisieren, um die Krankheit zu bekämpfen. Diese unentbehrliche Bedeutung des Placebos in heutiger Pharmakologie und Medizin haben allerdings eine Kehrseite, die alle Fachleute und die Bevölkerung ständig berücksichtigen sollen. Sie wird mit einem Gegenspieler Placebos namens Nocebo verbunden. So wurde eine negative Reaktion auf eine Arznei oder ein Placebo genannt, die gerüchteweise eine beeinträchtigende Wirkung auf die ganze Gesundheit oder das Wohlbefinden haben könnte. Es könnten bei Patienten unter dem Einfluss Nocebos unangenehme Erlebnisse oder sogar gesundheits- und lebensbedrohliche Folgen entwickeln werden könnten. Ein aufschlussreiches Beispiel dafür zeigt die Situation, wenn bei den Männern, denen bekannt wurde, dass das Arzneimittel, das ihnen verordnet worden war, als eine Nebenwirkung sexuelle Störungen haben konnte, die Entwicklung einer Impotenz dreimal häufiger als bei denen, die davon nichts wussten, bekamen. Ein wesentlicher Nachteil Nocebos besteht darin, dass dessen klinische Versuche wegen einer sittlichen Besonderheit fast nie stattfinden. Auf diesen Grund wurde das Nocebo noch nicht ausführlich untersucht worden.
Trotzdem wurde es vorwiegend indirekt herausgestellt, dass bei Menschen, die über ihre Gesundheit sowie über den Verlauf ihrer Krankheit unangenehmen Äußerungen anhören sollten, steigt die Aufregung besonders erheblich an, was den Blutdruck, Schmerzempfindlichkeit und andere ungünstige Symptome erhöhen sollte. Ähnliche krankhaften Änderungen wurden auch bei Parkinson- und Alzheimerpatienten nachgewiesen worden. Das heißt, die Verhältnisse um Kranken spielen eine große Rolle sowohl für den Verlauf der Krankheit, als auch für ihr Kurieren. Es gibt noch eine schwierige Angelegenheit, die die Einmischung in die persönlichen psychologischen Sachen betrifft. Es handelt sich dabei um eine Mitteilung den Patienten dessen ungünstigen Diagnose. In der Psychologie war diese Frage schon längst diskutiert und keine eindeutige Antwort bekommen habe. Einige Sachkundigen sind der Auffassung, dass die Botschaft einer tödlichen Diagnose dem Kranken einen schauderhaften Schlag versetzen sollte. Darf das der Arzt machen, der den Eid des Hippokrates abgelegt habe?
Sowie Placebo als auch Nocebo stellen eine Einmischung ins Bewusstsein des Patienten vor, die ganz schwer vorhersagbaren Wirkungen haben können. Der kranke Organismus kann darauf sehr unterschiedlich reagieren. Eine unangenehme Nachricht kann für ihn kränkend oder tödlich werden. Ein günstiges Placebo kann dagegen erstaunlich heilend wirken. Placebo wird also ein Heilmittel, das dem Patienten sich behaglich fühlen lässt. Viel wichtiger dabei ist aber, dass solche Behaglichkeit gut für den Kranken ist. Eine allgemeine Begeisterung für diese einfache Methode sorgte später allerdings für die Angst, dass die Mediziner ein Mittel bekamen, anstatt Menschen mit richtigen Medikamenten zu behandeln, ihnen Placebo zu verschreiben bevorzugen. Realistisch gesehen existierte solche Gefahr nicht, denn gegen alle schweren Erkrankungen sollten nur gut erprobten Arzneimittel angewendet werden, die eine Zulassung des entsprechenden Bundesgesundheitsamtes bekommen sollte. Mit diesem Genehmigungsverfahren ist die Bewährung eines Arzneimittels noch nicht abgeschlossen. Denn die Hersteller sind weiter streng verpflichtet, in Anpassung an die fortschreitenden Erkenntnisse der Wissenschaften die weitere Überwachung und Registrierung aller Beobachtungen den staatlichen Stellen zu melden. Es betrifft vor allem solche über neu anerkannte Nebenwirkungen. Man sollte dabei alle Aspekte der Physiologie, Biochemie oder Bakteriologie in Betracht ziehen. Heutzutage kennt man viele molekularen und strukturellen Besonderheiten der Arzneistoffe, die für die bestimmten gefährlichen Nebenwirkungen (