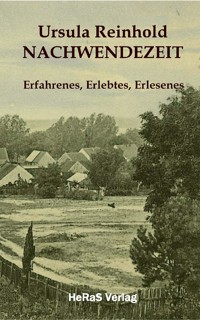Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
1938, zwölf Jahre nach meinem Bruder kam ich auf die Welt. Zu dieser Zeit war die Lage meiner Eltern so, dass sie sich ein zweites Kind leisten wollten. Mein Vater hatte seit 1934 Arbeit, seit 1935 baute er als gelernter Klempner in den Henschel-Werken in Schönefeld an Flugzeugen. Die Wohnlaube auf der Ko-lonie "Gemütlichkeit" im Südosten Berlins war leidlich winterfest. Wohnzim-merschrank, Schlaguhr, Kachelofen machten die um 1925 als Sommerlaube gebaute Behausung beinahe behaglich. Nach meinem Bruder, der nicht unbe-dingt gewollt zur Welt gekommen war, hatte meine Mutter mehrere Abtreibun-gen, was für sie ziemlich schlimm gewesen sein muss. Meist musste sie sich selber helfen, wenn kein Geld da war. Der Arzt, den sie aufsuchte deshalb, sag-te ihr, dass sie erster, zweiter oder dritter Klasse fahren könne. Er war Jude, in Neukölln ansässig. Aber meine Eltern wurden deshalb keineswegs Antisemiten. Sie hatten damals schon ihre Überzeugungen. Hitler hatte die Abtreiberei ent-schiedener noch unter Strafe gestellt. Es gab nicht einmal mehr einen Arzt, bei dem man dritter Klasse fahren konnte. Für den bevorstehenden Krieg wurden Soldaten und Heldenmütter gebraucht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 409
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ursula Reinhold
Gemütlichkeit
Erinnerungen an eine Kindheit
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Herkommen
Frühe Eindrücke
Tages- und Nachtangriffe
Stadt- und Landausflüge
"Die Russen kommen"
"Feindberührung"
Vom Organisieren und Verteilen
Auf dem Schulweg
Weihnachten 1946
Viehzeug
Heinerle kehrt heim
Doris und ich
Badefreuden
Wie bekommen wir nur dieses Geld
Meine Mutter als Bauherrin
Stiftungsfest
Familientreffen
Neue Horizonte
Hohe Schule oder wohin mit mir
Verschiedene Stadtansichten
Alte Freundinnen, neue Freundinnen
Liebe oder so ähnlich
Späte Referenz an einen Lehrer
Abiturjahrgang 1956
Impressum neobooks
Herkommen
1938, zwölf Jahre nach meinem Bruder kam ich auf die Welt. Zu dieser Zeit war die Lage meiner Eltern so, dass sie sich ein zweites Kind leisten wollten. Mein Vater hatte seit 1934 Arbeit, seit 1935 baute er als gelernter Klempner in den Henschel-Werken in Schönefeld an Flugzeugen. Die Wohnlaube auf der Kolonie "Gemütlichkeit" im Südosten Berlins war leidlich winterfest. Wohnzimmerschrank, Schlaguhr, Kachelofen machten die um 1925 als Sommerlaube gebaute Behausung beinahe behaglich. Nach meinem Bruder, der nicht unbedingt gewollt zur Welt gekommen war, hatte meine Mutter mehrere Abtreibungen, was für sie ziemlich schlimm gewesen sein muss. Meist musste sie sich selber helfen, wenn kein Geld da war. Der Arzt, den sie aufsuchte deshalb, sagte ihr, dass sie erster, zweiter oder dritter Klasse fahren könne. Er war Jude, in Neukölln ansässig. Aber meine Eltern wurden deshalb keineswegs Antisemiten. Sie hatten damals schon ihre Überzeugungen. Hitler hatte die Abtreiberei entschiedener noch unter Strafe gestellt. Es gab nicht einmal mehr einen Arzt, bei dem man dritter Klasse fahren konnte. Für den bevorstehenden Krieg wurden Soldaten und Heldenmütter gebraucht.
So war ich also willkommen. Für meine Eltern, nicht mehr ganz jung, eine durchdringende Freude! Sie hatten nichts Besonderes vor mit mir, ließen mich einfach wachsen. Meine Mutter wollte mich zwar zu Fleiß, Ordnung, Ehrlichkeit und Sparsamkeit erziehen, aber das stellte sich erst etwas später heraus. Sie hatte da schon ihre Ziele. Mein Vater dagegen wollte nicht gestört sein, wenn er las. Er verbot mir wenig, kontrollierte mich kaum, bewunderte meine körperliche Geschicklichkeit und strafte nur in seltenen Fällen. Aber dann ungerecht. Es hatte gar nichts mit mir zu tun. Er war Choleriker. Das war ein Erbteil seiner Mutter, die polnische Vorfahren hatte und aus dem Oberschlesischen kam. So wie ihre Mutter schon, war auch sie eine Dienstmagd. Die Mitteilungen meines Vaters darüber waren spärlich. Er wusste nichts Genaues über ihr Herkommen, weil die Mutter nicht viel darüber sprach. Vielleicht gab es auch keine Gelegenheit mehr, denn mein Vater sah sie nach der eigenen Familiengründung nur selten.
Die Großmutter muss sich einfach unmöglich aufgeführt haben, als mein Vater mit 26 Jahren meine Mutter geschwängert hatte. Vorehelich, wie es ihr selbst auch passiert war, in der Zeit, als sie in Berlin als Dienstmagd arbeitete. Hier hatte sie meinen Großvater kennengelernt, einen Klempner, wie später mein Vater. Er kam aus einer Hugenottenfamilie, die seit Generationen in der Altmark ansässig war. In Stendal besuchte er eine Mittelschule, für die er eine Freistelle bekommen hatte. Dann kam aber doch nur eine Klempnerlehre infrage. Mit einer Anstellung bei den Gaswerken in Rixdorf muss er für meine Großmutter als eine gute Partie gegolten haben, kurz vor der Jahrhundertwende. Er hat dort gearbeitet, als der Kaiser abdanken musste, als die Weimarer Republik in die Brüche ging und als es mit Hitler vorbei war, auch noch. Bis 1950, dann bekam er eine ansehnliche Pension. Ich glaube, er war dort unkündbar.
Um meinen Vater zu entbinden, fuhr meine Großmutter im November 1899 zurück ins Oberschlesische, wo sie Anhang hatte, wen weiß ich nicht. Überhaupt weiß ich wenig von ihr. In einem Medaillon, einer handwerklichen Arbeit meines Großvaters, gibt es ein Jugendbild von ihr. Das habe ich oft betrachtet. Mit einem aufgezwirbelten, wilden, schwarzen Haarschopf sieht man sie dort, darunter ein schmales, ebenmäßiges Gesicht, in dem etwas dicke, sinnliche Lippen auffallen. Weil ich aus den Erzählungen meines Vaters entnommen habe, dass sie jähzornig, wild und unberechenbar war, fand ich, dass man ihr solches Temperament ansah auf dem Foto. Dann gibt es noch ein zweites Bild, auf dem sie, schon eine alte Frau, vor einem Vogelkäfig am Fenster sitzt. Die wenigen Male, die ich sie sah, verschmelzen in meiner Erinnerung mit diesem Foto. Immer sitzt sie vor diesem Vogelkäfig. Ansonsten ist mir nur das überliefert, was mein Vater erzählte und was meine Mutter beisteuern konnte.
Die Schwiegermutter hatte meine Mutter mit Stinkbomben verfolgt, als sie von meinem Vater ein Kind erwartete. Das klingt übertrieben, soll aber wirklich so gewesen sein. Sie war der Meinung, dass sie meinem Vater nicht umsonst eine Klempnerlehre ermöglicht haben konnte. Sie wollte, dass er zurückzahlte. Nicht nur Kostgeld, sondern überhaupt. Er war der Älteste von vier Kindern, die in großen Abständen geboren worden waren. Das Letzte kam zwanzig Jahre nach dem Ersten zur Welt. Wahrscheinlich war man in dieser Ehe nur in großen Abständen zusammengekommen. Das kommt manchmal bei einer guten Partie heraus. Der Großvater war ein verträglicher und ruhiger Mann. Er war ein dicker alter Mann, als ich ihn kennenlernte. Mein Vater und seine zwei Schwestern erlebten ihn nur hinter dem "Neuköllner Tageblatt" verschanzt. Die ersten beiden Kinder meiner Großeltern wurden katholisch getauft, wie meine Großmutter es wollte. Die nächsten zwei evangelisch, nach der kirchlichen Zugehörigkeit meines Großvaters. Ob das vorher so besprochen worden war oder ob mein Großvater sie auf dem Standesamt so hatte eintragen lassen und inwiefern hierbei das eheliche Kräfteverhältnis zum Ausdruck kam, bleibt offen. Auf jeden Fall war es so, dass die erste Schwester meines Vaters vom Großvater katholisch und auf den Namen Anna standesamtlich eingetragen worden war. Das erfuhr ich aber erst sehr spät, weil sie für alle nur Lucie hieß. So hatte es meine Großmutter durchgesetzt, weil ihr Anna nicht gefiel, und es blieb so. Sie hat sich am Anfang ihrer Ehe durchgesetzt und später auch, aber vielleicht nicht mehr so entschieden. Sie muss viel Energie gehabt haben, ein ungezügeltes Temperament. Mein Großvater fand, dass sie sich viel zu oft aufrege und deshalb nicht alt werden würde. Er hatte recht. Er überlebte sie um mehr als zwanzig Jahre. Sie verbrauchte sich in ständigem Aufruhr gegen den Mann. Auch gegen seine Vernunft. Denn er hatte Schulbildung im Unterschied zu ihr. Sie konnte nur mit Mühe lesen und unterließ es deshalb. Sie war gläubig bis abergläubisch und spielte vor den Kindern Gespenst, um sie durch Erschrecken zum Gehorsam zu bringen. Mein Vater als der Älteste, tröstete dann die kleineren Schwestern, die das Theater noch nicht durchschauten. Das Phlegma, die Überlegenheit und Anpassungsbereitschaft des Mannes müssen sie zur Weißglut gebracht haben. Vielleicht war es nicht immer so, aber in den Erzählungen meines Vaters wurde das Familienklima nur in solchen eruptiven Szenen erinnert. Meine Großmutter schmiss meinem Großvater das Suppenfleisch hinterher, weil er es zu mager eingekauft hatte. In späteren Jahren noch warf sie Schippen voll Sand nach ihm, als sie, einem allgemeinen Trend folgend, ein Grundstück in Klosterfelde hatten. Der Grund für ihren Zorn: Er war um fünf Uhr morgens aufgestanden, hatte sie wach gemacht und nichts geschafft. Das brachte sie auf die Palme.
Meine Großmutter wollte ihren Ältesten, nicht an einen „Fabrikklater“ verlieren. Damit meinte sie meine Mutter. Dass sie ihren Sohn schon verloren hatte, wusste sie nicht, oder sie ahnte es und gebärdete sich gerade deshalb so. Mein Vater sollte in die Betstunde für junge Männer gehen, die die katholische Kirche in der Richardstraße in Neukölln veranstaltete, wie seine zweite Schwester, die Else, die dort ihren späteren Mann kennenlernte, einen gut situierten Herrn. Er war Beamter, später Angestellter des Westberliner Senats, arbeitete dort bis zu seiner Pensionierung. Mein Vater weigerte sich, in die Bibelstunde zu gehen. Er wollte nicht beten, nachdem er an der Front erlebt hatte, wie Leute sich mit gesegneten Waffen totschossen. Er stieß zur Wandervogelbewegung. Hier war man friedlich und ging in die Natur. "Fürsten in Lumpen und Loden". Wandern, Nacktbaden, Rabindranat Tagore lesen und reden. Das kostete kein Geld. Aber das war nur ein Grund, weshalb sich meine Großmutter aufregte, wenn sie überhaupt Gründe brauchte, sich aufzuregen. Eher liegt nahe, anzunehmen, dass sie keine brauchte oder sowieso genügend hatte, wie man es nehmen will. Der zweite Grund ihrer Aufregung war ohnehin gegenstandslos geworden. Mein Vater hatte kurz nach seiner späten Lehrzeit die Arbeit verloren und konnte also gar kein Kostgeld abgeben. Deshalb gewöhnte er sich auch so schwer an den Gedanken, dass meine Mutter ein Kind von ihm bekam. Erschrocken war auch meine Mutter, weshalb sie noch im sechsten Monat eine Abtreibung versuchte. Aber mein Bruder blieb. Ein junges Mädchen ohne mütterlichen Ratschlag wusste nicht viel.
Sie hatte zu diesem Zeitpunkt nur noch einen Vater, dem sie im Krieg die Beine zerschossen hatten. Er hatte steife Knie und litt große Schmerzen. Er starb, bald nachdem mein Bruder geboren war. Meine Mutter hatte man mit zwei jüngeren Schwestern 1916 in ein Waisenhaus gebracht, als auch die Stiefmutter starb, die der Vater geheiratet hatte, nachdem er Witwer mit vier Kindern geworden war. Meine Mutter war sechs Jahre alt, als ihre leibliche Mutter an einer Unterleibssache zugrunde ging. Die jüngste Schwester, Hilde, war gerade ein Jahr, Lucie, die dritte, vier und Otto, der Älteste, neun Jahre alt, als ihnen die Mutter wegstarb. Von ihrer richtigen Mutter hat meine Mutter nur wenig im Gedächtnis behalten. Anders war das mit der Stiefmutter. Die Erinnerungen an sie blieben meiner Mutter lebendig. Für mich haben ihre Erzählungen das Bild von Stiefmüttern bestimmt. Die Frau muss so gewesen sein, wie man Stiefmütter aus Märchen kennt. Von ihr bekamen die drei Mädchen und der ältere Junge nur eine einzige Brotschnitte zum Abendbrot, verschieden dünn oder dick, wie man's nimmt. Es gab während des 1. Weltkrieges, wie man ihn später nannte, viel Hunger. Darauf konnte sie sich herausreden. Meine Mutter erzählte, dass sie und die jüngeren Schwestern für jede Laus, die sie aus der Schule in ihren langen Zöpfen mitbrachten, eine Ohrfeige einstecken mussten. Hilde, die kleinste der Schwestern, bekam manchmal Schokolade von Onkels, die am Vormittag zu Besuch kamen. Otto, schon vierzehnjährig, soll dann immer "Schweigegeld, Schweigegeld" gerufen haben. Warum mein Großvater diese Frau geheiratet hat, konnte meine Mutter nicht sagen. Einige Jahre hindurch hatte er es mit bezahlten Hilfen versucht, Frauen, die die Kinder für Geld betreuten. Aber das Geld war nicht reichlich, und außerdem wuchsen die vier Kinder den Tanten über den Kopf. Deshalb wohl hatte er sich für die Heirat mit dieser Frau entschieden. 1917 starb auch sie, und die drei Schwestern kamen ins Waisenhaus. Woran die Frau starb, wusste meine Mutter nicht. Die Nachbarn sprachen über deren Krankheit nur hinter vorgehaltener Hand. Zuletzt war sie im Krankenhaus, und der Vater bekam keinen Fronturlaub.
Das eine Jahr Waisenhaus ist in der Erinnerung meiner Mutter nicht das schlechteste ihres Lebens gewesen. Es gab dort etwas mehr zu essen als bei der Stiefmutter, besonders von den weißen Bohnen konnten sie satt werden. Nach einem Jahr brachte man sie auf einen Bauernhof nach Lindenberg im Kreis Beeskow. Die Bauern suchten eine Magd, und da meine Mutter dreizehn Jahre alt war, erwarteten sie sich von ihr eine Hilfe. Die zwei jüngeren Schwestern kamen zu anderen Bauern im gleichen Dorf. Das war eine Bedingung der Waisenhausleitung, die die Schwestern nicht getrennt sehen wollte. Im Ganzen ging es meiner Mutter in dieser Bauernfamilie nicht schlecht. Sie lernte alle bäuerlichen Arbeiten, hatte es dabei natürlich schwerer als die gleichaltrigen Söhne des Bauern, denen alles vertraut war. In Lindenberg ging meine Mutter noch ein Jahr in die zweiklassige Dorfschule. Dort lernte sie nach eigener Aussage nichts mehr dazu. Entweder fiel der Unterricht wegen Siegesfeiern aus, die der Lehrer Sommerfeld mit kurzen Chorproben begehen ließ. Oder sie konnte nicht in die Schule gehen, weil wichtige Feldarbeiten ins Haus standen. Wenn sie in der letzten Bank saß, weil sie eine gute Schülerin war, las sie die "Gartenlaube", die sie auf dem Boden des Bauernhauses gefunden hatte. Zu den Bauersleuten fasste sie schnell Zutrauen, als sie bemerkte, dass die von ihr keine andere Arbeit erwarteten als von sich selbst. Auch konnte sie sich das erste Mal in ihrem Leben wirklich satt essen, Kartoffeln, Brot und Quark waren immer ausreichend für alle da. Nicht nur am Anfang, wie sie zunächst befürchtet hatte.
Mit achtzehn Jahren verließ sie Lindenberg und ging wieder nach Berlin zu ihrem Vater. Der bewohnte eine Kellerwohnung, in der die wenigen übrig gebliebenen Möbel seines ehemaligen Hausstandes untergebracht waren. Das Wohnzimmer war zugleich die Werkstatt, in der er Brieftaschen, Etuis und Portemonnaies herstellte. - Die Jänickes, wie die Bauernfamilie hieß, hatten meiner Mutter von ihrem vierzehnten Lebensjahr an Lohn auf ein Sparbuch bezahlt. Aber von dem Geld sah meine Mutter nichts. Die Inflation hatte den Ertrag von vier Arbeitsjahren aufgezehrt. So brachte meine Mutter 1923 nur die Schuhe und das Kleid mit nach Berlin, die sie zu ihrer Konfirmation getragen hatte. Beide waren ihr zu groß, weil man sie auf Zuwachs gekauft hatte. Meine Mutter trug Zeitungen aus, dafür bekam sie Geldscheine mit vielen Nullen. Einige dieser Inflationsnoten haben in meiner Kindheit noch existiert, und ich war immer ganz fassungslos über die hohen Beträge, die ich in meinem Kaufmannsladen hatte. Auch der Bruder Otto wohnte beim Vater in der Kellerwohnung. Er hatte seinen Freiplatz auf der Handelsschule wegen Bummelei verloren, während der Vater im Krieg war.
Otto war mit Karl befreundet, mit dem er in den Arbeitersportverein „Fichte“ ging. So lernte mein Vater die Grete kennen, die Schwester seines Freundes. Sie gefiel ihm, er lud sie zu gemeinsamen Wanderungen ein, und es dauert nicht lange, bis sie schwanger war.
Nachdem meine Mutter in andere Umstände geraten war, wollte sich mein Vater das Leben nehmen. Aber dann besann er sich und ging zusammen mit Otto auf die Walz, ins Ruhrgebiet. Die Ausweispapiere warfen sie beide weg, weil sie sowieso ein Nichts waren, wie sie feststellen mussten, ohne Arbeit und Geld. Natürlich konnte da nur die Weltrevolution Abhilfe schaffen, für die Otto schon im Kommunistischen Jugendverband arbeitete. Meine Mutter trug währenddessen Zeitungen aus und kam die letzten vier Monate der Schwangerschaft in einem Schwesternheim unter. Dort lernten Hebammen an ihr das Entbinden, und sie musste sauber machen und konnte unentgeltlich ihr Kind zur Welt bringen. Sie war's zufrieden. Es hätte schlimmer kommen können. Nachdem mein Bruder ein viertel Jahr alt war, musste sie dort weg, sie wohnte wieder in der Kellerwohnung. Karl, der Vater ihres Kindes war inzwischen wiedergekommen. Er hatte ihr vorher einen Brief geschrieben, in dem er eine Zeile aus einer damals bekannten Operette zitierte. Da ist von den Schwalben die Rede, die sich ein Nest bauen wollen. Ich habe diesen Brief später entdeckt und mir so meinen Vers darauf gemacht. Aus dem Ruhrgebiet war er zurückgekehrt, weil es auch dort nur Aushilfsarbeit gab. Außerdem gab es Wanzen, die er von dem Schlafburschen übernommen hatte, der das gleiche Bett benutzte, wenn Karl seine Schicht machte. Die Arbeit, wenn es sie gab, war schwer und die Arbeiter ohne Klassenbewusstsein. Da kam mein Vater lieber zurück in die Reichshauptstadt. Hier bekam er sogar vorübergehend Arbeit, bis 1928 etwa. Dann war Schluss, dann gab' s nur noch den Nachweis, wie die Berliner damals die Arbeitsämter nannten. Mein Vater musste immer zum Arbeitsamt an der Sonnenallee, wo er stempeln ging, um seine Arbeitslosenunterstützung zu bekommen. 14 Reichsmark bekam er für die Woche. Damit musste gewirtschaftet werden. Wie kann ich nicht so leicht sagen. Aber es gehörte zu den Kunstfertigkeiten meiner Mutter, das zu können. Sie hat einen großen Teil ihrer Energie darauf konzentriert, das zu erlernen. Darüber verging ihr das Leben.
Ohne Geld bekam man auch keine Wohnung. So ging es meinen Eltern. Bei einem Spaziergang am Britzer Zweigkanal, an dem damals noch die Treidelbahnen die Lastkähne entlang zogen, entdeckten sie an einem Alleebaum einen Anschlagzettel, auf dem ein gewisser Bartoldi eine Laube zum Verkauf anbot. Sie befand sich auf der Kolonie "Gemütlichkeit'', nahe dem Vereinsheim und dem Spielplatz. Hiermit nun ist der zentrale Schauplatz meiner kindlichen Welt genannt. Das Universum meines damaligen Lebens. Bis 1959 blieb die Familie hier wohnen, dann bekamen die Eltern die erste Wohnung ihres Lebens. Damals, 1927, war an mich noch nicht zu denken, und ich kann mich nicht auf die eigene Erinnerung, sondern nur auf die familiäre Überlieferung stützen. Ich schöpfe aus dem Fundus von Geschichten, die in meiner Familie erzählt wurden. Inwieweit sie zutreffen, kann ich nicht entscheiden. Da meine Eltern glaubwürdige Leute waren, die es strikt mit der Wahrheit hielten, nehme ich an, dass alles so war, wie es erzählt wurde.
1927, als meine Eltern die Laube kauften, war schon mein Bruder da. Sie hatten 650,-- RM zu bezahlen, die hatte ihnen der Vater meiner Mutter vorgeschossen. Das war viel Geld und auch für ihn nicht leicht aufzubringen. Sie vereinbarten einen Rückzahlungsmodus, aber er erlebte die letzte Ratenzahlung nicht mehr. Bei dem Kauf hatten sie großes Glück, denn üblicherweise wurden die Lauben und Parzellen nur durch den Vorstand vergeben. Und die wussten, wen sie haben wollten und wen nicht. Es waren Bedingungen zu erfüllen. "Gemütlichkeit“ war in der Hand von SPD-Leuten, die sich der Idee von Dr. Schreber verpflichtet fühlten. Das Vereinsleben war strikt geregelt, die Art und Weise, wie die kleine Parzelle von 200 m² zu bebauen war, vorgegeben. Zwar unterlag die Entscheidung, welche Blumen gepflanzt wurden, dem individuellen Geschmack, aber dass nicht nur Blumen, sondern Bäume, Sträucher, Gemüse und anderes Nützliche in den Garten gehörte, war unzweifelhaft. Es gab Verpflichtungen innerhalb des Vereins. Jeder musste sich an den gemeinschaftlichen Arbeiten beteiligen. Einige schwarze Schafe, die zu viel Ziersträucher hatten und den Wildwuchs nicht durch regelmäßigen Schnitt regulierten, wurden auf den Versammlungen öffentlich gerügt. Der Vorgänger war wohl ein solches schwarzes Schaf. Er hatte sich nicht in die geltenden Normen gefügt, sich nicht den Verkaufsregeln des Vereinsvorstandes unterworfen. Daher die Annonce und ein eigener Preis, der ziemlich hoch war.
So also kamen meine Eltern zu ihrem Nest. Es lag an einer historisch interessanten Nahtstelle, wie sich später herausstellte. Nordöstlich ist das Gebiet vom Britzer Zweigkanal begrenzt, einem verbreiterten Flüsschen, das in Baumschulenweg in der Höhe der Köpenicker Landstraße die Spree verlässt, von mehreren Brücken überquert, an der Britzer Grenzallee mit dem Teltowkanal zusammenfließt und dort einen Industriehafen bildet. Mit dem Teltowkanal zusammen verkürzt das Flüsschen den Schifffahrtsweg durch Berlin zwischen Spree/Dame im Südosten und Havel im Westen erheblich.
Dieser Britzer Zweigkanal wurde der Mississippi meiner Kindheit, mit dem sich viele Abenteuer verbinden.
Der Zufall, der meine Eltern in den Besitz einer Laube gebracht hatte, erwies sich als historisch folgenreich. Erstmals wurde ein erklärter Kritiker der Sozialdemokraten auf ''Gemütlichkeit“ ansässig. 1925 war Paul von Hindenburg an die Stelle des verstorbenen sozialdemokratischen Reichspräsidenten Friedrich Ebert getreten. Auch die Phase der großen Koalitionen mit bürgerlichen Regierungsvertretern hatten die Sozialdemokraten bereits hinter sich. Im Gegensatz dazu bestimmten sie auf "Gemütlichkeit” noch, was zu geschehen hatte. Die regierende Prominenz dort war erbost über das Ei, das ihnen Herr Bartoldi, der nur kurz zu ihrer Vereinsgemeinschaft gehörte, gelegt hatte. Denn mein Vater war Fichte-Sportler, stand der KPD nahe, war in der Kommunistischen Partei Opposition. Jedenfalls war er politisch recht radikal und hatte vor allem eine völlig andere Vorstellung vom Garten. Er gedachte ihn auf seine Art zu nutzen. Oder gar nicht. Das entspräche ihm noch besser. Er sonnte sich an seinen langen Arbeitslosentagen, spielte Schach mit seinen Freunden, die, auch arbeitslos, von Neukölln aus kamen, politisierte mit ihnen und las. Und das erstaunlich viel. Von diesen Büchern machte auch ich später Gebrauch. Dass er viel gelesen hat, besagt auch die Erinnerung an ihn aus meinen Kindertagen. Mein Bruder muss das auch schon so erlebt haben. Er las Balzac und Dostojewski, Tolstoi und Swift, Panait Istrati und Rolland, Barbusse und Gorki, Pilnjak und Scholochow, Nietzsche und Bakunin, Lenin und Bucharin. Er las Bücher aus der Büchergilde Gutenberg, aus dem Arbeiterverlag Wien und vom Malik-Verlag, später aus der Reihe „Der rote 1-Mark-Roman“. So war mein Vater ein leibhaftiges Beispiel der kulturellen Arbeiteremanzipation. Seine politischen Vorstellungen radikalisierten sich in der Weltwirtschaftskrise. Ernst Busch und Erich Weinert drückten die Stimmung meines Vaters in dieser Zeit aus. Tucholsky und Ossietzky waren ihm schon zu bürgerlich. Obwohl er die "Weltbühne'' immer gelesen hat. Auch nach 1945. Vollständige Jahrgänge von 1945 bis 1948 finden sich im Familiennachlass. Vieles sahen seine Vereinskollegen in "Gemütlichkeit” Ende der zwanziger Jahre vielleicht gar nicht so anders. Denn sie machten die gleichen Erfahrungen, waren auch arbeitslos. Dennoch begegneten sich die Sozis und die Kommunisten mit strengem Vorbehalt. Die Sozis hatten die Vereinsgewalt und tadelten meinen Vater wegen seiner ungeschnittenen Hecken. Auch ließ er es zu, dass ein Freund von ihm ein Paddelboot auf der Parzelle abstellte. Die Gärten waren so winzig, dass aber auch gar nichts verborgen blieb. "Der will wohl einen Fichte-Sportverein hier aufmachen”, hieß es dann. Mein Vater tat nicht, was erwartet wurde: den Garten ordentlich zu bebauen und am Wochenende auf ein Bier in die Vereinslaube zu kommen, um mit den Kollegen zu klönen.
Also mein Vater, als Choleriker und Kommunist, war ein ziemlicher Einzelgänger auf "Gemütlichkeit". Obwohl ich mir nicht vorstellen kann, dass er das wie eine Fahne vor sich her trug. Das würde nicht zu ihm passen. Den Choleriker merkte man ohnehin erst bei längerem Umgang mit ihm. Im Allgemeinen war er freundlich und witzig. Und Kommunist, das wollte er erst werden. So hat er das jedenfalls später immer gesagt. Vielleicht aus Protest. Ich habe früh mitbekommen, dass es nicht so einfach war zwischen meinen Eltern und den Leuten dort.
Zu der Zeit, als meine Eltern die Laube kauften, war ein Mann namens Pascheka Vereinsvorsitzender. Freidenker seit vor dem Weltkrieg, SPD-Genosse und Großvater meiner Freundin Doris, die ihn aber nicht mehr kennengelernt hat. Richard Pascheka war der Mann, der die Tadel gegen meinen Vater öffentlich aussprach. Das gefiel meinem Vater verständlicherweise nicht, und er war wütend auf diesen Mann. Dass der aber auch vor seinen eigenen SPD-Genossen nicht haltmachte, beeindruckte meinen Vater, und er behielt ihn auch in späteren Zeiten achtungsvoll in Erinnerung. Eine gewisse Ordnung hielt auch er für nötig, aber sie widersprach seinem Temperament. Den bestehenden Zustand hielt mein Vater sowieso für provisorisch. Das betraf sowohl das Wohnen in der Laube als auch die Verhältnisse in der Weimarer Republik, die ihn in einen Wartezustand versetzten. Er wartete auf Arbeit. Wie ernst ihm dieses Warten war, weiß ich nicht, denn er bildete keine Ausnahme. Sechs Millionen warteten auch. Die kurzen Arbeitsphasen in seinem Leben bis 1933 verliefen höchst unbefriedigend. Darüber hat er mehrfach berichtet. Einmal meinte der Meister, sich nicht um ausreichend Werkzeuge kümmern zu müssen, sodass sich die Arbeiter morgens um die wenigen Lötkolben schlugen. Das machte mein Vater natürlich nicht mit. Da folgte er lieber der Aufforderung zu gehen. Die war schnell ausgesprochen. Eine halbe Stunde später hatte er seine Papiere. Oder aber er beteiligte sich an einem Streik, bei dem es um mehr Lohn oder das Recht auf gewerkschaftliche Organisierung ging. Dann ging er wieder auf den Nachweis, zur "Sonne", zweimal die Woche, um den Stempel für die Arbeitslosenunterstützung zu bekommen.
Die Überzeugung meines Vaters, dass diese Verhältnisse nur vorübergehend waren, bewahrheitete sich. Allerdings wartete er damals auf einen gründlichen revolutionären Umsturz. Wie der aussehen und was dann kommen sollte, wusste er natürlich auch nicht. Auf jeden Fall sollte alles ganz anders werden. Bis es soweit war, verbrachte er seine Tage so, wie ich angedeutet habe, und weigerte sich gegenüber meiner Mutter strikt, die Sommerlaube auf den kommenden Winter vorzubereiten. Die Laube bestand zu dieser Zeit aus dünnen Kistenbrettern. Zimmer, Küche, Kammer und Veranda waren ohne Fundament. Die Tapete davor bildete Hohlräume, in denen Wanzen einen Unterschlupf fanden, die meinen Bruder piesackten. Meine Mutter kam ihnen erst langsam auf die Schliche und verfolgte sie nachdrücklich. Sie war entschlossen, den provisorischen Verhältnissen Dauerhaftigkeit zu verleihen. Sie hatte Vorschläge und Pläne, schaffte Baumaterialien heran und ging meinem Vater damit auf die Nerven. Denn der wollte seine Ruhe zum Lesen, Schachspielen, Schwimmen und Faustballspielen. In dieser Zeit hatte sie manchmal Arbeit, aushilfsweise in einer Batteriefabrik in Schöneweide. Hier musste sie im Akkord Säure in kleine Behälter gießen, die in jede Batterie hinein gehörten. Dafür bekam sie Pfennige. Die männlichen Kollegen dort stimmten mit der Fabrikleitung darin überein, dass der Lohn der Arbeiterinnen niedriger zu sein habe als der eigene. Das fand mein Vater empörend. Er unterstützte meine Mutter gegen diese Ungerechtigkeit. Weniger Beifall fand sie mit ihrer Idee die Laube zu tapezieren. Sie hatte Tapeten gekauft und mein Vater, der zu Hause war, sollte beginnen. Aber er begann nicht. Er fand es überflüssig, weil sowieso die Weltrevolution vor der Tür stand. Außerdem betreute er in dieser Zeit meinen Bruder, der ein ruhiges, in sich gekehrtes Kind war und den Vater wenig störte. Aber manchmal störte er doch. Eines Tages hat er die vor dem Ofen abgestellte Asche über sich und sein Bett verteilt. Da war mein Vater sehr böse über das ungezogene Kind.
Meine Eltern mussten im Winter 1929/30 aus ihrer Sommerlaube flüchten. Denn der war sprichwörtlich kalt, er gehörte zu den kältesten Wintern des Jahrhunderts. Über Wochen bis 25 Grad minus. Das war schon ungewöhnlich für unsere Breiten. Sie hatten inzwischen Hühner und die wurden während dieser Zeit in der Küche untergebracht. Mein Vater hatte dem Federvieh eine Trinkanlage gebaut, mit einem ewigen Flämmchen, damit das Wasser nicht gefror. Er war als Handwerker nicht ungeschickt, bisweilen findig, wenn er wollte.
Als meine Mutter im Frühjahr die Laube wieder betrat, erkannte sie ihre Küche nicht wieder. Mein Vater hatte alle Schranktüren geöffnet, um dem Federvieh Anflugplätze zu bieten. Sie Hühner hatten Spuren hinterlassen, auf die hinzuweisen meine Mutter auch in späteren Jahren nicht müde wurde. Mein Vater konnte das Erschrecken meiner Mutter nicht verstehen, weil er als regelmäßiger Fütterer der Hühner kontrolliert hatte, dass sie sich wohl befanden und den strengen Winter überstehen konnten. Diese innige Beziehung zu den Hühnern muss sich später bei ihm etwas verloren haben, als wir nach dem 2. Weltkrieg wieder Hühner hielten.
So oder ähnlich lebten sie bis 1933. Dann bekam mein Vater Arbeit. Natürlich hat es für beide auch gute Stunden gegeben. Wenn sie mit Fichte wanderten oder, wenn sie zelteten, am Zeesener See oder in Neukamerun an der Tongrube in Körbiskrug Faustball spielten. Mein Onkel Otto spielte Gitarre, mein Vater Zither oder Mundharmonika, was er sich selber beigebracht hatte. Dazu wurde gesungen. Wanderlieder, Volkslieder, Kampflieder wohl weniger. Lustig muss es auch gewesen sein, als meine Mutter im Kanal schwimmen lernte. Mein Vater hatte zusammen mit seinem Freund Erwin Fröhnert einen Schwimmgürtel gebaut, den meine Mutter um den Leib bekam. Sie befestigten daran ein langes Seil und stellten sich auf die Brücke, die über die Britzer Allee führte. Sie hielten meine Mutter so hoch, dass sie kaum das Wasser berühren konnte. Ihre Rufe interpretierten sie falsch und zogen sie höher. Das Experiment wurde ergebnislos abgebrochen, weil meine Mutter nicht mehr wollte. Sie lernte dann in aller Stille das Schwimmen ohne meinen Vater. So gingen die pädagogischen Bemühungen meines Vaters meistens aus. Darüber konnte er lachen oder auch wütend werden. Je nachdem. So vergingen die Jahre. Der zusammenfassende Kommentar meiner Mutter über diese Zeit ging dahin, dass sie die mühseligen Bemühungen um die elementare Existenzsicherung erinnerte. Sie berichtete, wie sie mit vierzehn Mark über die Wochen gekommen sind. Aus Rinderknochen und Bruchreis Mittagessen gekocht hat, welche Aushilfsarbeiten sie machte. Währenddessen besuchte mein Vater im Winter das Schwimmbad in der Ganghofer-Straße und bereitete dort mit seinen Freunden, unter der warmen Dusche stehend, die Weltrevolution vor. Man stellte sich vor, dass sie unmittelbar bevorstand.
Frühe Eindrücke
Nun kann ich wohl endlich mit mir selbst beginnen. Meine Geburt, die Kleinkinderzeit waren in keiner Weise irgendwie besonders. Ein unauffälliges, normales Kind, so wuchs ich auf. Nur die Zeit war unverwechselbar, unwiederbringlich wie jede Zeit.
Entbunden wurde meine Mutter von mir in der Geburtsklinik Karlshorst in Berlin. Sie erlitt dabei einen Dammriss, die Hebamme hatte ihr eine Wehenspritze gegeben, damit sie schneller niederkommen sollte. Das war damals noch ziemlich unüblich, und die Hebamme fürchtete den Arzt. Sie bat meine Mutter, ihm nichts von der Spritze zu sagen.
Meine Eltern waren etwas enttäuscht über diese Art der Entbindung von meiner Winzigkeit. Denn eigentlich hielten sie viel vom Fortschritt der Wissenschaft und der Medizin. Sie sprachen immer mit einer gewissen Ehrfurcht von Dingen, von denen sie wenig wussten. Meine Mutter stillte mich ein Jahr lang und wickelte, fütterte, badete mich nach den neuesten Einsichten und Regeln der damaligen Säuglingspflege. Sie widmete sich mir voll und ganz. Seit meiner Geburt war sie nicht mehr berufstätig. Ihre letzte Stelle war im Staatstheater am Gendarmenmarkt, wo sie in der Theaterwerkstatt an Bühnendekorationen nähte. Bei Gustav Gründgens sozusagen. Aber sie hat das Theater kein einziges Mal während einer Vorstellung besucht.
Meine älteste Erinnerung an mich selber kann ich nicht genau datieren. Immer, wenn ich es versuche, stoße ich auf Überliefertes. So fällt mir die erste Erinnerung an mich mit den Fotos zusammen, die von mir als Kleinkind existieren. Man berichtete mir, dass ich mit einem Jahr laufen konnte, niemals krank und immer in Bewegung war. An meinen Bruder hab ich die Erinnerung, dass er mich festhalten und umarmen wollte, während ich wegstrebte. So jedenfalls dokumentiert es ein Foto. Auch den Zärtlichkeiten von Tanten und Onkeln versuchte ich zu entgehen. Vor ihren Küssen verspürte ich einen leichten Ekel. Ich glaube, das geht vielen Kindern so. Sie wagen es nur nicht einzugestehen, weil sie bemerken, dass das den Erwachsenen nicht gefällt. Mir war das egal. Die Erinnerungen an meinen Bruder aus früher Zeit sind außerordentlich spärlich. Ich kann mich entsinnen, dass er Mensch-ärgere-dich-nicht mit mir spielte. Auch wenn er keine Lust hatte. Denn ich erwartete ihn so dringlich, wenn er von der Arbeit kam, dass er es nicht fertigbrachte, mir diesen Wunsch abzuschlagen. Er lernte damals Schriftsetzer bei M&K (Max Krause) in der Alexandrinenstraße. Ich erinnere mich, dass mein Bruder häufig den Werbespruch der Firma im Munde führte: „Schreibst du ihr, schreibst du mir, schreibst du auf M&K-Papier." Diese Druckerei sank bei einem Großangriff im Februar 1945 in Schutt und Asche, wie das ganze Presseviertel.
Mein Bruder las mir aus seinen Lesebüchern vor. Es waren immer die gleichen Balladen. "Nis Randers”, ”Das Riesenspielzeug", "Herr von Ribbeck im Havelland” kann ich noch heute auswendig hersagen. 1932 hatte man meinen Bruder in eine weltliche Schule geschickt, aber schon 1933 musste er in eine Volksschule umgeschult werden, weil Hitler die weltlichen Schulen verbot. Insgesamt muss die Schule für ihn eine ziemliche Drangsal gewesen sein. Die Kinder hänselten meinen Bruder wegen seiner abstehenden Ohren, und er war unfähig, sich zu wehren. Das hat er auch später nicht gelernt. Damals, als er mit mir Mensch-ärgere-dich-nicht spielte, habe ich von seinen Kümmernissen nichts geahnt. Wahrscheinlich habe auch ich, als seine kleine Schwester, ihn ausgenutzt. Denn er tat, was ich wollte. Wenn er zum Spielen keine Lust hatte, bohrte ich hartnäckig, bis er nachgab.
Genau erinnere ich mich an den Tag, an dem er in den Krieg musste. Das war im Frühsommer 1943, er war gerade siebzehn Jahre alt. Meine Mutter und ich waren auf dem Lindenberger Hof. Unerwartet stand mein Bruder vor der Küchentür. Er hielt ein beschriebenes Blatt in der Hand und zeigte es meiner Mutter, die schnell zu ihm hingetreten war. Sie schaute erschreckt auf das Papier und nahm dann meinen Bruder beim Kopf. Dabei flossen ihr die Tränen über das Gesicht. Dann saß mein Bruder am großen Bauerntisch in Jänickes Küche und aß. Wir saßen um ihn herum und sahen zu, wie er kaute. Mein Bruder blieb nur kurz. Gleich nach dem Essen stand er auf, wollte gehen. Meine Mutter bat ihn, zu warten. Sie machte ihm ein Paket Stullen zurecht. Die nahm er und ging. Zuvor hatte er auch mich kurz umarmt. Er schüttelte meine Mutter ab, die ihn begleiten wollte. Der Abschied kann nicht länger als zwanzig Minuten gedauert haben. Auf meine Frage antwortete meine Mutter eher beiläufig, dass es nun soweit sei, auch Heinz müsse in den Krieg. Ich war nicht überrascht, hatte oft angehört, wenn die Eltern ihre Befürchtungen austauschten. Daher war mir geläufig, was jetzt eingetroffen war. Ich fragte nicht weiter.
Er hatte drei- oder viermal Urlaub. Immer nach einer Verwundung, die dann gerade erst notdürftig ausgeheilt war. Granatsplitter trafen ihn am Kinn, an der Schläfe, am Oberarm und in die Hand. Jede dieser Verwundungen kommentierten meine Eltern mit der Bemerkung, dass er Glück gehabt habe. Darüber wunderte ich mich, begriff aber bald, dass sich diese Bemerkung auf schlimmere Möglichkeiten bezog. Bevor er wieder einrücken musste, erwogen unsere Eltern mit ihm, wie er den Urlaub verlängern könnte, welche List anzuwenden war, um ein paar Tage herauszuholen. Mein Bruder schüttelte den Kopf bei solchen Erwägungen, er wollte davon nichts wissen, sondern meldete sich pünktlich wieder zur Stelle. Auch die Ermunterungen meines Vaters, beim Fronteinsatz in Gefangenschaft zu gehen, überzulaufen, quittierte er mit ratlosem Achselzucken. ''Wie du dir das vorstellst'', entgegnete er schüchtern. Ich bin im Zweifel darüber, ob ich mich wirklich an die Gespräche selbst erinnere. Oder ob die Quelle meiner Erinnerung ihre wiederholte Besprechung in späteren Jahren ist. Denn als mein Bruder fünf Jahre später aus der Kriegsgefangenschaft zurückkehrte, wurden diese Dinge wieder und wieder erörtert. Einzelne Bilder sind mir aber wirklich geblieben, die mich an seine Urlaube erinnern. Immer stand er ganz plötzlich in der Tür unserer Laube. Traurig, abgerissen und zerschunden. Auch an seine Verwundungen, an die durchtränkten Verbände und die noch nässenden Wunden kann ich mich erinnern. Ich ekelte mich und vermied es, ihm nahe zu kommen. Einmal ist meine Mutter mit mir nach Merane gefahren, um ihn dort im Lazarett zu besuchen. Eindrücke hinterließen das neblige, kalte Klima der Stadt und das ungeheizte Zimmer, in dem wir schliefen. Auch die Menschen auf überfüllten Bahnhöfen während einer nicht enden wollenden Bahnfahrt mit vielen Zwischenaufenthalten. An den Besuch bei ihm im Lazarett kann ich mich dagegen nicht erinnern. Es ging ihm schlecht damals.
An einen anderen Gefährten meiner Kindheit habe ich genaue Erinnerungen. Das ist mein Cousin Klaus. Gleichaltrig verbrachten wir viel Spielzeit zusammen. Er war der Ältere meiner Tante Lucie, der Schwester meiner Mutter, drei Jahre später kam noch Karin dazu. Sie haben wir meistens nur geärgert. Das nimmt sie uns heute nicht mehr übel. Tante Lucie trug damals Zeitungen aus, und deshalb brachte sie ihr Kind zur älteren Schwester. Mit Klaus war ich gern zusammen. Er war gemütvoll und wollte, was ich wollte. Am liebsten fasste ich immer seine Ohren an, weil die so klein und fleischig waren. Aber das mochte er nicht und wehrte mich ab. Ein Foto, aufgenommen im Buddelkasten unseres Gartens verrät mir, dass mir nicht jede zärtliche Annäherung lästig war. Hier umarme ich meinen Klaus ganz innig, der ein eher gequältes Gesicht dazu macht. Ich denke nicht, dass man mir das angetragen hatte für das Foto. So etwas war bei uns nicht üblich. Ein anderes Foto zeigt uns beide inmitten einer Gruppe von Schafen, die wohl damals noch auf den Feldern an der Straße 6 gehütet wurden. Dort, wo jetzt ein großer Müllplatz entstanden ist. Ich bin in meiner typischen Haltung von damals festgehalten. Auf zwei Fingern nuckelnd, vergrabe ich die andere Hand in der dichten Wolle eines Schafrückens. Dazu soll ich dann ”Schäfchen ei” gesagt haben, wie man mir später glaubhaft versicherte. Mein Cousin Klaus sieht auf allen diesen Bildern recht rund aus. Er aß sehr gern und wurde mir deshalb immer als Vorbild hingestellt. Manchmal strich er sich über seinen kleinen Bauch und sagte: „wie Göring“. Das löste ein beachtliches Gelächter aus, worüber wir beide erschraken, aber schließlich mitlachten. Aufgrund dieses Erfolges wiederholte er das. Er hatte das wohl von seiner Mutter aufgeschnappt, die voller Witz war.
Dass man auf "Gemütlichkeit" 1941, so etwa muss das gewesen sein, darüber so einfach lachen konnte, besagt schon viel. Allerdings nicht alles.
Von den in der SPD organisierten Vereinskollegen, wie man sich hier nannte, blieben die meisten, was sie waren. Allerdings ermunterten, 1940/4l in der Zeit der deutschen Siege, einige ihre Söhne, zur Luftwaffe zu gehen. Man versprach sich davon einen Vorzugsplatz in der Schlachtordnung. Die jungen Männer, Altersgenossen meines Bruders zumeist, kehrten fast alle nicht zurück. Ich kann mich allein an sechs von ihnen erinnern. Zwar weniger an die jungen Männer selbst, als vielmehr an ihre Namen und die Tragödien in der Nachbarschaft, die sich um sie drehten. Einige von den Indifferenten, wie sie mein Vater nannte, wurden Nazis. Zwei gingen zur SA, und Herr Peküh wurde Blockwart. Er sammelte für den Eintopf und die Winterhilfe. Aber mein Vater gab nichts oder nur Pfennige. Dennoch kam er immer wieder. Denunziert hat er wohl niemanden. Dafür wollte er später von meinem Vater einen Schein für die Entnazifizierung, einen Persilschein, wie das dann hieß. Er bekam ihn nicht, obwohl er sich beim Betteln regelrecht erniedrigte. Nachsicht und Vergeben waren nicht die Stärken meines Vaters. Dann gab es noch den Luftschutzwart Herrn Schmidt, mit dem mein Vater manchen Strauß ausfocht, weil der immer unsere Verdunklungsvorrichtungen beanstandete. Der eine SA-Mann war vorher im Roten Frontkämpferbund, und mein Vater kannte ihn sehr genau. ”Der drückt sich jetzt hier nur so vorbei”, sagte mein Vater. Da er mit seiner Familie schon vor dem Ende des Krieges von ''Gemütlichkeit" wegzog, kann ich mich an ihn nur ganz vage erinnern. Niemand wusste, wo er abgeblieben ist. An den zweiten SA-Mann kann ich mich dagegen erinnern, ich kannte ihn, wie man als Kind jemanden kennt. Ich spielte mit seiner Tochter Eva. Aber das sollte ich nicht und bezog deshalb die erste und einzige Tracht Prügel von meinem Vater. Später, nach dem Krieg lockerte sich das Spielverbot, aber ich hatte nun keine Lust mehr, mit der Eva zu spielen. Sie war ohnehin älter, und ich mochte sie nicht, weil sie mich nicht für voll nahm.
Meine ältesten Erinnerungen an Nachbarn haben sich durch Erstaunen eingeprägt. Verwundern war mein vorherrschendes Empfinden, so sagt mir mein Gefühlsgedächtnis. Ich fand, dass alle unsere Nachbarn nette Leute waren. Die eine Nachbarin schenkte mir Kekse, sie hieß Frau Knospe, sie hat sich später das Leben genommen. Die andere ließ mich zu ihren Kaninchen, damals hatten wir selbst noch keine. Sie hieß für mich die Mucki-Tante. Eine andere, Frau Straube, führte lange Gespräche mit mir, und Frau Schneider brachte mir das Beten bei. Aber das behielt ich damals für mich. Mit den Männern stand ich auf weniger vertrautem Fuß. Sie schienen mir unnahbar und waren auch meistens auf Arbeit. Ich machte auch hier die Erfahrung, dass sie nicht so furchtbar waren, wie ich gedacht hatte. Mein erleichtertes Erstaunen über die netten Leute muss daher gerührt haben, dass ich vieles von den Gesprächen meiner Eltern aufgeschnappt habe, die mir die Nachbarn in keinem allzu günstigen Licht erscheinen ließen. Es gab da Gesprächsfetzen, die etwa so gingen: "Der freut sich auch über jede versenkte Bruttoregistertonne und denkt nicht daran, dass wir das alles einmal bezahlen müssen" oder: „Die kriegt ihren Arm auch nicht hoch genug." Im Unterschied zu den Männern erwarteten einige Frauen etwas vom Führer, sie waren der NS-Frauenschaft beigetreten und sorgten dafür, dass bei bestimmten Anlässen die Fahne auf dem Vereinsplatz gehisst wurde.
Tages- und Nachtangriffe
In dieser Zeit gab es längst schon die Fliegerangriffe auf die Reichshauptstadt, die wir auf "Gemütlichkeit” im Splittergraben abwarten mussten. Diese Splittergräben waren auf dem Gelände einer nahe gelegenen Gärtnerei gebaut worden. Sie bestanden aus Betonplatten und Erde. Ich kann mich an ihren Bau erinnern, weil wir zuvor auf dem gelagerten Material herumgeturnt hatten, was uns natürlich verboten war. Allerdings gingen nicht alle Bewohner in diesen Splittergraben. In der Straße 6 gab es einen Bunker, dort konnte man Zimmer für, wie es dann später nötig wurde, jede Nacht reservieren. Die Leute machten sich diese Zimmer mit Matratzen, Decken und Stühlen wohnlich. Ein solches Zimmer stand meinen Eltern nicht zu. Andere standen auf dem Gang, auf dem es mit der Zeit immer enger wurde. Da mochten meine Eltern auch nicht stehen, weil sie bei einem Einschlag Panik befürchteten. Wir waren ein einziges Mal in diesem Bunker, weil uns ein Tagesangriff auf dem Weg von Neukölln nach Hause überrascht hatte. Ich konnte mich davon überzeugen, dass meine Eltern recht hatten. Es war eng in dem Gang, in dem wir nahe dem Eingang standen. Die Luft war dick, besonders bei mir da unten, bis mich mein Vater hochnahm, da wurde es etwas erträglicher. Außerdem heulten und schrien die Menschen durcheinander. Das gab es in unserem Splittergraben nicht. Dort ging alles ruhig zu. Man sorgte dafür, dass wir Kinder schlafen konnten.
Heute weiß ich natürlich, dass die Bombenangriffe ab 1943 zunächst mehrmals in der Woche kamen und dann gegen Ende des Krieges immer häufiger, auch tagsüber. In meiner Erinnerung gehören die Luftangriffe zum alltäglichen Leben von damals. Auch ich war auf den durchdringenden Sirenenton geeicht, der zuerst Vorwarnung, dann Warnung, nach den Bombenabwürfen Entwarnung bedeutete. Im Rundfunk erkannte ich sofort die Erkennungsmelodie, mit der uns die Sondermeldung verkündet wurde, dass in Kürze das Sirenengeheul zu erwarten war. Dieser Ton ging mir auch später, bei den mittwöchentlichen Sirenenproben tief in die Seele. Wenn der Radiosprecher verkündete, dass sich die Flugzeuge im Anflug über Hannover/Braunschweig befanden, war in wenigen Minuten mit der Sirenenwarnung zu rechnen. Wenn es hieß, dass sie nach Westen abdrehten, etwa in Richtung auf Köln oder Frankfurt a. Main, dann konnten wir aufatmen. Es ist mir nie in den Sinn gekommen, dass es dort auch Kinder gab. Nur einmal, es muss schon gegen Ende des Krieges gewesen sein, hat mir mein Vater gesagt, dass vor uns schon englische Städte bombardiert worden waren und wir das jetzt zurückbekamen. Das leuchtete mir damals ein.
Ein Luftangriff löste in unserer Familie immer die gleichen Reflexe aus. Mein Vater musste zuerst auf die Toilette, die nur über einen kleinen Hof zu erreichen war. Er blockierte sie ziemlich lange, sodass ich warten musste. Er wollte auch gar nicht in den Splittergraben, es wäre ohnehin alles egal, sagte er. Meine Mutter dagegen drängte zur Eile und steckte noch einige Sachen in den Koffer, der stets in unserer Veranda bereitstand, um mit in den Splittergraben genommen zu werden. Mein Vater hielt auch das für überflüssig, schickte sich aber in die Anordnungen meiner Mutter. Nur dass ich meine Puppe mitnahm, dagegen hatte er nichts. Es leuchtete ihm offenbar ein, dass ich die brauchte. Ich kann mich erinnern, dass ich schlaftrunken war, wenn wir die 300 Meter zurücklegten, bis wir in unseren Splittergraben kamen. Manchmal wurde ich vorgeschickt auf diesem kurzen Weg, oft nahm mich irgendjemand bei der Hand. Manchmal aber auch nicht, und ich ging allein. Da war mir bange, besonders wenn die Weihnachtsbäume am Himmel standen und es schon irgendwo krachte. Denn die Zeiten zwischen Vorwarnung und Warnung waren so kurz, dass sich niemand in Sicherheit bringen konnte. Aber die gab es ja ohnehin nicht. Ich wusste, dass diese Art Weihnachtsbäume zu fürchten waren, wusste von meinen Eltern, dass sie markierten, wo Bomben abgeworfen werden sollten und fürchtete vor allem die, die direkt über mir standen. Einer meiner wiederkehrenden Albträume hängt mit diesen Weihnachtsbäumen zusammen. Ich sollte mit meiner Mutter eine mir noch nicht bekannte Familie besuchen, auf die ich neugierig war. Der Besuch war aus irgendeinem Grunde ausgefallen, und ich hatte die Spannung darauf mit in den kurzen Schlaf der folgenden Nacht genommen, die wieder unterbrochen wurde. Allein vorausgeschickt ging ich einen falschen Weg und stiftete damit ein großes Durcheinander. Meine Eltern mussten mich während des Alarms suchen. Befragt, wo ich denn hin gewollt hatte, gab ich den Namen der Familie an, die wir besuchen wollten. Die Suche nach irgendetwas und die Weihnachtsbäume über mir kehren oft in meinen Träumen wieder.
Im Ganzen muss ich sagen, hatten wir auf "Gemütlichkeit" am Rande Berlins großes Glück. Bomben haben nur wenige Lauben zerstört. Sie wurden durch Luftminen getroffen. Die konnte ich schon am Luftdruck und am Explosionsgeräusch erkennen, konnte sie von Brandbomben, die von den Erwachsenen für weniger gefährlich erklärt wurden, unterscheiden. Auch Sprengbomben gehörten zu den gewöhnlichen Dingen meiner kindlichen Welt. Die Luftminenwirkung hat mich erschüttert. Fassungslos stand ich vor der geschwärzten Brandstelle, die am Vortag noch eine Laube gewesen war, in der Leute gewohnt hatten. Es ragten nur noch ein paar verkohlte Balken hoch und einige gemauerte Steine, die von Küche und Herd übrig geblieben waren. Aber auch mit den Brandbomben war nicht zu spaßen. Ich merkte daran, dass den Erwachsenen auch nicht immer zu trauen war. Mein Bruder hatte Urlaub und musste mit uns in den Splittergraben. Eine Brandbombe durchschlug die Decke des Splittergrabens, ging dicht neben seinen Füßen in den Boden. Mein Vater, beherzt in Augenblicken, in denen es darauf ankam, nahm sie und trug sie vor die Tür, wo sie kurz darauf explodierte. Wieder einmal hatten wir Glück gehabt. Wir verloren auch sonst nichts. Mein Vater betonte zwar immer, dass wir sowieso nichts zu verlieren hätten, aber mir will das von heute her durchaus anders erscheinen. Da hatte er, glaube ich, nicht recht.