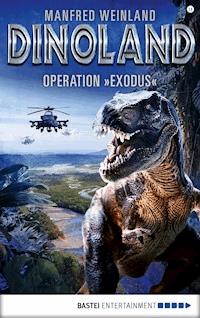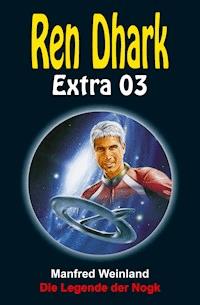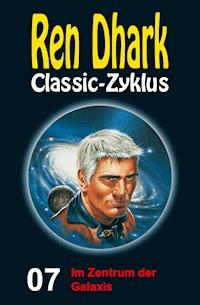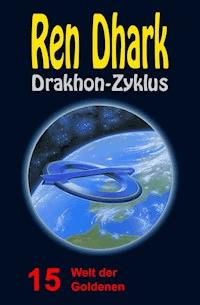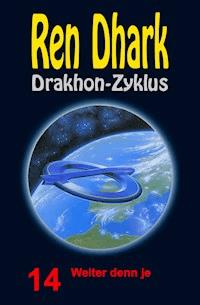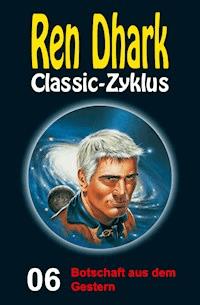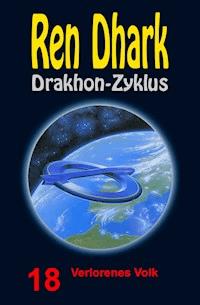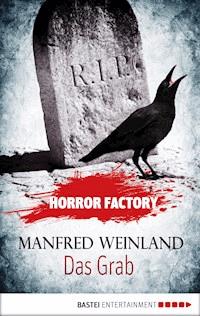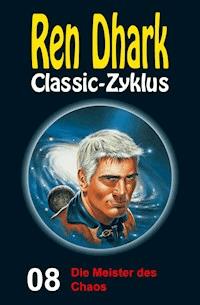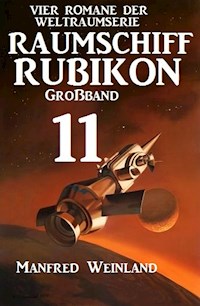1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Gespenster-Krimi
- Sprache: Deutsch
Am Abend vor dem großen Sterben ging Ben Glück mit Angst im Bauch ins Bett. Für den nächsten Morgen stand eine schwere Klassenarbeit an. Was diesen eigentlich unumgänglichen Termin anging, sollte der Vierzehnjährige seinem Namen alle Ehre machen und tatsächlich Glück haben. In allem anderen jedoch ...
Ben wachte auf, weil der Radiowecker ihn mit dem treibenden Sound eines Oldies weckte: dem Refrain von Closer To The Edge, den die Band Thirty Seconds to Mars intonierte. Er liebte diesen Groove. Zu dieser Zeit gab es auch noch Strom, sonst wäre ihm schneller etwas aufgefallen. So aber schlurfte er erst einmal unter die Dusche, zog sich an und verließ sein Zimmer.
Ab da wurde es komisch. Er war es gewohnt, in die Küche zu kommen und vom Duft frisch gebratener Eier mit Speck empfangen zu werden. Die Kaffeemaschine blubberte, der Tisch war komplett gedeckt, und die erste Ladung Toast brutzelte schon vor sich hin.
Normalerweise ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 146
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Inhalt
Cover
Mutation
Vorschau
Impressum
Mutation
Teil 1 von 2
von Manfred Weinland
Am Abend vor dem großen Sterben ging Ben Glück mit Angst im Bauch ins Bett. Für den nächsten Morgen stand eine schwere Klassenarbeit an. Was diesen eigentlich unumgänglichen Termin anging, sollte der Vierzehnjährige seinem Namen alle Ehre machen und tatsächlich Glück haben. In allem anderen jedoch ...
Ben wachte auf, weil der Radiowecker ihn mit dem treibenden Sound eines Oldies weckte: dem Refrain von Closer To The Edge, den die Band Thirty Seconds to Mars intonierte. Er liebte diesen Groove. Zu dieser Zeit gab es auch noch Strom, sonst wäre ihm schneller etwas aufgefallen. So aber schlurfte er erst einmal unter die Dusche, zog sich an und verließ sein Zimmer.
Ab da wurde es komisch. Er war es gewohnt, in die Küche zu kommen und vom Duft frisch gebratener Eier mit Speck empfangen zu werden. Die Kaffeemaschine blubberte, der Tisch war komplett gedeckt, und die erste Ladung Toast brutzelte schon vor sich hin.
Normalerweise ...
An diesem Morgen war alles anders. Die Küche war kalt. Und still.
Eigentlich, fand Ben, sah sie noch ganz genauso aus wie gestern Abend, als er sich zum Schlafen verabschiedet hatte.
»Mam?«
Seine belegte Stimme verriet, dass er beunruhigt war. Er konnte sich nicht erinnern, dass seine Mutter oder sein Vater – erst recht nicht beide zusammen – jemals an Werktagen außerhalb der Ferien verschlafen hatten.
Unwillkürlich machte er auf dem Absatz kehrt und ging zum elterlichen Schlafzimmer.
»Mam? Paps?«
Zaghaft klopfte er an die Tür.
Niemand antwortete.
Sein Herz klopfte plötzlich bis zum Hals, trotzdem drückte er die Klinge nach unten und machte die Tür so weit auf, dass er den Kopf durch den Spalt schieben konnte.
Drinnen war es hell.
Weil es draußen längst hell war und jemand die Jalousien nach oben gezogen hatte ...
Ben erkannte seinen Irrtum in dem Moment, als er das verwüstete Bett sah und sein Blick zum Fenster huschte. Gleichzeitig blies ihm Zugluft entgegen, weil –
Sein Herz setzte für einen Takt aus.
– das große Schlafzimmerfenster nicht einfach nur auf Kippe oder ganz offen stand, sondern eingeschlagen war.
Im Rahmen hingen nur noch ein paar vereinzelte, gezackte Scherben.
Mit bleiernen Beinen bewegte sich Ben auf das Fenster zu. Dabei glitt sein Blick eingehender über das Doppelbett, von dem jemand sämtliche Decken, Kissen und sogar das Laken geworfen und die Matratze mit einem Messer oder was auch immer aufgeschlitzt hatte. An manchen Stellen quollen die Drähte der Federung heraus.
Bens kindliches Gehirn errichtete einen Schutzwall, sodass er nicht weiter darüber nachdachte, wie so etwas hatte geschehen können. Gleichzeitig zog ihn das zertrümmerte Fenster fast magnetisch an. Im Nähertreten sah er auch Reste der Jalousien im Freien baumeln, was ihn zu dem Schluss brachte, dass sie doch geschlossen gewesen waren – als das, was die Scheibe zum Bersten gebracht hatte auch sie beschädigte.
Aus Bens Mund löste sich ein leises Wimmern, das er selbst gar nicht bemerkte.
Er trat an die Fensterbank.
Ein letztes Zögern – dann streckte er den Kopf über die Brüstung und blickte nach unten.
Die Stadt bot ein noch erschreckenderes Bild als die Wohnung. Überall standen kreuz und quer Autos auf den Straßen und Bürgersteigen herum. Mancherorts waren sie auch in Schaufenster, Vorgärten oder den Kiosk gegenüber gerollt.
Ben versuchte zu erkennen, ob sich noch jemand in den verunglückten Fahrzeugen befand. Aber aus der Höhe war das schwer zu sagen.
Dann blickte er steil nach unten und sah auf dem Bürgersteig vor dem Haus zwei riesige rote Flecken.
Sonst nichts.
Nur Rot, als wären zwei Farbeimer hinuntergefallen und auseinandergeplatzt.
Jetzt erst drang eine ferne Sirene an sein Gehör. Ben versuchte die Richtung, aus der sie kam, herauszufinden, aber er sah Rauch an verschiedenen Stellen der Stadt aufsteigen.
Irgendwo brannte es.
Die Sirene veränderte weder Ton noch Lautstärke. Andere Fanfaren, etwa von Feuerwehrautos oder Sanitätern, wurden nicht laut, obwohl fast jeden Tag Einsatzwagen der Polizei oder des Rettungsdienstes durch das Straßengewirr der Großstadt eilten.
Ben spürte, wie ihm kalt wurde.
Nach ein paar Minuten löste er sich vom Fenster und ging in die Diele. Dort stand die Handystation. Er nahm das Mobilteil herunter und wählte die Nummer seiner Tante, die nur ein paar Blocks weiter wohnte und keinem Beruf nachging.
Die Leitung war frei, es läutete durch. So lange, bis irgendwann das Besetztzeichen kam.
Bens Hand am Hörer zitterte jetzt wie Espenlaub.
Er versuchte noch drei, vier andere Nummern, zuletzt die beiden für den »äußersten Notfall«, wie seine Eltern ihm eingetrichtert hatten, zuerst die der Polizei, dann die der Rettungsleitstelle.
Bis auf die 112, wo sich eine Stimme vom Band meldete, hob niemand ab – und auch da war es ja nur ein Automat.
Ben verließ die Wohnung im achten Stock und klingelte bei den Nachbarn auf derselben Etage.
Niemand reagierte oder machte gar auf.
Ben versuchte es auf anderen Etagen, auch bei der alten Frau Heinecke. Deren Tür stand zwar offen, aber seine Rufe blieben unerwidert, und irgendwie hatte er Angst, in die Wohnung zu treten.
Irgendwann kehrte er in die elterliche Wohnung zurück. Er drückte die Tür nicht nur hinter sich ins Schloss, sondern schob auch den Sicherheitsriegel vor.
Er zitterte jetzt am ganzen Körper.
Von da an verließ er die eigenen vier Wände nicht mehr aus eigenem Antrieb.
Er wartete, ohne genau sagen zu können, worauf eigentlich.
Im Kühlschrank war noch einiges an Essen, und es gab auch ausreichend zu trinken.
Nur der Fernseher machte Mucken. Entweder lief gar nichts oder Programme, mit denen er nichts anfangen konnte. Im Radio dasselbe. Kritisch wurde es, als sich die Nacht über die Stadt senkte. Die erste Nacht ohne Eltern. Oder überhaupt ohne Menschen.
Ben machte alle Lichter in der Wohnung an und baute sich ein Lager hinter der Wohnzimmercouch. Hier fühlte er sich einigermaßen sicher. Aber er fand kaum Schlaf.
Der nächste Tag war fast wie der zurückliegende, nur dass Brandgeruch durch die Fenster hereinkam, weil ganz in der Nähe ein Haus in Flammen stand.
Ben hatte Angst, dass das Feuer bis zu ihm kommen würde, aber irgendwann erlosch es. Warum, konnte er nicht erkennen.
In der folgenden Nacht passierte etwas Schlimmes: Der Strom fiel aus. Alle Lichter erloschen gleichzeitig, und Ben hörte unheimliche Geräusche draußen und im Haus selbst. Einmal glaubte er, Schritte vor der Wohnungstür zu hören, aber die Angst war größer als die Hoffnung, seine Eltern könnten zurückgekehrt sein.
Später gab es einen gewaltigen Knall und Lärm im Treppenhaus, und als wieder Stille einkehrte, fiel Ben in einen Erschöpfungsschlaf, aus dem er erst wieder gegen Mittag des nächsten Tages erwachte.
Da hatte sich, wie ein Blick aus dem Fenster verriet, wieder etwas Neues in der Stadt getan. Gerade noch in Sichtweite schien ein neues Gebäude dazugekommen zu sein, das Ben noch niemals zuvor gesehen hatte. Es fiel ihm sofort auf, obwohl es keine besondere Größe hatte. Etwas Bedrohliches ging davon aus, und es verlangte Überwindung, überhaupt hinzusehen.
Am Nachmittag öffnete Ben die Wohnungstür und spähte vorsichtig ins Treppenhaus. Die Tür der Wohnung gegenüber war aufgebrochen und hing schief in den Angeln.
Ben schoss die Hitze ins Gesicht.
Schnell verrammelte er wieder die Wohnung. Aber es nützte nichts. In der kommenden Nacht kamen sie zu ihm.
†
Ben starb tausend Tode, als die Tür, wie bei der Wohnung gegenüber, aus den Angeln gehoben wurde. Irgendwo in der Nähe brannte es wieder, sodass flackernder Schein sich mit der Dunkelheit der Wohnung vermischte.
Ben wagte sich nicht hinter seinem Couchversteck hervor, aber sie fanden ihn trotzdem. Wie aus dem Nichts heraus sprang ein Körper auf ihn zu. Er schrie verzweifelt auf, dann spürte er auch schon den Stich. Von da an wurde alles gut.
Bei vollem Bewusstsein, aber ohne Angst, wurde er aus Wohnung und Haus getragen. Unterwegs begegneten ihm andere, die sich in ähnlicher Lage wie er befanden. Auch sie wurden getragen, weil ihre Beine dazu nicht mehr in der Lage waren.
Schließlich tauchte vor ihnen ein wunderschönes Haus auf, wo er und die anderen nach all der Mühsal endlich ihren Frieden fanden.
Ben sah zu, wie ein wohliges Bett um ihn herum gestrickt wurde. Er war so müde. Er wollte nur noch ruhen.
Von irgendwoher drangen schmatzende Geräusche und wiegten ihn in den Schlaf ...
†
Ruben Nathaniel Proktor, der Anführer der Illuminaten, verstand es, seine TV-Auftritte zu zelebrieren, obgleich er einfach nur dastand, vor einem schlichten Rednerpult, an dem nichts vom Illuminaten-Führer selbst ablenkte. Wie jedes Mal, seit die Sendungen im Bunker empfangen wurden, trug Proktor einen schwarzen Anzug mit violettem Schlips über einem dunkelgrauen Hemd. Auf dem Knoten der Krawatte prangte ein kleines rotes Emblem, dessen Ränder golden glänzten. Auf der Nasenspitze des älteren Mannes, über dessen wahres Alter die Soldaten, die gebannt auf den Bildschirm starrten, immer noch spekulierten – er konnte ebenso gut erst sechzig wie deutlich über achtzig sein –, klemmte eine Lesebrille, die er immer dann konsultierte, wenn er auf ein vor ihm liegendes Papier hinunterblickte. Aber das geschah selten. Freie Rede, auch unter Einbindung komplexer wissenschaftlicher Fakten, war eine von Proktors unstrittigen Fähigkeiten.
Aber der Anführer der Illuminaten wirkte bei jeder neuen Sendung mehr wie ein selbsternannter Messias, der versuchte, Anhänger – Jünger –um sich zu scharen, in seinen unmittelbaren Einflussbereich zu locken.
Wie üblich in den letzten Stunden, warnte der Illuminaten-Führer auch jetzt vor den Schrecken des Virus, das nicht nur Landstriche, sondern angeblich die ganze Welt so gut wie entvölkert hatte. Da draußen wüte eine Seuche von biblischen Ausmaßen, wurde er nicht müde zu unterstreichen.
»Da draußen«, das war aus der Sicht von Drei-Sterne-General Friedrich Schiller eigentlich »da oben«. Er befand sich mit zweihundertfünfzig ihm unterstellten Soldaten in »Terrasse Grün« – irgendein Zyniker im Verteidigungsministerium hatte den unterirdischen Hochsicherheitskomplex zwischen Vollmarshausen und Dörnhagen einmal aus einer Bierlaune heraus so getauft.
Die Verniedlichung Terrasse Grün drückte das genaue Gegenteil dessen aus, was die unterirdische Bunkeranlage tatsächlich darstellte. Statt der Aussicht von einer erhöhten Warte aus gab es nur in künstliches Licht gehüllte Katakomben, die über ein Labyrinth von Gängen miteinander verbunden waren.
Und grün war hier unten fast gar nichts, Betongrau dominierte neben Rot, Gelb oder Schwarz, mit denen die Wände beschriftet waren. Diese Beschilderungen leuchteten bei Stromausfall und Dunkelheit von ganz allein, sie waren mit fluoreszierender Farbe aufgetragen worden.
Der Raum, in dem sich Schiller aufhielt, war vollgestopft mit Monitoren und anderer Technik, die es ihnen ermöglichte, die Propaganda der Illuminaten zu empfangen.
»Ihre Befehle, Herr General?«, rief sich seine Ordonanz in Erinnerung.
Der Gefreite Lehning stand etwas versetzt von der einzigen Tür des Kommandostands, den Schiller kaum noch verließ, seit an der Oberfläche die Seuche grassierte und dabei war, sämtliche Säulen der Zivilisation zum Einsturz zu bringen.
Wahrscheinlich existiert sie schon gar nicht mehr – und wird auch nicht wiederzubeleben sein. Wir halten an überholten Werten fest. Die Rangabzeichen auf meinen Schulterklappen beeindrucken vielleicht noch den kleinen Haufen hier im Bunker. Ob sie da draußen noch etwas zählen, weiß allein der Himmel.
Oder doch eher die Hölle? Denn offenbar war die Welt da oben ja zu genau dem geworden. Der letzte Kontakt, den Schiller mit seinem Verbindungsmann im Verteidigungsministerium gehabt hatte, lag drei Tage zurück und war mitten im Satz abgebrochen.
Alle Versuche, die Verbindung zu seiner vorgesetzten Stelle wieder herzustellen, waren gescheitert. Die meisten nationalen Fernsehübertragungen, die seither hereinkamen, spulten inzwischen Programme aus der Konserve ab. Die Hoffnung, daraus Tendenzen herauslesen zu können, wie der globale Kampf gegen den tödlichen Erreger geführt wurde, hatte Schiller schon wenige Stunden nach dem Ausbruch des Virus begraben. Einzig die von ihm mit größtem Argwohn verfolgten Illuminaten-Sendungen schienen stets auf dem aktuellsten Stand zu sein.
Wer waren diese verdammten Illuminaten überhaupt? Und wieso schienen sie so unverhältnismäßig wenig unter dem allgemeinen Kollaps zu leiden zu haben?
Der Verdacht, dass diese Gruppierung, die erstmals vor einem Vierteljahrhundert von sich reden gemacht hatte, etwas mit der Seuche zu tun haben könnte, drängte sich förmlich auf.
Aber selbst wenn er damit ins Schwarze traf – da draußen schien es niemanden mehr zu geben, der diese Geheimbündler zur Rechenschaft zog. Sie konnten schalten und walten, wie es ihnen beliebte – und streiften sich dabei auch noch das Mäntelchen der Nächstenliebe über.
Seit Stunden gingen Meldungen über die Sender, in denen die Überlebenden – oder die Immunen, wie sie genannt wurden – vom charismatischen Proktor aufgefordert wurden, sich zu der jeweils nächstgelegenen Illuminaten-Basis zu begeben. Proktor bezeichnete die Stützpunkte seiner länderübergreifenden Organisation in all seinen Reden als »Fluchtburgen« in Zeiten der globalen Gefahr.
Schiller wusste, dass der Begriff »Burg« nicht zufällig oder als reine Metapher gewählt war. Seine Recherchen in den Speicherbänken der Bunkerrechner hatten ergeben, dass die Illuminaten seit ihrer Gründung weltweit bevorzugt tatsächliche Burgen oder vergleichbare Bauten aufgekauft hatten, um darin, unbeachtet und ungestört von der Öffentlichkeit offenbar ihr eigenes Süppchen zu kochen. Die Illuminaten hatten sich über zweieinhalb Jahrzehnte von der Außenwelt abgeschottet und waren immer nur dann in Erscheinung getreten, wenn es nötig wurde, um ihren Einflussbereich zu erweitern.
Die Regierungen der Staaten hatten dabei tatenlos zugesehen. Aus einem Grund, der Schillers Blut in Wallung brachte. Weil die Politiker und ihre Exekutiven längst vor dem kapituliert hatten, was sich vor ihrer Haustür abspielte. Die schleichend entstandenen Parallelgesellschaften innerhalb sämtlicher Staatsgrenzen hatten zum Zeitpunkt des Virus-Ausbruchs schon so viel Macht auf sich gebündelt, dass ein gewaltsames Vorgehen gegen sie völlig utopisch gewesen wäre.
Die Regierungen der meisten Länder hatten nur noch auf dem Papier existiert. Die wahre Macht im Staate war von zwielichtigen Strukturen wie den Kalifaten in westeuropäischen Großstädten ausgeübt worden – oder eben jener World Templar Organization, die sich nun, nach der Katastrophe, immer stärker in den Fokus der Überlebenden rückte.
»Meine Befehle?« Schiller fasste seine Ordonanz scharf ins Auge. »Rufen Sie Faller zu mir. Ich brauche eigene Informationen – nicht nur das, was diese obskuren Samariter uns auftischen.«
»Faller, Herr General, ich kümmere mich darum.« Lehning salutierte, machte auf dem Absatz kehrt und verschwand aus der Tür.
Friedrich Schiller sah ihm nach und hatte den Anflug einer Ahnung, wie die Dinosaurier vor 65 Millionen Jahren sich gefühlt haben mochten – nach dem Einschlag des Meteoriten, als sich schon absehen ließ, dass ihre Tage gezählt und die Welt nie mehr »ihre« sein würde.
†
Wenige Stunden später
Schiller verengte die Augen und rutschte näher an die Monitor-Phalanx heran, über die er mit seinem engsten Stab den Außeneinsatz verfolgte.
Oberstleutnant Martin Faller, der den Trupp befehligte, war einer seiner besten Männer. Fallers Vater hatte mehrere Auszeichnungen während der Hungeraufstände erhalten, und offenbar war sein Können an den Sohn vererbt worden. Selbst in höchster Gefahr und einer scheinbar ausweglosen Situation behielt Faller einen kühlen Kopf. Das hatte er nicht nur in zahllosen Kampfsimulationen, sondern – und darauf kam es letztlich an – auch in mehreren realen Kampfeinsätzen in Krisengebieten bewiesen.
Auf Faller war also Verlass, und da der Oberstleutnant die Mitglieder seines Erkundungstrupps handverlesen hatte, konnte Schiller davon ausgehen, dass auch auf sie Verlass war.
Der General leckte sich halbwegs zufrieden über die Lippen. Als sich das äußere Schleusenschott öffnete, schaltete er auf die Helmkamera des Oberstleutnants, der an der Spitze seiner Männer ins Freie trat.
Jeder einzelne Missionsteilnehmer war mit einer Kamera ausgestattet, auf die Schiller von seinem Regiepult in der Bunkerzentrale aus Zugriff hatte. Das Videosystem war so regelbar, dass Schiller entweder in dieselbe Richtung blickte, in die auch der Kameraträger sein Gesicht gewandt hatte, oder die Kameras ließen sich schwenken. Ein spezielles Programm lieferte bei Bedarf sogar eine Rundumsicht, die via Rechner aufbereitet und als Panoramabild auf die Mattscheiben projiziert wurde.
Es gab immer Situationen, in denen das eine sinnvolle Option war.
Schiller blieb zunächst auf der konventionellen Einstellung, die ihm das zeigte, was auch Faller zeitgleich ins Auge fasste, und das war das Militärgelände mit seinen vereinzelten Erhebungen, den Hangars für den Fahrzeugpark beispielsweise. Andere Hügel verbargen die Abschussvorrichtungen, der unterirdisch gelagerten Nuklearraketen.
Geradeaus war das Tor zu sehen, das jeder passieren musste, wenn er das umzäunte Gelände betreten oder verlassen wollte. Eine asphaltierte Straße, breit genug selbst für Schwertransporte, führte zum Tor, das rechts und links von zwei Würfelbauten flankiert wurde, die aus der Ferne wie Pförtnerhäuschen aussahen.
Neben den Häuschen – Schiller brauchte nur auf die entsprechende fest montierte Kamera im Torbereich umzuschalten, um das Bild heranzuzoomen – lag einer der Soldaten, der zum Zeitpunkt des Virusausbruchs Wachdienst verrichtet hatte. Er hatte kaum noch Fleisch auf den Rippen. Seine Kleidung war so achtlos zerfetzt, als hätte ein ungeduldiges Geburtstagskind die Verpackung eines Geschenks auseinander gerissen.
Schiller war ein abgehärteter Militär, der viele übel zugerichtete Leichen gesehen hatte. Die schlimmsten Fälle waren seiner Erfahrung nach Opfer von Tretminen oder Selbstmordattentätern, und in beiden Fällen war Sprengstoff der Verursacher hochgradiger Verstümmelung gewesen. Hier jedoch ...
Schiller merkte, wie sich sein Magen zu einem kalten Klumpen zusammenzog.
Hier jedoch hatten die eigenen Kameraden, die mit Wache geschoben hatten, dem Bedauernswerten all das zugefügt.
Schiller wusste nicht, wie oft er sich die Aufzeichnung der Torkameras angesehen hatte, obwohl es ihn größte Überwindung gekostet hatte. Aber der bestialische Akt hatte ihm keine andere Wahl gelassen, als ihn sich immer und immer wieder zuzumuten. Er hatte gehofft, irgendwann begreifen zu können, was die völlig entfesselten Soldaten getan hatten – aber letztlich hatte er sich nur tiefe seelische Verletzungen zugefügt.
Es gab keine rationale Erklärung für das Schlachtfest, das die Torwachen an einem der Ihren zelebriert hatten in jener Nacht, als sich die ganze Welt veränderte. Zu dritt waren sie über den vierten hergefallen und hatten ihm bei lebendigem Leib mit ihren Zähnen Fleischbatzen aus dem Körper gerissen. Aus Wange, Hals, Bauch, Armen, Beinen ...
Schiller versuchte den Schauder, der ihn überrollen wollte, zu unterdrücken.
Drei seiner Soldaten, die bis dato niemals auffällig geworden waren, hatten während der schicksalshaften Nachtwache ihren Kameraden wie Raubtiere zerfleischt. Nicht genug damit, hatten sie an ihm gefressen