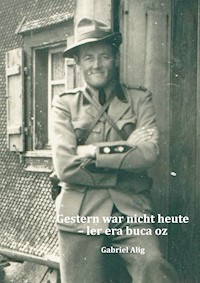
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Die Lebenserinnerungen von Gabriel Alig, geboren 1925, bieten ein wertvolles und seltenes Zeugnis eines ausserordentlichen und dennoch für seine Generation exemplarischen Lebenslaufs. So entsteht ein lebendiges Bild der Entwicklungen und des tiefgreifenden Wandels unserer Gesellschaft von der Zwischenkriegszeit im 20. Jahrhundert bis in die Gegenwart.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 287
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Vrin
Lebensmittel – Mittel zum Überleben
Kleider
Feiertage
Arbeiten im Dorf
Wollverarbeitung
Gemeinschaftliches Brotbacken
Hausmetzgete
Politik und gemeinschaftliche Pflichten
Kultur
Verkehr
Landwirtschaft
Telefon- und Wasseranschluss
Wohnverhältnisse und medizinische Versorgung
Kindheit, Vorschul- und Schulzeit
Exkurs: 16 Personen, 16 verschiedene Schicksale
Die Kriegsjahre
Rekrutenschule
Grenzwache
Liestal und Andermatt
Brusio – Puschlav
Liestal: Wiederholungskurs
Brusio: Zweiter Aufenthalt
Bernina Suot – Berninapass
St. Margrethen – Rheintal
Bernina Suot: Zweiter Aufenthalt
Campocologno
Jufplaun – Ofenpass
Umbrail
La Drossa – Ofenpassstrasse
Jufplaun: Zweiter Aufenthalt
Riehen – Basel
Boncourt – Jura
Steg – Fürstentum Liechtenstein
Oberriet – Rheintal
Santa Maria – Münstertal
Rheineck – Rheintal
Chur
Ausrüstung der Grenzwacht
Skiausrüstung der Grenzwächter
Sport
Schiessen
Bergsteigen und Wandern
Einige besondere Erlebnisse in den Bergen
Val Roseg, August 1951
Greina und Lukmanier, zwischen 1970 und 1980
Posta Biala
Camona Cavardiras
Sentiero Alpino
Jagd
Jagdausrüstung
Familie
Eheschliessung
Finanzielles
Ferien
Puschlav
Motorisierung
Bauen im Unterland und in Vrin
Appenzell und St. Gallen
Vrin
Unser Haus in Vrin
Lesen und Schreiben
Diverses und Beendigung
Ruhestand
Anhang 1:
Carli pign va giul Schuob – da Gabriel Alig, Vrin
Anhang 2:
Péz Territour 14.9.2021
Jeder Mensch wird tagtäglich mit Erlebnissen konfrontiert, die in seinem Gehirn registriert werden. Im Verlauf seines Lebens sammelt sich ein Teil dieser Erlebnisse als Langzeiterinnerungen an, die zu einem späteren Zeitpunkt abgerufen werden können. Daraus entsteht ein Mosaik, das bei jedem Individuum ein anderes Bild ergibt. Ich habe versucht, die in meinem Gedächtnis erhaltenen Erinnerungen Revue passieren zu lassen und sie nachfolgend in Schriftform festzuhalten. Als ich diesen Versuch wagte, war ich mir bewusst, dass es sich nicht um weltbewegende Begebenheiten handelt, sondern vielmehr darum ging, das alltägliche Leben eines Normalbürgers skizzenhaft aufzuzeigen.
Einleitung
Bevor ich mich in Details vertiefe, möchte ich mich in aller Kürze vorstellen. Geboren wurde ich 1925 als ältester Sohn in einer neunköpfigen Familie in Vrin, Graubünden. Meine Eltern betrieben einen kleinen Bergbauern-Betrieb, was damals eine sehr schmale Existenzgrundlage bedeutete. In Vrin besuchte ich die romanische Volksschule. Anschliessend war ich bis zum 20. Lebensjahr als Bauernknecht, Alphirt und Bauarbeiter tätig. Mit dem Lohn für diese Tätigkeiten unterstützte ich meine Angehörigen zu Hause. Im Sommer 1945 absolvierte ich in Chur die militärische Rekrutenschule. Kurz darauf vernahm ich per Zufall, dass die Zollverwaltung junge Leute suchte, die bereit waren, die Ausbildung als Grenzwächter zu absolvieren. Ich bewarb mich dafür und konnte Mitte August 1946 in Liestal diese Ausbildung beginnen. Es folgten 37 Jahre Grenzwachtdienst an der Süd- und Ostgrenze. Diesen hängte ich noch sechs Jahre Bürodienst an und wurde 1989 pensioniert. 1957 habe ich geheiratet. Uns wurden drei Söhne und vier Töchter geschenkt. Seit der Pensionierung lebe ich mit meiner Frau Käthi abwechslungsweise in Vrin und in Chur. Als naturverbundener Mensch bin ich sowohl im Sommer wie auch im Winter viel in den Bergen unterwegs. Während rund 50 Jahren übte ich die Bündner Hochjagd aus. Daneben habe ich intensiv Schiesssport betrieben. Kurz vor meiner Pensionierung wurde ich Imker, ein Hobby, das mir viel Befriedigung und Begeisterung bietet.
Der nachfolgende Erlebnisbericht ist ein Auszug aus einem längeren Text, den ich für meine Familie nach der Pensionierung verfasst hatte.
Vrin
Vrin ist ein Bergdorf wie viele andere in der Schweiz. Als Ausgangspunkt zur Greina-Hochebene, in Richtung Tessin, hat es im Zusammenhang mit den Bestrebungen, die Greinaebene unter Wasser zu setzen, einen grösseren Bekanntheitsgrad erlangt. Umweltorganisationen haben mit Erfolg den Bau eines Stausees bekämpft und die Verwirklichung eines Naturschutzgebietes erreicht. Vrin und Sumvitg werden als Territorialgemeinden für den Verzicht auf eine Wasserkraftnutzung mit einer jährlichen Geldsumme aus der Bundeskasse entschädigt. Dank diesem Bundesbeitrag kann sich die Gemeinde Vrin - inzwischen Lugnez - finanziell aus eigener Kraft über Wasser halten. Bis zu diesem Zeitpunkt war sie vom Gemeinden-Finanzausgleich abhängig.
Schaue ich zurück auf meine Kindheit, so herrschten gemeindeintern ganz andere Verhältnisse als heute. Jede Gemeinde, ob gross oder klein, ob arm oder reich, war auf sich selber angewiesen. Besonders die Berggemeinden hatten finanziell einen schweren Stand. Die Bevölkerung, vorwiegend Bergbauern, war arm. Die Familien waren, mit wenigen Ausnahmen, kinderreich. Einnahmen flossen sehr spärlich. An substanzielle Steuereinnahmen war nicht zu denken und die Schullehrer mussten für ihren Halbjahreseinsatz vom Kanton besoldet werden. Bereits der Unterhalt der Schulgebäude war für die finanzschwachen Berggemeinden eine starke Belastung. Die damaligen Familienhaushalte umfassten fast schon regelmässig drei Generationen. Da zu meiner Kinderzeit in Vrin Landwirtschaft die Hauptbetätigung der Bevölkerung war und Selbstversorgung zum Alltag gehörte, fand jede arbeitsfähige Person, ob jung oder alt, eine ihrer Leistungskraft entsprechende Aufgabe. Die jüngere Generation profitierte von der praktischen Erfahrung ihrer älteren Familienangehörigen. Da sämtliche anfallenden Arbeiten, sei es zu Hause oder auf dem Feld, manuell verrichtet werden mussten, war man darauf angewiesen, mit der eigenen Körperkraft rationell und überlegt umzugehen.
Eine Altersversicherung oder eine Pensionsberechtigung kannte man nur beim Staatspersonal, und von Bargeldersparnissen konnte nur geträumt werden. Infolgedessen war die alte Generation darauf angewiesen, ihren Lebensunterhalt aus dem eigenen Betrieb zu schöpfen. In der Regel wohnte ein verheirateter Sohn oder eine verheiratete Tochter mit der Familie in der gleichen Wohnung wie ihre Eltern. Abgesehen von dringenden Spitalaufenthalten blieb die ältere Generation bis zum Ableben in ihrem angestammten Familienkreis. Je nach Verlauf dieser Lebensphase kann langwierige, anhaltende Pflegebedürftigkeit nicht ausgeschlossen werden. In solchen Fällen machte sich die meist primitive Hauseinrichtung in negativem Sinn bemerkbar. Platzmangel, kein Anschluss für fliessendes Wasser, weder Bad noch Dusche, die Toilette ausserhalb des Hauses und steile Treppen zu den Schlafgemächern erschwerten die Betreuung der Pflegebedürftigen. Im äussersten Notfall stellte man das Krankenbett in der Stube auf.
Was passierte mit denjenigen Personen, die arbeitslos waren, gleich aus welchem Grund arbeitsunfähig und über keine eigenen finanziellen Mittel für ihren Lebensunterhalt verfügten? In solchen Fällen war es Aufgabe der Bürgergemeinde einzuspringen. Diese war damals für ihre Mitbürger, gleich wo sie wohnten, unterhaltspflichtig. Vrin hat nie ein Bürgerheim besessen; also mussten andere Lösungen in Betracht gezogen werden. Wo sollten bei einer mausarmen Berggemeinde, die praktisch keine Steuereinnahmen ausweisen konnte, die benötigten finanziellen Mittel hergeholt werden? Eine prekäre Lage, die auch die hilfsbedürftigen Personen zu spüren bekamen. Vrin besass in der Fraktion Ligiazun ein altes Haus, das seinerzeit von einer nach Mailand ausgewanderten Familie der Kirchgemeinde vermacht worden war. Sofern es sich um unterstützungsberechtigte Familien handelte, wurden diese dort einquartiert. Einzelpersonen in gleicher Situation versuchte man bei Verwandten unterzubringen, wer aber auf Wohltätigkeit angewiesen war, musste schmal durch; wie konnte man etwas anderes erwarten? Unterstützungsberechtigte Männer waren froh, wenn sie sich mit Holzspalten oder derlei Arbeiten eine kleine Mahlzeit verdienen konnten. Frauen versuchten es mit Sockenstricken und hatten Glück, wenn sie als Entgelt eine Schnitte Brot oder zwei Eier erhielten. Da in einem Bergdorf jeder jeden kennt, blieben die Betroffenen vor Reaktionen nicht verschont. Diese waren nicht immer wohlwollend, ja man degradierte solche Arbeiten zu Gaunereien und betrachtete die Hilfsbedürftigkeit als Schande.
Zu meiner Schulzeit wurde das Gemeinde-Armenwesen meinem Vater übertragen. Eine Gemeindekanzlei gab es nicht. Im Auftrag der Bürgergemeinde Vrin musste er sämtliche Unterstützungsgesuche, die eingingen, überprüfen und erledigen. Öfters waren es auswärts wohnende Personen, die ihren Bürgerort nur vom Namen her kannten. In solchen Fällen waren meinem Vater die Hände gebunden. Die Wohnsitzgemeinden der Bezugsberechtigten stellten Rechnung für ihre Auslagen und die Bürgergemeinde musste diese zähneknirschend akzeptieren und begleichen. In manchen Fällen versuchte man, die bezugsberechtigte Person dazu zu bewegen, den Wohnsitz nach Vrin zu verlegen, wodurch dort kostengünstigere Lösungen verfügbar gewesen wären. Dass sich die Betroffenen, je nach Verbindung zur Bürgergemeinde, gegen solche Ansinnen mit Händen und Füssen wehrten, ist gut begreiflich. Später wurde das Armenwesen eidgenössisch und kantonal neu geregelt und die Aufgabe der Bürgergemeinden hinsichtlich dieser Last entscheidend erleichtert.
Wie bereits oben erwähnt, wuchs ich mit sechs Geschwistern auf. Als Wohnraum stand uns ein halbes Haus, bestehend aus zwei Kellern, einer Stube, einer Küche, zwei Schlafzimmern und einem Estrich, zur Verfügung. Badezimmer gab es keines, die Toilette befand sich ausserhalb des Hauses und das Wasser musste am Dorfbrunnen geholt werden. Ebenfalls kannte Vrin bis 1948 keine Stromversorgung. Für die Beleuchtung von Wohnung und Stall standen vorwiegend Petrollampen zur Verfügung. Der grösste Teil der älteren Häuser in Vrin besteht bis auf die Keller- und Küchenmauern aus einer gestrickten Holzkonstruktion und weist grundsätzlich einen einheitlichen Grundriss auf. Mehrheitlich wurden sie, vermutlich aus finanziellen und aus Platzgründen, jeweils für zwei Familien konstruiert und beim Giebel senkrecht unterteilt, so dass jede Partei vom Keller bis zum Estrich über die Räume verfügte. Die Dächer bestanden aus Steinplatten, die in der näheren Umgebung abgebaut wurden. Unsere Stube diente, besonders im Winter, als wichtigster Aufenthaltsraum. Ursprünglich waren vier Fenster vorhanden. Irgendwann wurde das Fenster an der Westseite zugemacht. Die übrigen drei waren gegen den sonnigen Süden gerichtet. Der Boden bestand aus gewöhnlichen, gehobelten breiten Holzbrettern, die mit der Zeit von den genagelten Schuhen stark strapaziert wurden. An den langen Winterabenden trugen wir in der Stube die damals sehr bekannten blauen Finken. Für Wände und Decke wurden mit Nuten veredelte Holztäfer verwendet, natürlich alles präzise Handarbeit. Einzig eine Ecke war mit gewöhnlichen, breiten Brettern ausgestattet. An dieser Stelle wurde seinerzeit ein grosses Doppelbett, direkt mit der Wand verbunden, eingebaut. Dieses Bett war für Kranke, alte Leute und für Frauen im Kindbett bestimmt. In unserer Stube wurde dieses Bett zuletzt für einen kranken Onkel meines Vaters bis zu dessen Tod verwendet, nachher liess es der Vater verschwinden. Aber die nackte Ecke blieb als Zeugin von diesem Krankenpflege-System von dazumal erhalten.
Elternhaus 1935
Die Kälteisolation des Raumes war alles anders als ideal. Besonders der einfache Holzboden oberhalb der kalten Keller isolierte extrem schlecht. Nicht besser sah es bei den einfach verglasten Fenstern aus, die bei sehr tiefen Temperaturen am Morgen im Rauminnern mit einer Eisschicht überzogen waren. In der Ecke der Stube an den Trennwänden zum Gang und zum anderen Wohnteil hin stand ein prächtiger, quadratischer Specksteinofen mit einer Grösse von ca. einem Meter. Im Hochwinter bei klirrender Kälte war der Ofen ein begehrtes Objekt. Gross und Klein sehnte sich inbrünstig nach seiner angenehmen Wärme und an den langen Winterabenden verbrachten wir Buben die Zeit stundenlang direkt auf der warmen Ofenplatte. Die Möbel bestanden aus massiver Fichte, Einzelteile auch aus Hartholz, und wurden ausschliesslich von einheimischen Handwerkern hergestellt. Fabrikmöbel waren unbekannt. Viel Wert wurde auf sich gut präsentierende Stubenmöbel gelegt. Kunstvolle Schnitzereien veredelten beispielsweise die Stubenbüfetts. Auch kunstvoll mit Schnitzereien präparierte Stabellen waren keine Seltenheit. Direkt mit der Wand verbunden, stand jeweils rechts oder links von der Eingangstüre das Büfett. Dieses war der Grösse des Raumes angepasst und füllte diesen von der Türe bis zur Aussenwand aus. Obwohl nur aus gewöhnlichem Tannenholz konstruiert, war es ein Meisterstück. Eine grosse Eckbank, die an zwei zum Teil noch freien Wandseiten gelegen war, bot viel Sitz- und Abstellplatz. Als bewegliche Möbelstücke waren eine Kombination aus Kommode und Schreibpult, ein Tisch und zwei Stühle im Raum zu finden. Neben dem Ofen war öfters ein Klapptisch fest an die Wand montiert, der je nach Bedarf einsatzbereit oder sonst platzsparend an die Wand geklappt war. Zur obligaten Ausrüstung einer Vriner Stube gehörten unter anderem ein an der Wand befestigtes Kruzifix, ein Weihwasserbehälter neben dem Eingang, eine Petrollampe, ein oder auch mehrere Heiligenbilder und das obligate Büchergestell oberhalb der Eingangstüre, das für die zahlreichen Kirchenbücher im Taschenformat reserviert war. Irgendwo hing an einem Nagel der traditionelle „Calender Romontsch“, der als Kassabuch und für sonstige Notizen aller Art herhalten musste. Der Querbalken, Träger der Decke, diente auch als Depot für die spärlichen Zeitungen. Im Sommer wurde die Stube sehr wenig bewohnt, sie diente vielmehr, wegen des kalten Ofens, als Kühlraum für empfindliche Lebensmittel.
Nicht weniger wichtig als die Stube war die Küche. Besonders beim Bergbauern hatte diese noch zusätzliche Aufgaben zu erfüllen. Im Stall befanden sich Schweine und Hühner, die ihre Mahlzeiten grösstenteils von der Küche geliefert erhielten. Ich kann mich noch vage an unsere alte Küche erinnern. Es war ein rauchgeschwärzter, dunkler, schlecht isolierter Raum mit einem einzigen Fenster. Ein einfacher alter Holzkochherd ohne Bratofen stand mitten im Raum, auf einem Steinsockel platziert. Fliessendes Wasser gab es keines, und einen Schüttstein noch weniger. In einer Ecke stand, umzäunt von einer Eckbank, der Küchentisch, daneben ein kleiner Vorratstrog aus Holz, den mein Vater fabriziert hatte. Als Abstellplatz für das spärlich vorhandene Geschirr dienten einige Wandgestelle. Wir Kinder assen und tranken aus Aluminiumtellern und -tassen. Im Winter war die Küche oft eiskalt, und für die Mutter war es kein Vergnügen, dort zu arbeiten. Es ging nicht lange und die Küche wurde erneuert. Ein neuer Kochherd, natürlich nur für Holz, und ein zweites Fenster waren die wesentlichen Verbesserungen gegenüber vorher. Kurz vor meinem 20. Altersjahr leistete ich mit der Herstellung eines Küchenschrankes auch einen kleinen Beitrag an die Möblierung dieser Küche. Zu diesem Zeitpunkt wurde in Vrin ein dreiwöchiger Schreinerkurs für junge Bauern durchgeführt. Dabei lernten wir den Umgang mit Schreinerwerkzeug und die Herstellung einfacher Holzgegenstände. Sämtliche Arbeiten mussten von Hand verrichtet werden. Von den in diesem Kurs gewonnen Grundkenntnissen profitierte ich noch in meinem späteren Leben.
Vrin damals
Vrin heute
Abtransport von erwischter Schmuggelware, Zigaretten (Remita 1947) zu S. → ff.
Besuch von Tourenfahrern beim Grenzwachtposten Jufplaun im Spätwinter 1953 zu S. → ff.
Lebensmittel – Mittel zum Überleben
Welche Lebensmittel standen um 1935 unserer Mutter zur Verfügung und wie wurden die Mahlzeiten zubereitet? Wir waren neun Personen am Tisch, davon sieben Kinder, die immer einen guten Appetit hatten. Die von Hand verrichtete Feldarbeit erforderte eine Vielzahl an Kalorien. Der Betrieb eines kleinen Bergbauern warf damals jährlich höchstens 2000.- Franken an Bargeld ab. Von diesem Betrag mussten Ausgaben für Kleider, Schuhe und andere kleine Anschaffungen sowie für Arztrechnungen abgezogen werden. Was übrig blieb, sollte für Lebensmittel für die ganze Familie reichen. Obwohl die Preise im Vergleich zu heute viel niedriger waren, musste jeder Räppler zweimal umgedreht werden. Dies war auch ein Grund dafür, dass der Vater unter anderem unsere Schuhe selber reparierte, indem er Nägel einschlug, und uns Knaben auch die Haare schnitt. Als Bauer war Selbstversorgung ein wesentlicher Punkt, um die Finanzen gewissermassen im Griff zu haben. Milch, Milchprodukte, Fleisch, Kartoffeln, Getreide und Gemüse lieferte der eigene Betrieb. Für den Obstbau ist das Klima von Vrin nicht geeignet, deswegen waren wir froh, dass im Winter in den Schulen von auswärts geliefertes Gratisobst abgegeben wurde. Ein kleiner Garten in Hausnähe lieferte Rüben, Reben und Mangold. Alles wurde gekocht. Mit dem Mangold wurden die bekannten Bündner Capuns hergestellt. Dazu benötigt man einen Mehlteig und frischen Mangold. Eine Teigkugel wird in einem Mangoldblatt eingewickelt und dann eine Weile in Wasser gekocht. Diese Speise schmeckte mir gar nicht, aber trotzdem wurde ich gezwungen davon zu essen. Die übrigen notwendigen Lebensmittel mussten im Laden «gepostet» (eingekauft) werden. Ein sogenannter Zuckerhut musste für ein ganzes Jahr genügen. Konfitüre, Marmelade oder Honig kam bei uns nie auf den Tisch. Als flüssige Nahrung kannten wir: Suppen, Milch, Kaffee, warmes Wasser mit ein wenig Milch vermischt und das Restwasser von gekochten Teigwaren.
Das Frühstück, das Mittagessen, der Zvieri und das Nachtessen waren unsere täglichen Mahlzeiten. Am Morgen kam regelmässig eine warme Mahlzeit auf den Tisch. Trumpf war eine feste, in einer Kupferpfanne gekochte Polenta, wobei am Schluss ein Würfel Butter dazu gehörte. Gekocht wurde immer auf einer Holzfeuerung. Zur Abwechslung gab es Rösti oder Mehlmus. Zudem kamen Brot, Käse und öfters getrocknetes Fleisch oder eigene Wurstwaren auf den Tisch. Die Hauptmahlzeit des Tages gab es am Mittag. Makkaroni, Polenta, Knödel, Pizokel oder Reis – selten auch Spaghetti – kamen auf den Tisch. Als Beigaben dienten bei den Makkaroni und Pizockeln ungefähr ein Drittel mitgesottene Kartoffelwürfel, geriebener Zieger und am Schluss goss man etwas geschmolzene Butter darüber. Nebst normal mit Wasser gekochtem Reis (Risotto) gab es zur Abwechslung Milchreis, was uns Kindern besonders schmeckte. Die Pizokel (Knöpfli) wurden mit einem Messer aus Holz von einem kleinen Holzbrett weg portionenweise in das siedende Wasser gegeben. Manchmal landeten ziemlich grosse Brocken in der Pfanne. Sehr begehrt waren die im Fett zubereiteten Speisen wie Omeletten oder Bündner Tatsch. Leider kamen solche Gerichte wöchentlich höchstens einmal auf den Tisch. Maluns, ein weiteres bekanntes Bündner Gericht, gab es bei unserer Mutter nie. Und auch Fleisch kam am Mittag unter der Woche nie auf den Tisch. Der Zvieri wurde im Verlauf des späteren Nachmittags, vor Aufnahme der Stallarbeit, aufgetischt und bestand aus Kaffee, Brot, Käse, Butter und Trockenfleisch, sofern noch vorrätig. Die letzte Mahlzeit, das Nachtessen, gab es bei uns das ganze Jahr hindurch erst gegen 20 Uhr und war leicht verdaulich. Vorherrschend war Mehlsuppe, wobei Weissmehl braun geröstet wurde und dann mit Wasser abgelöscht. Weil mit Fett beziehungsweise Öl sehr sparsam umgegangen wurde, bestand die Gefahr, dass das Mehl anbrannte, was natürlich einen unerfreulichen Geschmack hinterliess. Diese Suppe war bei mir gar nicht beliebt. Lieber war mir eine gute Minestra, die Kartoffeln, Gerste und gelegentlich auch eine kleine Portion Teigwaren enthielt. Ausnahmen von den täglichen Kochrezepten bildeten Sonnund Feiertage: dann durfte das Mittagessen ein wenig auf Feststimmung hindeuten. In einem grösseren, halbvoll mit Wasser gefüllten Kochtopf wurden einige luftgetrocknete Fleischbrocken und Würste aus der Fleischkammer zusammen mit Polentabrocken (Amplius), Kartoffeln, Gerste und gelegentlich Hülsenfrüchten, Rüben und Räben einige Stunden lang auf leichtem Feuer gekocht. Diese Mischung ergab eine beliebte, schmackhafte Mahlzeit.
Plastikgeschirr gab es damals noch nicht, hingegen waren Aluminiumteller und -tassen für die kleineren Kinder üblich. Teller kamen nur bei flüssigen Mahlzeiten auf den Tisch, sonst assen alle direkt aus einer grossen Schüssel. Wollte man nicht mit Hunger vom Tisch gehen, galt es zuzupacken. An Appetit fehlte es bei niemandem und alle griffen kräftig zu. Wenn wir Glück hatten, gab es im Verlauf des Winters eine kleine Menge an getrockneten Kastanien. Roh schmeckten sie mir ordentlich, gekocht hingegen gar nicht. Überhaupt: Bezüglich des Essens war ich als Kind ziemlich heikel.
Im Verlauf des Monats Juli wird in Vrin das Kirchenpatronsfest (romanisch: Perdanonza) gefeiert, ein besonderer Festtag mit Besuch von auswärtigen Verwandten und Bekannten. An diesem Tag war man mit der Mahlzeit jeweils nicht knauserig. Frisches Fleisch von einem frisch gemetzgten Tier oder aus dem Einmachglas ersetzte das übliche Trockenfleisch. Dazu gehörten auch aufgeweichte Dörrzwetschgen oder etwas Ähnliches. Natürlich durfte ein gutes Glas Wein nicht fehlen. Gäste, die erst nach Beendigung der Hauptmahlzeit eintrafen, wurden mit Kaffee und Kuchen bedient. Wie viele andere alte Bräuche leidet auch die Perdanonza unter der schnelllebigen heutigen Zeit. Man ist motorisiert, wird durch allerlei Veranstaltungen abgelenkt, die Distanz und der persönliche Kontakt spielen sich in anderen Dimensionen ab als früher.
Vater Rest Giusep, 1897-1961
Mutter Onna Turtè, 1896-1982
Woher bezogen unsere Eltern die Lebensmittel und unter welchen Bedingungen? Polenta, Reis und Mehl kauften wir in 50 kg-Säcken. Teigwaren waren in Holzkisten verpackt und Kochfett gab es in 10 kg-Kesseln. Kiloweise abgepackte Lebensmittel waren damals auf dem Markt nicht üblich. Solche Esswaren bezog man offen und sie wurden von Fall zu Fall abgewogen. Unser Lebensmittellieferant wohnte in Vella, 12 Kilometer von Vrin entfernt. Den Warentransport besorgte unser Nachbar, der mit seinem Pferd die Route wöchentlich ein bis zweimal abklopfte. Unser Fuhrmann wohnte im gleichen Haus wie wir. Wenn eine Bestellung fällig war, wurde ihm dies mündlich mitgeteilt, und man konnte sich darauf verlassen, dass die Lieferung korrekt und pünktlich ausgeführt wurde. Gleichzeitig bediente er noch weitere Kunden. Das oben genannte Lebensmittelgeschäft belieferte Kunden aus der ganzen Talschaft. Das besondere bei diesem Lieferanten war, dass er bereit war, grosszügig Waren auf Kredit zu liefern, was in erster Linie Kunden mit einer grossen Kinderschar zugute kam. Einer von diesen war unser Vater. Was sollte man sonst tun?
Obwohl unsere Eltern arbeitsam und sparsam waren, genügte das Einkommen nicht, um die auflaufenden Rechnungen zu begleichen. Wollte man die Kinder nicht verhungern lassen, musste man froh sein, auf Kredit einkaufen zu können. Einmal jährlich, im Verlauf des Herbstes, suchte der Geschäftsführer die Familien auf, welche bei ihm Schulden hatten, und bemühte sich, den möglichen Betrag einzukassieren. Konnte die bestehende Schuld nicht ganz abgetragen werden, wurde der Rest auf die neue Rechnung übertragen. Dieser Betrag musste von nun an verzinst zurückgezahlt werden. Je nach Familienentwicklung vergingen Jahre, bis die Nachkommen selber Geld verdienen und ihren Beitrag zur Schuldentilgung leisten konnten. Der Ladeninhaber ging gewiss mit der Kreditvergabe ein entsprechendes Risiko ein und vermutlich musste er auch Abstriche in Kauf nehmen. Aber die Familien waren für das ihnen entgegengebrachte Vertrauen dankbar und bemühten sich der Aufgabe auch bestmöglich gerecht zu werden. Sicher war jeder Familienvater froh und dankbar, wenn die Jungen einen Beitrag bei der Schuldtilgung leisteten, denn diese Belastung bereitete ihm bestimmt manche schlaflose Nacht. Die beschriebene Schuldenlast war auch ein Grund, warum ein grosser Teil der Schulentlassenen keine Möglichkeit hatte, eine Lehre zu absolvieren oder weitere Schulen zu besuchen. Die finanzielle Abhängigkeit war zu gross.
Während des 2. Weltkrieges war ein grosser Teil der Lebensmittel rationiert. Monatlich wurde für jede Person eine Lebensmittelkarte abgegeben, welche diese zum Bezug einer bestimmten Menge der verschiedenen Lebensmittel berechtigte. Grössere Familien erhielten, trotz der Eigenversorgung, auch Marken für Fleisch. Da die wenigsten es sich leisten konnten, Fleischprodukte zuzukaufen, waren diese Marken überflüssig. Diese Gelegenheit benützte der Talarzt, ein Tessiner, der bei jedem Krankenbesuch im Haus als erstes nach Fleischmarken fragte und sie auch erhielt. So konnte er seine Fleischbedürfnisse auf einfache Art stillen.
Kleider
Wie sah die Bekleidung der Bergbevölkerung, der Bergbauernfamilien um 1930-40 aus? Erstens gilt es Sonntags- und Werktagskleider voneinander zu unterscheiden. An Sonn- und Feiertagen legte man grossen Wert darauf, saubere, gepflegte, nicht abgenützte Kleidungsstücke zu tragen. Dies galt auch für die Unterwäsche. An Werktagen, also an Arbeitstagen, war man nicht wählerisch; so ziemlich alles war gut genug. Schnitt und Konfektion waren Nebensache. Ebenfalls störte es niemanden, wenn beispielsweise die Arbeitshosen mit verschiedenen Flicken dekoriert waren.
Ein Teil der getragenen Kleider wurde von einheimischen Schneiderinnen angefertigt, die meistens bei der Mutter oder einer Tante in den Genuss einer rudimentären Ausbildung gelangten. Den Hosen- oder Hemdenstoff kaufte man meterweise im Laden oder bei einer Hausiererin ein. Wurde ein elegantes Hochzeitskleid oder ähnliches benötigt, fand man einen zuverlässigen Anfertiger und Lieferanten in der Tuchfabrik Trun. Deren Vertreter suchten periodisch die einheimischen Haushaltungen auf und nahmen Bestellungen entgegen. Die gewünschten Kleidungsstücke wurden masskonfektioniert geliefert. (Mit Ausnahme von Zellulosefasern gab es noch kein synthetisches Gewebe.)
Die wichtigsten Kleidungsstücke für Männer und Knaben waren: Hosen, Tschopen (Jackett), Weste und in der kühleren Jahreszeit Pullover. Als Kopfbedeckung dienten der Hut oder die Mütze. Diese wurden im Freien, sonntags und werktags, immer getragen. Als Regenschutz, beispielsweise für Hirten, trug man einen Lodenmantel. In männlichen Kreisen gelangten nur die hohen Schuhe mit lederner Sohle zum Einsatz. Die Werktagsschuhe waren mit Nägeln beschlagen. Um deren Lebensdauer zu verlängern, wurden sie vom Dorfschuhmacher oder auch privat bis zum Gehtnichtmehr wieder instand gestellt. Bei den Frauen war das Tragen langer Hosen damals noch kein Thema. Bei den Jüngeren waren die halblangen Röcke üblich, Ältere bevorzugten Röcke, die annähernd bis zum Boden reichten. Ein wichtiges Kleidungsstück, das an Werktagen besonders von den erwachsenen Frauen ohne Ausnahme getragen wurde, war die Schürze. Das gleiche galt für das Kopftuch. Dieses wurde ausser Haus regelmässig bei jedem Wetter, ob im Sommer oder Winter, getragen; es schützte vor Wärme und Kälte. Einzig an Sonn- und Feiertagen, besonders für den Gottesdienst, war der Hut üblich. Als Hüte kamen je nach Tradition verschiedene, teilweise kunstvolle Kopfbedeckungen als Alternative zum Einsatz. Ein besonderes Kapitel waren die Damenstrümpfe. Genau zu meiner Bubenzeit kamen die ersten Seidenstümpfe auf den Markt. Diese konkurrenzierten die bisherigen aus Schafwolle. Den kirchlichen Instanzen waren die durchsichtigen Seidenstrümpfe ein Dorn im Auge. Deren Aufkommen wurde, mit teilweisem Erfolg, aus diesen Kreisen damals mit aller Vehemenz bekämpft.
Feiertage
Da man in Vrin vorwiegend von der Landwirtschaft lebte, galt es, mit wenigen Ausnahmen sonn- und werktags im Betrieb tätig zu sein. Je nach Jahreszeit variierte die Arbeitsintensität. Besonders im Winter blieb Zeit, um von der alltäglichen Monotonie ein wenig Abstand zu nehmen. Davon profitierten auch wir Kinder. Bereits am 6. Dezember erlebten wir einen Höhepunkt, den Klaustag: für uns Kleine ein Freuden- und Geschenktag. Wochen vorher hatten wir den Jelmolikatalog x-mal durchblättert und unsere gewünschten Objekte mit leiser Hoffnung auf Erfüllung betrachtet. Damals waren Einkaufszentren noch unbekannt, die Leute ortsgebunden, und die Versandhäuser Jelmoli und Oskar Weber lieferten die gewünschte Ware per Post ins Haus. Am Vorabend des 6. Dezember, vor dem Zubettgehen, breitete jedes Kind auf dem Stubentisch ein Taschentuch aus, so dass der bei stockdunkler Nacht heimlich hereinschleichende Samiklaus sich orientieren konnte und die Geschenke am richtigen Ort deponierte. Auf jedem Tuch lag ein Zettel mit Namen und Wünschen des Kindes. Vor lauter Erwarten und Spannung schliefen wir fast nicht und die Nacht wollte kein Ende nehmen. Endlich durften wir aufstehen und die Bescherung erleben. Und wie immer glänzten bei den einen vor Freude die Augen, andere waren traurig, enttäuscht, dass ihr Wunsch nicht erfüllt wurde. Eine Stube voller Kinder, ein leerer Geldbeutel bei den Eltern: Was konnte man schon bieten? Es reichte höchstens für etwas billiges Spielzeug, Kleidungsstücke für den Alltag und einige Lebkuchen, Orangen und Äpfel. Der Klaustag von damals galt bei uns als Geschenktag, dafür ging man an den Weihnachtstagen leer aus. Bereits am Vorabend war der Samiklaus mit Knechten, Magd und Esel von Haus zu Haus unterwegs. Überall wo Kinder daheim waren, meldete sich die Meute mit Glockengeröll und schweren Schritten, was unsere Nerven ziemlich strapazierte. Der Samiklaus setzte sich, umgeben von seinen Hilfskräften, mitten in der Stube auf einen bereitgestellten Stuhl. Im Hauseingang tobte der Esel (auch ein Junggeselle) wie ein Wilder. Wir Kinder knieten uns vor dem Samiklaus hin und beteten das Vaterunser. Dieser schlug ein dickes Buch auf, das gute und schlechte Taten und Gewohnheiten jedes einzelnen Kindes enthalten sollte, las diese vor, stellte Fragen und ermahnte. Ein Begleiter, verkleidet als Frau und als Magd qualifiziert, trug einen Korb. Aus diesem nahm der Samiklaus die Gaben, bestehend aus Äpfeln, Mandarinen, Orangen und Erd- oder Baumnüssen, die er unter den Kindern verteilte. Damit aber nicht genug: Ein Knecht trug unter den Armen einen Wisch Haselruten, von denen in jedem Haushalt mindestens ein Stück abgegeben wurde. Diese Rute wurde von den Eltern zwischen Stubendecke und Balken deponiert und stand zu jeder Zeit als Erziehungsmittel für ungehorsame Kinder einsatzbereit.
Vanescha: Kircheneinweihung nach der Renovation
Ein weiterer besonderer Tag für uns Kinder war das Neujahr. Dann galt es nämlich den Dorfbewohnern das neue Jahr anzuwünschen. Am frühen Morgen bei Dunkelheit machte sich Gross und Klein, einfach alle die ihre Beine gebrauchen konnten, auf durch die unbeleuchteten Gassen, zuerst in Vrin Dorf, dann nach Vrin Dado, auf den Weg von Haus zu Haus und rezitierte, so gut es ging, den romanischen Spruch: „Bien gi, bien onn da bienmaun“. Als Belohnung gab es ein Münzstück, angefangen bei einem Räppler bis zum Zehner; ausnahmsweise gab es bei den Verwandten auch einmal einen Zwanziger. Zurück zu Hause folgte der Besuch des Sonntags-Gottesdienstes. Am Nachmittag stand die Fortsetzung in den Fraktionen Cons, Ligiazun und Sogn Giusep auf dem Programm. Sofern man dort Verwandte hatte, bestanden gute Aussichten auf ein rechtes Zvieri. Bei diesen Hausbesuchen erhielt jedes Kind von seinem Götti und von seiner Gotte ein zusätzliches Geschenk meistens in Form eines Gewebestückes, geeignet für die Konfektionierung von Hemden und Kleidern. Wenn wir bis am Abend vier Franken beisammenhatten, waren wir glücklich. Trotzdem war es jedes Mal ein freudiges Ereignis. Was geschah mit diesem Geld? Wer meint, es landete auf dem Sparheft des Kindes, irrt sich. Nein, das Geld wurde von den Eltern eingesammelt und für notwendige Ausgaben verwendet. So waren die Zeiten – und Kindersparhefte waren unbekannt. Nicht nur für uns Kinder war der Jahresanfang etwas Besonderes, sondern auch die Erwachsenen pflegten eine alte Tradition. Unter der Verwandtschaft und Freunden suchte man einander zu Hause auf, brachte die Glückwünsche und wurde als Entgelt mit einem währschaften Imbiss, bestehend aus Kuchen, Trockenfleisch und dem obligaten Schnaps, belohnt. Die ledigen Männer suchten im gleichen Sinn gruppenweise die ledigen Töchter auf.
Am 6. Januar, dem Dreikönigstag (Buania), studierten vier Buben der letzten Schulklasse ein entsprechendes Lied ein, das sie, von Haus zu Haus ziehend, dort vortrugen. Dabei konnten sie ein paar Franken verdienen. In meinem letzten Schuljahr wollte auch ich dabei sein. Doch unser Lehrer, der den Gesangsunterricht erteilte, befand mein Gesangtalent als zu wenig ausgeprägt, und ich sollte meinem jüngeren Bruder den Vorzug geben, was dann auch geschah.
Arbeiten im Dorf
Zweifellos pulsierte das Dorfleben im Winterhalbjahr bedeutend intensiver als in der übrigen Zeit. Die Arbeiten auf dem Feld ruhten. Noch bevor der erste Schnee fiel, wurden in einem grösseren Kupferkessel auf offenem Feuer im Freien die eigenen Kartoffeln für die Mästung der Schweine gesotten und anschliessend in Gefässen eingestampft. Um die gleiche Zeit wurde das nun reife Getreide gedroschen. Jeder Landwirt betrieb für den eigenen Bedarf Ackerbau. In Vrin reifte nur Gerste. Für Getreidesorten wie Weizen oder Roggen war das Klima zu rau. Damit das Getreide recht reifen konnte, wurde es nach der Ernte sorgfältig zu Garben gebunden und über dem Heustock direkt unter dem Dach aufgestapelt. Dort blieb es zwei bis drei Monate. Zum Dreschen gab es zwei Varianten: maschineller Betrieb mit Benzin oder Handarbeit. Bei der Handarbeit standen Flegel im Einsatz. Dabei wurde das Getreide in der Stalltenne gleichmässig verteilt, ausgelegt und mit Flegelschlägen behandelt. Wenn möglich führten vier Personen diese Prozedur aus und zwar mit einem rhythmischen Taktschlag. Auch ich war einige Male dabei – eine interessante, aber anspruchsvolle Arbeit. Anschliessend wurde das abgefallene Getreide durch eine Mühle getrieben, die Körner und Spreu voneinander trennte. Später brachte man das Getreide in die mit Wasser betriebene Dorfmühle, wo es zu Mehl verarbeitet wurde. Als Mahllohn für seine Arbeit behielt der Müller eine gewisse Menge des Mehls zurück. Besonders das von Hand gedroschene Stroh war angenehm weich und eignete sich, in grossen Säcken abgefüllt, vorzüglich als Bettmatratze. Diese Schlafunterlagen gaben Wärme ab und waren im Winter in den kalten Zimmern sehr willkommen. Für uns Kinder war die erste Nacht auf dem frischen Stroh ein besonderes Erlebnis. Nach drei, vier Monaten war ein Wechsel wieder fällig. Das alte Stroh wurde im Stall zum Streuen verwertet.
Bisher war die Rede von Tätigkeiten, die periodisch regelmässig zu verrichten waren. Im Winter, wenn Arbeiten im Freien, besonders für die Frauen, nur beschränkt stattfanden, verfügten diese über genügend Zeit, um weiteren Beschäftigungen nachzugehen.
Wollverarbeitung
Bekanntlich war das synthetische Gewebe mit Ausnahme von Zellulose vor 80 Jahren noch unbekannt, hingegen fand die Schafwolle einen guten Absatz. Besonders Socken, Strümpfe, Pullover und Kopfbedeckungen wurden aus diesem Naturprodukt hergestellt. Da in Vrin die meisten Bauern auch Schafzucht betrieben, war es selbstverständlich, dass die gewonnene Wolle in erster Linie für den eigenen Bedarf verwendet wurde. Nach dem Scheren, natürlich alles von Hand, wurde diese sauber gewaschen, dann ins Unterland zwecks Zwirnerei versandt. Nach dieser Prozedur waren die Frauen an der Reihe, daraus die vorgenannten Fertigprodukte herzustellen. Das Spinnrad wurde aus dem Sommerschlaf herausgeholt und das Spinnen zu einem regelmässigen, konstanten Faden konnte erfolgen. Das Spinnen erforderte Geduld und gutes Fingerspitzgefühl. Die Arbeit konnte in der warmen Stube stattfinden und füllte die täglichen Arbeitslücken aus. Ein Wollknäuel nach dem anderen formte sich zur Freude der Spinnerin; eine wohltuende Befriedigung. Jetzt erst ging es richtig an die Herstellung des gewünschten Kleidungsstücks: das Stricken. Diese Arbeit lernten die Mädchen bereits in der Schule. Verschiedene Strickmuster, viele nach eigener Fantasie, kamen zum Zug. Dies galt besonders für die Pullover. Dafür wurde mit Vorliebe mit gefärbtem Faden gearbeitet. Jede Strickerin war eine Architektin in Miniatur und ein gesunder Wettbewerb war selbstverständlich. Kleidungsstücke aus Wolle gaben eine angenehme Wärme ab und waren strapazierfähig. Im Verlauf der wärmeren Jahreszeit hatten sich durchlöcherte Socken und Strümpfe angesammelt. Rückte die kältere Jahreszeit heran, waren diese an der Reihe. Stück um Stück wurde unter die Lupe genommen und dem Schaden entsprechend wieder ausgebessert.
Auch meine Mutter machte jeden Winter diese Prozedur mit. Da sie die Hausarbeit mit einer grossen Familie allein verrichten musste, reichte ihr die Zeit nur, um neue Strümpfe zu lismen und die alten zu flicken. Auch für die Arbeit am Spinnrad musste die Zeit fast schon „gestohlen“ werden. Später, als meine Schwestern grösser wurden, reichte die Zeit, um gemeinsam anspruchsvollere, wollene Kleidungsstücke anzufertigen. Der Anblick meiner Mutter am Spinnrad ist mir noch heute präsent, als wäre es gestern gewesen. Mit dem Aufkommen der Kunstfaser, die rapid die Bekleidungsindustrie eroberte, wurde die Schafwolle an den Rand gedrängt und somit auch deren Verwertung mühsamer. Ihre Preise fielen regelrecht in den Keller. Die Spinnräder dösen auf irgendeinem Estrich vor sich hin oder dienen als dekorative Antiquitäten.
Auch der Webstuhl hatte noch nicht ausgedient. Gemäss meinen Erinnerungen wurden diese Werkgegenstände nur noch vereinzelt installiert und in Betrieb genommen. In früheren Jahren hatten sie eine weit grössere Bedeutung und entsprechend intensiv waren sie im Verlauf des Winters im Einsatz. Sofern genügend Räume vorhanden waren, stellte man den platzbeanspruchenden Webstuhl in einem Raum auf, der noch für diesen Zweck verfügbar war. War dies nicht möglich, musste die Wohnstube beansprucht werden. Auf dem Webstuhl wurde Leinen zu Gewebe gewoben. Auf dem Weg von der der Pflanze, die im Frühjahr ausgesät wurde, bis zum Leinen mussten verschiedene anspruchsvolle Etappen berücksichtigt werden. Das fertige Gewebe war robust, aber nicht wärmefördernd. Bettwäsche, Handtücher und vereinzelte Kleidungsstücke fertigte man aus diesem Gewebe an.
Gemeinschaftliches Brotbacken





























