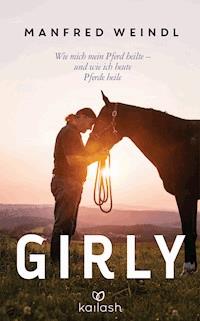
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kailash
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Manfred Weindl ist Polizist mit Leib und Seele, als ihn ein Zwischenfall im Dienst aus der Bahn wirft: Er stürzt in eine tiefe Depression und muss schließlich seinen Job an den Nagel hängen. Auf dem Höhepunkt seiner Krise kauft er eine Stute, Girly – obwohl er nie zuvor auf einem Pferd gesessen hat. Durch Girly bekommt Weindl wieder Zugang zu seinen verschütteten Gefühlen, kann sich Stück für Stück aus seiner Depression befreien. Und er entdeckt, dass in ihm das Talent schlummert, verhaltensauffällige Pferde zu heilen. Seine Feinfühligkeit, so erkennt er, ist keine Schwäche, sondern seine größte Stärke.
Weindls Geschichte erzählt von der Kraft des Selbstmitgefühls, der Chance von Krisen – und sie beweist, dass es nie zu spät ist seine Träume zu leben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 292
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
In seinem ersten Leben war er Polizist: ein Helfer des Menschen, und das aus Überzeugung. In seinem zweiten Leben wurde Manfred Weindl Pferdeflüsterer: ein gefragter Experte, der in ganz Deutschland Pferden und ihren Besitzern hilft.
Ein Traum wurde wahr, doch diesen Traum musste sich Manfred Weindl hart erkämpfen. Er war Alkoholiker, litt unter Depressionen, musste sich schweren Operationen unterziehen. Erst Girly brachte die Wende – das Pferd, das ihn heilte, so dass er heute Pferde heilen kann.
Bewegend und inspirierend berichtet Weindl über die erstaunlichen Wandlungen in seinem Leben. Seine Geschichte erzählt von der Kraft des Selbstmitgefühls, der Chance von Krisen – und sie beweist, dass es nie zu spät ist seine Träume zu leben.
Vita
Manfred Weindl arbeitete 25 Jahre lang als Polizist, davon 18 Jahre in Passau. 2007 schied er aus dem Polizeidienst aus. Nachdem er die Anglo-Araber-Stute Girly gekauft hatte, entdeckte er sein Talent für Pferdekommunikation. Im Jahr 2011 gründete er die Firma G.e.K.o.–Verhaltenstherapie für Pferde und entwickelte sein Programm „Sprachkurs: Mensch – Pferd“. Mittlerweile hat er mehr als tausend Pferde behandelt. Mit seiner Familie lebt Manfred Weindl in Salzweg in Niederbayern.
Weitere Informationen unter www.pferdefluesterer-salzweg.de.
MANFRED WEINDL
Mit Daniel Oliver Bachmann
GIRLY
Wie mich mein Pferd heilte – und wie ich heute Pferde heile
Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
1. Auflage
Originalausgabe
© 2017 Kailash Verlag, München
in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Lektorat: Anne Nordmann
Umschlaggestaltung: ki 36 Editorial Design, München, Daniela Hofner Umschlagmotiv: Frank Bauer
Satz und E-Book Produktion: Satzwerk Huber, Germering
978-3-641-20964-3
www.kailash-verlag.de
Einleitung
Diesen Weg lege ich fast täglich zurück: von meiner Haustür bis zum Pferdehof. Ein guter Teil der Strecke verläuft im Wald, dann wieder geht es auf schmalen Straßen an Wiesen und Feldern vorbei. Ich passiere einige hübsche Weiler und gelange zu einem Aussichtspunkt, der den Blick übers Donautal hinweg Richtung Tschechien und Österreich erlaubt. Meistens geht mir durch den Kopf, welche Aufgaben ich in meinem Beruf als Pferdeflüsterer demnächst zu lösen habe. Manchmal denke ich daran, wie es den Pferden und ihren Haltern ergeht, denen ich bereits helfen durfte. Selten kommt mir in den Sinn, wie komplett anders mein Dasein heute ausschaut im Vergleich zu meinem Leben früher.
Doch kürzlich ist etwas geschehen, das alles verändert hat. Zunächst war es wie immer: Ich rollte auf das Gelände des weitläufigen Pferdehofs und erfreute mich am hervorragenden Zustand von Haupthaus und umliegenden Ställen. Ich fuhr noch ein Stück weiter, denn Girlys Stallung liegt etwas abseits. Als ich den Wagen parkte, schaute sie bereits aus dem Tor ihres Offenstalls, wie sie das immer tut, wenn sie nicht draußen auf der Weide ist. So ein Offenstall ist eine prima Sache: Hier haben Pferde einen Witterungsschutz und ihren Fressplatz, können gleichzeitig aber auch den Auslauf genießen.
»Hast du mich erwartet?«, begrüßte ich Girly. Auch das frage ich immer, weil es tatsächlich so ist: Sie spürt, dass ich unterwegs bin, und weiß, dass ich kommen werde. Pferde haben diesen Instinkt. Hunde haben ihn ebenfalls, und kürzlich erzählte mir ein befreundeter Imker, dass es bei seinen Bienen auch so sei. Girly wieherte zur Antwort. Ich ging zu ihr, streichelte sie, und in diesem Augenblick war der Gedanke so intensiv in meinem Kopf, als habe sie ihn mir zugeflüstert: »Du solltest deine Geschichte aufschreiben.«
Darüber hatte ich noch nie nachgedacht, doch plötzlich war es völlig klar, und ein Gedanke jagte den nächsten: Früher wolltest du als Polizist Gerechtigkeit in die Welt bringen, bis du erkannt hast, dass in diesem harten Job kein Platz für Gefühle ist. Du hast dich von deinen Gefühlen regelrecht abgespalten, hast einen auf »harten Kerl« gemacht, bis diese Scheinwelt zusammenbrach. Erst als du dieses Pferd kennengelernt hast, als Girly in dein Leben trat, erkanntest du nach und nach, dass Sensibilität keine Schwäche ist, sondern deine ureigene Stärke. Nur durch diese Feinfühligkeit bist du als Pferdeflüsterer so erfolgreich geworden. Es war ein langer und harter Weg, und es lohnt sich, ihn zu erzählen.
»Hey«, sagte ich zu Girly, »danke!« Auch das sage ich häufig zu ihr, einfach so, weil wir immer füreinander da sind. Doch heute meinte ich noch mehr damit. Als ich ihr den Sattel auflegte, aufstieg und wir den Ausritt begannen, wusste ich, dass von nun an vieles anders sein würde. Ja, ich würde meine Geschichte und die tiefe Verbundenheit, die zwischen Girly und mir entstanden ist, in Worte fassen. Auf diesem Weg würde ich nichts auslassen – weder die Schmerzen noch die Glücksgefühle –, damit jeder nachvollziehen könnte, dass eine Lebenskrise, und sei sie noch so groß, zugleich eine Chance auf Neues beinhaltet. Mein Weg zur Heilung führte über den Zugang zu meinen Gefühlen – das ist der Weg, den Girly mir gezeigt hat. Und wer weiß? Vielleicht kann Ihnen unsere Geschichte ebenfalls einen Weg weisen.
In herzlicher Verbundenheit,
Ihr
1
Spür dein Ziel.
Der Anruf kommt spät, gegen zehn Uhr abends.
»Bin ich beim Pferdeflüsterer?«, fragt eine weibliche Stimme. Sie klingt gepresst, wie geschockt. Ich kann heraushören, dass etwas Schlimmes vorgefallen sein muss. »Mein Hengst. Der Avalon. Er ist schwierig, aber so etwas hat er noch nie getan, ich kann es mir gar nicht erklären, es ist furchtbar!«
»Was ist furchtbar? Was hat er getan?«
Die Frau stockt. Es kostet sie Mühe, die Wahrheit auszusprechen. »Avalon hat ein anderes Pferd totgetreten. Er ist völlig ausgerastet, niemand konnte ihn bändigen. Sie müssen kommen, Herr Weindl, bevor noch mehr passiert.«
Sie nennt mir eine Adresse in Kaufbeuren. Gut drei Stunden Autofahrt, schätze ich. Wir verabreden uns für den nächsten Morgen um acht Uhr. Bis dahin, sagt die Frau, steht Avalon isoliert in seiner Box. Eine Hochsicherheitsbox, betont sie. Niemand wird sich Avalon nähern. Nicht dass er noch einen Menschen tottritt.
Als ich auflege, fragt meine Frau Evi: »Ein Notfall?«
Sie kennt sich mit Pferden ebenfalls gut aus, aber vor allem kennt sie sich mit mir gut aus. Oft gebe ich Anrufern unentgeltliche Tipps am Telefon, wenn das möglich ist, ohne das Pferd zu begutachten. Hier ist es mit Ratschlägen allerdings nicht getan. Es geht um Leben und Tod, und Evi hat das gleich gespürt. Ich erzähle ihr, was ich erfahren habe. So mache ich das immer. Wir sind seit 30 Jahren verheiratet und haben in dieser Zeit gemeinsam so viel gemeistert, dass es für mehrere Leben reichen könnte. Im Grunde genommen kommt das der Wahrheit auch ziemlich nahe: Ich bin mittlerweile in meinem zweiten Leben angekommen, in dem als Pferdeflüsterer. Es unterscheidet sich von meinem ersten Leben als Polizist, als Alkoholiker, als körperliches Wrack mit 23 überstandenen Operationen so sehr, dass wohl kein Romanautor diesen extremen Gegensatz erfinden könnte. In all dieser Zeit war Evi stets an meiner Seite, und ich kann mit Fug und Recht sagen: Wäre sie es nicht gewesen, wäre ich heute nicht hier. Dann würde ich jetzt nicht an meinem Schreibtisch sitzen, mit ihrem Foto und das unserer drei Jungs neben dem Computer, um meine Geschichte in Worte zu fassen. Ich hätte keines der mittlerweile mehr als 1.500 Pferde behandelt. Und ich wäre nach diesem abendlichen Anruf nicht losgefahren, um einen schwierigen Fall zu lösen.
Ich mag es, den Tag früh zu beginnen. Wir leben in Salzweg, in der südöstlichsten Ecke Deutschlands. Die Grenzen zu Tschechien und Österreich sind kaum einen Steinwurf entfernt. Passau, in gut fünfzehn Autominuten erreichbar, ist die nächstgrößere Stadt und gleichzeitig geliebte Heimat. Als ich in den Wagen steige, freue ich mich bereits wieder auf die ersten Kilometer der vor mir liegenden Strecke. Wie oft bin ich schon von Salzweg nach Passau gefahren, und trotzdem geschieht es jedes Mal: Sobald ich die Serpentinen unter die Räder nehme, die oberhalb der Halser Ilzschleifen hinab ins Tal der Ilz führen, schlägt mein Herz höher. Wie schön, dass das jetzt wieder so ist. Als ich psychisch erkrankt war, konnte ich nirgendwohin mehr fahren, nicht einmal die kurze Strecke nach Passau.
Der Fluss Ilz entspringt im Nationalpark Bayerischer Wald, und sein moorreiches dunkles Wasser vermischt sich in Passau mit dem blauen Wasser der Donau und dem grünen des Inn. Wasser und Passau – das sind zwei Worte, die sich nicht trennen lassen. Als ich aus dem Tunnel unterhalb der Veste Oberhaus fahre, leuchtet mir das Wasser entgegen: Donau, Inn und Ilz vereinigt, an dieser Stelle mehr See als Fluss. Dahinter erhebt sich die Stadt. Die italienisch anmutenden Gebäude aus der Renaissance im ersten Licht der aufgehenden Sonne, überstrahlt von den gewaltigen Kuppeln des St.-Stephans-Doms. Wie müssen erst die Menschen im Mittelalter gestaunt haben, wenn sie diese Stadt betraten – eine der prächtigsten Städte des Heiligen Römischen Reiches –, wo selbst mir bei ihrem Anblick regelmäßig ein Schauer den Rücken hinabfährt. Und so schwelge ich in Erinnerungen, während mein Blick über die am Kai vertäuten Flusskreuzfahrtschiffe schweift: Da drüben habe ich mit meinen Eltern, meinem Bruder und meiner Schwester gelebt, bis die Schanzlbrücke gebaut wurde und das Wohnhaus dafür zu weichen hatte. Dort ist eine der vielen Volksschulen, die ich besuchen musste. Ja, musste, denn meine Schulzeit gehört nicht zu den schönen Erinnerungen. Und in diesem Haus … eine dunkle Wolke legt sich über meine Gedanken. In diesem Haus hat sich ein verzweifelter Familienvater umgebracht und eine Frau und vier kleine Kinder zurückgelassen. Er gehört zu den vielen, vielen toten Menschen, die mich in meinem Leben als Polizist manchmal selbst an den Rand einer Depression trieben, und am Ende dann sogar weit über diesen Rand hinaus. Erst in diesem Beruf ist mir bewusst geworden, wie viele Menschen in Deutschland durch Selbstmord ihr Leben beenden. Die jüngsten Zahlen sind erschreckend: In unserem Land sind es mehr als 10.000 Menschen pro Jahr. Das sind fast doppelt so viele wie durch Verkehrsunfälle, Drogen, Aids und Gewaltverbrechen zusammen. Dazu kommen über 100.000 Selbstmordversuche, bei Frauen fünfmal häufiger als bei Männern. In Berlin stirbt täglich ein Mensch durch Selbstmord. Oft ist eine Depression der Grund dafür.
Man sagt, nur wer Depressionen aus eigener Erfahrung kennt, kann auch darüber sprechen, und deshalb werde ich das tun. Denn diese schwarze Wolke, die meinem Dasein lange Zeit jede Freude, jede Farbe und jedes Licht entzog, trug ebenfalls dazu bei, dass ich heute Pferde so gut verstehen kann. Nichts von dem, was ich durchlebt und erlitten habe, war umsonst. Doch sagt sich so etwas in der Rückschau einfach. Wer von der Depression gepackt wird, kann nicht mehr an das Morgen denken. Für ihn besteht das Heute nur noch aus Unmöglichkeiten. Häufig genug wählt dieser unglückliche Mensch den scheinbar letzten Ausweg. Ich selbst habe ebenfalls einmal vor dieser finalen Entscheidung gestanden.
Doch jetzt wische ich all diese Gedanken beiseite. Heute, in meinem Leben als erfolgreicher Pferdeflüsterer, gelingt mir das auch. Ich konzentriere mich darauf, was vor mir liegt: erst 300 Kilometer auf der A92 zurücklegen, danach eine Aufgabe, auf die ich mich trotz aller Schwierigkeiten freue. Avalon, ein Hengst am Rande des Wahnsinns. 500 Kilogramm Muskeln, Kraft und Energie, gepaart mit einem hellwachen Pferdeverstand, aber massiv verstört durch was auch immer. Ich werde die Menschen, die ich dort antreffe, erst einmal nicht nach Ursachen fragen. Ich werde Avalon selbst fragen. Und er wird mir seine Antworten geben, da bin ich mir sicher. Dann werde ich ihm sagen, was ich zu sagen habe. Das geschieht nicht mit der uns Menschen verständlichen Sprache. Es geschieht durch Körpersprache, Blicke und dem minimalen, leisen Einsatz meiner Stimme. Was sie sagt, ist nicht so entscheidend, als wie sie es sagt. Avalon, dieser stolze Hengst, dessen Vorfahren 55 Millionen Jahre länger auf der Erde lebten als die Gattung Mensch, wurde von uns aus seinem ursprünglichen Habitat gerissen. Wir machten aus einem Flucht- und Herdentier ein Nutztier. Allein das ist für die meisten Pferde verwirrend. Und kennen wir das nicht selbst? Wenn wir verwirrt sind, ist die Krise nicht weit. Bei Pferden sind das die Augenblicke, wo mein Telefon klingelt. Es sind die Augenblicke, in denen der Pferdeflüsterer auf den Plan treten soll. Wo immer ich hinkomme, kümmere ich mich zunächst um ein Pferd im Ausnahmezustand. Doch danach kümmere ich mich um die Menschen – denn sie sind es, die eine falsche Entscheidung getroffen haben. Aus seiner Sicht macht ein Pferd immer alles richtig. Es handelt rein instinktiv. Deshalb liegen die Fehler bei uns Menschen. Wir denken nicht wie ein Pferd, sondern vermenschlichen es stattdessen. Da ich mich selbst mit falschen Entscheidungen gut auskenne – mein erstes Leben lässt grüßen – kann ich Pferd und Mensch etwas flüstern.
Ich schaue auf das Navi und lese die Ankunftszeit ab: 7:50 Uhr. Zeit für Musik. Ich schiebe eine CD ein und lausche meinem Sohn Alex, einem begabten Folk-Sänger. Ich lächele. Zwar bin ich nicht auf der Route 66 unterwegs, sondern auf der A98, aber es fühlt sich fast so an. Die Riffs seiner Western-Steel-Gitarre im Ohr, die blitzenden Sonnenstrahlen über den Ausläufern der Bayerischen Alpen im Auge und den ganz besonderen Duft eines rassigen Pferdes bereits in der Nase: Wer hätte gedacht, dass mein Leben eines Tages so glücklich sein würde? Ich ganz bestimmt nicht.
Als ich auf dem Hof ankomme, werde ich bereits erwartet. In der ganzen Aufregung hat die Anruferin gestern Abend ihren vollständigen Namen nicht genannt. Jetzt stellt sie sich als Luise Bargmann vor. Sie sieht aus, als habe sie die ganze Nacht nicht geschlafen. Der Eigentümer des Hofes ist da, und eine weitere Frau, in deren Augen Tränen stehen. Es ist ihr Pferd, das totgetreten wurde. Obwohl ich gerne ohne detaillierte Vorkenntnisse den Hengst aufgesucht hätte, denn ich will einen unverfälschten Blick auf die Gegebenheiten, setzt mich Luise Bargmann ins Bild. Es sprudelt geradezu aus ihr heraus. Avalon ist ein 8-jähriger Haflinger-Hengst. Haflinger sind im Allgemeinen ehrgeizig und leistungsbereit, zeichnen sich aber auch durch Ruhe und Besonnenheit aus. Ausgerechnet ein Exemplar dieser Rasse hat ein anderes Tier totgetreten?
Das Opfer ist einer der beiden Wallache, die mit Avalon zusammen gehalten wurden, bestätigt Luise. »Er hat ihn in die Ecke gedrängt und ihm derart zugesetzt, dass wir ihn einschläfern mussten. Wir konnten nichts dagegen tun. Seither tritt Avalon nach jedem, der sich ihm nähert. Sie können unmöglich zu ihm rein.«
Ich nicke und spare mir die Frage: Was soll der Pferdeflüsterer denn sonst tun? Natürlich ist ihre Warnung ernst zu nehmen. Der Hufschlag eines Hengstes kann nicht nur den sofortigen Knock-out bedeuten, sondern auch gefährliche Verletzungen nach sich ziehen. Während ich mich dem Stall nähere, spricht Luise weiter wie ein Wasserfall. Es ist ihr ein Bedürfnis, sich den Kummer mit ihrem Pferd von der Seele zu reden. Avalon sei schon immer speziell gewesen, erfahre ich. Kaum betrete jemand seine Box, drehe er ihm den Hintern zu und trete nach hinten aus. Heu füttern sei nur möglich, wenn man ihm gleichzeitig einen Eimer mit Leckereien vors Maul halte. Als wir den Unterstand des Hengstes erreichen, bleibe ich perplex stehen.
»Was ist das?«, frage ich.
»Avalons Box.«
»Das ist keine Box. Das ist ein Hochsicherheitsgefängnis.«
Der Unterstand ist so eng vergittert, dass wir das Pferd von außen kaum sehen können.
»Das war nötig«, verteidigt sich Luise. »Er hat uns sogar aus der Box heraus getreten und gebissen.«
Ich versuche, sie zu öffnen. Schon ist der Hengst da, wirbelt herum und tritt zu. Seine Hufe donnern gegen das Holz. Ich mache einen zweiten Versuch, um seine Reaktion zu testen. Dieses Mal tritt er so stark aus, dass die Besitzerin einen Schrei ausstößt.
»Sehen Sie? Es ist unmöglich, keiner kommt da rein!«
»Schaun’ wir mal«, antworte ich. Wie immer in schwierigen Situationen verlangsamt sich mein Pulsschlag. Das ist eines der Merkmale, die ich im Laufe meiner Arbeit als Pferdeflüsterer entdeckt habe. Anstatt den Puls zu beschleunigen, wie es üblich ist, arbeitet mein Körper in die andere Richtung. Seit geraumer Zeit trage ich ein Armband, das neben Puls und anderen Körperfunktionen auch meine Schlaffrequenz misst. Alle Daten werden auf mein Smartphone übertragen und statistisch ausgewertet. Seither weiß ich, dass mein Puls in Extremsituationen auf 50 Schläge in der Minute sinkt. Bradykardie nennen Mediziner dieses Phänomen und raten häufig zum Herzschrittmacher. Ich dagegen sehe mich in diesen Situationen wie ein austrainierter Leistungssportler und fühle mich pudelwohl mit meinem niedrigen Puls. Außerdem bin ich der Überzeugung, dass Pferde ihn spüren. Meine Ruhe überträgt sich auf die Tiere – nur leider nicht immer auf ihre Halter.
»Haben Sie Kraftfutter?«, frage ich.
Der Puls von Luise liegt vermutlich im dreistelligen Bereich. »Kraftfutter? Warum das denn? Was wollen Sie damit?«
»Haben Sie welches?«
Natürlich gibt es auf dem Hof Kraftfutter. Der Besitzer bringt mir einen Eimer. Ich öffne den Futterbarren und fülle es hinein. Sofort ist Avalon da. Gierig fährt sein Maul herab. Doch da ist auch meine Hand. Von außen bewege ich sie wie einen Scheibenwischer über dem Futterbarren. Ich kann die Anspannung des Hengstes hinter dem engen Gitter spüren. Er ist geradezu empört über diese Unverschämtheit! Er ist der Chef im Ring, er hat den Hochstatus, was bedeutet: Er steht sprichwörtlich über den anderen. Und nun kommt da einer und wagt es, ihm das Fressen zu verbieten? Er schnaubt, sein Maul streift über meine Hand, doch er beißt nicht zu. Unruhig und voller Aggression läuft er durch seine Box. Immer wieder poltert der Körper gegen die hölzerne Boxenwand. Die Schläge sind ohrenbetäubend. Dann versucht er nochmals, ans Futter zu kommen. Erneut macht meine Hand nichts weiter als eine lässige Scheibenwischerbewegung. Es geht mir nicht darum, einen Kampf mit dem Hengst auszufechten. Einer meiner wichtigsten Leitsätze lautet: Ich behandle Pferde und ihre Menschen für ein besseres gegenseitiges Verständnis und für gegenseitigen Respekt. Was mir Avalons Besitzerin in aller Hast erzählte, war Nachweis genug, dass es an diesem Verständnis gefehlt hat: Sie hat ihren Hengst mit allerlei Leckereien bestochen, was einer der häufigsten Fehler im Umgang mit Pferden ist. Kein Wunder, dass er ungehalten ist, wenn er sein Bestechungsfutter nicht bekommt. Diese Situation ist eskaliert – ich spreche dabei gerne von einem Aufschaukelungsprozess. Wie viele meiner Klienten hat sich Luise zu wenig Gedanken über das Wesen ihres Pferdes gemacht. Dabei ist es einfach zu verstehen. Ein Pferd ist dreierlei: ein Beutetier. Daher ist es ein Fluchttier. Und aus demselben Grund auch ein Herdentier, weil es in der Herde am besten geschützt ist. Diese Herden waren immer hierarchisch organisiert, jedes Mitglied hatte seinen definierten Rang und seine definierte Funktion. Jeder in der Herde war wichtig, von der Leitstute angefangen bis hinab zum letzten Rang. Ich spreche deshalb in der Vergangenheit, weil es Pferdeherden in freier Wildbahn nur noch selten gibt, zumindest nicht in unseren Breitengraden. Das hat gewaltige Auswirkungen auf die Psyche der Tiere.
Wenn ich Avalon jetzt das Fressen untersage, mache ich ihm klar: Ich bin hier der Boss. Strecke ich ihm dagegen einen Eimer mit Leckereien hin, ist die Botschaft genau anders herum: Du bist der Boss. Als Boss darf Avalon auch zutreten, das weiß er. Nun ist es an der Zeit für mich, auch Boss in seiner Box zu werden. Langsam nähere ich mich der Tür. Ich bin mir sicher, was passieren wird, doch Luise traut ihren Augen nicht. Als ich die Tür öffne, zieht sie vor Schreck die Luft ein. Doch der Hengst steht nur da und blickt mich ruhig an. Er dreht mir nicht den Hintern zu, sondern zeigt Unterordnungs- und Beschwichtigungsgesten: Er senkt den Kopf, sein Maul bewegt sich, er leckt und kaut. Ich nehme das Halfter und streife es Avalon behutsam über. Er lässt es zu. Hinter mir murmelt Luise: »Das dauerte keine fünf Minuten. Ein Wunder.«
Nein, es ist kein Wunder, doch sagen mir ihre Worte, dass die eigentliche Arbeit erst beginnt. Wenn ich vom Hof bin, muss der Hengst seine Besitzerin als ranghöheres Wesen akzeptieren. Das wird er ganz gewiss nicht tun, wenn sie ihn erneut mit Leckereien besticht. Daher werde ich bei Luise einige meiner Lieblingsthemen ansprechen: »Futterdisziplin« ist das eine, »Frustrationstoleranz« das andere. Darunter verstehe ich die Fähigkeit des Tieres, eine frustrierende Situation über längere Zeit auszuhalten. Pferde, die diese Fähigkeit nicht besitzen, werden schnell unwillig und reagieren mit Aggression. Sie neigen zu erhöhtem Anstrengungs- und Vermeidungsverhalten. Sie versuchen mit allen Mitteln, das Gewünschte zu bekommen, und wehren sich ebenso vehement, das von ihnen Verlangte umzusetzen. Weil sowohl Futterdisziplin als auch Frustrationstoleranz dafür sorgen, dass ein Hengst wie Avalon zu einem umgänglichen Pferd werden kann, werde ich im Laufe des Buches immer wieder darauf eingehen. Davon profitiert übrigens auch, wer kein Pferdehalter ist: Viele kennen die Situation, wenn Kinder im Supermarkt Wünsche äußern, welche die Erwachsenen nicht erfüllen möchten oder können. Auch weil wir wissen, dass wir Kindern keinen Gefallen tun, wenn wir ihnen jeden Wunsch von den Augen ablesen. Wir bereiten sie auf den Tag vor, wenn das »Nein« fester Bestandteil ihres Lebens wird. Am Beispiel von Avalon können wir erkennen, wie unberechenbar ein Lebewesen wird, wenn es nur verwöhnt wird. Dann fordert es immer größere Belohnungen ein – von einem Leckerbissen steigerte der Hengst sein Belohnungssystem auf einen ganzen Eimer. Am Ende zeigte er gar keine Toleranz mehr, wenn es nicht nach seinem Willen ging. Mit ihrem Belohnungssystem hat Luise ihrem Pferd nichts Gutes getan, ganz im Gegenteil. Sie hat es unter enormen Stress gesetzt. Seine Unzufriedenheit aufgrund des nicht pferdegerechten Umgangs gipfelte dann in dieser heftigen Aggression. Draußen in der Natur, erkläre ich ihr, wo Pferde ursprünglich herkommen, wäre so ein Verhalten undenkbar. Niemals würde ein ranghohes Tier einem niedriger stehenden den Futterplatz überlassen. Niemals käme es zu einem Belohnungssystem. In der genetischen Erinnerung der Pferde ist dieses Verhalten fest verankert.
»Du hast dein Pferd vermenschlicht«, sage ich ihr. »Nimm davon Abstand.«
Als Pferdeflüsterer habe ich heute kein Wunder vollbracht. Ich habe lediglich Avalon seine ureigene Wesensart zurückgegeben.
2
Auch eine Reise von tausend Meilen beginnt mit dem ersten Schritt.
Ich werde häufig gefragt: »Wie hast du das geschafft? Wie konntest du dein erstes Leben verlassen und ein zweites beginnen? Wie hast du deinen Traum verwirklicht?«
Auf diese Fragen folgt genauso oft das Bekenntnis, dass der Fragesteller mit seinem eigenen Leben unglücklich ist und glaubt, es zöge ungenutzt an ihm vorbei.
Auch das ist ein Grund, weshalb ich hier meine Lebensgeschichte erzähle. Wenn ich es geschafft habe, können andere es auch schaffen, davon bin ich überzeugt. Aus meiner Erfahrung als Polizist und aus der Erfahrung als Pferdeflüsterer weiß ich, dass viele Menschen einem Beruf nachgehen, der nur wenig mit ihrer inneren Überzeugung zu tun hat. Weil wir unsere Berufswahl, eine der wichtigsten Entscheidungen unseres Lebens, anderen überlassen, sie hoppla hopp treffen oder nicht auf unser Bauchgefühl, sondern nur auf den Verstand hören, führen wir ein Leben, in dem wir unsere wahren Träume nicht verwirklicht sehen. Damit sind wir bei einer der herausforderndsten Fragen unseres Lebens angelangt: Was sind eigentlich unsere wahren Träume?
Viele Menschen glauben, mein Leben als Polizist endete am Tag X, und am nächsten Tag Y begann mein Leben als Pferdeflüsterer. Zugegeben, es gab eine Zeit, da habe ich ähnlich gedacht. Der Grund war, dass in meiner Erinnerung keine Pferde vorkamen. In meiner Kindheit hatte ich kein Pony, im Gegensatz zu vielen meiner Kunden. Ich habe keine Zeit auf einem Pferdehof verbracht, habe nie voltigiert, geschweige denn Reiten gelernt. Ich musste 37 Jahre alt werden, bevor ich das erste Mal auf einem Pferd saß. Ich wuchs nicht als Sohn eines Pferdetrainers auf wie Monty Roberts, um im Alter von vier Jahren die ersten Turniere zu bestreiten. Mein Vater war Kraftfahrer in der örtlichen Zahnradfabrik. Auch wenn er von einem Bauernhof kommt, hatte er nie etwas mit Pferden am Hut. Meiner Mutter, die aus dem Bayerischen Wald stammt, erging es nicht anders. Da nimmt es nicht Wunder, dass ich eine Zeitlang behauptete: »Der Pferdeflüsterer wurde mir nicht in die Wiege gelegt.«
Doch als ich mich nach Girlys Eingabe hinsetze, um dieses Buch zu schreiben, beschäftigte ich mich noch einmal intensiv mit meiner Kindheit. Ich bin nämlich der Überzeugung, dass wir dort häufig Impulse erhalten, die uns einen wichtigen Hinweis auf unsere wahre Natur und unsere Herzenswünsche geben. Leider kann es passieren, dass wir Kinder diese Impulse zu deuten wissen, die Erwachsenen um uns herum jedoch nicht. Als ich tief in mich hineinspürte, fand ich diesen Impuls. Tatsächlich wurde mir die Liebe zum Pferd in die Wiege gelegt – und in der Kindheit hatte ich die Chance, das zu erkennen.
Damals lebten wir im Örtchen Neukirchen am Inn, ein Dorf mit 1.500 Einwohnern in einer von Äckern, Weiden und Wald geprägten Landschaft. Dort gefiel es mir. Ich erinnere mich daran, wie ich als Junge in kurzen Hosen barfuß über die Felder tobte, neugierig in den Ställen der Bauern nach Kühen und Rindern schaute und mit Katzen spielte, die faul in der Sonne lagen. Vielleicht war es bei der Kirchweih oder einem anderen Fest, das kann ich nicht mehr genau sagen, als sich die Sache mit der Tombola zutrug. Wenn in Niederbayern gefeiert wird, kommen deftige Mahlzeiten auf den Tisch, und das Bier fließt in Strömen. Für uns Buben war das langweiliges Erwachsenenzeugs. Bei diesem Fest aber gab es eine Tombola, und der Hauptgewinn war ausgerechnet ein Pony. Heute könnte ich das nicht mehr gutheißen, doch der Dreikäsehoch damals war begeistert! Mit jeder Faser meines Körpers wollte ich das Pony gewinnen. Und während die Erwachsenen zur Musik schunkelten, die Heranwachsenden erste Wettbewerbe im Maßkrugstemmen austrugen und Kinder die Festwiese in einen Spielplatz verwandelten, harrte ich bei diesem Pony aus. Es war mit einem Strick angebunden und zeigte alle Anzeichen von Stress, die ich damals allerdings nicht zu deuten wusste. Für mich war es einfach der fehlende Kamerad, von dem meine kindliche Seele glaubte, dass er eine enorme Lücke in meinem Leben schließen könnte. Darin unterschied ich mich nicht von vielen Pferdebesitzern, mit denen ich es heute zu tun habe. Oftmals müssen ihre Pferde als Kinder- oder Partnerersatz herhalten, was natürlich nicht ihrer angestammten Rolle entspricht. Damals sah ich das Pony durch dieselbe Brille: Du wirst mein Spielkamerad werden, sprach ich ihm zu, mein Freund, mein Vertrauter, mein Ein und Alles. Ich war mir völlig sicher, dass es schon bald mir gehören würde. Entschlossen marschierte ich zum Losverkäufer und investierte meine gesamte Barschaft in genau ein Los. Mehr Geld hatte ich nicht, aber mehr brauchte ich auch nicht, daran gab es keinen Zweifel. Mit diesem einen Los würde ich den Hauptpreis gewinnen: Das Pony, das jetzt nur noch darauf warten musste, von mir nach Hause geführt zu werden. Ob wir dort für das Tier einen Platz hätten, hielt ich für eine unbedeutende Frage. Was meine Eltern dazu sagen würden ebenfalls.
Der Rest des Festes zog sich endlos hin. Natürlich war die große Verlosung als Höhepunkt des geselligen Zusammenseins gedacht. Sie sollte spät am Abend stattfinden, wenn Buben wie ich längst im Bett liegen mussten. Doch ich quengelte so lange, bis ich es schaffte, die Zeit nach Hause zu gehen um eine Viertelstunde und noch eine Viertelstunde und eine weitere Viertelstunde hinauszuzögern. Endlich, als meine Eltern längst bezahlt hatten, griff ein Mann zum Mikrofon. Ich sehe ihn noch heute vor mir, wie er die Hauptpreise verkündete: von der Nummer zehn quälend langsam zur Nummer zwei. Natürlich war ich mit meinem Los noch nicht unter den Gewinnern, die freudestrahlend aufsprangen, um ihre Preise entgegenzunehmen. Meines war schließlich das Siegerlos.
»Der Hauptgewinn unserer diesjährigen Tombola fällt auf die Nummer …«, rief der Mann ins Mikrofon. Er machte eine Pause, natürlich machte er eine Pause, und ich raufte mir die Haare. Siehst du nicht, dass meine Eltern bereits gehen wollen? Sag endlich die Nummer, damit ich mein Pony mitnehmen kann!
»…371!«
War es die 371? Oder die 52? Oder irgendeine andere Zahl? Jedenfalls war es nicht meine Losnummer. Erst war ich der felsenfesten Überzeugung, dass der Mann sich geirrt hatte. Er hatte den Zettel falsch abgelesen. Er hatte seine Brille nicht auf. Es war ein Irrtum, anders konnte es nicht sein. Doch dann betrat ein wildfremder Mensch die Bühne, schüttelte Hände und band kurz darauf unter dem Applaus der Leute mein Pony los. So seltsam es klingen mag, für den Buben in kurzen Hosen brach eine komplette Welt zusammen. Ich war derart enttäuscht, kein stolzer Ponybesitzer zu werden, dass mir beim Schreiben dieser Zeilen noch einmal klar wurde, wie viel mehr für mich dahintersteckte. Für einen Augenblick war die Tür zu meinem Herzenswunsch aufgegangen, und ich hatte einen Blick dorthin werfen dürfen, wo meine größte Sehnsucht zuhause war. Dieses Pony, von seiner Größe dem Urpferd nicht unähnlich, war der Impuls, von dem ich heute spreche, wenn mich Menschen fragen: »Manfred, wie kann ich mein Leben ändern, so wie du es getan hast?«
Ich rate dann dazu, in der Kindheit nach der Situation zu suchen, die einen Hinweis auf einen großen Wunsch liefert. Oft ist er mit einer Enttäuschung verbunden, weil wir unseren Herzenswunsch nicht erfüllt bekommen haben. Deshalb werden wir später im Leben zu Suchenden, wir suchen nach dem Richtigen für uns.
Erlaube ich mir heute die »Was wäre wenn«-Frage, lautet sie folgendermaßen: Was wäre, wenn ich das Pony gewonnen hätte? Oder was wäre, wenn meine Eltern meinen innigen Wunsch wahrgenommen hätten? Vielleicht wäre dieser einfache Weg gar nicht gut gewesen. Vielleicht habe ich die lange Reise machen müssen, weil nur sie am Ende dazu führte, dass ich mich heute besonders gut in die Pferde einfühlen kann? Trotzdem war es für mich wichtig, beim Schreiben des Buches herauszufinden, dass sich meine Seele schon damals mit diesen wunderbaren Geschöpfen verbunden fühlte.
Manfred Weindl und seine Girly
© Frank Bauer
Das Schicksal – oder wie immer wir unseren Lebenspfad nennen – wird niemals aufhören, uns Hinweise zu geben, bis wir den richtigen Weg gefunden haben. Manche dieser Hinweise sind einfach zu verstehen, wie der mit dem Pony. Andere sind nicht ganz so deutlich, weil sie immer mit den im Augenblick vorhandenen Möglichkeiten spielen. Genau das passierte mir einige Jahre später. Wir waren in der Zwischenzeit mehrfach umgezogen und hatten einige Jahre in Passau verbracht, bis meine Eltern den günstigen Bauplatz in Salzweg fanden. Sie tauschten die Mietwohnungen gegen ein einfaches Haus ein, und ich meine kurzen Hosen gegen lange. Mittlerweile war ich halbwüchsig geworden, und wieder stand ein Fest vor der Tür. Wieder gab es eine Tombola. War ein Pony der erste Preis? Das wäre zu viel des Guten. Der erste Preis war ein Mofa, allerdings nicht irgendeines, sondern eine Honda Monkey, mit dem heute legendären Einzylinder-Viertaktmotor und dem fußgeschalteten Dreigang-Getriebe. Wer die Welt durch die Augen eines pubertierenden Jugendlichen sieht, kann in diesem seltsam gedrungenen Zweirad durchaus ein Pony erkennen.
Dazu passt eine Anekdote, die mir ein Bekannter kürzlich erzählte: Auf seiner Reise durch die Mongolei traf er auf viele ehemalige Nomaden-Hirten. Sie waren sesshaft geworden, und das nicht freiwillig, wie er betonte. Hatten sie bisher ihre Tage auf dem Rücken von Pferden verbracht, saßen sie nun auf Motorrädern. Doch wählten sie solche Motorräder aus, die ihren kleinwüchsigen Steppenpferden am ähnlichsten waren. »Das sind jetzt unsere Pferde«, sagten sie zu meinem Bekannten. Ich schmunzelte, als er mir davon berichtete, doch damals, als ich wieder mit nur einem Los eine Tombola gewinnen wollte, war mir nicht nach Lachen zumute. Natürlich sah ich in dem Mofa eine Möglichkeit, dem engen Umfeld von Salzweg zu entkommen. Wer keinen motorisierten Untersatz hatte, schaute zu dieser Zeit schön blöd aus der Wäsche. Der letzte Bus nach Passau – mit anderen Worten in die große Welt – fuhr um 16:20 Uhr, der letzte Bus zurück um 18.20 Uhr. Zwar gab es ein Jugendhaus im Ort, doch mein großer Bruder wollte nicht, dass ich dort aufkreuzte. Weil ich ihn bewunderte und tat, was er sagte – was später weitreichende Konsequenzen haben sollte –, dauerte es lange, bis ich mich über sein Verbot hinwegsetzte. So kam es, dass ich zum zweiten Mal in meinem Leben ein Pony als Ausweg meiner Misere ansah. Dieses Mal hatte es eben einen Motor und bewegte sich auf ballonartigen Stollenreifen vorwärts.
Was soll ich sagen? Ich gewann das Mofa nicht, ein anderer knatterte mit ihm nach Hause. Das Leben wollte mich nicht mit einem Surrogat abspeisen, ich sollte das Echte finden. Doch kann man das einem Jugendlichen klarmachen, für den schon wieder eine Welt einstürzte? Heute weiß ich, mein Weg zu den Pferden begann mit den beiden Tombolas. Die ersten Schritte meiner Reise brachten mich zwar kaum voran, aber es ging zumindest in die richtige Richtung.
3
Ob auf dem Rücken eines Hengstes, ob im Sattel einer Honda: Freiheit ist nicht nur für John Wayne da oder Peter Fonda!
Es gibt da dieses Lied von der Thommie Bayer Band, einer der alten Gassenhauer, die wir in unserer Jugend am Lagerfeuer sangen, mit einer verstimmten Klampfe in der Hand, bei der meistens eine Saite gesprungen war. Es heißt »Der letzte Cowboy« und erzählt von einem Mann, der im Saloon von Gütersloh sitzt, dort von der Freiheit träumt, von den Frauen, und von einem Pferd mit langer weißer Mähne, das er mit dem Lasso einfing, aber wieder frei ließ, weil er weiß, dass kein Geschöpf dieser Welt in Gefangenschaft glücklich sein kann. Blicke ich auf mein erstes Leben zurück, fühlte ich mich ebenso: wie ein Gefangener. Ich hatte ein Lasso um den Hals, an dem immer wieder gezogen wurde, was dafür sorgte, dass ich keine Luft mehr bekam. Ich drohte zu ersticken, und das im wortwörtlichen Sinne. Schon bei meiner Geburt hatte sich die Nabelschnur so fest um meinen Hals gezogen, dass ich kurz vor dem Erstickungstod stand und schon ganz blau angelaufen war. Später, in der Therapie, sprach man davon, dass es aus diesem Grund kein Zufall sei, dass sich meine Panikattacken immer in Form von Erstickungsanfällen zeigen und ich dadurch unter Angstzuständen leide.
Ein Sprichwort der Lakota-Indianer sagt: Erinnerungen sind wie ein Ritt durch die Nacht mit einer Fackel in der Hand. Das Licht beleuchtet den Pfad nur ein Stück, der Rest ist pechschwarze Nacht. Genauso empfinde ich, wenn ich zurückschaue. Vieles liegt im Dunkeln, aber der Weg ist sichtbar. Wenn ich ihn noch einmal gehe, kann ich nachempfinden, wie er mich von A nach B geführt hat.





























