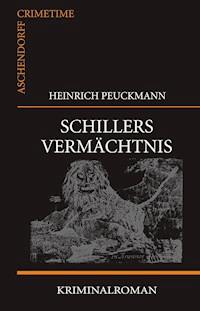Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Aschendorff
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
CHRISTIAN HENNECKE ist mittlerweile im deutschsprachigen Raum ein vielbeachteter Autor und geschätzter Gesprächspartner, wenn es um Fragen der Zukunft von Christentum und Kirche geht. Seine 'GLÄNZENDEN AUSSICHTEN' bleiben diesen drängenden Themen treu. Hennecke richtet seinen Blick vielfach über den deutschen Tellerrand hinaus und erzählt in persönlicher und unmittelbar verständlicher Art von neuen Gruppen, kirchlichen Initiativen und christlichen Aufbrüchen in Europa und rund um den Globus. Diese vielfältigen Erfahrungen im Kontext der Weltkirche weiß er für die Suche nach einer Zukunft von Kirche und Christentum hierzulande fruchtbar zu machen. Und so liegt die Stärke Henneckes sicher darin, dem realistischen Blick in die Gegenwart auch immer wieder eine hoffnungsvolle Zukunftsperspektive an die Seite zu stellen; denn 'ohne Vision verkommt das Volk'.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 442
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
CHRISTIAN HENNECKE
Glänzende Aussichten
Wie Kirche über sich hinauswächst
Vollständige Ebook-Ausgabe des im Aschendorff Verlag GmbH & Co. KG erschienenen Werkes Originalausgabe
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Copyright © 2011/2013 Aschendorff Verlag GmbH & Co. KG, Münster
ISBN der Ebook-Ausgabe: 978-3-402-19688-5
ISBN der Druckausgabe: 978-3-402-12853-4
Sie finden uns im Internet unter www.aschendorff-buchverlag.de
Inhaltsverzeichnis
Vorwort Bischof Dr. Felix Genn, Münster
I. Geschenkte Zukunft im Blick auf den Ursprung: Von der Gebärkraft einer Vision
1. »Seht, ich schaffe etwas Neues ...« (Jes 43,18)
2. Noch länger vor dem Jordan
3. Ohne Vision verkommt das Volk
4. Kirche wird österlich neu
5. Dem neuen Jerusalem entgegen
6. Was der Geist (auch heute) den Gemeinden sagt … .
7. Unheimliche Begegnung mit der Vision Gottes? ....
II. Vorgeschmack kirchlicher Zukunft: Stationen einer Entdeckungsreise
1. Oswalds Sterne
2. Wie Gott in Frankreich
3. Finding faith today: Begegnung mit John Finney
4. Matthäus 25 in Mexiko
5. Soul Side Linden: Welche Kirche suchen wir?
6. Im Osten viel Neues
7. Pariser Kirchenlandschaften
8. The American way of church
9. Wie Christ werden und bleiben
10. Katechese neu erleben und denken
11. Evangelisierendes England
12. Die Zeit des Meisters
III. Was vom Himmel kommt, muss aus der Erde wachsen: Erfahrungen mit Kleinen Christlichen Gemeinschaften
1. Stationen einer Reise: Orte und Erfahrungen
2. Weltkirchliche Lerngemeinschaft als Chance zur Inkulturation
3. Kleines Pastoraltagebuch aus Mumbai 2009
4. Eine Mystik für das Volk Gottes
5. Kirche bleibt im Dorf
6. Der fantastische sechste Schritt
7. Miteinander Kirche werden
8. Die Summerschool
9. Bukal ng Tipan
IV. Die Zeichen der Zeit im Licht der verheißenen Zukunft
1. Ahnungen einer Kirche im Werden: Prophetische Zwischenrufe
2. Was auf uns zukommt: Die postindividualistische Gesellschaft
V. Der kommenden Kirche entgegengehen: Weichenstellungen auf dem Weg zu einer neuen Ekklesiogenesis
1. Kirche wächst: Die österliche Perspektive
2. Gemeinsam einen Weg entdecken
3. Auf dem Weg zur Charismenorientierung
4. Eine Spiritualität des Volkes Gottes
5. Ein neues Miteinander
6. Kirche wird durch das Wort
7. Die eucharistische Mitte
8. Lokale Kirchenentwicklung
9. Wie wir den Übergang begleiten können
VI. Wie Abraham und Gideon die Zukunft erbten: Eine abschließende Wegbetrachtung
Anmerkungen
FÜR
Oswald, Fritz, Vijay, Dieter, Matthias, Bernd, Gaby, Mechthild, Angelika, Harald, Estela, Mark, Christoph, Dan, Martin, Marianne und die vielen Gefährtinnen und Gefährten auf dem Weg zu einer anderen Weise des Kirchewerdens
In besonderem Gedenken an Guido Brune
Vorwort
Die ersten Monate des Jahres 2010, in denen dieses Buch in Druck geht, zeigen ein Bild von Kirche, das von glänzenden Aussichten weit entfernt ist. Wer nur dem Titel des Buches begegnet, ohne seinen Inhalt aufzunehmen und zu studieren, könnte den Eindruck haben: Hier redet jemand schön, macht sich froh, weil er die Härte der rauen Wirklichkeit nicht erträgt oder sogar bewusst ausblendet.
In einer bedrängenden Situation ist es für einzelne Personen wie auch für Gruppen und Gemeinschaften hilfreich, in Distanz zu treten und Abstand zu nehmen von dem, was unmittelbar vor Augen liegt, und dies nicht, um zu verdrängen, sondern das Hier und Jetzt in den größeren Horizont zu stellen, vor dem sich das Leben abspielt. Gerade für einen glaubenden Menschen ist dies eine immer wieder notwendige geistliche Übung, sich zu fragen: In welchem größeren Horizont stehe ich und auf welchen Horizont hin habe ich das Heute meines Lebens zu gestalten? Wer auf den Horizont schaut, hat eine Aussicht, und er weiß selbst in einer nebligen Situation, dass es mehr gibt als das, was er im Augenblick sieht. Dies gilt in besonderer Weise für die Kirche.
Regens Dr. Hennecke hat in den zurückliegenden Jahren durch einige Publikationen der pastoralen Landschaft in der Bundesrepublik geholfen, diese Distanzübung zu leben. Er versteht sich ausdrücklich nicht als Pastoraltheologe, sondern als Theologe und geistlicher Mensch, als Priester, der die Erfahrungen, die er im Alltag des Lebens mit und für Gemeinden macht, zurückbindet, also reflektiert, an die Sendung und den Grundauftrag, dem die Kirche verpflichtet ist.
In diesem Zusammenhang möchte ich ein Wort von Kardinal de Lubac erinnern:
»Nicht die Zukunft zu erraten ist wichtig, sondern zu sehen, was die Gegenwart fordert. Nicht seine Chancen zu berechnen tut not, sondern seine Sendung zu bedenken« (Henri de Lubac, Glaubensparadoxe, Einsiedeln, 1972, 40/41).
Zunächst könnten der Titel dieses Buches und die Perspektiven, die es entwickelt, diesem Wort des großen französischen Kirchenlehrers der Gegenwart widersprechen. Zugleich aber wird der aufmerksame Leser spüren, wie sehr der Autor bemüht ist, die Sendung der Kirche zu bedenken und zu helfen, damit jeder einzelne Christ, vornehmlich aber die, die hauptberuflich in ihr arbeiten, tun können, was die Gegenwart fordert. Allzu leicht ist man nämlich geneigt, nur das Negative, die Defizite, das, was schlecht ist, zu sehen. Dabei läuft man immer Gefahr, Aufbrüche zu übersehen und das, was »aus der Erde wächst«kleiner zu reden, als es an innerer Kraft enthält.
Wie in den bereits veröffentlichten Büchern von Regens Dr. Hennecke, so hilft er auch mit den hier vorliegenden Überlegungen, die Kirche im Jetzt wertzuschätzen und ihrer kommenden Gestalt in Hoffnung entgegenzugehen. Ich kann in diesem Zusammenhang von einer Erfahrung berichten, die ich am Rande einer Kommissionssitzung mit Regens Dr. Hennecke machen durfte. Wir hatten uns im Gespräch über die Situation der Kirche heute vorgenommen, diese Distanzübung zu machen und uns gegenseitig Erfahrungen zu vermitteln, in denen wir hoffnungsvolle Ansätze sehen, die der Herr der Kirche schenkt, damit sie weiterhin ihrer Sendung treu bleiben kann, am Aufbau des Reiches Gottes in dieser Welt zu arbeiten und dessen Keim in der Gegenwart zu sein, wie es das II. Vatikanische Konzil gesagt hat. Ich kann jedem Leser nur empfehlen, in einem guten Gespräch mit einem Glaubensbruder oder einer Glaubensschwester, eine solche Übung zu wiederholen. Es ist erstaunlich, zu welcher kreativen Phantasie der Geist Gottes jeden Einzelnen von uns bewegen kann, so dass wir wie Abraham und Gideon durchaus erahnen können, welche Zukunft Gott denen bereitet hat, die Ihn lieben – eine Zukunft im Hier und Jetzt.
12. März 2010
Dr. Felix GennBischof von Münster
I. Geschenkte Zukunft im Blick auf den Ursprung: Von der Gebärkraft einer Vision
1. »Seht, ich schaffe etwas Neues …« (Jes 43,18)
Es könnten Stationen einer Weltreise sein: Mexiko, Südafrika, Singapur, Indien, Philippinen, Taiwan, Brasilien, USA, Frankreich, Italien – aber es sind Orte, die für mich in den letzten Jahren ein Gesicht bekommen haben im Blick auf eine neue Gestaltwerdung der Kirche. Ein Gesicht durch Menschen, die ich kennen lernen durfte und die allesamt leidenschaftlich für einen neuen Weg des Kircheseins leben und arbeiten: für kirchlich verwurzelte Basisgemeinschaften, die aus der Schrift schöpfen und in ihrem Lebensumfeld diakonisch und missionarisch wirken, und für Kleine Christliche Gemeinschaften als konkrete Lebensgestalt der Kirche im Umfeld, dort, wo die Menschen leben und für diese Menschen da.
Es könnten auch Stationen auf einem ökumenischen Weg sein: der Kongress der Arbeitsgemeinschaft missionarischer Dienste in Leipzig und die Begegnungen mit den Kollegen im Haus Kirchlicher Dienste in Hannover, die Begegnungen mit dem anglikanischen Bischof Finney, die Beziehung zu Prof. Michael Herbst in Greifswald und den Bemühungen seines Instituts für die Erforschung der Evangelisation, die Kontakte zu Bill Hybels und zur von ihm gegründeten Willow Creek Community Church in Chicago – in all diesen Begegnungen treffe ich auf Menschen, die Kirche in einem existenziellen Aufbruch sehen und ihre Bemühungen lenken auf kleine Gemeinschaften, Zellgruppennetzwerke und Hauskreise, die nach außen wirken und der Gesellschaft dienen wollen. Bei aller Verschiedenheit ist hier eine Verbundenheit im Geist zu verspüren – und eine überraschende Erkenntnis: Die Herausforderungen der Kirchen wie die Lösungsansätze in der missionarischen Weltökumene sind sich überraschend ähnlich.
Es ist auch wie eine Landkarte der geistlichen und kirchlichen Bewegungen: Die Kontakte mit der Fokolarbewegung, der Gemeinschaft Emmanuel, der Schönstattbewegung, die Gemeinschaft S. Egidio, die charismatische Gemeindeerneuerung – überall treffe ich auf spirituell im jeweiligen Charisma gegründete Netzwerke kleiner Gruppen, die eine Vielzahl von lokalen und weltweiten Initiativen tragen. Diesen charismatischen Gleichklang bei gleichzeitiger Unterschiedlichkeit ihrer Charismen haben die geistlichen Gemeinschaften und Bewegungen ja schon entdeckt und auf europäischer Ebene sogar ökumenisch erweitert: Die großen Kongresse in Stuttgart 2004 und 2007 sind ein beredtes Zeugnis dafür.
Erfahrungen ganz anderer Art ließen sich ergänzen: Die katholischen Kirche in Lateinamerika wird herausgefordert durch das exponentielle Wachstum freier pfingstlerischer Kirchen. Es wäre zu einfach, nur auf die monetäre Unterstützung aus den USA zu verweisen, um ihr Wachstum zu erklären. Wahr ist nämlich auch, dass diese Kirchen sich als personale und überschaubare Gemeinden entwickeln und dort sind, wo die Menschen sind. Diese Beziehungsnähe im Lebensraum der Menschen spielt eine entscheidende Rolle auch für die Tragfähigkeit der Diakonie und Nächstenliebe. Die Förderung der kirchlich verwurzelten Basisgemeinden in dieser Perspektive einer wohnortnahen und beziehungsreichen Kirche, die spirituell im Wort Gottes gründet und mit der Gesamtkirche verbunden ist, ist ein wichtiges Anliegen der letzten lateinamerikanischen Bischofsversammlung in Aparecida:
»Die kirchlichen Basisgemeinden betrachten in der missionarischen Nachfolge Jesu das Wort Gottes als Quelle ihrer Spiritualität und die Orientierung durch ihre Hirten als Leitung, die sie in der kirchlichen Gemeinschaft verankert. Sie setzen sich mit ihrem evangelisierend-missionarischen Engagement unter den ganz einfachen und am Rande der Gesellschaftlebenden Menschen ein; sie machen die vorrangige Option für die Armen sichtbar. Aus ihnen sind verschiedene Dienste und Ämter für das Leben in Kirche und Gesellschaft hervorgegangen. Wenn sie in der Gemeinschaft mit ihrem Bischof bleiben …, werden die kirchlichen Basisgemeinden zu Kennzeichen der Vitalität in der Ortskirche. Wenn sie so gemeinsam mit den Gruppen der Pfarrei, den kirchlichen Vereinen und Bewegungen handeln, können sie dazu beitragen, die Pfarreien wieder lebendiger zu gestalten und sie zu einer Gemeinschaft von Gemeinschaften zu machen.«(Aparecida 2007, n179)
So ähnlich formulierten die asiatischen Bischöfe schon 1990 in Bandung:
»Die Kirche wird eine Gemeinschaft von Gemeinschaften sein, wo Klerus, Laien und Ordensleute einander als Brüder und Schwestern anerkennen. Sie sind gemeinsam versammelt und vereinigt um das Wort Gottes. Dabei teilen sie miteinander die frohe Botschaft und entdecken Gottes Wille für sich in ihrem unmittelbaren Lebensumfeld. Sie unterstützen sich gegenseitig in ihrem täglichen Leben. Es ist eine partizipierende Kirche, wo die Gaben und Charismen erkannt und aktiviert werden, um den Leib Christi aufzubauen, die Kirche in der Nachbarschaft.«(FABC, Bandung 1990)
Papst Johannes Paul II. formulierte seinerseits im Zusammenhang der Notwendigkeit einer Erneuerung des missionarischen Auftrags der ganzen Kirche:
»Die kirchlichen Basisgemeinden ... sind Gruppen von Christen, die sich auf familiärer Ebene oder im begrenzten Umkreis treffen. Sie kommen zusammen um zu beten, die Heilige Schrift zu lesen, das Glaubenswissen zu vertiefen und menschliche und kirchliche Probleme im Hinblick auf ein gemeinsames Engagement zu besprechen ... Basisgemeinden sind Ausgangspunkt für eine neue Gesellschaft, die gegründet ist auf eine ›Zivilisation der Liebe‹. Sie werden zum Sauerteig zur Umwandlung der Gesellschaft.«(Redemptoris Missio 51)
Diese – auch lehramtliche – Konsonanz ist überraschend. Wo Gott seine Kirche erneuert, wo der Geist Gottes das Angesicht der Erde erneuert, dort geschieht das offensichtlich im Gleichschritt. Bei allen Unterschieden zeichnet sich ein Weg und eine Gestalt ab, die überraschend ähnliche Strukturelemente aufweist: Überall dort wächst Kirche, wo diese nicht gesteuerten Aufbrüche rezipiert werden – und ihnen Raum gegeben wird.
Der weltkirchliche Resonanzraum kirchlicher Erneuerung, der an verschiedenen Strängen entwickelt werden könnte, soll hier nur an einem Beispiel kurz skizziert werden: an dem komplexen Entwicklungsweg der Kleinen Christlichen Gemeinschaften1.
— Ein afrikanisch-deutscher Erstimpuls … —
Schon in den 60er Jahren, im Umfeld des Konzils, waren – wie auch in Lateinamerika – in Ostafrika an vielen Orten Kleine Christliche Gemeinschaften entstanden. Bei aller Vielfalt nahmen sie dennoch alle einige Grundakzente des II. Vatikanums auf: Vor allem ging es darum, dass möglichst viele Christinnen und Christen einen Zugang zum lebendigen Wort Gottes finden konnten. Auf diese Weise konnte – in den großen pastoralen Räumen Ostafrikas – Kirche wachsen, die das gemeinsame Priestertum aller Gläubigen ernst nahm.
Die beiden Regensburger Priester Fritz Lobinger und Oswald Hirmer waren Ende der 50er Jahre nach Südafrika gekommen. Nach zehn Jahren Missionsarbeit wurde ihnen deutlich, dass eine bayrisch-barocke Kirchengestalt kein Weg in Südafrika war. Nach ersten Versuchen kehrten beide nach Münster zurück und promovierten in Pastoraltheologie über die Fragen der Gemeindeleitung und Gemeindebildung. Dabei nahmen sie Impulse der gemeindetheologischen Diskussion auf, die in Deutschland durch F. Klostermann, K. Rahner und andere in den sechziger Jahren entwickelt worden waren. Die eigentliche Arbeit in Südafrika begann danach.
Angesichts der geringen Zahl der Priester und der Gefahr, dass auch der Einsatz der Katechisten zu einer Versorgungskirche nach europäischen Muster führte, stellten sich im wesentlichen drei Fragen, die die deutschen Priester (und späteren Bischöfe)bewegten: Wie können alle Gläubigen einen eigenen Zugang zum Wort Gottes erhalten? Wie kann Kirche in den Dörfern wachsen und am Leben bleiben? Wie kann das gemeinsame Priestertum aller Gläubigen sich entsprechend den Charismen und den Gaben der Einzelnen entfalten?
Das »gospel-sharing« – die »Gemeinschaft im Wort Gottes« – entwickelte sich »zufällig« nach vielen Versuchen und Flächentests. Der Weg der sieben Schritte erwies sich aber sehr schnell als ein Weg, der eine große Resonanz bei den Menschen hatte. Gleichzeitig war der Anspruch viel größer: es ging um die Erneuerung der Kirche im Geist des II. Vatikanums – gerade auch im Blick auf die gesellschaftlichen Herausforderungen in Südafrika. Die Vision, die die beiden Priester gemeinsam und im Dialog mit vielen anderen entwickelten, ging – so wird hier schon deutlich – weit über die eine Restrukturierung der Kirche in ein Netzwerk Kleiner Gemeinschaften hinaus.
Wer Oswald Hirmer und Fritz Lobinger kennen lernen durfte – und mir ist das geschenkt worden –, dem wurde vielleicht deutlich, dass es hier um weit mehr ging – und geht! – , als um eine pastorale Methode oder einen bibelpraktischen Impuls. Auf vielen Reisen nach Deutschland waren das BibelTeilen und die Kleinen Gemeinschaften als pastorale Neuheiten mit »im Gepäck«, aber sie wurden von ihrer umfassenden pastoral-visionären Perspektive losgelöst und »eingepasst« in das Prokustesbett deutscher Gemeindegefüge. Damit wurden sie aber auch unfruchtbar gemacht – und stellen ein Beispiel dafür dar, wie Inkulturation nicht gelingen kann.
— ... nach Asien —
Anders erging es Oswald Hirmer in Asien. Seit den 90er Jahren nahmen die asiatischen Bischöfe den südafrikanischen Impuls auf. Auf der Versammlung der asiatischen Bischöfe 1990 wurden die Kleinen Christlichen Gemeinschaften als ein Weg der notwendigen Erneuerung der asiatischen Kirche benannt. Diese Erneuerung war aber fundamentaler angelegt und entsprechend sollten die südafrikanischen Impulse auch in den asiatischen Kontext übertragen werden. Ein solcher Weg der Inkulturation braucht Zeit. In der Tat siedelte Oswald Hirmer für mehrere Jahre nach Singapur um. In Singapur, in den Philippinen, in Indien und Korea vor allem wurde dann in den nächsten Jahren in sorgfältiger Weise der zugrunde liegende Pastoralansatz weiterentwickelt und in die verschiedenen asiatischen Kulturräume inkulturiert. Eigene Pastoralinstitute und Fortbildungsstätten entstanden, eine umfassende Visionsarbeit mit Bischöfen und Priestern und »pastoral workers« entwickelte sich, die Ansätze einer von diesen Erfahrungen geprägten Theologie und Ekklesiologie entwickelten sich.
Für mich sind die Begegnungen und Freundschaften, die mit Wendy Louis (Singapur), Fr. Thomas Vijay (Indien), Estela Padilla und Fr. Mark Lesage (Philippinen) und Cora Mateo (Taiwan)entstanden, noch wichtiger geworden als die Übernahme eines pastoralen Konzepts. Denn sie sind lebendige Zeugen einer Entwicklung, Experten eines Inkulturationsprozesses mit einem langen Atem. Bei ihren Besuchen in Deutschland (und bei manch einem Gegenbesuch)konnten wir in ihnen Gesprächspartner finden, die um die Herausforderungen des Ansatzes in doppelter Weise wussten:
Zum einen war klar, dass der hier zugrundeliegende Gesamtansatz das Antlitz der Kirche und ihre Gestalt verändert und dabei Maß nimmt an den Intuitionen des Zweiten Vatikanischen Konzils und der Konsonanz weltkirchlicher Aufbrüche. Allein schon diese Dimensionierung der Pastoral ist eine große Herausforderung: Es geht um einen ekklesiologischen und ekklesiopraktischen Paradigmenwechsel, der hier in praktischer »kleiner Münze« umgesetzt wird. Die vorausliegenden Bewusstseinsänderungen brauchen ihre Zeit – und ihre Bemühungen, denn sie kommen nicht von selbst.
Zum anderen haben sie immer darauf verwiesen, dass sie wohl Grundprinzipien und Leidenschaft an uns Europäer weitergeben können, dass der eigentliche Inkulturationsprozess aber in unseren Händen liegen muss.
Wenn man bedenkt, welche langen Wege dieser Ansatz seit den 60er Jahren gegangen ist, und dabei um die ganze Welt gekommen ist, dann wird auch deutlich, dass ein solcher Erneuerungsprozess, der zugleich ein immerwährender Prozess der Inkulturation ist, leidenschaftliche Visionäre braucht, die nicht mit kurzfristigen Erfolgen rechnen.
— ... und nach Europa? —
Genau das stellte sich als Herausforderung für diesen Pastoralansatz in Europa heraus. Erst in den letzten Jahren wurde deutlich, dass die Idee der Kleinen Christlichen Gemeinschaften und das so genannte BibelTeilen nicht einfach als neue Pfeile im Methodenköcher der Gemeindeentwicklung dienen können. Der Reiz des Neuen und Exotischen hat ja nur eine kurze Halbwertzeit. Offensichtlich findet die Idee dort immer mehr Resonanz, wo die Krisensymptome des volkskirchlichen Gemeindeparadigmas überdeutlich werden. Zwar ist nicht zu erwarten, dass die Perspektive der Kleinen Christlichen Gemeinschaften in den nächsten Jahren zum Durchbruch kommen kann. Aber in den letzten fünf Jahren sind an verschiedenen Orten Experimente gestartet worden. Sie stellen den spannenden Versuch eines Inkulturationsprozesses dar. Angesichts der weltkirchlichen Erfahrungen stellen sich zunächst sehr viele neue Fragen. Die Mitwirkung an diesem Prozess ist sehr herausfordernd. Offensichtlich braucht man viele Fehler und Versuche, um einen echten visionären Weg gehen zu können. Inkulturationsprozesse sind offene Wege des Geistes, die es zu riskieren gilt.
— Uniformität oder Inkulturation? —
Aber es gibt eine intuitive Abwehr gegen Impulse, die einen Paradigmenwechsel erahnen lassen. Man könnte formulieren: Je intensiver dieser Abwehrprozess ist, desto klarer ist, welche revolutionären Potentiale in einer neuen Idee stecken. Natürlich gibt es Versuche verkürzter Inkulturation, die lediglich die angebotenen Ideen und Erfahrungen in das schon bestehende Eigene integrieren wollen. Dieser Versuch der Assimilation ist verständlich, wird aber dem Anspruch des Pastoralansatzes, der hinter dem Bemühen um Kleinen Christlichen Gemeinschaften steht, nicht gerecht. Die Ergebnisse solcher Assimilation sind ernüchternd – und bestärken die eigenen Vorurteile: eine selfullfilling prophecy. Schnell wird aus dem BibelTeilen eine naive Methode der Bibelarbeit, die sogar gefährlich sein kann, schnell werden aus den Kleinen Gemeinschaften Kuschelgruppen und Selbsthilfegruppen des Glaubens, schnell wird aus einer kirchlichen Spiritualität eine rein individuelle geistliche Tankstelle.
Es lohnt sich aber, die weltkirchliche Perspektive nicht vorschnell abzuwehren. Es lohnt sich, der eigenen zuweilen provinziell amutenden Enge zu entgehen und sich zu öffnen dafür, dass wir in unserer katholischen Perspektive wirklich eine weltkirchliche Lerngemeinschaft sind. Gerade am Thema einer lokalen und partizipativen Kirchenentwicklung lässt sich entdecken, dass in einer solchen weltkirchlichen Lerngemeinschaft die Aufnahme einer Gestaltrevolution der Kirche nicht durch eine naive Übernahme der Ideen gelingt, sondern durch einen langen Prozess der Inkulturation. Dieser Prozess ist an der Zeit. Er ist spannend und voller Risiken. Er macht die Herzen brennen – ein echtes Abenteuer des Geistes, an dem wir teilnehmen dürfen.
2. Noch länger vor dem Jordan
Es ist eine Schlüsselsituation in der Kundschaftererzählung, wie sie Numeri 14 berichtet. Wie kommt es, dass das Volk Gottes, angesichts der reichen Früchte aus dem verheißenen Land, sich nicht entscheiden kann, der Verheißung zu folgen und ins verheißene Land einzuziehen? Diese paradoxe Situation soll noch einmal intensiv in den Blick genommen werden. Sie verheißt Erkenntnisse, gerade angesichts der Wahrnehmungen, die sich im Blick auf die aktuelle Situation des Übergangs aufdrängen.
— Im Prinzip weiter so! —
Denn was ist zu beobachten? Auf der einen Seite beschäftigt sich die Kirche vornehmlich mit der strukturellen Umgestaltung. Ein geordneter Rückzug wird geplant und durchgeführt: Zusammenführungen von Pfarreien, Bildung von Seelsorgeeinheiten, Umwidmung und Profanierung von Kirchen, weniger Einstellungen von pastoralem Personal – all das ist schmerzlich und protestfördernd bei vielen Christen angekommen. Gleichzeitig ist seit zehn Jahren die Rhetorik der missionarischen Kirche en vogue – ohne dass leicht erkennbar würde, welche Strategie dabei einzuschlagen wäre. Verwunderlich ist: Piloterfahrungen und erste Früchte liegen vor – aber die Hauptsorge liegt eher darin, wie das, was bisher getan wurde, auch weiterhin getan wird. Es ist deutlich, dass für einen Neuaufbruch der Pastoral oft Energie und Kraft fehlt – vor allem fehlt eine Vision, vor allem fehlen Visionäre. Was vorliegt, ist der Versuch, das bestehende Setting weiterzuführen. Und das gelingt an vielen Stellen durchaus überzeugend.
Gleichzeitig wird die Spannung größer. Denn mit der Veröffentlichung der Ergebnisse der Sinus-Milieustudien wurde deutlich, dass das bestehende pastorale Gefüge zwar noch funktionieren kann – auch über weitere Jahrzehnte – , dass so aber ganz deutlich die jüngere Generation aus dem Blick verschwindet.
Die jüngere Generation: Wer genau hinschaut, entdeckt das, was die jüngsten Studien wie der Religionsmonitor belegen. Zu dieser Generation gehören im wesentlichen alle unter sechzig. Der Bruch mit dem selbstverständlich übernommenen Glaubenserbe ist kein neues Ereignis – »Pilger und Konvertiten« sind inzwischen die große Mehrheit der Christen. Nur noch ein kleiner Teil der Katholiken findet sich in der – oft sehr persönlich modifizierten – Glaubenspraxis katholischer Kerngemeinden.
Das mag all jene erschrecken, die sich so intensiv um die gemeindlichen Aktivitäten bemühen. Und es wird nicht gerne wahrgenommen. Und in der Tat: Sind es nicht weiterhin die kleiner werdenden und dennoch großen Zahlen am Sonntag und in den Gruppen und Verbänden, die das Leben unserer Kirche ausmachen? Und sind nicht vielgepriesene Aufbrüche mikrobische Randerscheinungen?
Einem deutschen Bischof wurde zu seinem Abschied im Jahr 2008 ein wunderschöner Bildband überreicht. Er beschrieb einen Tag – den Geburtstag des Bischofs – im Leben des Bistums. Wer dieses wunderbare Buch durchblättert, der wird angesichts des hier deutlichen Reichtums und der überbordenden Fülle des kirchlichen Lebens fragen, aus welchem Grund hier irgendein Handlungsbedarf zur Veränderung besteht. Warum darf nicht alles so weitergehen, wenn weiterhin so volles Leben allerorten zu beobachten ist?
Das ist zweifellos genauso wahr wie das Gegenteil. Je nach Blickweise wandelt sich das Bild. Taufe und Erstkommunion, Firmung und Trauung, Feier der Gottesdienste, Leben und Engagement von Gruppen machen keineswegs den Eindruck, dass hier etwas nicht stimmt: weiterhin Fülle.
So erklärt sich aber auch, dass alles getan wird, um diesen Zustand und dieses Leben zu erhalten. Bei geringer werdenden Zahlen von Priestern, Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, bei laufend geringer werdenden Zahlen von Gottesdienstbesuchern werden dann strukturelle Maßnahmen in den Mittelpunkt gestellt. Während die Gestalt und das Gefüge kirchlichen Lebens als Konstante gilt, ändern sich nur die Strukturen: Pfarreien werden größer, die Zahl der Kirchen nimmt ab. Und was der Pfarrer nicht mehr machen kann, das machen jetzt die Ehrenamtlichen. Haben die nicht immer noch dem Pfarrer bei seinen Aufgaben geholfen?
— Und warum missionarisch sein, warum Neues wagen …? —
Hingegen gibt es ein weitverbreitetes Unverständnis: Warum sollten wir angesichts einer solchen Lebendigkeit missionarisch sein? Warum Neues wagen? Warum noch etwas Neues dazutun? Sind wir nicht schon mit allen Kräften damit beschäftigt, das Bewährte zu bewahren? Angesichts der strukturellen Herausforderungen geht es doch zunächst darum, den Bestand zu sichern und zu begleiten. Es kann keine missionarische Priorität geben, wenn alle Kraft darin steckt, jetzt die mehrfache Anzahl von Taufen, Kommunionen, Beerdigungen gut zu gestalten, die Gruppen und Verbände miteinander in Verbindung zu bringen – die Gebäude zu finanzieren.
Im Frühsommer 2008 durfte ich bei einem Prozess der Prioritätenfindung in einem Dekanat mitwirken. Ein interessanter Prozess. Die jeweiligen Pfarreien hatten in einer Gruppenarbeit unter sich jeweils fünf Punkte zu benennen, wo etwas wächst, wo etwas stirbt, wo etwas irritiert. In einem zweiten Schritt sollten sie klären, welche drei Prioritäten und welche eine Posteriorität zu setzen wäre.
Ganz überraschend waren die Ergebnisse dann auch nicht: während klassische Gruppen und Verbände, gewohnte Muster gemeindlichen Lebens im Rückgang, ja Sterben begriffen waren, wuchsen einige Initiativen, die neu dazugekommen waren. Dennoch wurde deutlich, dass eine Prioritätensetzung, und schon gar eine Posterioritätensetzung nicht möglich waren. Es gab auch hier – in einem Dekanat, das sich seit mehreren Jahren auf einen Weg der Bewusstwerdung der veränderten Situation befindet – eine klare Option für die Weiterführung des Bewährten.
Das gilt aber für alle Ebenen kirchlichen Lebens. Beispiele sind Legion. Die Personalplanung vieler Diözesen orientiert sich weithin an der angenommenen und zukünftig stark abnehmenden Zahl der Pfarrer und auch die Strukturplanung orientiert sich daran. Mit anderen Worten kommt dies der Weiterführung des Bestehenden bei gleichzeitiger Ausdünnung gleich. So geschieht es auch an anderen Orten der Pastoralplanung: Ob es um den Erhalt theologischer Fakultäten oder von Priesterseminaren geht, ob es um Fragen des konfessionellen Religionsunterrichts geht – immer wieder wird deutlich, dass das bewährte Gefüge bis zum Paradox ausgereizt und erhalten werden soll. – Ist das logisch? Ist das vernünftig? Die Antwort kann nur ein deutliches »Ja« sein.
— »In dieser Wüste werden sie sterben … «: Die dramatische Logik der Erneuerung —
An dieser Stelle unserer Überlegungen kommt die Kundschaftergeschichte erneut in den Blick, mit ihrer schon benannten Paradoxie. Eine kurze Erinnerung. Moses hatte Kundschafter gesandt, die in der Tat mit reichen und schweren Früchten zurückkehrten. Sie brachten auch Nachrichten aus dem verheißenen Land mit:
»Wir kamen uns selbst klein wie Heuschrecken vor, und auch ihnen erschienen wir so. Da erhob die ganze Gemeinde ein lautes Geschrei, und das Volk weinte die ganze Nacht …«(Num 13,33–14,1).
Und das schon gewohnte Murren beginnt. Der Glaube an Gottes Geschichtsmächtigkeit verlässt das Volk erneut. Wieder neu orientiert sich der Blick an der bewährt-verklärten Vergangenheit. Gott reagiert. Aber nach inständigem Bitten Mose reagiert er barmherzig und verzeiht den Unglauben. Er hebt die Verheißung nicht auf. Das verheißene Land ist weiterhin Ziel Seines Weges mit dem Volk:
»Da sprach der Herr: Ich verzeihe ihm, da du mich bittest. Doch so wahr ich lebe und die Herrlichkeit des Herrn das ganze Land erfüllt. Alle Männer, die meine Herrlichkeit und meine Zeichen gesehen haben, die ich in Ägypten und in der Wüste vollbracht habe, und die mich jetzt schon zum zehntenmal auf die Probe gestellt haben und doch nicht auf mich gehört haben, sie alle werden das Land nicht zu sehen bekommen, das ich ihren Vätern mit einem Eid zugesichert habe«(Num 14,20–23).
Die Dramatik der Erfüllung der göttlichen Verheißung entfaltet der Herr jetzt in deutlicher Weise. Angesichts der unglaublichen Vergangenheitsprägung des Volkes und seiner Unfähigkeit an Gottes Verheißung zu glauben, erfüllt sich an diesem Volk die ihm eigene Prägung. In der Tat wird Gott sie nicht in das verheißene Land bringen, weil sie an Seine Verheißung nicht glauben. Aber er wird sie auch nicht umbringen. Es findet vielmehr das langsame und natürliche Sterben einer ganzen Generation statt – ein langsamer und schwieriger Prozess vor allem für die Jungen:
»Eure Söhne müssen vierzig Jahre lang ihr Vieh in der Wüste weiden lassen, sie haben solange unter eurer Untreue zu leiden, bis ihr alle tot in der Wüste liegt. So viele Tage, wie ihr gebraucht habt, um das Land zu erkunden, nämlich vierzig Tage, so viele Jahre lang … müßt ihr die Folgen eurer Schuld tragen … Ich, der Herr , habe gesprochen. Unwiderruflich werde ich es mit dieser ganzen bösen Gemeinde so machen, die sich gegen mich zusammengerottet hat: in dieser Wüste finden sie ihr Ende; hier müssen sie sterben«(Num 14,33–35).
Das ist eine dramatische Ansage – auch im Blick auf unsere Situation. Worin genau besteht hier die Untreue, die Gott seinem Volk vorwirft? Es ist ein Mangel an Vertrauen auf Gottes Zusage, sein Volk zu führen. Stattdessen regiert eine Angst: dass die Gegenwart und Zukunft des Volkes Gottes hinter der gewohnten Vergangenheit zurückbleibt. Es gibt eine Fixierung auf die Vergangenheit der Sklaverei, die nicht zulässt, sich auf Gottes Zukunft einzulassen. Diese Vergangenheit holt das Volk gewissermaßen in jeder schwierigen Situation – samt seinen Verantwortlichen – wieder ein und verhindert einen Aufbruch.
Gegen diese Prägung könnte Gott nur handeln, wenn er das Volk vernichten würde, wenn er ganz neu anfangen würde – und genau dies ist seine Absicht (vgl. Num 14,11–12), um doch mit einem neuen Volk seinen Verheißungsweg gehen zu können.
Da Moses ihn an seine Treue erinnert, gibt es nur einen anderen – den beschriebenen – Weg: Das notwendige Sich-Öffnen auf Gottes Zukunft geschieht durch eine Warteschleife. Die Zukunft kann erst betreten werden, wenn diejenigen, die sie durch ihre Prägungen verhindern, den Weg des natürlichen Sterbens gegangen sind. Warten muss dabei die nächste Generation: »Eure Söhne müssen vierzig Jahre lang ihr Vieh in der Wüste weiden lassen …«
Eine solche Strategie der Erneuerung wirft ein helles Licht auf unsere Situation: Dort, wo Prägungen überwiegen, wird offensichtlich eine Zukunftsverheißung nur im Blick auf die gewohnte Vergangenheit wahrgenommen. Die Angst zu verlieren und zu sterben, die Angst gewohnte Muster loszulassen, verhindert neue Wege, selbst wenn sie Gottes Zukunftswege sind.
Für mich ist diese drastische und dramatische Innovationstheologie der Schrift ein Schlüssel, die ambivalente Zukunftsorientierung der gegenwärtigen Situation zu verstehen. Offensichtlich besteht eine hohe Sorge um den Bestand eines Gefüges, die es Zukunftsorientierungen mehr als schwer macht. Aus dieser Sorge lässt sich die faktische Gestaltung pastoraler Umbrüche gut erklären: Die Strukturierung neuer pastoraler Räume, die langwierige und schrittweise Reduktion des Immobilienbestandes und der Institutionen geschieht zunächst intentional nicht, um Raum für das Neue zu eröffnen. Ganz umgekehrt wird versucht, das bestehende Gefüge auf einem niedrigeren Level weitestmöglich zu erhalten. Dass dies auf Dauer nicht gelingen kann, ist allen Verantwortlichen wahrscheinlich klar. Und dennoch werden alle Kräfte zurzeit in genau diesem Systemerhalt gesteckt – während neue Impulse es oft mehr als schwer haben.
Die Schrift gibt eine Perspektive an: Osffensichtlich ist es nicht möglich, das Systemgefüge und die damit verbundenen Prägungen zu verlassen, selbst wenn man das Neue schon erlebt und gelebt hat. Veränderung ist also dann nur in einem lebenslangen Prozess des Sterbens der Geprägten möglich – und umgekehrt wird der Einzug in das Neue erst für eine neue Generation möglich, die im Schutz der geprägten Generation heranwächst. Erneuerung ist also keine aufklärerisches Ereignis und auch nicht die Transformation eines Gefüges in ein neues Gefüge durch pastorale Strategien, sondern ein dramatischer Prozess des Sterbens und Neubeginnens, der sich über einen langen Zeitraum erstreckt.
Offensichtlich ist es nicht möglich, das geprägte Gefüge umzuformen. Es muss seinen Weg bis zum Ende gehen. Auf dieser Folie also wird deutlich, warum die Bemühungen der deutschen Kirche sich oft so überwiegend in Strukturprozessen erschöpfen: Was auch immer gestaltend geschieht, wird eingeholt von den systemischen Prägungen: Es geht darum, dass geprägte und normative Gefüge ererbter Christlichkeit mit all ihren systemischen Elementen weiterzuentwickeln.
In dieser Sichtweise lässt sich verstehen, warum bisher missionarische Gestaltungsversuche wie der Katechumenat, wie Kleine Christliche Gemeinschaften oder eine mystagogische Gestaltung der Sakramentenpastoral und vor allem auch die Ausrichtung der Katechese auf Glaubenwege Erwachsener sich noch nicht durchsetzen konnten. Wie auch die neuen geistlichen Gemeinschaften gehören diese Elemente missionarischer Pastoral auch einem anderen, noch kommenden Gefüge und einer neuen Gestalt der Kirche an – einer Zukunft, die Gott im Augenblick nur als Erstlingsfrüchte sichtbar machen kann –, denn wir stehen noch vor dem Jordan und sind im Moment damit beschäftigt, den Zerfall des milieuchristlichen Kirchengefüges durch einen geordneten Rückzug zu verlangsamen. Immerhin ist zahlenmäßig und ansichtig die milieuchristliche Kirchengestalt weiterhin erfolgreich – auch wenn ein Ende absehbar ist.
— Wie der Weg über den Jordan gelingen kann: Strategien der Erneuerung —
Ich denke inzwischen, dass ein anderer Weg zurzeit nicht denkbar ist – und auch nicht verantwortlich: Denn in der Tat braucht es eine vielfache Anstrengung. Zum einen muss gewürdigt werden, dass die prägende Gestalt der milieuchristlichen Variante ein stimmiges Gefüge für die unmittelbare Vergangenheit darstellt – und viele Christen diese Gestalt als normativ erachten. Noch über längere Zeit wird diese gewachsene Gestalt Bestand haben – und an manchen Orten langsam sterben.
Um auf eine andere Weise Christ zu werden und Kirche zu sein, bräuchte es eine Vision der Zukunft, die ihrerseits mehr ist als eine Fantasie oder Utopie, und die den großen biblischen Verheißungen entspricht. Woher kann eine solche Vision kommen, die nicht nur einfach eine liberalere oder konservativere Variante des Bestehenden ist? Sie entspringt nicht einfach den planerischen Überlegungen, die – wie schmerzlich deutlich wird – eher im Strukturellen stecken zu bleiben drohen. Ganz in der Logik der biblischen Erkenntnisse ginge es hier wohl eher darum, die Erstlingsfrüchte als Vorboten der Zukunft wahrzunehmen und ihnen das Wachstum zu ermöglichen. Damit meine ich vor allem jene Aufbrüche, die es in unserem Kulturraum eher schwierig haben. Genau die sperrigen Erfahrungen der Weltkirche sind gemeint wie auch charismatische Aufbrüche. Kirchengeschichtlich gehört es zu den Standards, dass Erneuerung der Kirche ein geistgewirktes Geschehen ist, das nicht ohne Widerstand des etablierten Kirchengefüges eine evangeliumsgemäße Antwort auf die Zeichen der Zeit gibt. Die Geschichte der Orden ist voll von solchen Beispielen, aber auch die jüngste deutsche Kirchengeschichte. Man denke nur an die Spannungen im Umfeld der Entstehung der Kolpingsfamilie. Das betrifft heute die Kirchlichen Bewegungen wie auch pastorale Ansätze der Weltkirche. Hier zeichnen sich Perspektiven einer Zukunftsgestalt der Kirche ab, denen auch mitten im verständlichen Erhaltungsprozess ein Schutzraum gegeben werden müsste.
Die Wege dafür öffnen sich paradoxerweise in dem Maß, in dem die strukturellen Maßnahmen des Downsizing greifen: Es entstehen Räume, die einer ungeahnten Vielfalt Raum geben und in denen deswegen Neues langsam – im Schutz des Alten – wachsen kann. Dies geschieht aber nicht von selbst. Zunächst müssen natürlich die Chancen wahrgenommen werden, die in diesen Neuaufbrüchen stecken, und zugleich müssen diese Neuaufbrüche und andere Piloterfahrungen immer wieder gesichtet und begleitet werden: Die Einrichtungen von Pilotprojekten und Austauschräumen erweisen sich in dieser Hinsicht als wichtig. Denn es wird nicht möglich sein, tout court eine Pastoral der Erneuerung zu gestalten. Wahrscheinlicher, aber auch realistischer ist es, wenn im Schutz des Bestehenden Neues langsam wachsen darf – dies setzt aber charismatische Personen und Piloterfahrungen voraus.
Dabei wird sich zeigen, dass die unveränderliche und substantielle Tradition des Glaubens zu unterscheiden ist von den geschichtlichen und zeitgebundenen Gestaltwerdungen dieser Tradition. Denn es werden sich – so zeigt die aktuelle Situation deutlich – neue Gestaltungen und Gestalten des Christseins, Christwerdens und Christbleibens inmitten der bewährten, aber zu Ende gehenden Gestalt des Kircheseins entwickeln. Es ist eben nicht zu erwarten, dass die derzeitigen Übergänge nur eine Modifikation der bisherigen Gestalt bedeuten.
Eine solche Übergangssituation ruft geradezu dazu auf, sich erneut der zugrunde liegenden Vision zu vergewissern, damit sowohl die Stärken der bewährten Gestalt wie auch das Aufscheinen einer neuen Gestalt wahrgenommen werden können, und damit es inmitten der Dramatik des Übergangs die begründete Hoffnung auf eine gottgeschenkte Zukunft geben kann: eben »Glänzende Aussichten«.
3. Ohne Vision verkommt das Volk
Der Tisch wird gedeckt. Der alte Diener stolpert bei jedem Schritt über den Kopf des Tigerfells, der auf dem Weg zur Anrichte liegt. Endlich ist alles bereitet. Miss Sophie, festlich gekleidet, betritt den Speiseraum. Am Tisch setzt sie sich – die anderen Plätze bleiben leer. Leer? Sie lässt sich von James die abwesend-Anwesenden vorstellen. Sie sind alle schon gestorben, und trotzdem sind sie ja »da«. Und das festliche Dinner findet statt, nur dass jetzt der Diener die Rolle des jeweils Abwesenden übernimmt. Zu essen gibt es nur für Miss Sophie, aber offensichtlich wird in jeder Runde ein Trinkspruch ausgesetzt – und die Trinkrunde ist real: James macht es möglich. Berechtigte Nachfrage von James: »The same procedure as last year, Miss Sophie?« »The same procedure as every year, James«, kommt es deutlich von Miss Sophie.
Aus dieser tragikomischen Konstellation lebt der Sketch »Dinner for one«, der bis zur Betrunkenheit des Dieners führt, der immer wieder – in seiner Rolle als einer der vier virtuellen Gäste – sein Glas erheben muss. Was hier stattfindet, ist aber auch ein Bild für manche Situation in der Pastoral.
Beispiele? Man denke an eingerillte Rituale der Sakramentenpastoral. Seit Beginn der 90er Jahre spätestens wird gewarnt vor der Alternative zwischen »Ausverkauf und Rigorismus« (Dieter Emeis). Immer wieder ähnliche Fragen stehen seit mehr als 20 Jahren auf der Tagesordnung: Warum eigentlich ist am Sonntag nach der Erstkommunion alles wie vor der Erstkommunion? Warum lassen sich Jugendliche nicht einbinden in Jugendgruppen? Darf man eigentlich Kinder taufen, wenn Eltern kaum mehr glauben?
Man denke aber auch an manche Hilflosigkeit der Verbands- und Gemeindearbeit. Seit Jahrzehnten altern Gemeindegruppen vor sich hin, geraten Verbände in immer größere Überalterung. Seit Jahrzehnten gelingt es Kinder- und Jugendarbeit nicht mehr, Menschen zu Christen zu formen. Seit Jahrzehnten sinkt die Zahl derer, die Gottesdienste mitfeiern – und seit Jahrzehnten definiert sich ohne eine klare Linie neu, was katholisch sei: Faktisch werden in den Gemeinden Standards klassischer Kirchlichkeit fallen gelassen: Da Kirchgang kein »Muss« mehr ist, bleibt subjektive Bedürftigkeit – und vielen Eltern, Kindern und Jugendlichen ist Christsein und Kirchlichkeit zum Hobby geworden, nicht zur Lebensform.
Seit Jahrzehnten engagieren sich viele Christinnen und Christen in den Gemeinden überzeugend nach innen – und es bleibt eine Blindheit nach außen, ins Umfeld hinein. Unter der Hand ist das Christsein oftmals privat gewordene Religiosität geworden.
Es ist kurzsichtig, mahnende, bedrohende und einfordernde Appelle zu lancieren. Es ist sinnlos, jeweils aktuelle Schuldige zu suchen. Aber es wäre wichtig, einmal grundsätzlich in die Lehre von »Dinner for one« zu gehen und von hierher die Situation zu deuten.
— The same procedure as every year … —
Die Tragikomik solcher Pastoral liegt darin, dass sie Verhältnisse voraussetzt, die nicht mehr da sind. Ja, denn auch die Perspektive milieuchristlicher Pastoral lebte von Voraussetzungen, die sie nicht schuf: die selbstverständliche und ererbte Christlichkeit, die alternativlos das Leben der Menschen prägte, gehört der Vergangenheit an. Der Rahmen, der dem Gesamtgefüge die Logik gab, geht verloren. Das ist keine neue Erkenntnis, aber das Gesamtgefüge der Kirchlichkeit lebte davon, dass Christsein für eine gesamte Gesellschaft gegeben war, und eigentlich nur noch ausgefaltet und später angemahnt werden musste.
Nach dem Abschmelzen der rahmengebenden Milieus und ihrer Voraussetzungen begann ein langer Kampf um den Erhalt des Gefüges. Man kann die Pastoralgeschichte der letzten vierzig Jahre als die Jahrzehnte einer solchen tragikomischen Bemühung sehen, die ihr tiefes Recht hat. Das Ziel war klar die Wahrung der sozialgestützten Selbstverständlichkeit des Christseins. Der Weg und die Methoden versprachen dies.
Zum einen wurden aus den Pfarreien »Gemeinden«: das Gemeindeleben in Gruppen und Verbänden sollte dafür sorgen, dass ein Milieu entstehen konnte, in dem Familien, Kinder, Jugendliche und Erwachsene den christlichen Glauben einüben und leben konnten – und so auch christlich durchgeprägt werden könnten. Aus der christentümlichen Vorgegebenheit wurde nun eine Wahlgemeinschaft, innerhalb derer sich Christwerdung ereignen können sollte.
Zum anderen wurden katechetische Prozesse entwickelt, die die Selbstverständlichkeit des Christwerdens über lange Jahrzehnte des selbstverständlich christlichen Milieus kondensierten in Kursen, die sowohl gruppendynamisch eine Gemeindeerfahrung als Gemeinschaftserfahrung simulierten und zum anderen in immer neuen Methoden die Defizite in Glaubensvollzug und Glaubensinhalt aufheben sollten.
Dass dies nicht gelingen konnte, hatte mit der Grundoption zu tun, die dem Grundmuster des »Dinner for one« entspricht: nicht die Grundvoraussetzungen wurden in den Blick genommen, sondern die Methode. Das Ziel war vorgegeben: Aus Getauften sollten geformte Christen werden.
Um im Bild zu bleiben: Das Dinner wurde weiter serviert, die fehlenden Gäste wurden zwar ersetzt, indem ein anderer ihre Rolle übernahm – ein richtiges Dinner aber war es nicht mehr – die grundsätzliche Voraussetzung hatte sich so geändert, dass nur noch eine tragikomische Imitation daraus werden konnte. Die grundsätzliche Frage, wie sinnvollerweise Gäste am Tisch sitzen könnten, wurde ausgeblendet.
Und ebenso wurde pastoral übersehen, dass nicht nur das gegebene Milieu sich auflöste, sondern damit auch die Bedingungen des Christwerdens sich fundamental änderten. Es geht eben nicht mehr um Integration von ungeformten Christen in eine bestehende und lebendige Gemeinschaft, sondern viel fundamentaler um Wege der Initiation und der Ekklesiogenesis.
Diese grundsätzliche Frage ist bis heute nicht eingeholt. Die seit den 90er Jahren ebenfalls neu ausgebrochene Diskussion um den Weiterbestand der Volkskirche und die Risiken einer elitären Entscheidungskirche bezeugen die Aporie. Und ähnlich gestaltet sich auch die jüngste Diskussion um das Thema der Vergemeinschaftung. In all diesen Überlegungen und Diskussionen ist übersehen, dass es nicht um Entschiedenheit versus Weite und auch nicht um Gemeinschaftlichkeit des Glaubens versus Individualität geht, sondern dass das Grundparadigma sich verändert hat. Auch die Diskussion um den Wert und Bestand der Gemeindetheologie übersieht dies zuweilen.
Was hingegen sich vollständig verändert hat, sind die Grundbedingungen des Christwerdens und des Christbleibens, also die Frage nach Initiation und Ekklesiogenesis. Der Übergang, in dem wir stehen, ist nicht zu gestalten als eine Weiterentwicklung, sondern als ein Paradigmenwechsel. Für diesen Wandel fehlt die Vision. Und ohne klare Vision verkommt das Volk.
— Ohne Vision verkommt das Volk (Spr 29,18) —
Was ist konkret damit gemeint? Es ist offensichtlich, dass angesichts fundamentaler Übergänge die herkömmlichen Wege des Christwerdens und Kirchewerdens versagen, und es ist zugleich offensichtlich, dass die sich abzeichnenden neuen Wege des Christwerdens und Kirchewerdens nicht verstanden werden, wenn sie in die gewohnten Parameter eingeordnet werden.
Zunächst fehlt eine Einsicht in diesen fundamentalen Umbruch. Das Spiel und die Spiellogik bleiben dieselbe, obwohl die Früchte ausbleiben. Es geht darum, gemeinsam die Einsicht zu wagen, dass wir in einem solchen fundamentalen Umbruch stehen. Dies ist ein langwieriger Prozess, der nur gemeinsam gewagt werden kann. Er ist aber die notwendige Voraussetzung dafür, sich für eine neue Perspektive zu öffnen.
Es ist geradezu fatal, wenn in den vergangenen Jahren auf kirchensoziologischer Ebene wie auch auf kirchenamtlicher Ebene immer wieder von der Krisis der Gemeinde gesprochen wird und dies schon geradezu mit aufreizender Selbstverständlichkeit, und andererseits kein Bewusstwerdungsprozess auf lokaler Ebene gewagt wird. In diesem Licht erscheinen manche derzeitigen Strukturmaßnahmen in der Tat als visionsloses Kleinkürzen, und es ist verständlich, wenn Ehrenamtliche sich dann als Lückenbüßer vorkommen. Eine Logik des langsamen Untergangs mit all den nicht verarbeiteten Trauerprozessen erscheint hier als normal.
Und umgekehrt wird – »the same procedure …« – mühselig weiter gearbeitet, mit einer ungeheuren Frusttoleranz. Denn dass angesichts des fundamentalen Umbruchs der Rahmenbedingungen mehr als spontane Erfolgsmeldungen möglich sind, ist eben nicht zu erwarten. Der Trend zum langsamen Auslaufen kehrt sich nicht um.
Schließlich können die Früchte der kommenden Kirchengestalt nicht entdeckt werden. Im Gegenteil werden sie als schwierig, ja als sektiererisch und nicht katholisch abgewertet. Die Kritik an den geistlichen Gemeinschaften, am Weltjugendtag und an neuen Impulsen der Kirchwerdung einerseits, das Unverständnis für Wege des Katechumenats andererseits sprechen hier eine deutlich Sprache: Es fehlt Einsicht in das Woraufhin und also in die kommende Wirklichkeit und eine Einsicht in das Wovonher, also der prägenden Leitvision einer milieukirchlichen Gestalt des Christentums und den Gründen ihres Endes.
So verkommt das Volk, weil die grundlegenden Perspektiven, die grundlegende Vision einer gottgeschenkten Zukunft nicht vermittelt werden. Mir scheint, dass die erste Bemühung deswegen darin liegen müsste, diese grundlegende Vision des Christwerdens und Kirchewerdens, die uns geschenkt ist, zu vergegenwärtigen, um von hier aus den Übergang gestalten zu können. Aber: Wie könnten wir diese Vision vergegenwärtigen?
— »Keep the vision clear« —
In seiner unnachahmlichen Art hat Bill Hybels, der Gründer der freikirchlichen Willow Creek Community Church in Chicago, für mich deutlich gemacht, worum es uns gehen muss. Stimmen unsere Beobachtungen, und stimmt unsere Grundüberzeugung, dass Gott seinem Volk einen Weg auch heute in die Zukunft bahnt, dann käme alles darauf an, die Vision eines erneuerten Gesamtgefüges wahrnehmen zu lernen. Und dies kann in drei Schritten geschehen.
Zum einen sind die »Erstlingsfrüchte« nicht nur als »exotische Meteoriten« einer fremden Welt abzuschirmen oder auf ihre Brauchbarkeit für die bestandswahrerischen Bemühungen zurechtzuschneiden, sondern es ginge darum, sie wahrzunehmen als Hinweise auf eine Zukunftsgestalt des Christentums, und ihr innovatives Potential zu entdecken und in unserem Kontext zu entwickeln2.
Zum anderen ginge es darum, an möglichst vielen Orten mit möglichst vielen Menschen gemeinsam in eine Visionsarbeit einzutreten. Dabei ist zu bedenken, dass in den vergangenen Jahrzehnten diese neue Gesamtgestalt des Christwerdens sich auch schon in vielen Biographien der Generation der unter Sechzigjährigen abzeichnet. Das ist mir deutlich geworden im Blick auf viele pastorale Mitarbeiter in meiner Generation. Dort, wo es gelingt, in ein Gespräch über die Ursprünge und Ideale ihrer Sendung einzutreten, stellt sich oft heraus, dass die innerlichen Antriebe nicht im Blick auf den Bestandserhalt einer milieuorientierten Kirche ans Licht kamen. Gleichzeitig ist die vielfache Enttäuschung pastoraler MitarbeiterInnen auch zu verstehen als Reaktion auf die Ausbildung zum pastoralen Bestandswahrer und die inneren Zwiespalte, die sich im Blick auf die eigene Vision ergeben hatten. Der Ausstieg in Nebenfelder der Pastoral oder auch die Spezialisierung auf kategoriale Seelsorge ist ein unmittelbares Resultat. Ähnliches lässt sich auch konstant seit mehr als dreißig Jahren an der latenten Unzufriedenheit in der Priesterausbildung feststellen. Es wäre unberechtigt, den Ausbildern mangelnde Sensibilität für die sich verändernde pastorale Situation vorzuhalten. Was hingegen fehlt, ist die gemeinsame Zielvision, die nur im geduldigen Hinhören und Anschauen der Biographien und Früchte gelingen kann.
Es braucht also Räume, in denen sowohl die Erstlingsfrüchte der Zukunft in visionärer Perspektive gehoben und entfaltet werden, als auch die inneren Visionen der Akteure in den Blick genommen werden müssen. Und schließlich braucht es einen Blick auf die biblische Ursprungsvision, die norma normans grundlegend für die kommende Gestalt des Christwerdens und des Kircheseins ist.
Mehr als die Fragen pastoraler Methodik und der Bereitstellung pastoralen Handwerkszeuges braucht es heute zentral diese vielgliedrige und nachhaltige Bemühung um die Vision, ohne die in der Tat alle pastorale Praxis blind wird: Auch wenn alles richtig wäre, wäre alles falsch.
4. Kirche wird österlich neu
Frankreich, Ende der 50er Jahre, in einem kleinen Dorf. Alle sind erblich katholisch. Milieukatholizismus plus Sozialkontrolle durch den Bürgermeister. Alle in der Kirche, vorne die Reichen, hinten die Armen… Die Fastenzeit beginnt, und es stürmt. Eine Frau mit einem Kind kämpft sich über den steilen Fussweg ins Dorf, blaurot gekleidet (irgendwie erinnert sie ikonographisch an Maria). Sie eröffnet ein Schokoladengeschäft, selbstgemachte Spezialitäten. Die Story beginnt.
Je länger der Film »Chocolat« dauert – er spielt durch die gesamte Fastenzeit –, desto mehr zeigt sich hier eine Parabel für ekklesiale Entwicklung. Auf der einen Seite die traditionelle Gemeinde, die ›innerlich steif‹ überhaupt nicht mit dem Tabubruch eines Schokoladengeschäfts in der Fastenzeit umgehen kann, mit einer selbstbewussten und emanzipierten Alleinerziehenden, die auch noch dazu sonntags nicht in die Kirche geht. Auf der anderen Seite sammelt sich bei ihr eine andere Gemeinschaft: die Gemeinschaft der Armen und Ausgestoßenen, der Leidenden, der Kinder, der Verrückten: und alle werden aufgenommen und mit Schokolade getröstet.
Die Geschichte spitzt sich dramatisch zu, und ist natürlich vor allem und auch eine Liebesgeschichte. Und dennoch ist sie auch die Geschichte des Übergangs der Gesellschaft und der Kirche in ihr. Denn während bislang die Gesellschaft in sich geschlossen und homogen war (und es auch nichts anderes gab), so kehrt mit der Provokation der Fastenzeitchocolaterie und der Frühhippies um Johnny Depp eine Pluralität, eine Selbstreflexivität und eine Wahlmöglichkeit ein, die bislang nicht zu denken war.
Und jene »Kirche von unten«, die sich in der Chocolaterie bildet, ist einfach nicht zum Aushalten: der Blick auf das Schicksal des Einzelnen, die Sorge um die oft verborgene Not, die Publikation der Heuchelei – all das hatte es noch nie gegeben. Unerhört.
Die Dynamik der Erzählung verdichtet sich in der Karwoche in einer dramatischen Konfrontation, in der die Sympathien klar verteilt sind: gegen die formalistisch-traditionelle Gesellschaft und Kirche steht die Menschlichkeit, Liebe und Zugewandtheit der »Kirche der Chocolaterie«. Und dann kommt Ostern. Im Pascha der Osternacht wird vom Bürgermeister, dem obersten Sozialcontroller der kirchlichen Gesellschaft, die Chocolaterie überfallen – doch er erliegt der dortigen Versuchung. Und es wird Ostersonntag. Fest der Auferstehung. Die Kirche ist gefüllt, der Pfarrer predigt über die Freiheit und die Liebe. Und auf dem Dorfplatz treffen sich alle zum Fest. Happy End, wie immer? Nein, ein Beispiel für die neue Vielfalt, die sich im eucharistischen Fest entdecken lässt und es bereichert.
— Wie im Himmel —
Schweden. Irgendwann Ende des Jahrtausends. Der berühmte Dirigent zieht sich zurück in sein kleines schwedisches Heimatdorf. Herzschaden. Keine Fortsetzung der Karriere mehr möglich. Langsam wird er wieder heimisch. Und natürlich bekommen die Menschen bald mit, dass ihr berühmtester Sohn zurückgekehrt ist: in die Provinz, in ein Dorf, dass aus einer traditionellen Stabilität lebt; in ein Dorf, in dem die Modernität unter dem Deckmantel der Tradition einkehrt, in dem Missbrauch, Gewalt und Heuchelei verborgen werden unter der Normalität landeskirchlicher Traditionen. Sonntagsgottesdienst »wie immer«, und natürlich ein schrecklich schräger Kirchenchor.
Eines Tages verschlägt es den Dirigenten in die Probe des Kirchenchors, und mehr aus Mitleid denn aus Überzeugung beginnt nun das Abenteuer, aus einem katastrophisch schlecht singenden Chor eine Gemeinschaft zu stiften, die singen kann.
Denn darum geht es hier eigentlich: um die Genesis eines Chores, einer Gemeinschaft – einer »Kirche« … in der Kirche. Die Musik, die von der himmlischen Partitur auf dieser Erde zu interpretieren ist, ist jenes »Wort«, das Communio stiften kann. In einer wahnsinnig exakten und wunderschön inszenierten Parabel wird hier Chorbildung als Ekklesiogenesis beschrieben: Jeder und jede, mag er noch so krank oder schräg sein, bekommt seinen Platz, ist ein einzigartiger Solist und zugleich Mitsänger. Keiner ist überflüssig, jeder ist nötig. Die Freude wächst – die Gemeinschaft wächst, und immer mehr Menschen bringen ihre Gaben ein.
Und natürlich kommt es zu dramatischen Konflikten, die dazu führen, dass die traditionelle Kirchengemeinde – und sie besteht fast nur noch aus der Institution des traditionellen Pfarrers – diese neue Gemeinde hinausweist, und sie ihr neues Zuhause beim Dirigenten findet, als solidarische und tragfähige Gemeinschaft für andere.
Diese neue, existenzielle Erfahrung der eigenen Berufung, des eigenen Charismas, der gemeinschaftsstiftenden und zugleich konflikterzeugenden Neuheit einer neuen Gestalt des Miteinanders mündet in der geradezu himmlischen Schlussszene. Sie hat einen doppelten Schlüssel: »Singen kann man nicht im Wettbewerb. Man kann nicht ›gegen‹ andere singen«, sagt der Dirigent immer wieder. Und das führt zu einer himmlischen Szenerie eines Gesangswettbewerbs, der eben nicht gegen, sondern mit den anderen in eine himmlische Schlusssymphonie einmündet: Jeder und jede von den vielen tausend Sängern kann seinen Ton singen und so seinen Teil beitragen. Und den ersten Ton gibt der Schwächste, der Behinderte – der schwedische Chor wird Zeichen und Werkzeug der Einheit …
Der zweite Schlüssel ist österlich: es ist der Dirigent, der am Ende einer Herzattacke blutig stirbt, und durch einen Lautsprecher noch die himmlische Melodie mithören kann. Wer hier, als aufmerksamer Christ und ekklesiologischer Zuschauer, diese Parabeln entschlüsselt, ist fasziniert von dieser Bildwelt, die uns erschließt, welche Perspektiven – gewollt oder ungewollt – sich für den Weg der Kirche hier erschließen. Natürlich finden sich auch viele andere Bildwelten in diesen Filmen, aber sie sind sicher auch im Blick auf den umfassenden Übergang – der österliche Übergang vom Tod zum Leben – unserer Kirche zu deuten. Es wird sichtbar, dass nach den Auflösungserscheinungen einer Kirche der Moderne nicht die Substanz verloren geht, sondern neu aufscheint, in einer neuen Lebendigkeit.
Die Paschadimension der Erneuerung ist im Blick zu halten, auch wenn dies gerade bedeutet, dass Erneuerung der Kirche eben kein menschlich geplanter Prozess sein kann, der sich als Weiterentwicklung bisheriger Gestalten und Formen zeigt. Das Pascha der Kirche ist kein harmloses Geschehen, sondern ein zutiefst verstörender und desorientierender Sterbeprozess, eine kollektive dunkle Nacht gewissermaßen, die aber im Blick auf den gewissen Morgen der Auferstehung »Glänzende Aussichten« verheißt.
— Charismatische Erneuerung und traditionelle Beharrlichkeit: Ein Blick auf das Apostelkonzil —
Wir wollen uns nicht ändern, wenn es nicht unbedingt nötig ist. Wir sind alle geprägt durch eine bestimmte Grunderfahrung. Und deswegen ist unser Blick gerade dann, wenn wir eine Wachstumserfahrung in einem bestimmten Gefüge erlebt haben, immer misstrauisch auf Veränderungen gerichtet. Denn gerade in Fragen kirchlicher Weiterentwicklung gibt es einen ausgeprägten Sinn für eine Kontinuität und einen Argwohn gegen jede Dialektik des Bruches. Und dennoch muss gesagt werden: Gerade weil es diese Kontinuität gibt, wird es immer wieder Sterben und Auferstehen geben: Die Kontinuität besteht in der Wandlung, in der Gegenwart des Auferstandenen. Gerade im Blick auf Wandlungsprozesse in Gesellschaft und Kirche ist auch der hermeneutische Hinweis in der eschatologischen Vision des Himmlischen Jerusalems zu beachten: »Und ihre Leuchte ist das Lamm« (Offb 21,23): Das Lamm aber steht für den gekreuzigten und jetzt universal gegenwärtigen Christus. Von ihm, von seiner österlichen Lebensdynamik will Veränderung als Verwandlung und Weiterführung erlebt und gedeutet werden.
Der Blick auf die frühe Kirche kann diese schwierige und doch notwendige Krise und Dynamik sichtbar machen. Die Apostel, deren Aufgabe ja entscheidend darin bestand, die Tradition der Gegenwart des Auferstandenen in dem sich wandelnden Szenario kirchlichen Wachstums zu bewahren, standen vor einer immensen Herausforderung. Für sie alle war die jüdische Tradition nicht nur eine Tradition. Die Thora, Gesetz und Propheten, die Lebensordnung war Ort der Gottesgegenwart – die Schrift und der Tempel waren definitive Orte der Gegenwart JHWHs. Und diese Tradition mitsamt ihrer Gestalt war also nicht zufällig und eben nur geschichtlich gewachsen – sie war der von Gott gewiesene und eröffnete Weg der Begegnung mit ihm; sie war die Hoffnung auf die verheißene Zukunft, der man unbedingt treu bleiben musste.
Umso gewaltiger wirkt, was wir bei Paulus lesen dürfen. Angesichts der Begegnung mit Christus und der Fülle seiner Gnade kann Paulus all dies als »Mist« (Kol 3,8)bezeichnen, was vorher sein Heilsweg war, und sich ausstrecken auf die Begegnung mit Christus. Aber dies ist kein statisches Geschehen, sondern fordert von ihm ein Eintreten in den Weg der österlichen Dynamik ein. Dies aber übernimmt Paulus radikal:
»Da ich also von niemand abhängig war, habe ich mich für alle zum Sklaven gemacht, um möglichst viele zu gewinnen. Den Juden bin ich ein Jude geworden, um Juden zu gewinnen; denen, die unter dem Gesetz stehen, bin ich, obgleich ich nicht unter dem Gesetz stehe, einer unter dem Gesetz geworden, um die zu gewinnen, die unter dem Gesetz stehen. Den Gesetzlosen war ich sozusagen ein Gesetzloser – nicht als ein Gesetzloser vor Gott, sondern gebunden an das Gesetz Christi – um die Gesetzlosen zu gewinnen. Den Schwachen wurde ich ein Schwacher, um die Schwachen zu gewinnen. Allen bin ich alles geworden, um auf jeden Fall einige zu retten. Alles aber tue ich um des Evangeliums willen, um an seiner Verheißung teilzuhaben«(1 Kor 9,19–23).