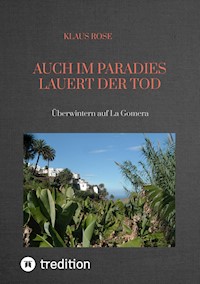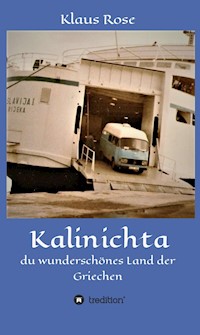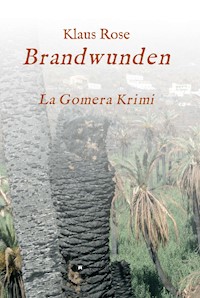2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Das Buch beschreibt das Reiseabenteuer eines 70-jährigen nach seinem Herzinfarkt. Mit grob abgesteckten Zielen reist er mit seiner Frau durch viele ferne Länder und beweist damit, dass er noch nicht zum alten Eisen gehört.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 474
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
KLAUS ROSE
GLOBETROTTER AUS LEIDENSCHAFT
ISBN
Paperback
978-3-7469-0817-5
Hardcover
978-3-7469-0818-2
e-Book
978-3-7469-0819-9
Verlag und Druck: tredition GmbH
Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
©2018 Klaus Rose
Umschlag, Illustration: Klaus Rose
Verlag: tredition GmbH, Hamburg
Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Ohne Zustimmung des Autors und des Verlages ist eine Verwertung unzulässig. Dies gilt für die Verbreitung, für die Übersetzung und die öffentliche Zugänglichmachung.
KLAUS ROSE
GLOBETROTTER
AUS
LEIDENSCHAFT
Ein Weltreiseerlebnisbericht
Personen, Umgebung und Handlung sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind Zufall, so auch Übereinstimmung mit vorhandenen Einrichtungen.
Das Buch:
Das Buch erzählt, wie der 70-jährige Autor, der einen Herzinfarkt überlebt hat, seinem langgehegten Herzenswunsch wahr macht.
Vom Reisefieber gepackt, unternimmt er mit seiner Frau eine siebenmonatige Entdeckungsreise durch weit entfernte Länder. Die führt sie auf die indonesische Insel Bali, dann an die Ostküste Australiens, sowie auf die Nord- und Südinseln Neuseelands, und weiter über Hongkong nach Ostasien.
Neben Bangkok erkunden sie mehrere Inseln und den Norden Thailands. Sie fahren auf dem Mekong durch Laos ins wunderschöne Luang Prabang. Von dort fliegen sie nach Vietnam, das sich von den Kriegswirren erholt hat. Anschließend fahren sie mit dem Bus durch Kambodscha, wo sie sich an der atemberaubenden Kultur des Landes ergötzen.
Doch damit ist es nicht genug, kehren sie nach Bangkok zurück und reisen nach Kao Lak und in den Kao Sok Nationalpark, dann auf die Inseln Ko Lanta und Ko Phi-Phi und das Schlusslicht der Reise bilden Goa und Mumbai an der Westküste des spektakulären Indien. Mit seiner Reise liefert der leidenschaftliche Globetrotter den Beweis, dass er beileibe nicht zum alten Eisen gehört, trotz Herzinfarkt und den vier Stents.
Der Autor:
Klaus Rose, Jahrgang 1946, kommt 1955 als Flüchtling nach Aachen. Nach dem Studium lebt er in München. Er kehrt nach Aachen zurück und engagiert sich in der Kommunalpolitik. Nach dem Renteneintritt verbringt er die Freizeit mit dem Schreiben seiner Romane.
Dem Schicksal ist die Welt ein Schachbrett nur, und wir sind die Steine in des Schicksals Faust.
George Bernhard Shaw
Lesenswert für jeden Reiselustigen
Warum, wann, wohin?
Verwöhnt von der Sonne in Indien und Thailand, wo wir zuletzt zwei Monate verbracht hatten, ist der Tag der Rückkehr ins nasskalte Düsseldorf ein Schock. Der stinknormaleDienstag im April istdurch und durch ungemütlich, denn schwarze Regenwolken verdunkeln den Himmel.
Ich ruckele am Arm meiner schlafenden Frau. „Wach auf, Liebste. Wir landen“, flüstere ich ihr miesepetrig ins Ohr, wegen des unbehaglichen Wetters, dann setzt das Flugzeug der Firma Boing auf der Landebahn auf. Mit an Bord meine Frau und ich, der siebzigjährige Reisefanatiker Klaus.
Während der mehrstündigen Flüge von Mumbai nach Dubai und von dort nach Düsseldorf haben wir kaum geschlafen, daher sind wir in miserablem Zustand. Und mit dem auschecken endet das ungewöhnliche Reiseabenteuer, das gespickt war mit packenden Erlebnissen. Nun sind wir gespannt auf das, was uns nach der Rückkehr erwartet. Und was schenkt uns die Heimat?
Es ist ein fürchterliches Sauwetter, eine beispiellose Frechheit. Trotz Frühlingserwachen hat eine Regenfront das Regiment an sich gerissen. Zerknirscht setzen wir uns in die Bahn. Mit der fahren wir zum Aachener Hauptbahnhof, wo wir nach der Ankunft das restliche Teilstück des Heimweges zu Fuß bewältigen, dabei trotten wir unter den ergrünenden Alleebäumen entlang in unsere vertraute Umgebung mit dem gewissen Pfiff. Die ist geprägt von einer prächtigen Altbausubstanz.
Und da sind wir. Das farbenfrohe Graffiti auf der Fassade um unser breites Erdgeschossfenster herum lächelt verschmitzt. Für das abstrakte Kunstwerk mit Motiven aus unserem Wohnviertel mit der Burg haben wir einem Graffitikünstler freie Hand gelassen, so hat er das Bild in saftigen Blautönen angefertigt. Die Schmierereien auf der Fassade hatten wir schlichtweg satt. Ich schließe die Haustür zum Treppenhaus auf und öffne sie, danach geschieht selbiges mit der Tür zu unserem Wohnrefugium. Es wirkt fremd auf uns, als wir es betreten. Sieben Monate haben wir uns in der Ferne herumgetrieben. Dieser Umstand hat die Vertrautheit fast weggewischt.
Nach einer Verschnaufpause, bei der wir die angenehme Atmosphäre gierig aufsaugen, legen meine Frau und ich die Wanderrucksäcke ab, dann entledigen wir uns der Jeansjacken. Die sind im Bereich des Rückens mit Schweißflächen übersät. Zum Trocknen hängen wir sie über die Lederstühle am Esstisch. Auch die ramponierten Rollkoffer haben ausgedient, doch anstatt sie auszupacken, rollen wir sie unter die Holztreppe, die das Erdgeschoss mit dem Obergeschoss verbindet. Durch zig Länder haben wir sie auf ihren zuverlässigen Rädern hinter uns hergezogen.
Die Wohnung ist ausgekühlt. Ich stelle die Heizung an, danach sind wir bereit die Zimmer zu inspizieren. Mit prüfendem Blick untersuchen wir deren Inneres auf Auffälligkeiten. Nichts macht uns stutzig, denn wir entdecken keine Veränderungen. Auf den ersten Blick scheint alles in Ordnung zu sein. Unterwegs ab und zu aufgekommene Sorgen waren unbegründet. Sogar die Pflanzenpracht auf den Fensterbänken macht einen hervorragenden Eindruck. Unsere Freundin hat das uns ans Herz gewachsene Grünzeug ohne das Einschalten der wärmenden Heizung ohne Mühen durch den Winter gebracht. Ausgestattet mit dem grünen Daumen hat die Gute die respektabel in die Höhe geschossenen Pflanzen perfekt versorgt.
Wegen meines Schlafmangels habe ich tiefe Furchen unter den Augenhöhlen, zudem bin ich total durch den Wind. Daher verwerfe ich die Idee, uns bei meinen Kindern zurückzumelden, obwohl das schlechte Gewissen in mir bohrt. Zwei Telefongespräche verschlingen viel Zeit. Eine Kontaktaufnahme werde ich am nächsten Tag in Ruhe angehen, schon ist das Thema abgehakt. Stattdessen essen wir die Reste mitgeführter Plätzchen und etwas Obst, denn ich bin nicht hungrig. Die Versorgung durch Emirate war hervorragend, so reicht mir eine Kleinigkeit.
Erst nach dem Snack wird mir ohne Ausflüchte bewusst, was ich bisher erfolgreich verdrängt hatte. Eingefahrene Abläufe mit der Familie und des Wohnumfeldes werden wieder Besitz von uns ergreifen. Auf die gilt es sich einzustellen, ob wir es wollen oder nicht, denn die große weite Welt hat uns aus den Fittichen entlassen. Den Rhythmus des vertrauten Lebens aufzunehmen, das eilt jedoch nicht. Das Sabbatjahr meiner Frau endet erst in vier Monaten und bis dahin läuft noch viel Wasser den Vater Rhein hinunter, außerdem steht ein Inselhüpfen durch die Ägäis auf dem Programm.
Können wir in dem aufgekratzten Zustand überhaupt schlafen? Wir wollen es versuchen. Nach über zweihundert Nächten in guten und auch weniger angenehmen Betten, oder auf den Matratzen der Campingbusse freuen wir uns auf unser eigenes Doppelbett. Ich gehe ins Schlafzimmer und ziehe mich aus. Meine Frau putzt sich derweil im Duschbad die Zähne. Als auch ich meine Beißer gesäubert habe, lege ich mich zu meiner Frau ins Bett und knipse das Licht aus.
Es ist stockdüster im Zimmer, trotzdem liege ich noch lange wach. Mir schwirren die abstrusesten Geschichten aus atemberaubenden Ländern mit der Hartnäckigkeit des Wespengeschwaders durch mein Innenleben. Waren wir tatsächlich fast sieben Monate, zuerst auf Bali, dann in Sydney und an Australiens Ostküste, danach durch Neuseeland, im ostasiatischen Raum und als Abschluss in Indien unterwegs? Oder habe ich das Spektakel nur geträumt und ich bilde mir die Länder nur ein?
„Herr im Himmel“, murmele ich im Halbschlaf. „Was soll der Quark? Die Erlebnisse sind keine Fata morgana, die sind Realität.“
Gedanklich die Erlebnisse der ellenlangen Fernreise vor Augen, befeuchte ich meine Lippen mit der Zunge. Was war das doch für ein sagenhaftes Projekt, stelle ich genussvoll fest und spüre mein zufriedenes Lächeln auf meinem entspannten Gesicht. Alles daran war einzigartig, ja wir hatten phantastische sieben Monate erlebt. Diese Traumreise hat mir das mir wohlgesonnene Schicksal geschenkt, denn ich hatte sie mir verdient.
Die Monate vom September des zurückliegenden Jahres bis zur Rückkehr im April waren wie im Überschallflugzeug verflogen. Vor sieben Monaten hatten wir uns noch auf die Reiseziele gefreut, und schwup, schon haben wir alle Länder gesehen und das Abenteuer ist passee.
Und jetzt, zurück im Heimatort, finde ich keinen Schlaf. Diese Schlafproblematik verfolgte mich auf jeder Flughafenbank, ja selbst im Airbus von Mumbai nach Dubai, und später nach Düsseldorf, war mir kein Minutenschlaf gegönnt. Das Dilemma muss an meinem Brummschädel liegen, denn in meiner Gehirnmasse knistert die abwechslungsreiche Erlebniskette wie Pergamentpapier. Mein Kopf ist gefüllt mit Episoden, die verarbeitet werden wollen.
Vor fünfundzwanzig Stunden spazierten wir noch in der Metropole Indiens herum, das war in Munbai bei fünfunddreißig Grad im Schatten. Eine Temperatur, die uns Mitteleuropäern zu schaffen machte, trotz monatelanger Ostasienerfahrung. Mir kam es vor, als würden sogar die heiligen Kühe unter der sengendheißen Sonne nach Abkühlung hecheln. Wegen der Bullenhitze litten gerade die armen Menschen in den Slums an Höllenqualen, obwohl sie jahreszeitbedingt normal war und sie daran gewöhnt waren. Jedenfalls war’s in Indien knackig heiß und alles ging drunter und drüber. Dagegen herrscht in Aachen eine abscheuliche Kühle, dementsprechend krass ist der Übergang.
Mit der halbjährigen Mammutreise hatten wir dem heimischen Winter und den hiesigen Wetterkapriolen ein Schnippchen geschlagen. Wärme und ausreichende Sonnenbestrahlung, ein Markenzeichen für Ostasien, das war unsere Welt. Besser die Hitze Indiens ertragen zu müssen, als bibbernd durch die verschneiten Straßen der Heimat zu latschen. Aber in Neuseeland trafen alle gegensätzlichen Attribute zu.
Nach der Landung im Inselnorden war es kalt, erst später wurde es warm, aber es blies andauernd ein stürmischer Wind. In Thailand dagegen, um ein Beispiel Ostasiens zu nennen, hatten wir unsere alternden Gelenke ein paar monsunartigen Stürmen ausgesetzt. Dann wurde der Schiffsverkehr eingestellt, aber das war’s dann auch.
Und wie sieht’s hier in Deutschland aus? Bitteschön, was ist an einem Winter gut? Man kommt kaum raus vor die Tür, aber Bewegungsarmut macht krank. Trotz des Herzinfarktes resigniere ich nie. Ich bin nicht der verzagende Typ, der die Flinte ins Korn wirft. Meine Prämisse lautet: Ich will weiterhin eine Menge erleben. Durch die große weite Welt gondeln, das war allzeit meine Devise.
Aber wie kam es zu der ungewöhnlichen Reise? Wer hatte mich und meine Frau Angela auf die mutige Idee gebracht? Welche Anregungen haben uns zu dem ungewöhnlichen Projekt ermuntert? Und vor allem, wann nahm die Utopie der Reise in uns wildfremde Regionen Gestalt an?
Um die Entstehungsgeschichte der Reise grob zu skizzieren, spule ich mein Leben fünf Jahre zurück, denn nach meinem Renteneintritt rumorte das Reisefieber in Vulkanstärke in mir. Seit ich zu denken begonnen habe, bin ich vom Fernweh besessen. Die Reiselust hat sich tief in mich eingebrannt und steckt in mir wie das Herz oder die Milz. Zu jener Zeit hatten wir den Grundstein zu dem Abenteuertrip gelegt, der das ganz Besondere werden sollte. Nur der Rahmen war unklar, aber nach unseren Vorstellungen würde es eine Tour rund um die Welt, landläufig auch Weltreise genannt. Über manche Variante steht im Buchhandel eine Menge Literatur in den Regalen. Vom Begriff Modeerscheinung distanziere ich mich allerdings.
Jedenfalls war die wegweisende Initialzündung oder der Paukenschlag das Beantragen des Sabbatjahres meiner Frau, sie ist Lehrerin. Das bedeutet, ihr steht ein Jahr bezahlter Urlaub zu, den sie in den vorherigen fünf Jahren durch Gehaltsverlust angespart hat. Eine geniale Einrichtung, als hätte man sie für uns erfunden.
Und diese Antragstellung schärfte meine Sinne für das Abenteuer, denn sie beförderte den in uns schlummernden Unternehmergeist endgültig ans Tageslicht. Sich ein komplettes Jahr in eine ungewisse Zukunft begeben, das war der Plan. Kennen Sie das Gefühl, etwas Großes steht an?
Von da an entwickelte sich die Weltreise zu unserem Steckenpferd. Wir besprachen alle möglichen Routen, aber auch die Finanzierbarkeit war ein heißes Thema. Es sind enorme Unkosten, die man nicht eben mal aus dem Ärmel schüttelt. Man macht sich kein Bild von dem Ausmaß des Finanzvolumens, das auf Reisewillige zukommt
Ich stand noch ein Jahr in Lohn und Brot eines Ingenieurbüros für Umwelttechnik, in dem man von meinen Plänen nichts ahnte. Damals lautete die meistgestellte Frage, wobei man mich milde und bemitleidend anlächelte: „Was machst du eigentlich, wenn du nicht mehr arbeitest? Dir fällt sicher die Decke auf den Kopf.“
Diese Denkweise ist typisch und weit verbreitet. Als ob das Wichtigste im Leben die Arbeit wäre, dabei sind Gesundheit, geistige Fitness und meine Reiselust das höchste Gut.
Ich dachte mir meinen Teil und reagierte nicht auf die dummen Anspielungen, denn ich hatte zwei Jahre zuvor meine zweite Chance bekommen. Völlig unvorbereitet hatte mich ein Herzinfarkt überrascht. Den hatte ich auf dem heimischen Sofa an der Seite meiner Lebensgefährtin durchgestanden und hauchdünn überlebt. Dessen Vorboten spürte ich bei der Heimfahrt in der Höhe des Aachener Klinikums.
Zuerst waren es Atembeschwerden, und dann das verdächtige Ziehen im linken Armbereich. Doch da ich die Symptome bis dato nicht kannte, ignorierte ich die Bedrohung. Anstatt zum Klinikum abzubiegen und mich der Obhut der Fachärzte anzuvertrauen, setzte ich die Autofahrt fort. Wie eine Dampfturbine raste mein Herz, meine Herzkranzgefäße drohten zu bersten. Seitdem ist mir der Begriff Todesangst vertraut. Und als sei nichts passiert, feierte ich am darauffolgenden Tag den Geburtstag meines Sohnes mit dem Fußballspielbesuch im Stadion des 1. FC Köln.
Zwei Tage später ging ich zum befreundeten Hausarzt, der mir nach dem EKG meinen sprichwörtlichen Dusel vor Augen führte und mir kräftig Beine machte.
„Mensch, Klaus“, schimpfte er, Gott zum Erbarmen. „Du hattest einen Herzinfarkt. Los, ab mit dir ins Klinikum.“
Auf der Intensivstation wurde ich notversorgt. Und nach nicht mal einer Stunde brachte man mich in den OP. Mein erster Stents sorgte für Entspannung in der Herzregion.
Ja, ja, genauso dramatisch lief der Infarkt damals ab. Aber bitte kein Mitleid. Das wäre kontraproduktiv. Ich war ja beteiligt am Dilemma, denn so gut wie nichts hatte ich gegen meine Stressanfälligkeit unternommen. Zudem hatte ich in den Krankenhaustagen viel Zeit, über meine ungesunde Lebensführung nachzudenken. Instinktiv hatte ich kapiert: Ich muss meine schlechten Gewohnheiten abstellen.
Als Konsequenz machte ich einen Radikalschnitt und verabschiedete mich von der Politik als Sprecher der Grünen im Rat der Stadt und vom Rauchen. Ich setzte auf gesunde Ernährung und versuchte mich durch autogenes Training in die Spur zu bringen. Bloß nicht die Rolle rückwärts und den Umgang mit Schwächen zulassen, doch hinterher blieb es bei Lippenbekenntnissen. Ich redete mir die Laster schön. Erst drei weitere Stents rüttelten mich wach. Durch die fälligen Herzkathederrungen hatte ich es geschnallt. Mit der Lebensführung würde ich nicht alt werden und ich könnte meine Reiseambitionen vergessen.
Unabänderlich zog ich den Schlussstrich unter die Lasterhaftigkeit, denn ich hing am Weiterleben. Danach hinterfragte ich meine Erwartungsperspektive. Und die sah plötzlich rosig aus, denn ich stieß auf Wünsche voller Feuer und Leidenschaft.
Prompt fiel es mir wie Schuppen von den Augen: Der Trauerklos a la Schwesterherz, werde ich auf keinen Fall. Sie hatte das Lachen verlernt und lebte nach der Scheidung ohne Lebenslust vor sich hin. Mir leuchtete ein: Von ihrem Trübsinn lasse ich mich nicht anstecken. Jeder ist seines Glückes Schmied. Ich lebe gern und blicke mit Karacho in die Zukunft.
Etwas ironisch, und doch mit der nötigen Ernsthaftigkeit, nahm ich mir vor: Anstatt einer Kreuzfahrt auf der Aida, was viele Rentner antreibt, mache ich eine Radtour in meine von der Republikflucht geprägte Vergangenheit.
„Auf geht’s, das Radabenteuer wage ich“, redete ich mich stark. „Und danach die Weltreise mit meiner Frau.“
Ich war von mir begeistert, ohne wenn und aber.
Doch es gab Freunde, die belächelten meine Pläne. „Du spinnst“, versuchten sie mich vom Vorhaben abzubringen. „In dir stecken vier Stents, du schluckst fünf verschiedene Tabletten, also bleib auf dem Teppich. Was du vorhast ist blanker Wahnsinn.“ Sprach daraus der Neid?
Natürlich hatten die Kritiker nicht unrecht, denn wäre ich vernünftig, hätte ich mich hinterfragt. Geht’s noch? Warum mute ich mir die dreiwöchige Radtour und danach diese Mammutreise zu? Wie reagieren meine Körperfunktionen, besonders mein Herz, auf Überbelastungen?
In Ostasien, speziell in Indien, da ist die Luftfeuchtigkeit enorm hoch, hinzu kommt die ungeheuerliche Hitze, außerdem liegen diese Länder mehr als einen Steinwurf von einem guten Herzzentrum entfernt, sollte ich die Einweisung brauchen.
Anderseits hatte ich null Bock auf eine Neiddebatte. Vernunft ist ein langweiliges Geschäft. Ich allein entscheide über meine Lebensgestaltung und die soll nicht griesgrämig und debil, sondern spannungsgeladen und lebendig verlaufen. Wer nichts wagt, der kann nichts gewinnen. Nur den Mutigen gehört die Welt.
Genauso ist es. Mit dem Reise-Gen in mir, bot ich allen Zweiflern die Stirn. Meine Sucht auf fremde Länder war nicht gestillt, und sobald ich auf einer Reise war, fühlte ich mich sauwohl.
Heimweh als Bremswirkung? Das kannte ich nicht. Und sollte ich wegen des Infarkts allem entsagen?
Okay, der Kraftaufwand der Arbeitswelt hatte mich gerupft, auch der Scheidungskram mit der Kindererziehung als alleinerziehender Vater. Ich hatte jede Menge Federn gelassen, daher kam mein Infarkt nicht von ungefähr, doch nun war es an der Zeit, daraus die Lehren zu ziehen.
Heidewitzka, sagte ich mir, und übernahm die Kritik als Ansporn. Immer nach vorn blicken und Herausforderungen meistern, das ist richtg. Ich bin kein Hans Wurst, der die Hände in den Schoß legt. Bloß nicht zurückstecken oder kneifen. Das wäre inkonsequent. Noch dazu war meine Partnerin bis in die kleinste Faser bereit, die Reiselust mit mir zu teilen. Ich konnte mir ihrer Unterstützung sicher sein, denn glücklicherweise war ich geschieden. An der Seite der Exfrau, die meine Leidenschaft als Weltenbummlerei abgetan hatte, hätte ich das Globetrotterleben nicht führen können. Sei’s drum.
Durch mich ging ein Ruck. Mit wohl dosierter Bewegungsstrategie wandelte ich die freigesetzte Körperspannung in produktive Energie um. Ich erklärte den Begriff Langeweile zum unerwünschten Fremdwort und schiss auf den Dauerbegleiter Rückfallgefahr. Schlussendlich hatte ich begriffen, nach vier Stents würde ich
keine weitere Chance bekommen.
Sogar mein Hausarzt bestärkte mich: „Mach deine Deutschlandradtour, Klaus“, beschwor er mich. „Du bist mit den Tabletten gut eingestellt und über deine Weltreise können wir später reden.“
Also bitte. Es geht doch.
Mit überschäumender Freude im Herzen schwang ich mich aufs Rad. Ich machte meine Lebensstationen zu Etappenzielen, dabei half das Abschiedsgeschenk der Bürokollegen zum Rentenbeginn, ein teures Tourenrad. Und lange Rede, kurzer Sinn, die drei Wochen auf dem Fahrradsattel waren phantastisch. Ich besuchte mein Geburtshaus an der Saale und die Flüchtlingsunterkünfte in Berlin und Lübeck, in denen ich zwei Jahre meiner Kindheit zugebracht hatte, aber der Höhepunkt war München, meine Lieblingsstadt. In der Weltstadt erinnerte ich mich an meine Hippiephase und ließ mein Kneipenleben von damals neu aufleben. Ich radelte mir auf zweitausend Kilometern die Lunge aus dem Hals und legte nur eine Heilpause ein, wegen meines wundgefahrenen Hinterns.
Ja wunderbar, das Vorprogramm auf die Weltreise war geschafft. Und wie lautete die Schlussfolgerung aus dem Höllenritt? Ich war topfit und auch sonst war alles im Lot, also mein Herz, die Gelenke und die Muskeln. Körperlich war ich gerüstet. Auch mein Kardiologe war voll des Lobes. Was konnte da schief gehen?
Wie Sie sehen war das Reisemenü angerichtet, bis auf die Finanzen. Über die zermarterten wir uns die Köpfe. Wir errechneten die Belastung für die Wohnung mit Nebenkosten. Wir zählten die Einnahmen zusammen, also das Lehrergehalt meiner Frau und meine Rente, dann addierten wir die Ersparnisse hinzu.
Und was kam raus? Eine abgespeckte Routenplanung. Schweren Herzens fällten wir die Entscheidung, den Trip auf sieben Monate zu verkürzen. Eine zwölfmonatige Reise hätte den Finanzrahmen gesprengt.
Mein Gott, so ist es eben. Auch davon geht unsere Reisewelt nicht in die Brüche. Ich konnte mit der Verkürzung auf sieben Monate gut leben, auch das halbe Jahr war ein Hammer. Wir werden das Beste daraus machen, sagte ich mir. Es muss ja nicht die ganze Welt sein. Heben wir uns Südamerika und Afrika für spätere Reisen auf. Mit der nötigen Bescheidenheit werden wir den australischen und asiatischen Raum mit vollen Zügen genießen. Besonders in den Ländern Ostasiens gibt es erlebenswerte Schmankerl.
Und den Vorgeschmack auf die Umplanung in mich aufgesogen, löste auch die neue Route über Bali nach Australien, Neuseeland, Thailand, Laos, Vietnam, Kambodscha und letztendlich nach Indien regelrechte Beifallsstürme aus. Ich schnalze jetzt noch mit der Zunge, berücksichtige ich die kulturelle Vielfalt. Reisen bildet, sagt man sehr schön, und wir werden neue Horizonte entdecken.
Aber die Reiserei ist nicht nur spannend, sie ist auch anstrengend. Sehe ich es aus körperlicher Sicht, dann kam die Verkürzung der Reisezeit, trotz der Lobhudelei der Ärzte, meinem Gesundheitszustand entgegen.
Die Langstrecken bewältigen wir mit dem Flugzeug, beschlossen wir. Dann bereisen wir mit dem Camper die Ostküste Australiens und mit einem anderen über die Nord- und Südinsel Neuseelands. Und wir benutzen die Bahn, dann Überland- und Minibusse, aber auch Fähren durch Thailands Inselwelt.
Erwähnung verdient eine zweitägige Bootsfahrt auf dem Mekong. Sogar kleinere Radtouren waren geplant, wenn möglich Wanderungen durch die landschaftlichen Leckerbissen Neuseelands. Zu Fuß kann man Land und Leute hervorragend beschnuppern, und deren Gewohnheiten. Zudem galt unser Augenmerk den exotischen Ländern. Bis dato hatten wir den ostasiatischen Raum nie besucht.
Und nun mein eindringlicher Appell: Mit Wagemut und Energie ist solch eine Reise machbar. Hängen Sie sich diese Weisheit als Wahlspruch übers Bett. Man darf sich nie ins Boxhorn jagen lassen. Auch als Herzgeschädigter habe ich den Trip locker überlebt, trotz kritischer Phasen. Dass ich mich dabei pudelwohl gefühlt habe, kann ich einhundertprozentig bejahen. Ich kenne keine Personen in meiner Altersklasse und mit meiner Vorgeschichte, die sich auf derartige Abenteuer eingelassen haben.
Doch zurück zu den Vorbereitungen: Nachdem die Reiseroute grob abgesteckt war, nahmen wir das Hilfsangebot einer befreundeten Reisekauffrau in Anspruch. Zusammen tüftelten wir an einem wunschgerechten Round the World-Flugticket.
Das besteht aus den Stationen Düsseldorf, Dubai, Jakarta, Bali, Brisbane, Sydney, Auckland, Hongkong, Bangkok, Mumbai und zurück nach Düsseldorf.
Die Inlandsflüge organisieren wir per Internet, auch preiswerte Unterkünfte. Diese Vorgehensweise erspart eine abendliche Suchaktion in fremden und gefährlichen Stadtteilen.
Aber bitte nicht alles bis ins Detail festzurren, denn Spielräume für Umplanungen sind wichtig. Das ist ein Bestandteil unseres Denkansatzes. Nur keine Festlegungen treffen, die man hinterher bereut, denn eine Mammutreise hat Überraschungsmomente parat. Alles klar?
Die Reiseroute war festgezurrt. Ausgelassen tanzten wir durch die uns wohlgesonnene Weltgeschichte, als seien die Reisen ein Salsa-Kurs. Und das hatte gute Gründe, denn wir waren zügig in die Puschen gekommen. Und weil uns das Baden in der Vorfreude saumäßigen Spaß machte, hockten wir stundenlang im Reisetrakt einer Buchhandelskette herum und machten uns über die Reiseländer schlau.
Bevor es losgeht, eine Empfehlung: Vorteilhaft ist es, man reist als Paar oder zu mehreren. Andere Formen sind gefährlich, wobei ich an Vergewaltigungen in Indien denke. Außerdem ist es eine Typfrage. Es gibt Einzelgänger, die benötigen das Alleinsein. Aber reist man in Begleitung, dann ist es wichtig, dass man sich sehr gut versteht. Wir hatten vor Reiseantritt geheiratet. Nach zwanzigjährigem Zusammenleben erschien uns das Risiko der Ehe gering zu sein. Man verbringt jede Minute gemeinsam, sei’s im Flugzeug, im Bus, in der Bahn, oder auf Schiffen. In kalten Neuseelandnächten im Camper rückt man sich mächtig auf die Pelle. Auch Gasthäuser und Strandhütten bieten nur wenige Freiräume zum Abschalten. Daher spielt friedvolles Miteinander eine wichtige Rolle. Nie ist man sich sicher, dass alles problemlos klappt.
Nicht verschweigen will ich das Überraschungsmoment, das nicht einplanbar ist und Improvisationen erforderlich macht. Solch ein Moment ereignete sich in Cairns. Wir warteten vergeblich auf den Flieger nach Sydney. Eine höhere Gewalt in Form eines Sturms hatte den Weiterflug verhindert.
Schlimmes passierte bei der Einreise nach Neuseeland. Ich wurde wie ein Schwerverbrecher behandelt, weil ich dummerweise ein halbes Glas Honig eingeführt hatte. Wegen des Berappens von vierhundert Dollar Strafe ärgerte ich mich grün und blau, aber mehr über mich selbst, denn ein Ex-Arbeitskollege hatte mich vor den strengen Einreisebestimmungen gewarnt.
Natürlich gab es auch positive Überraschungen, die aufzeigen, wie klein die Welt geworden ist. Eine total verrückte ereignete sich in Kambodschas Hauptstadt, in Phnom Phen.
Beim Entlangspazieren an den Restaurants hörte ich urplötzlich den Ruf meines Namens. Mit „Hey, Klaus“, drangen bekannte Laute an meine Ohren. Wem gehörte die Stimme?
Kambodschaner, die Klaus heißen, wird’s nicht viele geben, rätselte ich. Der Zuruf gilt mir.
Meine Augen suchten nach der rufenden Person.
Und siehe da, Richard saß im Eingangsbereich eines Lokals, der langjährige Freund der Schwester meiner Frau. Zwanzigmal hatten wir uns in der Weihnachtszeit im Kreis der Familie meiner Frau im Emsland getroffen und unterhaltsame Abende verbracht. Tja, wenn das kein Zufall war?
Weitere Ereignisse aufzuzählen, wäre ein zu großer Vorgriff auf den Ablauf. Es ist besser, ich schildere die Reiseländer nacheinander und unsere Erlebnisse frei von der Leber weg. Dabei wird sich Sentimentalität einschleichen, bitte verzeihen Sie mir den Lapsus, aber die beeinflusst meinen Erzählerdrang nur mäßig, denn ich bleibe mein Leben lang angetörnt wegen der Einzigartigkeit der Reise.
Nun gut, mir gefällt mein Schreibmodus. Mit dem flutscht es bei mir, das kann man so sagen. Sitze ich vor dem Computer und schreibe über die Reise, fühle ich mich wie in einem Rauschzustand. Dann klabastern unglaubliche Geschehnisse durch meine Sinne, und die erlebt zu haben, erfüllt mich mit riesiger Freude.
Ich nehme Sie also mit auf eine sensationelle Tour. Wie erwähnt führte die mich und meine Frau auf die Insel Bali, an die Ostküste Australiens, auf die Nord- und Südinseln Neuseelands, nach Thailand, Vietnam, Kambodscha und Laos, und als Krönung ins Desaster Indien. Dessen Armutsregionen, und das von Krisen durchgeschüttelte Ostasien, sind sagenumwoben, jedenfalls weit entfernt von einem Schlaraffenland. So wie jeder Mensch anders ist, so ist es auch manches fremde Land, daher nutzen Sie die Zeit und bereisen Sie die asiatischen Landstriche. In ein paar Jahren wird es die Ursprünglichkeit in Ostasien nicht mehr geben und Sie werden die jetzigen Lebensweisen nicht mehr bestaunen können. Durch den Raubbau der Chinesen verändert sich die Welt rasend schnell in eine ungewisse Zukunft, besonders die Ostasien.
Doch bevor Sie weiterlesen, noch ein kleiner Tipp: Bitte verzeihen Sie mir meinen unbedarften Schreibstil. Bestsellerautoren fallen eben nicht jeden Tag vom Himmel. Und konsumieren Sie die Reisereportage mit der gebührenden Locker- und Gelassenheit, dann haben Sie mein Wort: Ihre Neugierde bleibt zügellos.
Und bedenken Sie eins: Eine Nachahmung ist niemals allein eine Frage der Finanzierung, oh nein, sie ist allein eine Frage des Wollens.
Aber Hallo. Zweifeln Sie etwa an meiner Aussage? Denken Sie, ich würde das mit dem Wollen leicht und salopp daherreden? Meinen Sie gar, ich sei altklug und neige zur Übertreibungen? Oder trauen Sie sich einen ähnlichen Reisekrimi nicht zu?
Sollte es an letzterem liegen, dann fassen Sie sich ein Herz und wischen Sie die Zweifel weg. Angst wäre ein schlechter Berater. Ich verspreche Ihnen: Nehmen Sie die Herausforderung an, dann werden Sie verwundert feststellen, eine derartige Reise ist hochinteressant und dazu verhältnismäßig ungefährlich. Bei unserer Route treffen Sie auf Cowboys ähnelnde Australier und auf Neuseeländer als Schafshirten, wie sie der Reiseführer beschreibt, zudem auf die den Globetrottern und Touristen zugewandten Ostasiaten, aber auch auf gewöhnungsbedürftige und vor der Armut fliehenden Inder.
Natürlich ist die Reise keine Extremabenteuertour, vergleichbar mit der Hundeschlittenfahrt durch Alaska, auch kein Kletterspektakel auf einen Achttausender im Himalaja. Gegen diese heroischen Herausforderungen mutet unser Flug-, Bahn- und Schiffstrip bescheiden und bieder an. Ich bin siebzig Lenze und vergleiche mich nicht mit Reinhold Messner in jungen Jahren. Für unsere Reise muss man kein Übermensch sein.
Wir zum Beispiel sind alternativ angehaucht und aus solidem Holz geschnitzt. Wir kommen aus der Mitte der Gesellschaft. Eine gute Portion Entdeckerlust und Wagemut gehört dazu. Immerhin führt die Reise durch Länder mit unterschiedlichen Kulturen und Lebensformen, ebenfalls durch von Einsamkeit geprägte Landstriche. Die zu besuchen ist ein ungewisser Erlebnisverlauf. Noch dazu, wenn es sich um eine frei ausgewählte Reiseroute handelt, und nicht um eine organisierte Pauschalreise. Ich als Rentner habe mich an das Wagnis herangetraut. Darin bin ich eine Rarität und das erfüllt mich mit Stolz.
Mensch, liebe Leute, macht das Ding. Bietet sich die Chance, dann schlagt beherzt zu. Wer erst einmal auf den Geschmack gekommen ist, der bereut es nie.
Und nun kann’s losgehen. Mein Körper möchte vor Freude Purzelbäume schlagen, wäre er dazu nicht zu alt. Mit dem Wanderrucksack auf dem Rücken und die Rollkoffer hinter uns herziehend, verlassen wir unser Domizil. Auf unbequeme und schwere Tourenrucksäcke haben wir bewusst verzichtet. Im Alter belasten sie die Schulter- und Nackenpartie extrem. Das beruht auf den Erfahrungen des Inselspringens in Griechenland vor zwei Jahren.
Aber eins ist von vornherein klar: Mit der Tour betreten wir Neuland, denn die sprengt den normalen Urlaubsrahmen bei weitem. Dessen Umfang hatten wir als Seifenblase in unseren Köpfen runtergespult. Wir hatten die Reise wochenlang mit den Fingern auf dem Kartenmaterial und auf unserem Globus durchexerziert. Ist diese Unerfahrenheit ein Handicap? Wenn ja, dann ist es nicht zu ändern.
Gedanklich unterziehen wir unser Gepäck einer letzten Kontrolle. Haben wir alles Überlebenswichtige dabei? Schließlich handelt es sich nicht um einen Badeurlaub am Ballermann. Stattdessen müssen wir uns auf kalte Temperaturen in Neuseeland und Nordvietnam einrichten, demnach gehören wetterfeste Klamotten in die Koffer.
Allerdings dürfen wir nicht allzu viel Ballast mitschleppen, denn wir haben unser Augenmerk auf gewichtslimitierte Inlandflüge zu legen. Aber haben wir den Besuch Hanois hinter uns, dann lassen wir die warmen Klamotten zurück. Im weiteren Verlauf der Reise brauchen wir sie nicht mehr.
In meinem Koffer befinden sich eine Reservejeans, eine dünne Regenjacke, drei Shorts, drei Paar Strümpfe, zwei Badehosen, Unterwäsche, ein Kapuzenpulli aus Baumwolle für die kälteren Regionen, dazu zwölf T-Shirts mit und ohne Arm. Bei großem Verschleiß kann man sich die Hemdchen in Asien für einen Apfel und Ei nachkaufen, außerdem sind auf den Campingplätzen in Australien und Neuseeland Waschvollautomaten installiert. Dessen Vorhandensein hatten wir recherchiert.
Natürlich gehören Trekkingschuhe und Ledersandalen zur Ausrüstung. Auch meine Medikamente für sieben Monate sind unumgänglich für die Auslandsreise. Unser Hausarzt hat mich mit dem Notwendigsten ausgestattet. Und neben den Gesundheitsutensilien haben wir ein Kontingent US Dollar in der Brusttasche, falls sich dreiste Diebe der Rucksäcke und Rollkoffer bemächtigen. Derlei Vorsichtsmaßnahmen werden empfohlen und wir halten uns daran. Auch Fotokopien persönlicher Dokumente und der Ostasienreiseführer sind unentbehrliche Begleiter. Damit ist mein Koffer voll, denn ich habe mich für ein handliches Exemplar entschieden. Im kleinen Wanderrucksack transportiere ich die Digitalkamera mit ordentlichem Zoom, extra für die Reise erworben. Weiter dabei habe ich einen e-book Reader. Auf dem sind die Reiseführer für Australien und Neuseeland gespeichert, sowie dreißig Kriminalromane. Die als Bücher mitzuschleppen hätte den Gewichtsrahmen gesprengt.
Den Reiseführer für Südindien erstehe ich durch eine glückliche Fügung in Bangkok auf dem Nachtmarkt vor der Abreise nach Indien. Diese Nebensächlichkeit nur nebenbei.
Auch die Kurbeltaschenlampe, die mir mein Sohnemann zur Radtour geschenkt hatte, befindet sich im Rucksack, außerdem Proviant für die nächsten Stunden. Das Visum für Indien, vorher organisiert, schmückt bereits den Reisepass. So, das war’s. Hoffentlich haben wir an alles gedacht? Na, dann schauen wir mal.
Meine Nervosität kennt keine Grenzen, denn die Reise ist angerichtet. Die Wartezeit hat eine unbeschreibliche Glut entfacht und ich suhle ich mich in der Hitze der Vorfreude. Übernatürlich kribbelt es unter meiner Haut bis in die Fußsohlen. Zudem ist der Abreisetag ein Traumtag. Den versüßt eine gönnerhaft vom Himmel lachende Sonne. Die muss einfach Glück bringen.
Als Bewohner des Viertels um die Frankenburg, unweit des Aachener Stadtzentrums, ist unser fußläufiges Ziel der Hauptbahnhof. Von dem fahren wir mit einem Regionalzug nach Köln, um danach den Flughafen in Düsseldorf anzusteuern. Wir fliegen mit Emirate. Die Plätze in den Fliegern nach Dubai und weiter in die indonesische Hauptstadt Jakarta sind reserviert. Das klingt gut und einfach.
Einen Abbruch der Travel Tour kann und darf es nicht geben, denn wir haben uns mit Grillfleisch und anderem Brimborium von den Kindern, den Freunden sowie den Mitbewohnern der Hausgemeinschaft verabschiedet. Leider hat das Vermieten unserer Eigentumswohnung nicht geklappt. Wer weiß, wofür es gut ist. Vielleicht wären Vandalen eingezogen und hätten die Einrichtung ruiniert? Mit der Freundin und meinen Kindern bleiben wir in Kontakt, somit ist das Wichtigste in trockenen Tüchern.
So, geliebtes Heimatland. Auf ein Wiedersehen in Old Germany. Inzwischen habe ich Sie lange genug auf die Folter gespannt. Die Reisegeschichte kommt nicht als Krimi daher, sondern sie gleicht mehr einer Tagebuchschilderung, hoffentlich stört der Schreibstil nicht. Und nun raus aus einer heilen Welt, wie sie uns Europa im Moment bietet.
Freudig erregt fahren wir mit dem Zug vom Aachener Hauptbahnhof zum Airport Düsseldorf und pünktlich besteigen wir den Flieger. Es ist fünfzehn Uhr, da erhebt sich die Boing 770 mit uns an Bord in den wolkenlosen Himmel. Das Reiseabenteuer beginnt seinen mit schier grenzenlosen Erwartungen gespickten Verlauf.
Neben uns sitzt eine junge Frau mit Ziel Bangkok. Mit ihr unterhalten wir uns über ihre und unsere Reisepläne, dann über dies und jenes, denn sie ist sehr nett und reist allein. Dazu ist allerhand Mut nötig. Leider trennen sich unsere Wege nach sechseinhalb Stunden in Dubai. Sie startet ihren Weiterflug von einem anderen Gate. Wir verabschieden uns nach Erfolgswünschen mit herzigen Umarmungen.
Während der vier Stunden Aufenthalt ärgern wir uns über den Kauf einer Flasche Wasser für neun Dollar. Tja, dass ist Dubai. Der Preis ist typisch für viele Flughäfen. Ein Essen zu uns zu nehmen, ist nicht nötig. Entgegen deutscher und belgischer Fluglinien, die wir sonst nutzen, wurden wir von Emirate vor dem Anflug auf Dubai fürstlich versorgt, und Emirate lässt uns auch beim Flug nach Jakarta in Indonesien sicher nicht verhungern.
Ich bin vollgestopft mit Adrenalin und fühle ich mich ausgezeichnet. Mit Gelassenheit stecke ich den nun folgenden achtstündigen Flug ohne Mühe weg, obwohl meine Einschlafversuche kläglich scheitern. Und was macht man, um sich die Zeit zu vertreiben? Ich lese im Reiseführer für Ostasien, nebenbei glotzte ich auf die Mattscheibe. Der Film handelt von witzigen Drachen, mehr weiß ich allerdings nicht mehr.
Die Ankunft in Südostasien, also in der indonesischen Hauptstadt Jakarta, verläuft chaotisch. Wegen organisatorischer Missgeschicke müssen wir unsere Rollkoffer am Gepäckband abholen, obwohl sie nach Bali durchgeleitet gehört hätten, wie’s vereinbart war. Protestieren nützt da gar nichts. Dann gibt’s auch noch beim Kofferabholen Schwierigkeiten. Meine Nervenstränge sind höllisch angespannt.
Glücklicherweise wird das Problem geregelt und dass Koffer aufgeben am zuständigen Schalter für den Flug nach Bali klappt zu aller Zufriedenheit, außerdem haben wir bis zum Weiterflug viel Zeit.
War die blödsinnige Prozedur damit ausgestanden? Weit gefehlt, denn auch der Kauf des Visums verzögert sich aus unerfindlichen Gründen. Anscheinend gefällt dem Zollbeamten meine charmante Frau, denn ungewöhnlich lange schaut er auf ihre Erscheinung, dann auf ihren Pass, dann wieder sie an.
Schlussendlich passiert sie ohne Beanstandung die Sperre. Doch die Einreiseformalität ist unverschämt teuer. Sie kostet sage und schreibe fünfunddreißig Euro pro Kopf. Und als Krönung serviert uns Jakarta den Ausreiseterminal als Irrgarten, der übermenschliche Kenntnisse im Hellsehen verlangt. Doch mit Ach und Krach finden wir in der Unübersichtlichkeit den Abflugschalter für den Flug nach Bali.
Wir treffen abermals auf eine Frau. Die ist braungebrannt und hat sich anscheinend verirrt. Sollte sie sich auf der Rückreise nach Düsseldorf befinden, dann gehört sie überall hin, nur nicht hierher. Braucht sie Hilfe?
Die Ungereimtheiten klären sich auf, denn die in flippige Klamotten gehüllte Frau hat den Durchblick. Sie hat bis zum Abflug einige Stunden Zeit und erkundet in der Wartezeit das Flughafengebäude. Überaus redselig macht sie uns mit Erzählungen die Vorzüge unseres ersten Ziels schmackhaft.
Freudestrahlend erzählt sie uns: „Es war traumhaft schön. Ich bin immer noch hin und weg. Der dreiwöchige Urlaub auf Bali hat mich total angetörnt.“
Aha, denke ich. Aber ist das tatsächlich so? Ich bin gern gutgläubig, trotz allem frage ich kritisch dazwischen: „Ich habe entgegengesetzte Meinungen gehört. Was war so toll an Bali?“
„Nun gut“, wägt sie beleidigt ab, doch danach lässt sie die Funken ihrer Begeisterung sprühen: „Vielleicht ist nicht alles wie in einem Paradies, aber tagtäglich nur Sonnenschein und heilsame Wärme. Was willst du mehr? Und dann die kilometerlangen Strände, die allein sind eine Wucht.“
„Das glaube ich dir“, unterstütze ich ihr schwärmen. „Und was sonst so?“
„Phantastisch ist auch das Essen, und die Menschen sind angenehm und friedfertig. Mich beeindruckt die Kritik der Klugscheißer nicht. So schön wie auf Bali ist es nirgendwo.“
Das Balifieber hat sie erwischt, denn das Wesen ist im siebten Himmel. Sogar Kullertränen der Rührung rollen ihr über die Wangen. Meine Frau und ich vermuten: Die Meinung der Frau ist nicht zu bewerten, denn so wie sie dahingeschmolzen ist, hat sie eine nette männliche Bekanntschaft gemacht?
Trotzdem hören wir derlei Geschichten über die Insel der Götter und Dämonen gern, denn mit Unvoreingenommenheit wollen wir das Reiseziel angehen. Bali kann beweisen, was es draufhat. Von uns bekommt die Insel jede Möglichkeit. Gegen acht Uhr hat die Warterei ein Ende.
Wir besteigen die Boing 770, übrigens ein erstaunliches Kaliber. Und in der Maschine die Plätze eingenommen, serviert eine Flugbegleiterin für die restliche Flugstunde ein für Fastfood-Verhältnisse leckeres Chicken Curry.
Bali
Mit Bali verbindet man eindrucksvollen Hinduzeremonien. Der Name steht für hypnotisierende Tanzvorführungen, bezaubernde Menschen, grüne Reisterrassen, weiße Strände und atemberaubende Wellen. Wir sind gespannt wie ein Flitzebogen, ob die Lobhudeleien der Hochglanzbroschüren zutreffen. In uns steckt eine Menge Neugier auf ein Inselparadies, das sich australische Urlauber mehrheitlich angeeignet haben.
Spät abends am 30. September landen wir auf dem Ngurah Rai Airport in Denpasar. Und das Flugzeug verlassen, holen wir unsere Gepäckstücke ohne große Drängelei an der Gepäckausgabe ab. Die Boing war nur zur Hälfte besetzt. Und kaum raus aus dem Flughafengebäude, stürzt sich ein Schlepper auf uns, mit dem wir zum Taxistand rauschen, prompt zahlen wir erstmals Lehrgeld.
Das Aushandeln des Fahrpreises für die Fahrt nach Kuta ist durch die balinesische Währung ungewohnt für uns, so knöpft man uns siebentausend Rupien ab, umgerechnet acht Euro. Das ist eindeutig zuviel. Gerechtfertigt wären fünftausend Rupien gewesen. Mehr hätte die Taxifahrt für drei Kilometer nach Kuta nicht kosten dürfen.
Aber was soll’s. Das Draufzahlen haben wir schnell verdaut, denn Abzocke ist in Asien normal und legal. Vergisst du in der Hektik die Preisvereinbarung, dann wirst du bestraft. Dagegen hilft nur eins: Sich das Aushandeln ein für allemal einbläuen. Anderseits hat die Taxifahrt nicht mal fünf Euro gekostet. Zuhause hält für das Geld kein Taxi an. Dennoch, die Episode über das Taxigewerbe musste sein. Leider wird uns das Problem während der Reise durch Ostasien wie ein Gespenst begleiten.
Wechseln wir das Thema, denn mehr als der Taxipreis schockt uns das kolossale Verkehrsaufkommen im Inselsüden. Der Lärm ist unmenschlich, denn das Kleinmotorrad ist des Asiaten liebstes Kind. Doch die Behauptung, dass den Banausen die Hupe an die Hand gewachsen sei, oder sie mit der Hupe auf die Welt kämen, das ist ein Gerücht.
Aber egal. Der enorme Lärmpegel gehört zu Bali. Die krankmachende Geräuschentwicklung durch die Liebe zum knatternden Zweirad, das ist ein asiatisches Phänomen. Wer sich für Ostasien als Reiseziel entscheidet, der plant das Getöse ein, und berücksichtigt die Quälerei für das Trommelfell.
Jedenfalls bringt uns das Taxi zum Sie Doi Hotel, in dem wir ein respektables Doppelzimmer beziehen und uns auffrischen. Danach machen wir uns auf die Socken zu einem Essen mit sich anschließendem Schlummertrunk. Wir trinken unser Standardgetränk, ein Bier mit Sprite Gemisch, dann sind wir reif fürs Bett. Doch wegen des Flugmarathons fällt das Einschlafen schwer, was am nicht abebbenden Auspufflärm und an den stumpfsinnigen Huporgien liegt.
Das Frühstück ist sehr gut. Wir können wählen zwischen europäisch und asiatisch, doch viel besser und interessanter ist die Beobachtung, die wir von unserem Esstisch tätigen. Eine Balinesin drapiert ein hübsches Spendentellerchen mitten auf die Kreuzung, dabei wird uns schlagartig bewusst, welch wichtige Rolle die Religion auf Bali einnimmt. Die heute praktizierte Form des Hinduismus ist für die Balinesen der Motor. Er bestimmt die Abläufe vom frühen Morgen bis zum späten Abend. Das religiöse Leben ist den Opferritualen unterworfen. Ich finde, dem Treiben um den Hinduismus mit dessen Auswirkungen zuzuschauen, das macht den Reiz für Balireisende aus.
Dazu einige Hintergrundinfos: Wussten Sie, dass ungefähr 90 Prozent der Bewohner Hindus sind und 40 Prozent des Haushaltsvolumens in die Religion fließt? Das geht zu Lasten der Infrastruktur, was wir bei der Weiterreise auf den katastrophalen Straßen hautnah spüren werden.
Tja, so ist das mit den Religionen. Ich persönlich bin kein Freund von Glaubensrichtungen, von Göttern oder Götzenverehrung, deshalb bin ich Atheist. Deshalb finde ich die Opfergaben kitschig und fragwürdig. Bitte gestatten Sie mir den Seitenhieb, obwohl der albern klingt. Und wo bitte landet der Kladderadatsch? Doch sicher auf dem Müll. Diese Zukunftsproblematik zu hinterfragen, dass steht einem grünen Expolitiker zu.
Anderseits respektiere ich die Gewohnheiten der Inselbewohner. Ihr Umgang mit den Göttern ist zumindest interessant. Dazu ein nicht ernst gemeinter Kommentar: Mir persönlich hat der Hotelpool hervorragend gefallen. Den hatte ich vor dem Frühstück für meinen Frühsport genutzt.
Aber nun zu den Kuta-Aktivitäten. Die bestehen als erstes aus einem Spaziergang zum Strand. An dem beobachten wir eine Hochzeitsvorbereitung. Meine Tochter hätte ihre Freude daran gehabt, denn sie hat vor nicht allzu langer Zeit mit allem Pomp geheiratet, trotz eines heidnischen Vaters wie mich. Hier in einem imposanten Strandhotel zu heiraten, dass macht was her, keine Frage. Die Balinesen verstehen sich auf hübsche Dekorationen und begeisternde Darbietungen, sei’s auf tänzerischer oder musikalischer Basis.
Besonders die Sandqualität des Strandes von Kuta ist über jeden Zweifel erhaben, außerdem erstrahlt dessen Länge in einer selten erlebten Unendlichkeit. Stundenlang mit nackten Füßen durch den feinen Sand und das seichte Wasser rauf und runter zu spazieren, das ist ein tolles Vergnügen. Gegen die intensive Sonnenbestrahlung cremen wir uns dick ein und setzen unsere Kappen auf.
Positiv ist: Die Masse an Urlaubern ist überschaubar. Es ist keine Hochsaison. Etwas störend dagegen empfinden wir die fliegenden Händler, die uns unnötigen Kram aufzuschwatzen versuchen. Leider gibt es viele von den aufdringlichen Gesellen. Dagegen wirken die Strandrestaurants erfreulich und einladend in ihrer bunten Aufmachung. Hübsch hat man sie für die berühmten Sonnenuntergänge zurechtgemacht. Wir gönnen uns eine Cola in einer farbenfrohen Lokalität.
Wunderbar anzuschauen ist mancher Sarong, feilgeboten von Frauen in der Landestracht, aber Angela als Opfer bleibt hart. Irgendwann gedenken wir, uns eins der dekorativen und praktischen Tücher zuzulegen, so zum Beispiel als Strandtuch, doch am ersten Tag?
O nein, das muss nicht sein. Wir warten ab und vergleichen die Angebote. Was die Einkäufe betrifft, da müssen wir sparsam mit der Reisekasse umgehen.
Auf dem Heimweg ins Hotel mieten wir für die Weiterfahrt nach Padang Bai die Mitfahrgelegenheit in einem Kleinbus für den nächsten Tag. Der Touristenschmelztiegel Kuta ist nichts für uns. Hier fühlen wir uns deplaziert, denn wir sehnen uns nach dem ursprünglichen Bali. Der Shuttlebus wird uns elf Uhr am Hotel abholen, jedenfalls verspricht man uns das hoch und heilig.
Ich denke, dass der Glaube daran Berge versetzen kann. Jedenfalls haben wir die Weiterreise mit dem erworbenen Kleinbusticket schriftlich und der Preis ist ein Klacks. Lausige zwölf Euro kosten die Fahrkarten für uns beide. Bali ist im Finanzbereich immer noch ein Billigland. Gut, das zu wissen.
Dass wir durch den Ticketkauf das Untergehen der Sonne verpassen, ist schade, aber der Bärenhunger siegt über den Augenschmaus. Priorität erhält der Besuch im Smyly Frog Restaurant. Das Essen ist in Ordnung. Wir als Gäste lassen uns auf Wunsch des Hauses knipsen, und wir sind damit einverstanden, dass das Photo auf einer Bildwand gezeigt wird. Warum auch nicht?
Dann bricht die Nacht herein. Die Sterne dominieren den Himmel. Was gibt es da besseres, als sich in die Hölle Kuta’s zu wagen. Doch das Wagnis ist eher ein Ärgernis, denn Kuta besteht aus einer Ansammlung an hässlichen Großhotels. Die Klötze sind an Geschmacklosigkeit nicht zu überbieten, ebenso abscheulich ist das Vergnügungsangebot mit den teuren Restaurants und einer unüberschaubaren Masse an Klamottenläden und Souvenirbuden.
Doch wir kennen keine Resignation, denn glücklicherweise gibt es eine Ausnahme. Wir setzen uns mit mäßigen Erwartungen in ein Nachtlokal mit Live Musik, in dem die Band alte Klassiker der Popmusik spielt. Der Sänger wirkt mit seiner hochgestylten Mähne wild und ungezähmt. Irgendwie sieht er phantastisch damit aus.
In einer Auftrittspause treffe ich ihn in der Toilette. Er bringt seine Haare in Form und ich lobe ihn mit dem Daumen nach oben für seine Darbietungen. Er erzählt mir, dass er Indonesier wäre, aber in Australien leben würde, wonach die Oldies auch klingen.
Nach zwei langsam getrunkenen Mixgetränken, natürlich Bier mit Sprite, bezahlen wir, obwohl ich mit Grausen an die bevorstehende Nacht denke. Unter der Mithilfe von Ohrstöpseln versuchen wir dem Lärm der Mopeds beizukommen, doch das vergebens, denn mein Einschlafen misslingt.
Trotz allem bin ich in Gedanken mit dem ersten Tag auf Bali zufrieden, obwohl das Treiben in Kuta meinen Idealvorstellungen nur bedingt entspricht. An Urlaubsparadiese stelle ich andere Anforderungen.
*
Das Schrottteil als Kleinbus holt uns am nächsten Vormittag zur Fahrt nach Padang Bai ab, natürlich eine halbe Stunde zu spät. Ich frotzele und das zynisch: „An Unpünktlichkeiten werden wir uns auf Bali gewöhnen müssen. Verspätungen scheinen normal im Transportwesen Ostasiens zu sein.“
Der Bus ist besetzt mit neun Personen der verschiedensten Nationen. Meine Frau, mich und den Fahrer hinzugezählt ist die Buskapazität mit zwölf Personen ausgereizt. Padang Bai ist runde siebzig Straßenkilometer von Kuta entfernt. Das ist ein Katzensprung, sollte man meinen.
Vorerst aber ein dreifaches Halleluja, denn ich sterbe tausend Tode. Bei Überholmanövern versuche ich den Gegenverkehr auszuklammern. Ich schließe die Augen um nicht zu kollabieren und wende mich mit Grausen von den Zuständen auf der Landstraße ab. Bei mir wechseln sich Angstattacken mit Schweißausbrüchen ab, da der Fahrer wie der letzte Henker fährt, obwohl der überdimensionale Verkehr dem blanken Wahnsinn gleicht. Bei Verkehrsunfällen sterben täglich acht Personen auf Bali, eine achtmal höhere Zahl an Toten gegenüber Europa. Diese Information des Reiseführers quält mich während der Fahrt im Hinterkopf.
Doch trotz der gewagten Fahrweise des verhinderten Rennfahrers brauchen wir anderthalb Stunden bis Padang Bai auf den unterschiedlichsten und unübersichtlichen Verbindungsstraßen. Gott sei Dank, wir haben das Chaos überlebt. Dennoch hat sich das Busfiasko in mein Sicherheitsdenken eingebrannt.
„Ratsch“, macht es, als ich aussteige. Was war das?
Leider bin ich mit meiner Short an irgendeinem Hebel oder Haken im Bus hängen geblieben.
„Scheiße“, entfährt mir der typisch deutsche Fluch über den ekelhaften Riss im Gesäß. Aber das Beinkleid ist wichtig für den weiteren Reiseverlauf, denn ich bin nur mit einem Minimum an Shorts ausgestattet. Was also tun?
Kommt Zeit, kommt Rat. Vorerst befinden wir uns am Busbahnhof zur Fähre nach Lombok, wo fast alle Mitreisende zu den Gili Partyinseln weiterreisen. Wir dagegen haben Padang Bai als Aufenthaltsort auserkoren, dessen Ursprünglichkeit hat uns zu dem Schritt bewogen. War die Entscheidung gut?
Nach den ersten Eindrücken fällt der Ist-Zustand eher bescheiden aus, anstatt ursprünglich,. Padang Bai ist schmutzig. Die Umgebung ist zugemüllt. Wie erwähnt steht Bali vor einem riesigen Müllproblem. Für mich als Bauingenieur, der sich beruflich mit der Müllproblematik beschäftigt hat, ist der Zustand auf Bali ein Schlag ins Gesicht. Old Germany ist fortschrittlicher. Unser Heimatland nimmt die Vorreiterrolle bei der Mülltrennung und Verwertung in Anspruch. Wann begreift die asiatische Entwicklungsregion, dass der Missbrauch beim Umgang mit Plastiktüten eine Gefahr für den Lebenskreislauf darstellt und eine Geisel der Menschheit werden kann? Und was macht man in Padang Bai? Man schiebt das Problem beiseite.
Trotz des Negativeindrucks bummeln wir durch verwinkelte Gassen, denn wir brauchen eine Bleibe, dabei kommen wir an vielen mit elefantenähnlichen Skulpturen versehenen Häusern vorbei. Im altertümlichen Ortsbereich tun sich die schönen Seiten des ausgewählten Städtchens auf. Die gefallen uns sehr. Unser Wahlspruch lautet: Den Dreck nicht beachten. Und dass das klappt, darauf setzen wir unsere Hoffnungen, denn wir denken positiv.
Aber etwas anderes, nicht minder unangenehmes, tut sich auf? Es sind die vielen Kampfhähne, die in ihren Korb-Kerkern überall herumstehen, und das in der prallen Sonne. Hahnenkämpfe seien verboten, das habe ich im Reiseführer nachgeblättert. Doch wer hält sich dran? Auf Bali niemand.
Wie in Kuta den Lärm, so verdränge ich hier die Themen Dreck und Kampfhähne, prompt stellt sich der Erfolg ein bei der Unterkunftssuche. Blitzschnell ist die im Lonely Planet angepriesene Hüttenanlage mit ihren exotischen Pflanzen und Bäumen und dem wohlklingenden Namen „Billabong“ gefunden.
O Mann. Die hochhinausragenden Strohhütten sind eine optische Augenweide mit ihren geschwungenen Dächern und den leuchtenden Reisstrohwänden, woraus auch eine kleine Bank und ein Sekretär angefertigt sind. Ansonsten ist die Aufmachung spartanisch. Eine steile Treppe führt hinauf in den Schlafbereich mit Bett und Moskitonetz und unten ist der Sanitärtrakt, in dem die Wasserspülung nicht funktioniert und das Waschbecken leckt.
Der Preis pro Nacht ist dagegen spottbillig. Das schräge Häuschen kostet acht Euro, inklusive Frühstück. Doch leider ist das weniger bombastisch, denn es besteht aus einer Tasse Kaffee, dazu zwei Scheiben staubtrockenem Toast und etwas Honig. Aber die Anlage strahlt eine himmlische Ruhe aus und ist damit anheimelnd. Nur zwei weitere Hütten sind bewohnt.
Tja, was bedeutet diese Auslastung? In Padang Bai ist nicht gerade der Teufel los.
Wir akzeptieren das Frühstücksangebot und beklagen uns nicht, stattdessen testen wir den Strand Blue-Lagoon. Auf den ersten Blick ist er wunderschön und einladend. Tückisch sind glitschige Steine und unsichtbare Löcher auf dem Weg ins tiefere Wasser. Ich falle fürchterlich auf die Fresse und prelle mir dabei zwei Finger der rechten Hand.
„Das fängt ja gut an“, murmele ich mit Groll und lege meine Badewünsche an ad acta. Für die entgangenen Badefreuden kann mich höchstens ein gutes Essen entschädigen. Das erhoffe ich mir im Restaurant mit hohem Urlauberzuspruch. Und das zurecht, denn hinterher stellen wir fest: Es war ein leckeres Chicken Curry.
Nach dem Essen machen wir einen Rundgang durch die Botanik, dann lassen wir den Abend mit dem üblichen Bier und Limo Gemisch in einem netten Lokal ausklingen. Ein abwechslungsreicher Tag mit einigen Anstrengungen liegt hinter uns. Der zwingt uns relativ früh in unser Bett mit Moskitonetz.
Doch auch in Padang Bai schläft meine Frau sehr schlecht. Sie wird von den Schiffssirenen der Fähren nach Lombok und zu den Gilis wachgehalten, und die tuten relativ häufig.
*
Den nächsten Tag beginnen wir gelassen. Zuerst erstatten wir dem von mir nicht sonderlich geliebten Strand einen Besuch, immerhin sind die Voraussetzungen gut, um sich in der Sonne zu aalen. Auf dem Sarong liegend und in losgelöster Stimmung, gebe ich meinen Gedanken Freigang.
Herr im Himmel, mir geht es verdammt gut. Meine hervorragende körperliche Verfassung schmeichelt mir durch den Kopf. Ich bin bis auf die Prellungen beschwerdefrei. Mein Herz hat die Qualität eines Jungspundes, das hoffe ich zumindest, und mein Kreislauf gleicht dem eines Leistungssportlers. Und weiter denke ich: Wir werden ein halbes Jahr unterwegs sein, insoweit ist alles easy. Wenn nicht auf Bali, wo sonst kann es mir gelingen, das Leben in vollen Zügen zu genießen. Im Sonnenparadies entgehen wir der Horrorberichterstattung über den Zustand der Welt. Sehe ich über die Schwachpunkte der Insel hinweg, dann verbringen wir hier beschauliche Tage.
Über den nächsten Tag nachdenkend, beschließen wir einen Abstecher nach Ubud, das ist das künstlerische Mekka der Insel. Als wir vom Strand in den Ortskern zurückgekehrt sind, ordern wir die Mitfahrt in einem Minibus für den Ausflug, Unkostenpauschale zwölf Euro. Und die Formalitäten festgemacht, überrascht uns ein Regenschauer. Und der hat es in sich, sodass wir uns unterstellen müssen. Doch das tun wir nicht lange, dann geht’s weiter durch den Regen. Nach dem sonnenüberfluteten Badeaufenthalt empfinde ich den kühlenden Schauer als angenehm. Ja, auch auf Bali regnet es ab und an, nicht nur in der Regenzeit.
Aber nun weiter im Text. Wir landen pitschnass in einem Restaurant mit Jamaika Flair. An der Theke nehmen einen Drink zu uns, dann entscheiden wir uns für den Schachzug, uns an einen Tisch zu setzen und die Speisekarte zu studieren. Und siehe da, es gibt ein Chicken-Curry, und das ist eine Spur besser, als das des Vorabends. Es ist das bisher perfekteste Curry auf Bali. So ist es wenig verwunderlich, dass wir das Jamaika-Restaurant zu unserem Stammlokal ausrufen.
Hinterher bringe ich meine kaputte Hose zur Schneiderei. In der verspricht mir die Näherin mit Händen und Füßen, der Riss sei am folgenden Abend genäht. Sie spricht kein englisch, daher kann ich ihre asiatischen Laute nur in diese Richtung deuten, aber mein Vertrauen in die Glaubwürdigkeit des Versprechens ist ungebrochen.
Den Abend verbringen wir in der Kneipe am Ende der Straße. Es ist ein Lokal nach dem Geschmack europäischer Touristen, im balinesischen Folklorestil rausgeputzt, doch seltsamerweise spielt und singt ein spanischer Gitarrist.
Wir als La Gomera Fans kennen die Gesangsstücke in und auswendig. Manchen Song haben wir so oft gehört, dass er uns schon zum Hals heraus hängt. Schade ist der geringe Zuhörerzuspruch, daran bestätigt sich: Padang Bai genießt nicht den Ruf einer Touristenhochburg. Der Ort ist die Durchgangsstation für die Überfahrten nach Lombok.
Unseren Ausflug nach Ubud starten wir mit einer dreiviertelstündigen Verspätung. Noch dazu fährt das Taxi einen Umweg. Wir sind für die einstündige Strecke zwei Stunden unterwegs. Erschwerend kommt hinzu, dass auf der Insel ein religiöses Fest gefeiert wird, auf das sich die balinesischen Männer mit einer weißen Mütze als Kopfschmuck einstimmen.
„Das Fest des Geistes“, nennt es der Fahrer. Jedenfalls ist das Verkehrsaufkommen katastrophal. Wir dringen nicht bis zum Ortskern vor, so gehen wir den Restweg zu Fuß. Tja, und was bringt uns der Ausflug?
Dessen Bewertung ist Geschmackssache, denn bis auf Ausnahmen hängt in den Gemäldegalerien sehr viel Mist für die Touristen. Der übliche Ramsch. Natürlich sehen wir nur einen kleinen Teil des Kunstangebotes, denn die Masse an Galerien zu besichtigen, das fällt allein aus Zeitgründen flach. Immerhin kaufe ich mir als Andenken an Ubud zwei ärmellose T-Shirts mit dem Elefanten-symbol.
Beim Auspacken habe ich festgestellt: Meine Anzahl an T-Shirts ist knapp bemessen.
Danach ist eine Nahrungsaufnahme angesagt. Nach kurzer Sucherei finden wir ein Cafe, bei dem Pfannkuchen auf der Speisekarte stehen. Unser Gaumen freut sich über den Hochgenuss. Hoffentlich ähneln sie den Meinigen zuhause?
Sie waren sehr gut und ich habe zwei verspeist, daher gehen wir gesättigt zur Hauptstraße, auf der wir sogar zu Fuß viel Zeit verlieren, denn der Verkehr steht. Wir zwängen uns an der Blechlawine vorbei durch die verstopften Innenstadtstraßen, doch ausnahmsweise wird nicht gehupt, für mich eine balinesische Sensation. Der religiöse Feiertag macht’s möglich.
Nach der Herkulessaufgabe erreichen wir das Ziel, den Monkey Forrest Park. Den kennt man durch unsere ihr Unwesen treibenden Artverwandten. Die Aufpasser versuchen die Affen am Diebstahl der Handtaschen unvorsichtiger Touristen zu hindern, was eine Atmosphäre voller Witz und Schabernack erzeugt. Alles in allem ist der Aufenthalt ein von nicht enden wollendem Gelächter geprägtes Ereignis, dazu erzeugen das baumreiche Gelände und der einer Klamm in den Alpen ähnelnde Verlauf des Baches heimatliche Gefühle. Wie sich das Wasser durch die Felsen quetscht, das ist eine optisch sehr ansprechende Konstellation.
Und das war’s. Ehe wir uns versehen, ist die Zeit in Ubud vorbei. Der Tag ist zumindest halbwegs ausgereizt, aber wir müssen uns um die Rückfahrt kümmern. Wie jedoch finden wir ein Taxi an diesem Feiertag? Fährt überhaupt eins?
Erste Versuche schlagen prompt fehl, doch durch weitere Bemühungen ordern wir den Taxifahrer, der uns in einer Stunde praktisch bis vor unsere Haustür fährt. So soll es sein. Der Mann hat einen Orden verdient.
Wir machen uns schnell frisch und eilen in unser Stammlokal, in dem wir das Nasi-Goreng probieren. Es schmeckt hervorragend. Bei weitem nicht so langweilig wie die Fertiggerichte in den Restaurantketten europäischer Einkaufspaläste. Es ähnelt dem Chicken-Curry des Vortages.
Der übliche Schlaftrunk muss entfallen, denn der Gitarrist genießt seinen Ruhetag, daher beschäftige ich mich als Abendvergnügen mit meinem Reisetagebuch und knipse kurz nach zwölf das Licht aus.
Das spärliche Frühstück verfeinern wir mit Butter. Trotz schlechter Englischkenntnisse der Frühstücksbeauftragten verschaffe ich uns Butter für den Toast, und das mit Hand- und Fußakrobatik, was den Erfolg bemerkenswert macht. Nichtsdestotrotz wundere ich mich. Warum lernt die Frau kein englisch?
Nun ja, sie ist nicht mehr die Jüngste. Trotz allem ist die Platzherrin die Freundlichkeit in Person.
Einigermaßen satt ziehen wir los und mieten ein Taxi für die Weiterreise am nächsten Tag. Wir wollen den Norden Balis mit unserer Anwesenheit beehren. Bis dahin bleibt uns ein ganzer Tag, daher reagieren wir auf den Tipp des Taxivermieters, den südlichen Strand des Ortes aufzusuchen, zu Fuß eine halbe Stunde.
Somit beginnt er, der ganz normale Wahnsinn. Als wir bei der Schneiderei vorbeieilen, sehe ich meine Jeanshose unberührt daliegen, wie am jüngsten Tag. Wie kann das sein? Zu meinem Erstaunen höre ich, dass ich nach-mittags reinschauen solle.
Aha, jetzt soll sie am Nachmittag fertig sein. Verstehe ich das richtig? Kann ich das glauben? Auf Bali herrschen ungewöhnliche Zeitvorstellungen.
Aus Frust bekomme ich unbändige Lust auf einen Glimmstängel, was mich schmerzt. Ich war mir einhundertprozentig sicher, dass ich das Verlangen überwunden habe, aber unter Stress bin ich anscheinend anfällig für Kehrtwendungen. Bekommt die Tabakindustrie eine Chance?
O nein, ich bleibe knochenhart. Mein Suchtknubbeldasein ist vorbei. Durch den Infarkt habe ich den Tabakmissbrauch erfolgreich in die Schranken verwiesen und für allemal beendet. Zudem weiß ich nicht, woher ich eine Zigarette bekommen könnte.
Das Thema Rauchen kurz und schmerzlos abgehakt, gehen wir einen Umweg zum Strand, dadurch kommen wir durch eine sehenswerte Landschaft.
Als wir den beabsichtigten Strandabschnitt erreichen, knallt die Sonne erbarmungslos vom Himmel. Ich befriedige meinen Nachholbedarf an Schwimmaktivitäten, ja, ich tobe wie ein Kleinkind durch die sich auftürmenden und dann brechenden Wellen. Aufgeheitert verbanne ich die Gedanken an das Rauchen entgültig aus meinem Leben.
Doch das ausgiebige Badevergnügen macht hungrig. Wir setzen uns in die Essbude hinter den von uns ausgelegten Handtüchern und essen Pfannkuchen. Je eine Cola dazu getrunken, kostet das Festmahl zwei Euro siebzig. Wie können die Budenbetreiber davon leben? Preiswerter haben wir bisher nirgendwo gespeist. Aber danach heißt es Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen. Es besteht Sonnenbrandgefahr, trotz Sonnencreme und des schattenspendenden Baumes.
Also sind wir vernünftig. Wir brechen das Sonnenbad ab und wählen den Heimweg bei der Schneiderin vorbei.
Stockschwere Not, was macht die gute Frau mit mir? Ich bin am Boden zerstört, denn die Prinzessin an der Nähmaschine vertröstet mich auf den Abend. Die hat sie doch nicht mehr alle. Ist sie von allen guten Geistern verlassen? Mein Geduldsfaden ist dem reißen nahe. Aber mir sind die Hände gebunden, denn ich bin von ihr abhängig..