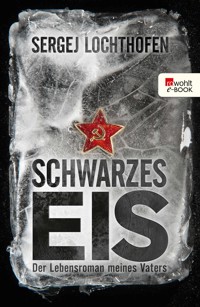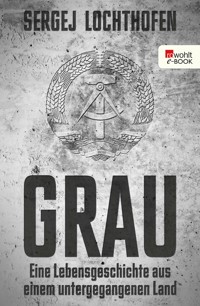
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Sergej Lochthofen gehört zur dritten Generation einer deutsch-russischen Familie, die den Stalinismus erlebt und erlitten hat – von der Oktoberrevolution über den Gulag bis zum Mauerfall. In diesem Buch erzählt er, wie er aus Workuta nach Thüringen kam, auf der Straße die Sprache lernte, als einziges Kind eines Zivilisten in eine sowjetische Garnisonsschule ging, von zu Hause ausbrach, um auf der Krim Kunst zu studieren, vor der Einberufung in die Sowjetarmee zurück in die DDR floh und während der bleiernen Honecker-Zeit den stupiden Alltag in einer SED-Zeitung als Journalist erlebte – bis schließlich die aufregende Wendezeit anbrach. Dabei wird deutlich: Die Verschränkung von Deutschland und Russland ist mehr als ein biographischer Zufall. Wer die DDR verstehen will, muss die Sowjetunion mitdenken.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 577
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Sergej Lochthofen
Grau
Eine Lebensgeschichte aus einem untergegangenen Land
Über dieses Buch
Sergej Lochthofen gehört zur dritten Generation einer deutsch-russischen Familie, die den Stalinismus erlebt und erlitten hat – von der Oktoberrevolution über den Gulag bis zum Mauerfall. In diesem Buch erzählt er, wie er aus Workuta nach Thüringen kam, auf der Straße die Sprache lernte, als einziges Kind eines Zivilisten in eine sowjetische Garnisonsschule ging, von zu Hause ausbrach, um auf der Krim Kunst zu studieren, vor der Einberufung in die Sowjetarmee zurück in die DDR floh und während der bleiernen Honecker-Zeit den stupiden Alltag in einer SED-Zeitung als Journalist erlebte – bis schließlich die aufregende Wendezeit anbrach. Dabei wird deutlich: Die Verschränkung von Deutschland und Russland ist mehr als ein biographischer Zufall. Wer die DDR verstehen will, muss die Sowjetunion mitdenken.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, September 2014
Copyright © 2014 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Lektorat Christof Blome
Umschlaggestaltung Anzinger und Rasp, München
Unmschlagabbildung thinkstockphotos.de
ISBN 978-3-644-03821-9
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Inhaltsübersicht
Motto
Widmung
Alles schien verloren.
Das Jahr 1970: ...
In der Bucht ...
1970. Kapitel
I
Das Jahr 1960: ...
Vor der Abreise ...
1960. Kapitel
I
II
III
Das Jahr 1961: ...
In der Garnisonsschule: ...
1961. Kapitel
Das Jahr 1963: ...
Letzte helle Momente: ...
1963. Kapitel
Das Jahr 1965: ...
Im Thüringer Wald: ...
1965. Kapitel
Das Jahr 1967: ...
Mit Manfred Stötzer ...
1967. Kapitel
Das Jahr 1968: ...
Aufnahme vor dem ...
1968. Kapitel
I
II
Das Jahr 1969: ...
Gefährlicher Karneval: Pawel ...
1969. Kapitel
1970. Kapitel
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
Das Jahr 1971: ...
Gitarrist einer Band, ...
1971. Kapitel
I
II
III
IV
V
VI
VII
Das Jahr 1972: ...
Rückkehr von der ...
1972. Kapitel
I
II
III
Das Jahr 1973: ...
Irgendwo auf dem ...
1973. Kapitel
I
II
Das Jahr 1974: ...
Nahe bei der ...
1974. Kapitel
Das Jahr 1975: ...
Standesbeamtin zu Maria: ...
1975. Kapitel
Das Jahr 1976: ...
Ferienidyll mit Westbesuch: ...
1976. Kapitel
Das Jahr 1977: ...
Ganz im Stil ...
1977. Kapitel
I
II
Das Jahr 1978: ...
Ursache für viel ...
1978. Kapitel
Das Jahr 1981: ...
Deutscher Sommer: Boris ...
1981. Kapitel
Das Jahr 1983: ...
Statt Ausweis: Ein ...
1983. Kapitel
Das Jahr 1985: ...
Erinnerung an die ...
1985. Kapitel
Das Jahr 1987: ...
Immer etwas anders: ...
1987. Kapitel
Das Jahr 1988: ...
Es gab sie ...
1988. Kapitel
I
II
Das Jahr 1989: ...
Auf Recherche in ...
1989. Kapitel
I
II
III
Das Jahr 1990: ...
Die neue Zeitung: ...
1990. Kapitel
«Solange man nicht ein Grau gemalt hat, ist man kein Maler.»
Paul Cézanne
Dank allen, die mir bei der Arbeit geholfen haben,
besonders Antje-Maria, die ich um ein Kapitel bat.
Alles schien verloren.
Ich begann, leise zu weinen.
Am liebsten hätte ich die Blechbüchse in den Fluss geworfen. Stattdessen schöpfte ich weiter. Doch das Wasser im Boot nahm nicht ab. Schmatzte um meine Schuhe. Stieg höher. Und höher.
Die beiden großen Jungs schwiegen.
Das einzige Paddel, das wir hatten, war gerade unter das Eis gerutscht. Mein Bruder schrie «Pass auf», aber da war es Slawka bereits entglitten. Bedrängt von einer dicken Scholle trieb das Boot langsam Richtung Wehr, und was dann passieren würde, verstand sogar ich, mit meinen kaum fünf Jahren. Als Erster löste sich Pawel aus der Starre. Er schob Slawka den Spaten zu, holte unter dem Sitz die Axt hervor und zog sich auf dem Bauch liegend über die Spitze des Bootes weit hinaus.
«Slawka, du ruderst mit dem Spaten, ich versuche, das Eis aufzuhacken. Und du, flenn nicht!», schnauzte er mich an. «Schöpf! Schöpf! Oder wir saufen ab!»
Ich hörte die dumpfen Schläge, sah die Splitter wie kalte Funken in alle Richtungen fliegen. Immer und immer wieder schlug Pawel auf das Eis ein. Doch die mächtige Scholle wollte ihre Beute nicht hergeben.
Dabei hatte unser Abenteuer so wunderbar begonnen.
«Los, komm!»
Pawel steckte seinen Kopf für einen Augenblick durch die geöffnete Küchentür und verschwand wieder. Die Mutter war mit Kara beschäftigt. Sie fischte einen Suppenknochen aus dem Topf und legte ihn in die Hundeschüssel. Die schwarze Schäferhündin ließ die Augen nicht von ihr. Beide waren so konzentriert, dass sie vom Bruder nichts mitbekommen hatten. Kara drehte sich nicht mal um, als ich meine Buntstifte auf den Tisch warf, vom Stuhl sprang und rausrannte. An der Stimme, an seiner ganzen Haltung hatte ich sofort gemerkt, dass draußen etwas Spannendes wartete. Und wenn einen der ältere Bruder aufforderte, ihm zu folgen, gab es nur eins: nichts wie hinterher.
Ich riss meinen schwarzen Winterpelz vom Haken, schob die Mütze in die Stirn und eilte in den Vorbau. Dorthin, wo das Motorrad stand, das gestapelte Ofenholz und das Regal mit den Vorratskisten. Im «Tambor» herrschte fast das ganze Jahr über leichter Frost. Ich sah, wie Pawel die Axt unter seinen Mantel schob und sich den Spaten schnappte. Den hatte der Vater in seiner Werkstatt selbst gemacht, er war etwas Besonderes. Russische Spaten waren klobiger und viel schwerer, auch nicht so handlich. Der Bruder legte den Finger an die Lippen.
Das Wetter war mistig. Kein Schnee, aber auch kein Regen. Unser zweiter Hund Tarzan, eine stattliche Laika-Mischung, schaute uns von der Kohlenkiste aus aufmerksam zu, gab aber keinen Laut von sich. Er kannte nur einen Chef über sich, das war der Vater. Der Rest ging ihn nichts an. Wir rannten um die Pfützen springend zum Fluss hinunter.
Die Workuta staute sich an dieser Stelle und war breit wie ein richtiger Strom. Der «Rudnik», die Siedlung, an deren Rande wir wohnten, lag in einer Krümmung des Flusses. Auf der einen Seite begrenzt durch das Wasser, auf der anderen durch den Stacheldraht des Lagerzauns, hinter dem Tag und Nacht die immer hungrigen Wachhunde bellten. Etwas weiter stromaufwärts, dort, wo die Werkstätten, die Schule und das Magazin lagen, sah man den schwarzen Kegel der Abraumhalde des Schachts. Die eigentliche Stadt Workuta duckte sich auf der anderen Seite des hohen Ufers und war nicht zu sehen. Im Sommer konnte man sie über eine Pontonbrücke erreichen, im Winter über das Eis, auf dem dann sogar Laster fuhren. Nur im Frühjahr und im Herbst während des Eisgangs wurde das Wechseln auf die andere Seite zum Wagnis. Die zwischen den Eisschollen lavierenden Boote waren stets hoffnungslos überladen, und der Fährmann, ein Georgier, der auf den schönen Namen Motoradse hörte, war meistens betrunken.
Vom abfallenden Sandufer erkannte ich es sofort.
Es war der Traum eines jeden Jungen hier. Am Fluss lag ein Boot. Ein richtiges Holzboot. Davor brannte ein Feuer. Pawels Freund Slawka tanzte wie ein Schamane darum herum.
Der Winter war auf dem Rückzug, die Eisdecke vor wenigen Tagen aufgebrochen. In der Mitte des Flusses konnte man schon eine breite Rinne des schwarzen Wassers erkennen. Aber ans Ufer schob sich bedrohlich knirschend ein dicker Brei aus großen und kleinen Eisschollen heran. Blieb stehen, sammelte Kraft und kroch weiter. Ich schaute Pascha, wie mein Bruder auf dem Hof genannte wurde, bewundernd an.
«Das Boot gehört Slawkas Nachbarn. Der weiß nicht, dass wir es geliehen haben. Wenn er dahinterkommt, schlägt er uns tot», erklärte er mir. «Der Pott leckt ein bisschen, aber wir kriegen das schon hin. Slawka hat Teer bei der Bahnwerkstatt aufgetrieben, einen ganzen Eimer. Wir schmieren es in die Ritzen, dann stechen wir in See. Stromaufwärts, auch wenn es nicht leicht wird. Das Boot muss zurück.»
Es war wohl die längste Rede, die mir mein Bruder je gehalten hatte. Ich war erschüttert. Bei sechs Jahren Altersunterschied nahm er mich so gut wie nicht wahr.
Auf dem Feuer blubberte Teer, eine träge schwarze Masse in einer zerbeulten Drei-Kilo-Gurkenbüchse.
«Ich glaub, die Suppe ist fertig», sagte Slawka statt einer Begrüßung. Dabei schaute er auf mich herab, als wollte er sagen: Was will der hier? Ist höchstens eine Belastung. Mein Bruder fing den Blick auf:
«Wenn Haie kommen, schmeißen wir ihn über Bord.»
Die großen Jungs lachten und machten sich daran, das Boot umzudrehen. Ich half nach Kräften. Endlich lag das schwere Ding mit dem Boden nach oben. Slawka begann, mit einer Pappe, einen Spachtel hatte er nicht beschaffen können, Teer in die Fugen zwischen die Planken zu schmieren. Das Holz war durch und durch nass, die Schmiere klebte schlecht, aber das schien die Kapitäne nicht zu stören. Mich schon gar nicht.
Aus dem Gespräch der beiden hatte ich verstanden, dass, sobald der Teer fest war, die Expedition starten würde. Ziel war das offene Wasser. Dann sollte es vorbei am achten Schacht und der unheimlichen Siedlung «Schanghai», die aus einem Sammelsurium von Balken und Brettern bestand, flussaufwärts zum heimatlichen Anlegesteg gehen, woher das Boot stammte. Überhaupt in die Nähe von «Schanghai» zu kommen, hatte mir die Mutter strengstens verboten. Es hieß, es seien ehemalige «Lagerniki», die dort hausten. Entlassene Häftlinge, die nicht mehr in ihre Heimat zurückkonnten, auf die keiner wartete. Viele waren nach den Jahrzehnten hinter Stacheldraht nicht mehr fähig, ein normales Leben zu führen. Krank, oft genug zu Krüppeln geschlagen, blieben sie in der Nähe ihrer Pein, zu schwach, sich dem Bann des Grauens zu entziehen. Einige waren auch zu alt, um irgendwo auf dem «Festland», wie die Welt unten im Süden hieß, einen neuen Anfang zu versuchen. Arbeit fanden sie keine, so vegetierten sie am Rande der Lagerzone, froh, dass sie von der Staatsmacht übersehen wurden. Natürlich hieß es auf dem Hof, in «Schanghai» würden Kinder verschwinden. Ich hatte einmal eine Frau von dort an der Halde gesehen. In Lumpen gehüllt, die mit lauter Stricken und Fäden zusammengehalten wurden, suchte sie im Abraum nach Kohle. Als sie die Mutter und mich sah, wir waren auf dem Weg ins «Magazin», um Brot, Hirse und Milch zu holen, falls es etwas davon gab, kroch sie scheu wie ein Tier die Halde hinauf. Bald konnte man sie zwischen den Gesteinsbrocken nicht mehr erkennen. Sie hatte sicher Angst, wir könnten sie verraten.
Dass die Route des Boots weit über meinen üblichen Horizont hinausführen sollte, beunruhigte mich wenig. Mein Bruder war ja dabei. Was mich weit mehr beschäftigte, war die Frage, ob wir es überhaupt bis zum offenen Wasser schaffen würden. Das andere Ufer schien unendlich weit. Dazwischen schob sich der Eisbrei. Natürlich sagte ich davon nichts, schließlich wollte ich nicht als Feigling dastehen.
Pawel breitete die Expeditionsausrüstung aus: Strick, Enterhaken, wie ihn die Flößer benutzten, ein Holzpaddel, Spaten, die Axt und zwei leere Konservendosen.
«Und wo ist das zweite Paddel?», war ich so unvorsichtig zu fragen. Sofort verfinsterten sich die Mienen der Kapitäne.
«Sei froh, dass wir eins haben. Und wenn du noch mehr dummes Zeug redest, bleibst du gleich da.»
Ich nahm mir vor, den Mund zu halten, obwohl ich gerne noch etwas gefragt hätte. Denn auch das einzige Paddel gehörte nicht uns. Ich wusste, woher es stammte. Von der Beton-Frau, die auf einem Sockel an der Anlegestelle des «Ilijitsch» stand. «Ilijitsch» war der einzige Dampfer, der die Workuta befuhr, er trug den Vatersnamen von Lenin. Das Kunstwerk stellte eine dralle Sportlerin mit Paddel in der Hand dar, das Ideal der sozialistischen Frau, arbeitsam, gesund, optimistisch. Workuta war zwar eine der größten Lagerregionen des Landes, geschaffen, Menschen und Natur zu vernichten, aber ganz ohne Kultur ging es auch hier nicht. Doch irgendjemand musste das missverstanden haben, ihr Busen und ihr Hintern waren frech mit Tinte beschmiert. Das gesellschaftliche Bewusstsein hinkte dem gesellschaftlichen Sein noch weit hinterher.
Jedenfalls hatten sich die beiden Jungs das hellblaue Ruder bei ihr ausgeliehen. Wenn Motoradse das wüsste, hätte er sie ordentlich verbläut. Doch das war jetzt unwichtig. Kaum war der Teer verschmiert, schoben Pawel und Slawka das Boot ins Wasser. Ich musste mich auf das Brett am Heck setzen und Alarm rufen, sollte ein großer Stein den Weg versperren. Das war nicht der Fall. Wir warteten noch eine Weile, bis der Eisbrei am Ufer aufriss, dann ging es mit einem kräftigen Stoß hinaus. Das Wasser war schwarz, unheimlich und anziehend zugleich. Sosehr ich mich darüber freute, bei diesem Abenteuer der Großen dabei zu sein, so sehr sehnte ich mich schon jetzt nach der warmen Küche, nach heißem Tee, ja selbst nach Karas feuchter Schnauze, die immer dort war, wo man sie am wenigsten brauchte.
Langsam bewegten wir uns auf die Mitte des Flusses zu. Aus den vereinzelten Tropfen, die schon die ganze Zeit auf uns herunterplatschten, wurde Regen, aus Regen wurde Eisregen. Die Großen ruderten, was ihre Arme hergaben. Pascha auf der einen Seite mit dem Spaten, Slawka auf der anderen mit dem Paddel der dicken Sportlerin. Hatten sie anfangs fröhlich geschwatzt, wurden sie jetzt immer leiser. Langsam, etwas schlängelnd, kamen wir voran. Fast hatten wir die Mitte des Flusses erreicht, als uns plötzlich die Strömung erfasste. Das Boot begann, sich zu drehen, trieb seitlich ab, sosehr die Ruderer auch dagegenhielten. Es gehorchte nicht mehr. Von meinem Platz am Heck konnte ich plötzlich das Heimatufer wieder erkennen, die niedrigen Häuser der Siedlung, und ich sah, wie aus unserem Schornstein feiner Rauch stieg. Die Wachtürme und die Reihen der Lagerzäune verschwammen im Nebel. Zwischen uns und dem Sandstreifen des Ufers hatte sich ein dicker Eispanzer geschoben. Gerade wollte ich das den beiden berichten, da sah ich in ihren Augen das blanke Entsetzen. Ich ließ meine Füße vom Brett, auf dem ich kauerte, und stand bis zu den Knöcheln im Wasser.
«Los, nimm die Büchse und schöpf!» Pascha warf mir eine der Konservendosen zu. «Schöpf, hör ja nicht auf!»
Dann drehte er sich zu Slawka:
«Wir müssen zurück, sonst saufen wir ab.»
Slawka versuchte, eine Eisscholle wegzuschieben, und ehe Pawel etwas sagen konnte, war es zu spät.
Das Paddel war weg.
Paschas Schläge donnerten jetzt über das Eis. Dann tat es einen Knacks – und tatsächlich, ein Stück von der Scholle sprang ab. Das Boot schob sich langsam in die Bresche. Slawka ruderte mit dem Spaten wie ein Berserker. Ich schöpfte. Der Spalt wurde breiter. Zentimeter um Zentimeter ging es Richtung Ufer. Als dann endlich nur noch ein, zwei Meter bis zum Sand blieben, lief das Boot auf Grund. Slawka maß die Tiefe mit dem Spaten und machte einen Satz. In seine Stiefel schwappte Wasser, aber er konnte stehen. Nun hielt auch mich nichts mehr. Ohnehin völlig durchgeweicht, sprang ich ins Wasser und platschte bis auf das Sandufer. Heulend vor Angst und Kälte, rannte ich los. Der Weg, den wir vor zwei Stunden fast fliegend hinter uns gelassen hatten, kam mir jetzt ewig lang vor. Es hatte uns weit von der Stelle abgetrieben, wo wir gestartet waren. Pascha, der mit Slawka das Boot zu vertäuen suchte, ahnte, was ich vorhatte, und lief mir wütend hinterher. Ich hörte seine Schritte immer näher kommen. Am Haus hatte er mich fast eingeholt. Ich hastete durch den Vorbau und riss die Küchentür auf. Doch die Mutter war nicht da. Als ich mich schreiend umdrehte, stand sie erschrocken im Korridor. Hinter ihr der atemlose Bruder.
«Was ist passiert?»
Gerade als ich loslegen wollte, dass mein Bruder und dessen Freund uns beinahe ertränkt hätten, sah ich, wie Pascha seine Hand hinter dem Rücken der Mutter zur Faust ballte. Sofort hörte ich auf zu weinen.
«Ich bin auf dem Hof in eine Pfütze eingebrochen.»
Pawel drehte wohlwollend ab, während mich die Mutter anhielt, die nassen Sachen auszuziehen.
Damit war meine Karriere als Schiffsjunge beendet. Aber auch die beiden Kapitäne saßen auf dem Trockenen. Das vereiste Boot riss sich in der Nacht los und trieb zum Wehr. Dort stürzte es die Staumauer hinunter und zerschellte auf einem Findling. Das hölzerne Skelett war noch lange Zeit auf den Steinen inmitten der Stromschnellen zu sehen. Ob Slawkas Nachbar je erfuhr, wer sein Boot auf dem Gewissen hatte, weiß ich nicht. Auf jeden Fall brauchte er ein neues.
Der Ausflug mit dem Boot zeigte mir, wie schnell alles vorbei sein kann. Noch bevor es richtig angefangen hat. Wie bei Lönka, dem Schulfreund meines Bruders. Sie saßen in einer Schulbank, ärgerten die Mädchen, sie pafften gemeinsam die erste Papirossa. Nur an diesem verdammten Nachmittag hatte Pawel keine Zeit zum Schlittschuhlaufen. Lönka ging allein zum Fluss. Er brach ein. Niemand konnte Hilfe rufen. Den leblosen Körper fanden sie später unter dem Eis.
Es war ein kalter Tag und eine strahlende Sonne, als die gesamte Schule dem Wagen mit dem kleinen Sarg folgte. Das Bild dieses bleichen, leblosen Jungen auf dem Pferdewagen setzte sich in meinem Kopf fest. Ich werde es nicht vergessen.
Nichts war, nichts ist selbstverständlich.
Dass ich im Gulag auf die Welt kam und doch eine behütete Kindheit hatte, dass ich von dort nach Deutschland kam und nicht irgendwohin in die Steppe, dass es der Osten war und nicht der Westen, Gotha und nicht Berlin, dass ich in eine russische und nicht die deutsche Schule ging, einen sowjetischen Pass und nicht einen Ausweis der DDR besaß.
Nichts davon ist selbstverständlich. Vermutlich auch nicht, dass ich keine Heimat habe.
Viele gingen fort und wollten nur vergessen. Die Kälte. Den Zaun. Selbst die Sprache. Lieber grau sein als anders. Ich nicht. Ich wollte immer wissen, was dort war, warum es so war und was ich damit zu tun hatte. Wie aus einer verheißungsvollen Utopie eine ganz reale Perversion wurde. Und ich hatte das große Glück, nicht nur zwei Überlebende von dort als Zeugen fragen zu können, sondern auch, dass sie das Erlebte in Worte fassen konnten.
Um das tragische Ende einer Geschichte zu verstehen, muss man an ihren Anfang zurück. Für mich liegt der bei meinem Großvater, Pawel Alexandrowitsch Alförow. Er war als Kommissar dabei, als das Reich der Zaren zusammenbrach und im Blut von Revolution und Bürgerkrieg die neue Zeit geboren wurde. Vieles von dem, was Jahrzehnte später die Massen zum Protest auf die Straße trieb – in Prag, in Danzig, in Leipzig –, hatte seinen Ursprung in diesem misslungenen Anfang. Mein Großvater war Zeuge des Niedergangs einer großen Idee und des Aufstiegs Stalins zum grausamen Diktator. Als die Revolutionsromantiker in den Salons von Paris und Berlin noch hofften, saß er im Gefängnis und wusste, so sieht die lichte Zukunft nicht aus. Seine Geschichte, die Geschichte eines Mannes, der über dreißig Jahre in Lagern und Verbannung zubrachte und sich doch nicht beugte, war und ist für mich prägend.
Mein Vater, Lorenz Lochthofen, floh aus dem sich braun färbenden Deutschland in die rote Sowjetunion. Ein Land, das vorgab, ihn schützen zu wollen. Als einfacher Schlosser aus dem Ruhrgebiet konnte er in Moskau studieren. Schien das nicht Beweis genug, dass ab sofort alles möglich war? Die bittere Zweideutigkeit der Erkenntnis musste er im Großen Terror erfahren. Auch er wurde verhaftet. Millionen Menschen wurden umgebracht, damit für einige wenige die Illusion weiterlebte.
Beide, Vater und Großvater, begegneten sich hinter dem Lagerzaun von Workuta. Dem Schicksalsort unserer Familie, der drei Generationen verbindet. Dort im hohen Norden wurde ich geboren. Im Schatten der Wachtürme. Das vergisst sich nicht. Das bleibt ein Leben lang, selbst wenn man das Glück hat, die Gulag-Zone zu verlassen und in Deutschland neu anzufangen. Gemeinsam sind wir Zeugen eines Jahrhunderts, das mit einer blutigen Revolution 1917 begann und mit einer friedlichen Revolution 1989 endete. Und nicht Marx, der geniale Utopist, oder Lenin, der wendige Pragmatiker, nein, der stupide Stalin hat dieser Zeit seinen Stempel aufgedrückt.
Ist Workuta deshalb vielleicht meine Heimat?
Nein, ist es nicht.
Wer aber keine Heimat hat, gilt schlechthin als bedauernswerter Krüppel. Als fehlte ein Arm oder ein Bein. Von Geburt an. Ich habe keine Heimat. Aber ich bin deshalb nicht traurig. Sie fehlt mir nicht. Goethe ist mir so lieb wie Puschkin, Dostojewski wie die Mann-Brüder, Tschechow wie Brecht. Bin ich damit ärmer oder reicher? Und was ist mit den wirklich Armen, die sich nur reich wähnen? Habe ich vielleicht nicht nur eine Heimat, sondern zwei? Jedenfalls sind sich die Deutschen und die Russen viel näher, als sie es wahrhaben möchten. Schaut man auf das vergangene Jahrhundert zurück, so sind sie Zwillinge.
In Workuta gewesen zu sein war lange Zeit nichts, worüber man laut sprechen sollte.
Warst dort?
Hast überlebt?
Na dann, sei froh und halt die Klappe.
Oder willst du wieder dorthin?
Das fragt heute keiner mehr, aber wie ist es morgen? Die Menschen, die bereit waren, den Nachbarn zu denunzieren, seine Kinder ins Waisenhaus zu bringen, zu foltern, diese Menschen gibt es auch heute noch. Überall. Sie leben unter uns, unscheinbar, emsig, grau. Warten auf ihre Chance. Dann, wenn ihre ganz besonderen Fähigkeiten wieder gefragt sind. Nur die Erinnerung an das, was war, wie es war und warum es so war, kann uns davor schützen, ihnen wieder Macht zu geben.
Erinnerung nicht als toter Stoff, sondern als lebendige Geschichte. Widersprüchlich, zweideutig, sperrig.
Den schwarzen Geschichten folgen somit die grauen. Dem «Schwarzen Eis» der Arktis das «Grau» der späten DDR.
Es geht nicht mehr auf jeder Seite um Leben und Tod. Der Stalinismus ist in die Jahre gekommen. Er musste sich anpassen, und er hat gelernt, nicht jeden und nicht alles verstümmeln zu wollen. Er ist geschmeidiger geworden. Eine warme Feuerstelle und ein Schlag «Kascha» ist nicht mehr der einzige Komfort, den er sich gönnt. Im Geschäft gibt es Kohl und Möhren, nach Milch und Brot muss man nicht anstehen. Aber denunziert und bespitzelt wird weiter. Andere Meinungen sind nicht geduldet. Wer sich nicht anpasst, wird weggesperrt oder in den Westen abgeschoben, wenn es Devisen bringt, auch verkauft.
Viele schwiegen. Schauten weg. Ich auch.
Nicht wenige blicken heute auf das Leben von damals durch ein grobes Raster: Schwarz und Weiß. Mehr nicht. Es gibt Gründe dafür. Doch in meiner Erinnerung waren es vor allem Grautöne, die das Leben in der Deutschen Demokratischen Republik prägten. Das Grau des «Industrienebels» über den Dächern der Stadt, der nicht Smog heißen durfte. Das Grau der abgeschabten Fassaden der Häuser. Das Grau im Gesicht der jungen Frauen, die gehetzt nach der Arbeit die Kinder aus der Krippe holten. Graue Autos. Graue Kaufhallenregale. Das Grau der Zirkulare und Parteibeschlüsse …
Grau in allen Schattierungen. Als sei jede andere Farbe mit Schimmel überzogen. Graue Menschen in einem grauen Land.
Das Jahr 1970: Willy Brandt trifft sich in Erfurt mit Willi Stoph. Die DDR-Bürger bekommen eine Personenkennzahl. Auflösung der Beatles. US-Invasion in Kambodscha. Kennzeichnung «Made in GDR» wird eingeführt. Bei Protesten gegen den Vietnamkrieg werden in Ohio vier Studenten erschossen. Gründung der Roten Armee Fraktion (RAF). Abschluss des Moskauer Vertrags über Gewaltverzicht zwischen Deutschland und der Sowjetunion. Jimi Hendrix stirbt. Kniefall Willy Brandts in Warschau vor dem Denkmal für die Opfer des Ghetto-Aufstandes. Der erste «Tatort» wird ausgestrahlt. Bei Streiks in Polen werden mehrere Arbeiter erschossen. Noch 19 Jahre bis zum Fall der Mauer.
In der Bucht des Kara-Dag: Mit dem Großvater am Schwarzen Meer Ende der fünfziger Jahre.
1970
I
Es quietschte jämmerlich. Ohne jegliche Vorwarnung hielt der Laster mitten auf der Straße. Von dem heftigen Ruck ließ ich die Bordwand los und rutschte auf meiner Zeitung, die ich auf den dreckigen Boden gelegt hatte, quer über die Ladefläche auf die Bäuerinnen zu. Sie hatten direkt hinter der Fahrerkabine die «Logenplätze» belegt.
Ein Glück, ich traf die Jüngere, sie mochte Ende dreißig sein. Ich fand mich mit dem Gesicht an ihrem üppigen Busen wieder. Die weiße Bluse roch kräftig nach Kernseife und einem leichten Hauch von Schweiß, gemischt mit einem Blütenduft. Vielleicht Maiglöckchen-Parfüm. Die Frauen gacksten auf, und die Junge schob mich, noch bevor ich etwas sagen konnte, lachend von sich. Die Ältere, die Sonnenblumenkerne knackte, seit wir in Sudak aufgestiegen waren, zischte halb ernst, halb lachend:
«Uch, studentik patlaty», sieh an, das langhaarige Studentchen.
Ich stammelte eine Entschuldigung, aber die ging im lauten Geschrei des Fahrers unter, wir sollten absteigen. Auf die Erwiderung der Frauen, dass wir noch lange nicht im Dorf seien, zog er eine undefinierbare Grimasse:
«Konetz! Hier ist Schluss, weiter ist Quarantäne!»
Jetzt sahen wir es auch, zwei Männer mit Jagdgewehren und weißen Stoffbinden am rechten Oberarm standen vor dem Laster. Einer von ihnen ging am Fahrer vorbei auf uns zu:
«Das nächste Dorf, alles bis nach Feodossija, ist Sperrgebiet. Cholera! Kein Rein in den Sperrbezirk und auch kein Raus! Sie haben schon einen toten Touristen aus dem Wasser gefischt. Also, alle wie ihr seid, zurück nach Sudak.»
Die ältere der Frauen fing an zu klagen.
«Wir können nicht zurück, Söhnchen, wir müssen nach Schebetowka. Nur noch die paar Kilometer. Heute Morgen sind wir auf den Markt in die Stadt gefahren. Da war noch keine Sperre. Ihr könnt uns doch nicht hier auf der Straße aussetzen.»
«Wir haben das nicht festgelegt. Wir stehen nur Wache. Also macht keine Scherereien und dreht um!»
«Ich muss die Kühe versorgen. Und was soll mein Mann sagen, wenn ich heute Nacht nicht daheim bin?»
Der zweite Wachmann im Hintergrund machte eine Bemerkung, die man auf der Ladefläche nicht hören konnte. Die Männer lachten laut. Der Lkw-Fahrer wurde ungeduldig.
«Was ist, wollt ihr wieder mit nach Sudak? Oder wollt ihr absitzen?»
Die Frauen tuschelten einen Moment, dann stieg die Junge über die Bordwand und ließ sich von der Älteren die beiden Taschen herunterreichen. Auch die Alte stieg ab. Ich blieb unentschlossen sitzen. Jetzt wurde mir klar, warum an diesem späten Nachmittag auf der ansonsten vielbefahrenen Straße kaum ein Auto zu sehen war und nur dieser nach Schnaps riechende Lkw-Fahrer überhaupt anhielt. Meinetwegen sicher nicht. Die beiden Frauen taten ihm offenbar leid. Doch nun standen wir hier in den Bergen an einer Gabelung. Weit in der Ferne sah man im Licht der Abendsonne ein kleines fast blauschwarzes Stückchen Meer. Einige Meter weiter brannte ein Feuer, an dem sich die Wachleute niedergelassen hatten. Auch wenn ich nicht davon ausging, dass sie mit ihren Jagdgewehren auf uns schießen würden, konnte man sie nicht ignorieren.
Der Fahrer, der es gerade noch eilig hatte, holte eine Schachtel Zigaretten raus, hielt sie den Wachleuten hin und steckte sich selbst eine an. Aus ihrem Gespräch konnte ich entnehmen, dass die Quarantäne mindestens eine Woche dauern würde und dass es Sondergenehmigungen zum Passieren der Sperre nur im Stadtsowjet gab. Für normale Leute war die Gegend also dicht. Angestrengt überlegte ich, wo ich die Nacht verbringen könnte. Zurück nach Sudak hätte mich der Laster bestimmt noch mitgenommen, aber die über hundert Kilometer bis nach Simferopol fuhr an diesem Abend mit Sicherheit nichts mehr. Auch per Anhalter war da nichts zu machen. Im Sommer hätte man am Strand schlafen können. Aber dafür waren die Nächte bereits zu kalt. Abgelenkt durch das Gespräch des Fahrers mit den Wachleuten, bemerkte ich erst spät, dass die beiden Frauen sich leise davonmachten.
«Stoj, bleibt stehen! Uch, job twoju», rief ihnen einer der Männer derb fluchend hinterher. Als die beiden keine Anstalten machten, trabte er ihnen mit dem Gewehr wutschnaubend nach. Es folgte ein kurzer, heftiger Wortwechsel, dann drückte die Jüngere dem Wachmann wortlos etwas in die Hand, worauf dieser entspannt zurückkam, während die Bäuerinnen im Gestrüpp verschwanden. Nun war mir klar, was hier gespielt wurde. Auch ich nahm meine Reisetasche und schritt keineswegs verstohlen Richtung Berge und Wald.
«Ej», stand sofort der zweite Gewehrträger vor mir, «kuda prjösch?», wo treibt’s dich hin?
Damit hatte ich gerechnet.
«Ich muss nach Schebetowka, mein Großvater wartet.»
«Da wird er noch eine Weile warten müssen, ich habe dir gesagt, da ist kein Weg. Vielleicht in einer Woche. Vielleicht dauert’s länger.»
Ein kräftiger Hauch Alkohol wehte von ihm herüber.
«Klar habe ich das gehört, aber mein Ded geht schon auf die neunzig, ich kann ihn nicht sitzenlassen. Ich muss hin!»
«Sag mal, Bürschlein, hörst du schlecht? Das geht nicht. Scher dich mit dem Laster in die Stadt, ehe ich ärgerlich werde.»
Er fuhr bedeutungsvoll mit dem Daumen über den Gewehrriemen. So standen wir uns gegenüber, sahen uns an und schwiegen. Der Lastwagenfahrer warf den Rest seiner Zigarette auf die Straße und stieg ein. Der Motor heulte auf.
«Dawaj, aufsitzen, sonst helfen wir nach.»
«Aber die Frauen durften doch auch.»
«Welche Frauen?», grinste mich der Wachmann an. «He, Andrej, hast du Frauen gesehen?»
«Wär schön, wenn hier Weiber wären», antwortete der, während er sich auf einen Stein setzte und ein Scheit nachlegte, «dann wären wenigstens die Nächte nicht so lang.»
Der Lkw-Fahrer hatte inzwischen gewendet und rief mir aus dem offenen Fenster zu.
«Nu? Fährste mit?»
Ich schaute erst zu ihm, dann wieder zu dem Mann mit dem Gewehr. Dann kramte ich in meiner Hosentasche, holte einen zerknüllten Fünf-Rubel-Schein raus und drückte ihn dem Wachmann etwas ungelenk in die Hand. Der wusste sofort, die nächste Flasche Wodka war gesichert. Schlagartig wurde aus dem abweisenden ein mitfühlendes Gesicht:
«Aber geh nicht auf der Straße, hörst du? In deinen weißen Höschen sieht dich jeder sofort. Dann schnappt dich eine Patrouille, und wir bekommen auch noch Ärger. Da ist ein Pfad, unterhalb der Straße. Am besten du folgst den Weibern. Den Hintern der jüngeren siehst du auch im Dunklen. Die beiden kennen sich hier aus. Beeil dich.»
Es war eben eine russische Quarantäne.
Ein halber Liter Wodka kostete im Laden drei Rubel sechzig. Mit meinen fünf Rubel und dem Geld der Frauen hatten die wackeren Vertreter der Staatsgewalt binnen weniger Minuten zwei Flaschen Schnaps verdient.
Der Lastwagen hupte und machte sich davon, während ich die steile Böschung hinabstieg. Hier und da musste ich an trockenen Grasbüscheln Halt suchen, um nicht abzurutschen. Es roch nach Thymian, in den Büschen zirpten die Zikaden. Weit vor mir sah ich im trockenen Bachlauf die Frauen zügig in das Dickicht der niedrigen Eichen verschwinden. Wäre da nicht die weiße Bluse der Jüngeren und ihr weißes Kopftuch, ich hätte sie kaum im Blick behalten können. Die tiefstehende Sonne ließ die Schatten immer länger werden, ich musste mich beeilen, wollte ich nicht allein herumirren.
Es war ein merkwürdiges Gefühl. Vor zwei Monaten war ich siebzehn geworden, hatte im Juni zuvor mein Abitur gemacht und die Aufnahmeprüfungen der Kunstschule auf der Krim bestanden. Nun hatte ich das erste Mal in meinem Leben einen Menschen bestochen. Und das ging leicht. Der eine gibt, der andere nimmt. Und weiter geht’s, wo gerade noch kein Weg war. Die Scham, die ich im ersten Augenblick dabei empfunden hatte, war schnell verflogen. Jetzt kam ich mir sogar ziemlich kühn vor. Wie beim ersten Glas Wein. Ein Akt der Emanzipation und des Erwachsenwerdens. Aber irgendwie war es auch unheimlich.
Im Vorbeigehen schnitt ich einen Stock ab. Nicht so sehr als Stütze, eher als Waffe gegen Schlangen. Ich hatte vor Jahren, in den Ferien hier auf der Krim, meine erste Erfahrung mit ihnen gemacht. Einer der Jungs aus unserer Straße schlug vor, im «Stawok», einem Wasserspeicher der Kolchose, schwimmen zu gehen. Alle stimmten fröhlich zu. Das Gewässer war so groß wie ein Fußballplatz und lag an einem ausgetrockneten Bachlauf, nicht weit von der Straße nach Sudak. Jetzt war ich sicher, dass ich in dieser Nacht daran vorüberkommen musste, irgendwie stimmte mich dieser Gedanke froh. Damals aber wurde mir mulmig, denn das Dumme war, ich konnte gar nicht schwimmen. Genauer gesagt, ich konnte allenfalls mit den Zehenspitzen auf dem Boden stehend die Hände so bewegen, dass es aussah, als könnte ich.
Auch anderen Jungs sah man bei aller Begeisterung die Unruhe an. Der «Stawok» galt als sehr tief, denkbar ungeeignet für Nichtschwimmer. Im Sommer zuvor war darin ein Agronom ertrunken. Aber nach allgemeiner Auffassung lag das nicht am Gewässer, auch nicht an den mangelnden Schwimmkünsten des Mannes, sondern daran, dass ihn seine Frau verlassen hatte.
Von den sechs Burschen unserer Clique konnten allenfalls zwei von sich behaupten, dass sie im Wasser nicht sofort untergingen. Dennoch gab es kein Zurück. Die Häme, mit der die Schwimmer alle anderen überzogen, ließ mir angeraten sein, mich nicht zu offenbaren. Bisher war das Risiko klein, als Nichtschwimmer entlarvt zu werden. Meist ging ich mit dem Großvater und meinem Bruder ans Meer, was die Jungs wegen der vier Kilometer Fußmarsch selten taten. So konnte keiner wissen, was ich wirklich draufhatte.
Nun wurde es eng.
Am Teich herrschte Betrieb. Selbst Mädchen waren da, was die Sache nicht besser machte. Ich zog mich in Zeitlupe aus, dankbar für jede Sekunde, die ich noch nicht ins Wasser musste. Vorsichtig schaute ich mich um, und das bisschen Mut, das ich noch hatte, verließ mich endgültig. Einen Strand im eigentlichen Sinn gab es am «Stawok» nicht. Wer schwimmen konnte, sprang mit Anlauf vom Steilufer in das lehmbraune Wasser, das vornehmlich zur Bewässerung der Weinfelder diente. Die Nichtschwimmer tummelten sich eng beieinander auf einer glitschigen Uferkante immer in der Gefahr, ins Tiefe abzurutschen.
Als eine «Besonderheit aus Deutschland» stand ich in der Hackordnung der Jungs weit oben, obwohl ich nicht rauchte und keine der üblichen Schimpfwörter gebrauchte. Nun sah ich diesen Abhang, und in mir krampfte sich alles zusammen. Nicht nur mein Leben, mein Ruf stand auf dem Spiel. Als Sascha, der fast gleichaltrige Nachbarjunge, mit dem ich all die Jahre während der Ferien in der Gegend herumstreifte, seine Zigarette ausgeraucht hatte, musste gehandelt werden. Während Sascha vorsichtig nach unten zu den Nichtschwimmern kletterte, zögerte ich noch. Dann rannte ich los und stürzte mich mit geschlossenen Augen ins Wasser. Es tat einen lauten Klatscher, den ich eigentlich gar nicht beabsichtig hatte, dann schloss sich das Wasser über mir. Ich sank immer tiefer, ohne den Boden zu erreichen. Für einen Augenblick öffnete ich die Augen, konnte in der dreckigen Brühe aber nichts sehen. Es ging tiefer und tiefer, das Wasser, gerade noch warm, wurde kalt und kälter. Ich machte mehrere verzweifelte Bewegungen und merkte zu meinem Erstaunen, dass ich das Sinken aufhalten konnte. Langsam ging es sogar wieder aufwärts. Ich tauchte auf und sah das rettende Ufer fünf oder sechs Meter von mir entfernt. Noch einmal griff die Verzweiflung nach mir. Ich strampelte wie wild und versuchte gleichzeitig, mich mit den Händen durch das Wasser zu schieben. Es ging. Es ging sogar sehr gut. Es machte sogar Spaß.
Ich konnte schwimmen.
Als ich das Ufer hinaufkletterte, warteten die Jungs schon auf mich. Sascha schlotterte mit blauen Lippen, obwohl mir das Wasser eher warm vorgekommen war. Aber er suchte wohl nur nach einem Anlass, um sich eine weitere Zigarette anzuzünden.
«Hast einen ganz schönen Satz gemacht, Serjöga!», sagte er voller Bewunderung.
«Ja, das mache ich immer, wenn ich nicht weiß, wie tief es ist», erwiderte ich, als sei es das Normalste von der Welt.
In Wirklichkeit jubilierte es in mir.
Ich wartete diesmal nicht, bis Sascha seine Zigarette geraucht hatte, sondern drehte mich auf der Stelle um, nahm Anlauf und wagte – nunmehr mit dem Kopf zuerst – einen weiteren Sprung ins Wasser. Wegen der Mädchen, die dem Deutschen neugierig hinterherschauten. Was ein Köpfer werden sollte, wurde ein kapitaler Bauchklatscher. Ungeachtet der brennenden Schmerzen machte ich ein paar Züge unter Wasser und tauchte erst in einiger Entfernung von der planschenden Meute auf. Es war ein befreiendes Gefühl. So ähnlich wie damals bei den ersten Metern auf dem Fahrrad in der Reuterstraße in Gotha, als mein Bruder, der die ganze Zeit neben mir hergelaufen war, plötzlich losließ. Ich raste zwar zum Anhalten in den Zaun, aber das zerschrammte Knie war mir egal. Endlich konnte ich Fahrrad fahren. Nun konnte ich also auch schwimmen. Kein Hundepaddeln, sondern richtig. Zug um Zug nährte ich mich einem Baum, dessen dicker Zweig weit über das Wasser reichte. Der Baum selbst hing wie angeleimt am Steilufer. Ich kam mir schon wie ein Entdecker vor. Jim Hawkins auf seiner Schatzinsel.
Doch als ich mich triumphierend zu den anderen umdrehte, verflog mein Hochgefühl. Wenige Meter von mir schaute ein kleines Köpfchen aus dem Wasser. Unscheinbar und glatt und höchstens so groß wie der Schwimmer einer Angel. Mit dem Unterschied, dass es sich schnell bewegte. Und da hörte ich sie auch schon schreien:
«Eine Schlange!»
«He, da ist eine Schlange!»
Sofort prasselte es Steine. Offenbar kam niemand der Gedanke, dass sie mich treffen konnten. Ich schrie etwas zurück, aber meine Worte gingen im Tumult unter. Verzweifelt schaute ich mich um. Bis zum Ufer waren es sicher noch fünfzig Meter. Mir kam die Strecke elend lang vor. Endlich kroch ich an Land. Sascha wartete schon.
«Nach so einer Begegnung kann man nur froh sein, wenn man nicht schwimmen kann. Stimmt’s?»
Er wartete auf Zustimmung. Als die nicht kam, reichte er mir seine angerauchte Zigarette.
«Es war bestimmt ein Gelbbauch. Die sind besonders giftig. Ich hab mal einen mit dem Spaten klargemacht. Obwohl der Kopf ab war, hat das Vieh noch mit dem Schwanz um sich geschlagen. Glaubst du nicht?»
Ich nickte zustimmend, zog an seinem Zigarettenstummel, hustete und gab ihn zurück.
Unsere Raucherkarrieren hatten zwar gemeinsam begonnen, später aber verschiedene Wege genommen. Er wurde Kettenraucher, bevor er zehn war, bekam die heisere Stimme eines Quartalsäufers, ich ließ beizeiten das Paffen sein. Rauchen war mir zu gewöhnlich. Sascha und ich waren nicht einmal sechs, als wir eines Tages die aufregende Entdeckung machten, dass mein Bruder mit seinen Freunden etwas Geheimnisvolles im Hühnerstall trieb. Der Anbau an der Scheune war nicht groß und hatte nur eine Öffnung wie eine Hundehütte, daher konnten wir aus unserem Versteck unter den Jasminbüschen nichts erkennen. Im Gegensatz zu uns wusste die Mutter sofort, worum es ging. Tabakgeruch verbreitete sich im Garten. Es folgte ein fürchterliches Donnerwetter, die Jungs wurden aus dem Hühnerstall ans Tageslicht gezogen und zu Strafarbeit verdonnert. Als sich die Lage beruhigt hatte, inspizierten Sascha und ich den Ort des Geschehens. Welche Freude, überall lagen Streichhölzer und angerissene Schachteln Papirossy. Wir zündeten uns jeder eine an, zogen am Mundstück, husteten mit Tränen in den Augen, gaben aber nicht auf.
Sascha schaute sich mit Kennerblick um:
«Hier sind bestimmt auch Präservative versteckt!»
Sein Gesicht war ernst. Es gab keinen Zweifel, hier sprach einer, der Ahnung hatte. Ich war mir da nicht so sicher. Präservative hatte ich bei meinen Bruder noch nie gesehen.
«Bist du sicher?»
«Na klar! Wo Papirossy sind, da sind auch Präservative.»
«Und was machen die damit?»
«Na, ficken!»
«Aha.»
Mit meinen fünf oder sechs Jahren besaß ich von derlei Sachen eher eine vage Vorstellung. Natürlich hatte ich längst mitbekommen, dass Mädchen anders waren. Aufregend anders. Und in dem Bildband der alten Meister, den wir daheim hatten, blätterte ich nicht nur, weil man dort so schöne Blumen und Früchte sehen konnte. Aber dass mein zwölfjähriger Bruder «fickte», das hielt ich doch für übertrieben. Andererseits, Sascha hatte zwei ältere Brüder. Vielleicht wussten die ja mehr.
Das Wort «ficken» war nichts Besonderes. So klein Sascha auch war – ich überragte ihn fast um einen Kopf –, die gängigen Schimpfwörter der Vulgärsprache «Mat» kannte er alle. Das galt auch für die übrigen Jungs im Dorf. Nur ich weigerte mich, aus auch für mich unerklärlichen Gründen, davon Gebrauch zu machen. Ein Junge, der nicht ständig «Ficken», «Fotze» oder «Schwanz» fallenließ, fiel auf. Schimpfwörter waren Zeichen der Zugehörigkeit. Man sagte nicht, «der geht mir auf die Nerven», sondern «der fickt mich an». Man zog jemanden nicht eine drüber, sondern «fickte» ihm eins. Das sagte der Enkel genauso selbstverständlich wie sein Großvater. Und eigentlich hatte der Verzicht darauf Hohn und Spott zur Folge. Dass ich nicht in dieser Art fluchte, auch nicht rauchte, passte zu meiner Sonderstellung als «Nemetz». Sicher war es ein Grund dafür, dass die Deutschen den Krieg verloren hatten …
Jedenfalls hatte ich bei meiner Wanderung in dieser Nacht keine Lust, auf eine Schlange zu treffen. Aber vor allem durfte ich die beiden Frauen nicht verlieren. Der Wachmann hatte recht, sie kannten sich aus und wählten den kürzesten Weg. Meine Befürchtung, dass die beiden in der Dunkelheit ihr Tempo drosseln würden, erwies sich als unbegründet. Nicht nur die Jüngere, auch die Alte schritt wacker aus. Wie auf Bestellung hüllte der Mond die Landschaft in silbriges Licht. Jeder Stein im Bachlauf war gut zu sehen.
«Mist!»
Ein stechender Schmerz durchfuhr meinen Knöchel. Vor lauter romantischer Rührseligkeit hatte ich einen Kiesel übersehen und war umgeknickt. Vorsichtig trat ich auf, es ging. Es musste gehen, denn die Frauen waren sofort auf und davon. Ich humpelte hinterher. Und war schon einige Meter gelaufen, da fiel es mir auf: Hatte ich wirklich auf Deutsch «Mist» gesagt? Mein Vater, im Gegensatz zu mir ein lupenreiner Deutscher, pflegte nach all den Jahren im Lager und Verbannung grundsätzlich nur russisch zu fluchen. Das erleichtert die Seele ganz anders als diese kindlichen deutschen Verwünschungen, fand er. Normalerweise schaltete ich je nach Lage aus der einen Sprache in die andere, ohne es zu bemerken. Wenn ich deutsch sprach, dachte ich deutsch. Und umgekehrt. Sollte dieses «Mist» ein Zeichen dafür sein, dass die eine Hälfte, und es war nicht die russische, ein Übergewicht bekam?
Ich lief und erinnerte mich an meine erste Annäherung an die deutsche Sprache nach unserer Übersiedlung aus Workuta nach Thüringen. Es ging nicht ohne Missverständnisse und Zwischenfälle ab. Das Verhältnis blieb immer gespannt. Mir fiel mein erster Denunziant ein.
Das Jahr 1960: Israel gibt die Festnahme Adolf Eichmanns bekannt. Armin Hary läuft als Erster die 100 Meter in 10,0 Sekunden. DDR-Präsident Wilhelm Pieck stirbt. Abschuss eines US-Spionageflugzeugs U2 über der UdSSR. Die Kollektivierung der Landwirtschaft in der DDR wird als abgeschlossen erklärt. Erste Antibabypille in den USA auf dem Markt. Die DDR-Propagandasendung «Der schwarze Kanal» startet. Nikita Chruschtschow schlägt in einer UNO-Debatte in New York mit dem Schuh auf das Pult. John F. Kennedy wird Präsident der USA. In den DDR-Atlanten darf der Name Deutschland nicht mehr verwendet werden.
Vor der Abreise nach Deutschland: Atelieraufnahme mit Mutter und Pawel in Moskau.
1960
I
Er hieß Peter. Ein unscheinbarer Junge. Wir waren fremd in Deutschland, ich verstand vieles noch nicht so richtig. Es war in Gotha, eines Tages klingelte es, und ehe die Mutter etwas mitbekam, öffnete ich freudig. Vor mir stand ein Polizist. Ein Mann in grüner Uniform mit einem schwarzen Tschako-Helm.
Der will dich holen, schoss es mir durch den Kopf.
Mit Wucht schmiss ich die Tür zu und rannte in die Küche. Die Mutter saß am Fenster und hielt gerade die Nadel zum Einfädeln hoch. Vor ihr lag der Stickrahmen.
«Miliz», flüsterte ich und verschwand im Kinderzimmer. Hier stand zwischen dem verstreuten Spielzeug ein russisches Klappbett. Es war mit olivfarbenem Tuch bespannt und hatte einen Metallrahmen. Ich kauerte mich auf das Bett und hörte aus der Ferne die Mutter «Nichts verstehen» sagen.
Im Gegensatz zur ihr verstand ich sehr wohl, warum der Polizist bei uns geklingelt hatte. Ich wusste: Er wollte mich holen. Ein russischer Milizionär war schon schlimm genug, ein deutscher Polizist schien mir weitaus schlimmer.
Ein Polizist würde sich von der Mutter bestimmt nicht abwimmeln lassen. Niemand konnte helfen. Der Vater kam erst in Stunden von der Arbeit. Kara war tot und Tarzan in Workuta geblieben. Wie ich die Hunde vermisste. Ich legte mich auf das Klappbett und schlief ein.
Die dramatischen Ereignisse hatten am Montag ihren Anfang genommen. Da marschierte mein Bruder das erste Mal seit Monaten wieder in die Schule. Er hatte sie nicht vermisst. Vor der Abreise nach Deutschland verbrachten wir einen langen Sommer auf der Krim, dann einige Wochen in Moskau, und bis wir in Gotha eine Wohnung in der Reuterstraße bekamen – parterre, nass und kalt – verging der November. Pascha fand das Leben ohne Schule und Hausaufgaben angenehm. Zumal der Wechsel aus einer ganz normalen sechsten Klasse einer russischen Schule in Workuta in eine deutsche Klasse mit erweitertem Russischunterricht in Gotha nur auf den ersten Blick logisch schien. Russisch war nicht das Problem, sondern der Rest. In eine sogenannte R-Klasse kamen nur die besten Schüler. Das konnte nicht gutgehen. Doch der Vater war überzeugt, das «schafft der schon, ist ja schließlich mein Sohn». Er hatte es ja auch geschafft, damals in der Emigration in Moskau, unter ganz anderen Bedingungen. Er schloss sein Journalistikstudium an der Universität mit Auszeichnung ab. Auch er konnte kein Wort Russisch, als er in die Sowjetunion kam. Außerdem hatte der Vater einen klaren Standpunkt in Erziehungsfragen: «Qualität setzt sich durch.»
Dass seine Kinder diesem Anspruch genügen würden, stand für ihn außer Zweifel. Das bisschen Sprache ließ sich lernen. Er drückte meinem Bruder ein graugrünes Vokabelheft in die Hand und riet, er solle deutsche Wörter, die er nicht kannte, aufschreiben und auswendig lernen. In ein paar Wochen seien Verständigungsprobleme kein Thema mehr.
Das klang einleuchtend. Nicht für Pawel. Ihm machte das Eintragen von Vokabeln keinen besonderen Spaß. Von der Mutter war keine Hilfe zu erwarten, sie beherrschte die Sprache selbst nicht. Alles lief auf heiße Auseinandersetzungen zu. Ein besonders geduldiger Mensch war der Vater nie. Mit Erziehung befasste er sich selten, dann aber umso leidenschaftlicher. Irgendwann, da war mein Bruder schon in der Lehre, er sollte vor dem Studium einen ordentlichen Beruf lernen, fand ich in dem Schränkchen in der Küche eine säuberlich geschälte Weidenrute, biegsam und unverwüstlich. An ihrem Ende waren mit Klebstoff grobe Salzkristalle angebracht. Ich stand auf einem Stuhl und betrachtete das pädagogische Instrument mit Schaudern. Selbst bekam ich es nie zu spüren, doch ich hatte es in der Hand des Vaters bei einer Auseinandersetzung mit Pawel gesehen. Das Bild, wie mein Bruder verzweifelt versuchte, durch den Korridor in sein Zimmer zu fliehen, aber schließlich unter den Schlägen in der dunklen Ecke auf dem Steinboden vor der Haustür landete, hat mich lange verfolgt. Wie die Schreie der Mutter, die zu schwach war, um dazwischenzugehen.
Die Lehrer kannten Pawel als einen zornigen Jungen, der alles hasste, was mit der Schule zusammenhing. Ein Glück, dass wenigstens die Russischlehrerin und sein Klassenlehrer zu ihm hielten. Sonst wäre er noch im ersten Jahr rausgeflogen. Alles, was nichts mit Radios, Röhren, Spulen und Transistoren zu tun hatte, interessierte ihn nicht. Als die Sache mit dem Vokabelheft nichts brachte, folgte die nächste Stufe der Eskalation: Pawel bekam einen Band Schiller und sollte täglich mehrere Strophen einer Ballade auswendig lernen. Sein Verhältnis zur deutschen Poesie blieb für immer kühl.
Als der Bruder nach seinem ersten Tag aus der deutschen Schule kam, wartete ich auf dem Hof. Allein war es doch ziemlich langweilig. Er bog um die Hausecke, die Begeisterung über die Veränderung in seinem Leben war ihm schon von weitem anzusehen. Von den beiden Schnallen der Schultasche war nur eine geschlossen, eine Ecke des weißen Hemds hing aus der Hose, und dem roten Pioniertuch, das ihm die Mutter zur Feier des Tages umgetan hatte, fehlte ein Zipfel.
«Na, wie war’s?»
«Scheiße!», antwortete er auf Deutsch. Er schaute mich Ahnungslosen verächtlich an. «Weißt du, was ‹Scheiße› heißt?»
Ich schüttelte den Kopf.
«Gawno!»
Nach dieser Übersetzung wusste auch ich, Schule ist nicht unbedingt etwas Erstrebenswertes, die deutsche Schule schon gar nicht. Als Pawel tags darauf wieder im Unterricht saß, stöberte ich routinemäßig in seinen Sachen. Das mochte er gar nicht, aber welcher kleine Bruder hat sich je darum geschert? Die Verlockung, etwas Spannendes zu entdecken, war viel zu groß. Nicht, dass ich etwas Bestimmtes suchte, aber in seinen Kästchen und Taschen gab es immer etwas. Er wusste von Dingen, von denen ich nicht einmal ahnte, dass es sie gab.
Erst kurz zuvor war ich mit ihm in der Stadt. Es dunkelte bereits, allein das war schon aufregend. Wir liefen zum Zeitungskiosk am Arnoldi-Turm hinter der Tankstelle. Im Licht der Laterne sah man die matschigen Flocken. Pascha schob der eingemummten Verkäuferin Münzen zu, einen «Fuffziger» und einen «Groschen». So weit kannte ich mich mit dem Geld schon aus. Die Frau reichte ihm ein dünnes Heft. Er drückte es mir in die Hand: Es war ein «Mosaik», die Nummer 36. Mein erster Comic. Außer ein paar Buchstaben und meinem Namen konnte ich damals noch nichts lesen. Deutsch schon gar nicht. Aber ich nervte den Bruder täglich, wann wir wieder zum Kiosk gingen, die nächste Geschichte zu kaufen.
Nicht Lehrbücher, sondern die Straße und die spannenden Abenteuer der drei Helden Dig, Dag und Digedag spielten bei mir dann auch die entscheidende Rolle beim Deutschlernen. Später kam Donald Duck dazu, obwohl es die Hefte im Osten nicht zu kaufen gab. Sie waren sogar verboten, zumindest in der Schule. So harmlos die Geschichten des Pechvogels oder des gerissenen Kater Carlo waren, die Ideologen fürchteten, die Kontrolle über die Jugend zu verlieren.
Doch der Besuch des Polizisten hatte mit Sicherheit nichts mit den Comics zu tun.
Beim Stöbern in Paschas Sachen hatte ich eine andere Entdeckung gemacht. Die Armbanduhr, die ihm der Vater zum Schulstart geschenkt hatte und das Klappmesser mit dem Horngriff brauchte der Bruder offensichtlich im Unterricht. Wie ärgerlich. Aber in einer leeren russischen Bonbondose wurde ich fündig: Patronen. Nicht nur Hülsen, sondern echte, scharfe Munition. Golden funkelnd, schwer in der Hand liegend, noch mit einer hauchdünnen Schicht Öl überzogen. Drei Stück, eine größere mit einem langen, spitzen Projektil und zwei kurze mit abgerundeten Spitzen. Die Patronen klimperten in meiner Hand, ich ließ sie in die Hosentasche gleiten. Damit konnte man draußen auf dem «Sandbersch», wie ich inzwischen in reinster Gothaer Mundart sagte, mit Sicherheit Eindruck machen.
Der Sandberg war eine große Baustelle, die Häuserblocks bestanden in dieser Zeit nicht aus Betonplatten, sondern wurden Stein für Stein hochgezogen. Was sie nicht hübscher machte. Doch einen besseren Spielplatz konnte man sich in der Stadt kaum vorstellen. Vor allem, wenn die Arbeiter wieder einmal für Wochen auf eine andere Baustelle abgezogen wurden.
Auf dem Weg dorthin fing mich jener Peter ab.
Er war älter als ich und hätte sich im Normalfall mit einem deutlich Jüngeren nicht abgegeben, da ich aber ein «Russe» war, umgab mich die Aura des Ungewöhnlichen. Russen kannte man in diesem Teil der Stadt nur als Soldaten, die gelegentlich auf dem Laster vorbeifuhren. Die russische Garnison, eigentlich waren es zwei, ein Infanterie- und ein Panzerregiment, lag am anderen Ende der Stadt.
«Nu, Serjoscha, wohin du gehen?», radebrechte er.
Es ist mir immer ein Geheimnis geblieben, warum so viele Menschen glauben, Ausländer verstünden sie besser, wenn sie ihre eigene Muttersprache verstümmeln. Ich blieb stehen, ließ erst einen Erwachsenen vorbeigehen, und griff dann mit verschwörerischer Miene in die Tasche. Stolz zeigte ich ihm die drei Patronen. Auch Peters Augen funkelten.
Er bat mich, er beschwor mich, er flehte mich an, nicht auf den Sandberg zu gehen, sondern, so viel hatte ich verstanden, ihm die Munition für einen Moment zu überlassen. Er würde sie mir sofort zurückbringen.
Unentschlossen stand ich da.
Es gab keinen Grund, warum ich ihm meinen Schatz aushändigen sollte. Selbstverständlich konnte er mir die Patronen einfach wegnehmen. Aber das barg für ihn ein unkalkulierbares Risiko. Mein großer Bruder war stärker als er. Und es hatte sich in der Gegend herumgesprochen, dass «der Russe» nicht lange fackelte. Also griff Peter zu einer List. Er holte aus seiner Tasche einen Hirschfänger mit langer, schmaler Klinge und einem Rehbein als Griff. So ein Messer hatte ich noch nie gesehen. Dass es die Dinger in der Stadt für sieben Mark fünfzig gab, wusste ich nicht. Den Hirschfänger wollte er mir leihen, wenn ich ihm die Patronen überließ. Letztlich siegte die Aussicht, nicht nur mit den Patronen, sondern auch mit dem Messer angeben zu können. Ich gab ihm die Patronen.
«Ich warte hier.»
Peter rannte triumphierend davon.
Er kam weder nach zehn Minuten noch nach einer halben Stunde zurück. Dann sah ich ihn zur Straßenbahnhaltestelle gehen. Geführt von seinem Vater. Er schrie mir etwas zu, aber das konnte ich nicht verstehen. Nur das Wort «Polizei». Eine Straßenbahn kam, beide stiegen ein. Mich packte das Entsetzen. Ich rannte nach Hause. Eine Stunde später klingelte es.
Was ich nicht wissen konnte: Peters Vater war Hilfspolizist. Das verschaffte Geltung und brachte etwas Geld. Auch der Sohn wusste schon, worum es ging. Schnurstracks war er mit den Patronen zu seinem Vater geeilt. Waffen oder Munition bedeuteten in einem Staat, der sich ständig und überall von Feinden umzingelt sah, immer höchste Alarmstufe. Da sich Peters Vater nicht traute, selbst «bei den Russen» vorzusprechen, brachte er die Munition mit seinem Sohn aufs Polizeirevier. Sofort setzte sich ein Genosse in Bewegung.
Als ich aufwachte, war es dunkel. Vorsichtig öffnete ich die Tür. Aus der Küche hörte ich fröhliche Stimmen. Vater, Mutter, Pascha. Fremde waren nicht dabei. Offenbar hatte man auch niemand verhaftet. Erleichtert lief ich über den Korridor und hoffte, ohne viel Aufsehen auf das Küchensofa huschen zu können, dorthin, wo die Mutter immer beim Abendbrot saß. Es gelang mir nicht. Ich ging auf Zehenspitzen, sie hörten mich trotzdem. Schauten mich an wie Geschworene, denen gerade ein Schwerstverbrecher vorgeführt wird. Ich schwieg. Sie auch. Als dieser Zustand unerträglich wurde, nickte mein Vater mir zu.
«Aha, Serjoscha, du bist es. Wir hatten schon Bedenken, dass dich der Polizist mitgenommen hat.»
Pascha prustete, wurde aber vom Vater mit einem strengen Blick ermahnt. Der Vater machte nicht den Eindruck, als sei das alles nur ein Spaß. Ich sah zur Mutter, sie wich meinem Blick aus und ging zum Herd.
«Du weißt, warum die Polizei hier war?»
«Ja. Wegen der Patronen.»
Meine Antwort war kaum zu hören.
«Und warum hast du Dussel die Patronen diesem Peter gegeben?», mischte sich mein Bruder in das Verhör.
«Weil er mir sein Messer geben wollte.»
«Und das hast du geglaubt?»
Pascha schaute zum Vater. Der ist noch klein und doof, sagte sein Blick. Vater lächelte meinem Bruder zu. Mir nicht.
«Du weißt, dass man wegen solcher Dinge eingesperrt werden kann?»
Ich nickte.
«Ein Glück, dass deinem Bruder eine gute Erklärung einfiel, woher er die Munition hat. Sonst säßen wir jetzt alle auf dem Polizeirevier.»
Ich nickte abermals, obwohl ich nicht wusste, welch Geistesblitz meinen Bruder erleuchtet hatte.
«Ich habe gesagt, dass ich die Patronen von dem sowjetischen Hauptmann bekommen habe, der uns mit seiner Frau neulich besucht hat. An einen Russenoffizier traut sich die deutsche Polizei nicht ran.»
Also war die Sache längst bereinigt, und die drei machten sich nur einen Spaß daraus, mich in meiner Angst zu belassen. Geduldig hörte ich mir ihre Belehrungen an. Vor allem mein Bruder konnte nicht aufhören, mit seiner Heldentat anzugeben.
II
Gotha-Ost blieb nur eine Episode. Als die Berliner Genossen Lorenz eine Arbeitsstelle in der Provinz zuwiesen, war es ihm wenigstens gelungen durchzusetzen, dass der Familie eine ordentliche Wohnung zustand. Die in der Reuterstraße war das nicht. Er hatte sie nur unter Vorbehalt genommen, um nicht weitere Monate im Hotel «Zum Mohren» zuzubringen. Das war teuer, und der Übergangszustand zerrte an den Nerven. Der ehemalige Gulag-Häftling und Verbannte war trotz dieser Vergangenheit in kurzer Zeit zum technischen Direktor des Waggonbaus aufgestiegen, eines der großen Betriebe der Stadt. Nicht durch Protektion und Hilfe der Partei, sein fachliches Können hatte sich durchgesetzt.
Eines Morgens in der Kantine kam der Bauingenieur zu ihm an den Tisch.
«Sag mal, suchst du immer noch eine Wohnung?»
«Ja.» Lorenz horchte auf, blieb aber zurückhaltend. Er wollte nicht, dass die im Betrieb wussten, wie sehr ihn das Thema belastete. «Sieht schlecht aus damit in der Stadt.»
«Kommt ganz drauf an», der Mann tat geheimnisvoll. «Ich hätte einen Tipp. Durch die Bauerei im Betrieb kenne ich auch die Wohnungsfritzen im Rathaus. Einer hat mir gesteckt, dass in West, da in der Gagfah-Siedlung, ein Häuschen frei wird. Vielmehr eine Haushälfte. Aber schön. Hinter den Gärten der Leina-Kanal, dann bis Sundhausen nur Felder. Für dich mit den Kindern wäre es bestimmt richtig.»
«Das klingt gut. Sehr gut.» Lorenz schaute sich um.
«Die Sache hat nur einen Haken», der Ingenieur beugte sich zu ihm. «Da hat ein Stasi-Mann die Pfote drauf. Die von der Stadt haben natürlich Schiss, ihm nein zu sagen. Also, wenn du eine Möglichkeit siehst …»
Lorenz dankte und nahm sich vor, dem Mann eine ordentliche Flasche Kognak zu spendieren.
Am nächsten Tag hatte er mit Fritz, dem Parteisekretär des Betriebs, im Rathaus zu tun, vorher machte der Dienstwagen einen kleinen Schlenker durch die Siedlung. Beiden gefiel das Haus. Aber Fritz zog ein Gesicht, als hätte er in einen grünen Boskop gebissen.
«Du sagst, einer von der Stasi? Das wird nicht einfach. Gegen die kommt keiner an.»
«Was ist schon einfach, in dieser Welt?», erwiderte Lorenz und dachte daran, dass es in Workuta keine Drei-Zimmer-Wohnung gab, und doch hatte seine Familie eine. Sie hielten vor dem Siedlungshaus. Als er das Gartentor öffnete, fiel es fast aus den Angeln. Man musste einiges Geld in das Häuschen stecken, aber die Substanz war offensichtlich noch in Ordnung. Nichts deutete darauf, dass jemand im Haus war, trotzdem klingelte er. Die Tür ging auf. Wenn überhaupt, dann hatte der Vater jemanden beim Packen erwartet, dass ihm ein Mann in Majorsuniform gegenüberstand, überraschte ihn. Sieh an, dachte er, der lässt nichts anbrennen, der hat schon den Schlüssel.
«Sie wünschen?»
«Entschuldigen Sie die Störung. Aber ich habe gehört, das Haus sucht einen Mieter, da wollte ich es mir ansehen.»
«Sie müssen sich irren. Das Haus ist schon vermietet.»
Der Mann sah nicht so aus, als wollte er sich unterhalten.
«Komisch. Die bei der Stadt sagen, es sei noch nichts entschieden. Vielleicht kann ich es ja ansehen, interessehalber?»
«Was die bei der Stadt sagen, ist mir egal.»
Das Gespräch kippte schnell.
«Aber wenigstens einen Blick kann man reinwerfen?»
«Ich sehe keinen Grund. Und wenn Sie sich Ärger ersparen wollen, gehen Sie, bevor ich …»
«Wollen Sie mir drohen?», fragte Lorenz in einem Unterton, der seinerseits nichts Gutes verhieß. Fritz versuchte, ihn zurückzuhalten, aber er ließ es sich nicht nehmen, die drei Stufen an der Tür hochzusteigen. Die Kontrahenten konnten sich damit direkt und auf einer Höhe in die Augen sehen.
«Hacken Sie es sich auf die Nase», knurrte Lorenz. «Sie werden mir den Schlüssel auf einem silbernen Tablett reichen.»
Er drehte sich um und ging zum Auto. Als sie zurück in die Innenstadt fuhren, war er wieder ruhig.
«Ab und zu muss doch diesen Herrschaften jemand die Grenze zeigen.»
Fritz nickte, er hoffte, das Thema sei beendet. Sich mit der Stasi anzulegen, das war keine Wohnung wert.
Der Chef der Wohnungsverwaltung schüttelte den Kopf.
«Da ist nichts zu machen. Der hat schon den Schlüssel.»
«Ich weiß. Schlüssel ohne Zuweisung, ist das üblich?»
Der Mann lächelte und schob eine Mappe in die Mitte des Schreibtischs, um zu bedeuten, die Audienz sei vorüber.
«Kann man die Entscheidung widerrufen?»
Lorenz ließ sich nicht beeindrucken.
«Schon. Aber es gibt keinen Grund. Wissen Sie einen?»
«Wie lange hat der Mann auf eine Wohnung gewartet?»
«Bei denen spielt das keine Rolle. Die tauchen auf keiner Liste auf.» Er war offensichtlich routiniert im Abwägen der Wörter – welche konnte man sagen, welche nicht. «Es ist ja nicht so, dass er keine Wohnung hätte oder dass die nass wäre. Aber die neue gefällt ihm besser.»
Die haben schnell gelernt, dachte Lorenz. In Russland brauchte der KGB Jahre, bis er sich einen vergleichbaren Stand geschaffen hatte. Offenbar konnte die Staatssicherheit von Anfang an auf die reichen Erfahrungen der sowjetischen Freunde zurückgreifen.
«Darf ich einmal Ihr Telefon benutzen?»
«Selbstverständlich.»
Der Amtsleiter schob das schwarze Bakelitgerät herüber. Lorenz zögerte. Dort, wo er jetzt anrufen wollte, konnte man das nur einmal tun. Ging es aus irgendwelchen Gründen schief, würde dieser Weg fortan verbaut sein. Er holte einen Zettel aus der Brieftasche und wählte. Der Wohnungsmensch schaute zu. Er machte keine Anstalten aufzustehen. So viel Höflichkeit war in seinem Amtsverständnis nicht vorgesehen.