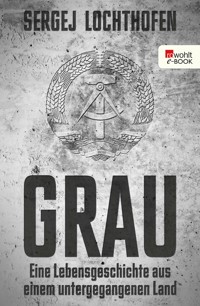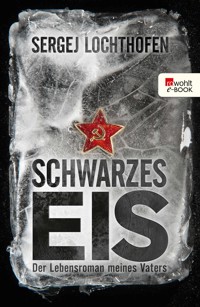
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
«Was ihm in diesen Tagen und Monaten widerfuhr, das war die Umwertung all seiner bisherigen Erfahrungen: Was als sicher galt, war zerbrochen. Was sauber schien, lag im Schmutz. Was wahr zu sein hatte, wurde Lüge. Selbst das Eis wollte nicht mehr rein und sauber sein.» Dieses Buch handelt von einem Mann, der in den blutigen politischen Glaubenskämpfen des 20. Jahrhunderts seinen Idealen treu bleibt, obwohl sie ihn fast das Leben kosten. Mit Erfindungsreichtum, Humor und der Hilfe des Zufalls kommt Lorenz Lochthofen durch – ohne zu verbittern. Schicksalsschläge und unerklärliche Wendungen, Liebe und Verlust, Aufbruch und Enttäuschung, Willkür und Grausamkeit: Sergej Lochthofen erzählt das Leben seines Vaters wie einen packenden, tatsachengestützten Roman – einen Lebensroman. «Ein spannend zu lesendes und aufwühlendes Buch. » Thüringer Allgemeine «Ein beängstigend atmosphärischer Tatsachen-Roman. » Leipziger Volkszeitung
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 579
Veröffentlichungsjahr: 2012
Sammlungen
Ähnliche
Sergej Lochthofen
Schwarzes Eis
Der Lebensroman meines Vaters
Über dieses Buch
«Was ihm in diesen Tagen und Monaten widerfuhr, das war die Umwertung all seiner bisherigen Erfahrungen: Was als sicher galt, war zerbrochen. Was sauber schien, lag im Schmutz. Was wahr zu sein hatte, wurde Lüge. Selbst das Eis wollte nicht mehr rein und sauber sein.»
Dieses Buch handelt von einem Mann, der in den blutigen politischen Glaubenskämpfen des 20. Jahrhunderts seinen Idealen treu bleibt, obwohl sie ihn fast das Leben kosten. Mit Erfindungsreichtum, Humor und der Hilfe des Zufalls kommt Lorenz Lochthofen durch – ohne zu verbittern. Schicksalsschläge und unerklärliche Wendungen, Liebe und Verlust, Aufbruch und Enttäuschung, Willkür und Grausamkeit: Sergej Lochthofen erzählt das Leben seines Vaters wie einen packenden, tatsachengestützten Roman – einen Lebensroman.
«Ein spannend zu lesendes und aufwühlendes Buch.» Thüringer Allgemeine
«Ein beängstigend atmosphärischer Tatsachen-Roman.» Leipziger Volkszeitung
Vita
Sergej Lochthofen ist Journalist. Geboren 1953 in Workuta (Russland), kam er als Fünfjähriger mit den Eltern in die DDR, wo er eine russische Schule besuchte; er studierte Kunst auf der Krim und Journalistik in Leipzig. Von 1990 bis Ende 2009 verantwortete er die Zeitung «Thüringer Allgemeine». Das «Medium-Magazin» wählte ihn zum regionalen «Chefredakteur des Jahres». Fernsehzuschauer kennen ihn als «Stimme des Ostens» im «Presseclub» (ARD) oder der «Phoenix-Runde».
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Oktober 2012
Copyright © 2012 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Covergestaltung ANZINGER WÜSCHNER RASP, München
Coverabbildung privat
ISBN 978-3-644-02231-7
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Schwarzes Eis
Der Kosake lehnte sich weit aus dem Sattel und schlug die Pika in das Tor. Von der Wucht der Lanze flog es auf und gab den Weg frei für die beiden Reiter. Eines der Pferde wollte nicht gehorchen, es musste mit einem Peitschenhieb auf den Hof gezwungen werden. Während sein Reiter das Tier zu beruhigen suchte, winkte der andere die Tagelöhner heran, die um einen schmutzigen Karren versammelt auf der Straße warteten. Die Männer schleppten Eimer voller Kalk am Haus und seinen Bewohnern vorbei in den Garten zur Jauchegrube. Sie verstreuten die weißgelben Klumpen und machten sich eilig davon.
Pawel schaute den Reitern nach, deren Silhouetten sich scharf gegen den Abendhimmel über der Steppe abzeichneten. Die Fähnchen an den Spitzen ihrer Lanzen wehten im Wind. 1892 war das Jahr der großen Choleraepidemie in Jusowka. Der Kalk, den die Kosaken brachten, sollte die Seuche im Kohlerevier am Don eindämmen.
Das ist die älteste Erinnerung unserer Familie, die ich kenne. Mit meinem Großvater, Pawel Alexandrowitsch Alförow, hatte ich am Abend in der Kate auf der Krim einen Kessel Tee getrunken, während wir nach den ersten Bildern seiner Kindheit suchten. Wir kramten in den Geschichten des Lebens und kamen von seiner Geburt 1890 unter dem Zaren zu Lenin und Trotzki, denen er in den Wirren des Bürgerkrieges als Revolutionskommissar begegnete. Wir sprachen über Stalin, der ihn für mehr als dreißig Jahre in Straflager sperren ließ.
Seine Erlebnisse sind Teil der Erinnerung unserer Familie, die über drei Generationen hinweg mit deutscher und russischer Geschichte verflochten ist. Es sind vor allem die Erzählungen meines Vaters, Lorenz Lochthofen, die für uns Nachgeborene prägend waren. Von ihm handeln die folgenden Seiten ganz maßgeblich. Seine Geschichte beansprucht dabei keineswegs exemplarische Aussagekraft für die unzähligen Schicksale im Wüten der Ideologien des zwanzigsten Jahrhunderts. Sie ist vielmehr ein individuelles Exempel für die Launen, denen so viele Menschen zwischen Grauen und Davonkommen in einer heute unwirklich fern erscheinenden Zeit ausgesetzt waren.
Lorenz Lochthofen floh Anfang der dreißiger Jahre nach einem Zusammenstoß mit der SA aus dem Ruhrgebiet nach Moskau. Er wurde vom berüchtigten Vorläufer des KGB, dem NKWD, verhaftet und kehrte nach Jahren in den Lagern der russischen Arktis als einer der wenigen Überlebenden des Gulag in den sozialistischen Teil Deutschlands zurück. In der DDR des Kalten Krieges blieb er trotz einigen Erfolges als Wirtschaftsführer zeit seines Lebens ein «Ehemaliger». Beargwöhnt, weil er die Arbeitslager der «Eigenen» überlebt hatte. Verdächtigt bis nach dem Tod.
Den Zeiten misstrauend, in denen allein schon das «Sammeln von Nachrichten» Menschen hinter Gitter brachte, hielt ich meine Gespräche mit Vater und Großvater auf unscheinbaren Zetteln, auf Packpapier fest und verbarg die Texte in einem Stapel der Literaturzeitschrift «Nowy Mir». Darauf hoffend, dass sich kein Stasimitarbeiter die Mühe machen würde, die «Russenhefte» zu durchwühlen, halfen mir diese Notizen Jahrzehnte später, Ereignisse und Gespräche zu rekonstruieren und Lücken durch Recherchen zu schließen.
Dieses Buch, wiewohl den Fakten der Zeitläufte verpflichtet, lebt in jeder Zeile vor allem anderen vom Talent meines Vaters, packend zu erzählen. Ein Talent, das neben dem schieren Glück im großen Unglück einer Odyssee der Gefangenschaft mindestens so wichtig war wie die Fähigkeit, mit eigenen Händen für ein Überleben unter unmenschlichen Bedingungen zu sorgen. Diesem «Erzählen» folgt auch die hier gewählte narrative Form, die meinem Vater sicher am ehesten gerecht wird: Das Miterleben kleidet die Fakten und bestimmt den Grundton. Schritt für Schritt begleitet die Handlung Lorenz Lochthofen auf seinem Weg. Das Leben formt den Stoff zum Roman. Aus Geschichten wird Geschichte. Nur dort, wo es das Verständnis des Geschehens befördert, wechselt der Blick auf einen der Gefährten, ergänzt meine eigene Erinnerung die Überlieferung des Vaters. Das Heulen des Schneesturms um die Lagerzäune war Teil meiner Kindheit, ich kenne das Krachen des schmelzenden Eises unten am Fluss im kurzen arktischen Frühling. Beim Schreiben konnte ich mich neben der Kenntnis der Orte auch auf das Zeugnis handelnder Personen stützen, die mir seit meiner Kindheit vertraut sind. Freunde meines Vaters, die sich lange beharrlich weigerten, vom «Aufbau des Sozialismus in der Arktis» zu sprechen, fanden Jahrzehnte später in Bad Liebenstein Worte für ihre Erlebnisse. In dem kleinen Kurort im Thüringer Wald verbrachte mein Vater von Krankheit gezeichnet die letzten Jahre seines Lebens, und immer wieder waren hier Weggefährten, Überlebende «von dort» zu Gast.
«Schwarzes Eis» ist eine Erinnerung an das große Experiment, das 1917 begann und siebzig Jahre später im völligen Zusammenbruch endete. Es ist eine Geschichte aus einem Jahrhundert voller Aufbruch und Hoffnung, aber auch voller Willkür, Grausamkeit und Blut. Es ist die Geschichte meiner Familie.
Kleines Foto: Lorenz Lochthofen 1931 bei Montagearbeiten im Donbass.
Größeres Foto: Lorenz Lochthofen 1934 als Student in Moskau.
Das Jahr 1937:Der russische Revolutionär Leo Trotzki, ausgewiesen aus der Sowjetunion, der Türkei, Frankreich und Norwegen, trifft in Mexiko ein. Franklin D. Roosevelt tritt seine zweite Amtszeit als US-Präsident an. Das deutsche Flugzeuggeschwader «Condor» zerstört in einem dreistündigen Bombenangriff Guernica. Auf der Grundlage des NKWD-Befehls Nummer 00439 werden 40000 Deutschstämmige in der UdSSR wegen angeblicher Spionage erschossen. Nach einem Scheinprozess wird die russische Militärspitze exekutiert. In München öffnet die Propagandaausstellung «Entartete Kunst», auf der Werke von verfemten Künstlern gezeigt werden. Hitler offeriert der Wehrmachtsführung seine Annexionspläne für Österreich und die Tschechoslowakei. Japanische Truppen verüben das Massaker von Nanking, bei dem mehr als 200000 Chinesen sterben.
1937
I
Sie rannten und lachten, und die dicken, warmen Regentropfen prasselten auf ihre Gesichter. Er hatte die Kleine, eingewickelt in seine Jacke, an die Brust gedrückt, während Lotte und Lena tanzend durch die Pfützen hüpften. Hinter ihnen, hoch über den Baumkronen, rumorte und donnerte es in den aufgetürmten Wolken, überstrahlt von einer Sonne, die keinen Zweifel ließ, dass sie den Unfug im Himmel nicht lange dulden würde. Es roch nach frischgeschnittenem Buchsbaum, nach Holunder und Jasmin. Die Zeit schien stehengeblieben zu sein. In einem besonders schönen Augenblick. Doch das Licht verlor an Kraft, das Donnern schwoll an, bekam einen seltsamen Klang. Wurde lauter und lauter. Plötzlich war es so nahe, als schlüge jemand direkt in seinem Kopf mit einem Stock auf einen Blecheimer.
Bomm. Bomm. Bomm.
Lorenz wachte auf. Das schwache Sperrholz der Wohnungstür schien zu splittern.
Bomm. Bomm. Bomm.
Das eine war nur ein Traum. Das andere die Wirklichkeit. Er warf die Wattedecke zurück, sprang aus dem Bett, streifte in der Dunkelheit die Hose über. Wieder und wieder donnerte es an die Tür.
Sie kommen.
Sie kommen.
Sie holen dich.
Etwas anderes konnte er nicht denken. Er wollte es wegschieben. Unsinn, einem Mann wie ihm würden sie nichts tun, würden es nicht wagen. Doch im Grunde seines Herzens wusste er es: Sie holen dich ab. Erst hatten sie Lorenz die Arbeit genommen. Dann aus der Partei ausgeschlossen. Nun kamen sie. Nun holten sie ihn.
Vorsichtig hob er den Vorhang am Fenster. Die Straße war tief in das Schwarz der Nacht versunken. Nur zwei Lichtkegel eines Autos stachen schmale Streifen aus der Dunkelheit. Die Umrisse eines Kastenaufbaus hinter dem Fahrerhaus ließen keinen Zweifel: ein «Schwarzer Rabe». So hieß in Russland seit jeher der vergitterte Wagen, mit dem die Arrestanten abgeholt wurden. Das war unter der «Ochranka» so, der zaristischen Geheimpolizei, das war unter Stalins NKWD nicht anders. Wo immer das Auto des Volkskommissariats für Innere Angelegenheiten auftauchte, verbreitete es Schrecken. In der Nacht war es der Rabe, am Tag ein Lastwagen mit der harmlosen Aufschrift «Brot» oder «Fleisch». Obwohl es schon lange nicht mehr genug Fleisch gab, das man ausfahren musste. Statt «Chleb» oder «Mjaso» hatte das fensterlose Gefährt Menschen geladen.
Lorenz ließ den Vorhang fallen. Er hatte diesen Moment immer und immer wieder im Kopf durchgespielt: Er ist gerade auf dem Weg in die Redaktion, da hält eine Limousine neben ihm, zwei biedere Herren in leicht zerknitterten Anzügen bitten ihn, doch einzusteigen. Oder: Er eilt nach einem Gespräch aus dem Stadtkomitee durch das Tor, froh, endlich dem ausschweifenden Gerede entronnen zu sein, da ruft ihn der Pförtner zurück. Und drinnen warten schon zwei Bewaffnete. Oder: Er steigt beschwingt aus dem Moskauer Zug, sieht Lotte mit den beiden Mädchen auf dem Bahnsteig, sie rufen und winken ihm zu, da möchte jemand in Uniform seine Fahrkarte sehen. Nur der Ordnung halber. Und während er nach dem Papier in seiner Tasche kramt, herrscht ihn der Milizionär an mitzukommen …
In vielen langen Nächten hatte er sich die Szenen wieder und wieder ausgemalt. Nachdem sie ihn aus der Redaktion der «Nachrichten» entlassen hatten, war es nur noch eine Frage der Zeit. Er wusste es. Natürlich wusste er es. Sein Verstand sagte es ihm, aber glauben, nein, glauben konnte er es nicht. Warum sollten sie ihn verhaften? Ausgerechnet ihn? Einen deutschen Emigranten, der dieses Land mit Händen und Klauen gegen jeden Angriff verteidigt hätte, der dieses Land liebte. Ein Land, in dem jetzt unfassbare Dinge geschahen. Menschen verschwanden, Freunde wurden verhaftet, Familien auseinandergerissen. Ohne Grund. Keine Erklärung. Kein Sinn. Nie im Leben hätte er gedacht, dass so etwas möglich sei. Nun wusste er es. Er glaubte, vorbereitet zu sein. Doch jetzt, wo es laut und drängend an der Tür hämmerte, packte ihn Entsetzen.
Die Schwere im Kopf war verflogen. Er hatte am Abend zuvor ganz gegen seine Gewohnheit zu viel und vor allem durcheinandergetrunken. Wodka. Portwein. Sekt. Und als wäre das nicht schon schlimm genug, darauf noch einige Gläschen Selbstgebrannten, «Samogon». Man wird eben nicht jeden Tag dreißig. Für einen Augenblick sah er sich, Lotte und Friedrich in der Tür des winzigen Zimmers stehen. Die letzten Gäste waren weit nach Mitternacht gegangen. Ihr lautes Gackern klang durch das offene Fenster noch lange in der von friedlichen Gärten gesäumten Straße. Es war ein ausgelassenes Fest in Lottes Häuschen. Die Kinder hatte es nicht gestört, Lena und Larissa schliefen friedlich. Lena mit ihren vier Jahren, eigensinnig und mit einem unüberhörbaren Hang zum Altklugen, Larissa gerade sechs Monate alt, noch ein wehrloses Bündel.
Sie standen da und lächelten verlegen. Lotte, umrahmt von ihrem Exgeliebten und ihrem Exmann. Das hatte schon seine Komik. Und wenn der Geliebte genauso ex war wie der Ehemann, ließ das viel Raum für Deutungen. Vor allem aber für fürchterliche Szenen. Lotte war die Frau, die Lorenz immer noch liebte. Klug, schön, zart und stark. War er ihretwegen oder sie seinetwegen oder aus ganz anderen Gründen nach Engels gegangen? So genau ließ sich das nicht mehr rekonstruieren. War auch nicht so wichtig, solange sie nebeneinander lagen, sich in den Armen hielten, das reichte. Das hätte für ein ganzes Leben reichen können, seine Liebe auf jeden Fall.
Aber so einfach war es nicht. Da gab es ein Leben davor, und in diesem Leben spielte sein Freund Friedrich Wolf die entscheidende Rolle. Der Autor von «Professor Mamlock» und «Zyankali», diesen bekannten Mann liebte auch seine Frau. Früher, vor seiner Zeit. Lotte und Friedrich kannten sich aus Stuttgart. Die Studentin war am Anfang nur die Pionierleiterin seiner Söhne Markus und Konrad, später auch Freundin der Familie. Was Friedrich wörtlich nahm: Lotte wurde schwanger.
Als die Nazis an die Macht kamen, flohen sie gemeinsam durch halb Europa bis nach Moskau. Auf dieser Reise kam in der Schweiz die Tochter von Lotte und Friedrich Wolf zur Welt. Lena. Entbehrung und Wirren der Flucht ließen zunächst keinen Raum für eifersüchtige Ränke. Später in Moskau wurde es schwieriger: eine Zwei-Hotelzimmer-Wohnung für Geliebte samt Tochter plus Ehefrau und die gemeinsamen Söhne plus Familienoberhaupt. Ein reichlich ungewöhnlicher Zustand, im prüden Moskau der dreißiger Jahre. Doch der Schriftsteller brauchte für seinen politischen Kampf die nötige Inspiration, er brauchte Muse und Ehefrau. Das verstanden selbst die sowjetischen Genossen.
Und Lotte gab eine prächtige Muse. Ihr Foto, blond, voller Lebenslust, zierte eines Tages die Titelseite des «Stürmers». Als Sinnbild deutscher Weiblichkeit. Da war sie längst nach Moskau emigriert und hatte mit dem Juden Wolf ein Kind. Doch was auf den muffigen Gängen des Hotels «Lux», in dem sich die Oberschicht der politischen Emigranten einquartiert hatte, als amüsant erschien, entwickelte sich im Leben zur Hölle. Irgendwann hielt es Lotte nicht mehr aus. Sie wollte weg, am liebsten an eine Universität. Doch in Moskau schien das unmöglich. Von Lenins Frau erhielt sie schließlich Order, nach Engels zu gehen, dort, in der Wolgadeutschen Republik, könne sie Pädagogik studieren oder irgendetwas mit Kunst, Hauptsache, sie verschwand aus der Hauptstadt. Nadeshda Krupskaja mochte die Eskapaden der jungen Leute nicht.
Trotz Lottes Flucht von der Moskwa an die Wolga blieben die Verhältnisse ungeklärt. Der Umstand, dass Lena Friedrichs Kind und Larissa das von Lorenz war, schien noch am übersichtlichsten. Lorenz, dem die schöne Frau schon in Moskau aufgefallen war, musste sie in Engels nicht lange suchen. Theater, Universität, sie begegneten sich überall, verliebten sich. Heirateten an einem Wochentag, ganz proletarisch in der Mittagspause, und suchten sich ein kleines Haus, als Larissa geboren wurde. Lotte hatte eine letzte Dollar-Reserve, so konnten sie es bezahlen.
Ihrem rauschhaften Sommer folgten ebenso leidenschaftliche Zerwürfnisse. Friedrich fand die Turbulenzen der Jungvermählten eher erbaulich, eben Ausdruck überschäumender Leidenschaft. Worüber er sich in Briefen an Freunde auch offen ausließ. Das fiel ihm umso leichter, da mit der Hochzeit seine Verantwortung für die junge Frau und seine Tochter Lena auf Lorenz übergegangen war. Dass Lotte zwischendurch nach Moskau zu Friedrich abdampfte, um dann geläutert nach Engels zurückzukehren, trug bei Lorenz nicht gerade zur Vertrauensbildung bei. Wenn man ihr zuhörte, wollte man gerne glauben, dass in der Tat nichts passiert sei. Wenn man Wolf kannte, fiel einem das deutlich schwerer.
Lorenz war ein durch und durch romantischer Mann. Aber nicht blöd. Der schnellen Hochzeit folgte die eilige Scheidung. In Sowjetrussland machte man um derlei Formalitäten nicht viel Aufhebens. Keine Fragen, keine Erklärungen, ein amtlicher Stempel beglaubigte die Trennung. Lorenz verließ türenknallend das Haus, nahm sich ein Zimmer, um dann jeden Tag wie ein braver Ehemann mit Blumen zur Familie zu eilen. Wenn schon nicht Lottes Temperament, so hielten ihn doch Larissas blaue Augen.
Deine, meine, unsere. War das die freie Liebe? Die freie Liebe, von der die Revolutionäre immer träumten? Vor allem die männlichen. Selbst ein Lenin hatte eine Schwäche dafür. Der Bruch mit aller bürgerlichen Tradition des Zusammenlebens? Die Absage an alles, was einengte, auf Dauer band, erpressbar machte? Und doch nur Verantwortung hieß. Freie Liebe? Lorenz hätte sich da auf nichts festlegen wollen. Es hatte sich so ergeben. Das komplizierte Knäuel ihrer Beziehungen sah aus der inneren Sicht weniger aufregend aus. Zumal die Scheidung ganz praktische Vorteile bot, redete er sich ein. Falls einer verhaftet würde, konnte sich der andere um die Kinder kümmern. Ein naiver Gedanke.
An diesem Abend hatten sie feiern wollen. Die Einheimischen, die Kollegen, sie mochten den jungen Redakteur aus Deutschland. Das passierte nicht oft. Das Verhältnis zwischen den Deutschen von der Wolga und den Zugereisten war nicht gut, die «Reichsdeutschen» galten als überheblich. Wer von der Komintern, der kommunistischen Weltzentrale, aus Moskau kam, besaß meist Anspruch auf die guten Posten. Das konnte den Alteingesessenen in Engels nicht gefallen. Auch wenn die Neuen vielleicht zehnmal gebildeter waren, mit ihren Universitätsabschlüssen glänzten. Warum ihnen nun gerade Lorenz als willkommen galt, darüber konnte auch er nur spekulieren. Vielleicht gefiel ihnen die offene Art, seine Herkunft aus einer Bergarbeiterfamilie im Ruhrgebiet. Gesagt hat es ihm keiner, offiziell gab es das Thema nicht. Jedenfalls wussten seine Kollegen, dass sich der einstige Schlosser vor dem Studium an der Moskauer Westuniversität auf den Baustellen im Kohlerevier des Donbass und im Kaukasus nicht geschont hatte. Manchmal erzählte Lorenz vom Brückenbau am Kuban, wie sie in der Höhe hingen, notdürftig von Seilen gesichert, unter ihnen der reißende Fluss.
So kamen sie am Abend, um einen der Ihren zu feiern. Kollegen, Freunde aus dem Theater, Mitarbeiter des Verlages, in dem Lotte eine Arbeit gefunden hatte. An der langen, mit weißen Bettlaken bedeckten Tafel saß fast die gesamte Redaktion. Das war nicht selbstverständlich. Lorenz galt nach seiner Entlassung als Aussätziger. Wer zu ihm kam, riskierte einiges.
Die «Nachrichten», die deutschsprachige Zeitung der Wolgarepublik, war für die meisten Einheimischen die einzige Möglichkeit, täglich etwas in ihrer Muttersprache zu lesen. Wohltuend in einer Welt, die ihnen zunehmend mit Misstrauen begegnete. Ganze Generationen hielten es für einen Segen, dass Katharina die Große einst Bauern aus der Pfalz, aus Baden oder Hessen ins Land geholt hatte, die Steppe urbar zu machen. Jetzt schlug die Wertschätzung in Neid und Hass um. Hatte man die Hungersnöte der Kollektivierung noch gemeinsam mit den Russen erlitten, bei der nicht nur die Großbauern enteignet wurden, sondern oft genug die letzte Kuh der Witwe in Staatsbesitz überging, bröckelte jetzt das Gemeinschaftsgefühl. Die deutschen Dörfer galten als reich und aufgeräumt. Angesichts des heraufziehenden Krieges mit Hitler-Deutschland gerieten die Wolgadeutschen unter Generalverdacht. Es begann ein Exodus biblischen Ausmaßes. Wer nicht sofort erschossen wurde, füllte die endlosen Menschentrecks nach Sibirien, nach Zentralasien. Viele überlebten den Todesmarsch nicht.
Doch an diesem Abend waren weder Krieg noch die katastrophale Versorgung ein Thema. Die Gastgeber hatten vorgesorgt. Über Wochen sparten Lotte und Lorenz für das Fest Lebensmittel auf, manches kauften sie zu Wucherpreisen auf dem Basar. Der Tisch bog sich unter der «Sakuska», der typischen Mischung von Speisen, die bei keinem russischen Trinken fehlen durfte. Der Volksmund war davon überzeugt, ohne Sakuska verkommt jede Feier zum Besäufnis. Selbst die härtesten Säufer fanden es unter ihrer Würde, allein und ohne etwas «zum Zubeißen» eine Wodkaflasche zu leeren. Trinken hieß in Russland immer Trinken in Gemeinschaft und mit etwas dazu. Sakuska konnte alles sein: eine saure Gurke, ein Kanten Schwarzbrot oder der Klassiker schlechthin, ein Hering. Bei Lotte und Lorenz gab es an diesem Abend mit Dill und Zwiebellauch dekorierte Teller voller Blini, marinierter Pilze, Tomaten und scharf gebratener Frikadellen. Und über all dem thronte der König aller russischen Flüsse: ein fetter Wolga-Stör. Am Ende blieb kein einziges Stück übrig. Nur die lange Gräte erinnerte daran, dass es ihn gegeben hatte. Selbst der Kopf war verschwunden. Bobik hieß der Dieb, der ansonsten treue Haushund, eine Mischung aus Schäferhund und erster oder zweiter Gasse.
Doch das war gestern. Oder zumindest vor dem Schlaf. Jetzt hämmerte es wie verrückt an die Tür. Man hörte dumpfe Flüche und das Scharren schwerer Stiefel. Lorenz drehte den Schlüssel um, zog den Eisenriegel zurück. Die Tür flog unter einem Fußtritt auf.
«Was zum Teufel …», schnauzte es ihm ins Gesicht.
Vor ihm standen zwei Rotarmisten mit dem vertrauten rubinfarbenen Stern auf der Budjonny-Mütze. Diesen wundersamen olivgrünen Tüten auf dem Kopf, die zum Symbol der siegreichen Roten über die Weißen, samt ihren deutschen oder englischen Verbündeten, wurden. Die Soldaten hatten, wütend vom langen Warten, ihre Gewehre im Anschlag. Zwischen ihnen stand ein schwarz gekleideter Mann. Er hielt seine Hand an der offenen Pistolentasche. Auch ohne die schwarze Lederjacke, die Stiefel und die ebenfalls mit einem roten Stern versehene Schirmmütze wäre klar gewesen, um welchen Besuch es sich handelte.
«Grashdanin Longofen?», fragte der Mann in Schwarz und schob Lorenz beiseite, ohne die Antwort abzuwarten.
«Bürger Lochthofen», übersetzte Lorenz automatisch im Kopf. Allein diese Anrede zeigte ihm, dass er nicht mehr Teil eines großen Ganzen, sondern ausgestoßen war. Das Kollektiv der «Genossen», das den Rhythmus des Lebens im Land bestimmte, hatte sich von ihm abgewandt. Um diesen «Bürger» wehte es jetzt kalt und teilnahmslos.
Der Mann in der Lederjacke trat festen Schritts in das Zimmer. Auf dem Korridor blieb es still. Der Hausmeister, der offenbar die Außentür aufgeschlossen hatte, hielt sich im Hintergrund. Kein Mitbewohner schaute aus der Tür. Alle wussten Bescheid. Ab morgen war ein Zimmer zu vermieten.
«Packen Sie ein paar Sachen und kommen Sie mit.»
Der Geheimdienstler sprach die Worte gereizt und herablassend aus. Jede Bewegung ließ erkennen, der Vorgang war Routine. Er musste den Soldaten nichts befehlen, sie mussten ihn nichts fragen. Der eine schob Lorenz mit dem Gewehrkolben tiefer ins Zimmer, der andere schloss die Tür.
Lorenz fragte mit gepresster Stimme, was gegen ihn vorliege, ob er den Haftbefehl sehen könne.
«Das erfahren Sie in der Zentrale.»
Die Antwort des NKWD-Offiziers kam prompt und klang wie einstudiert: «Wir halten nichts von dieser bürgerlichen Zettelwirtschaft!» Sicher wusste der Mann nur den Namen und die Adresse dessen, den er mitbringen sollte. Den Rest übernahmen die Genossen vom örtlichen NKWD-Quartier. Das Kommissariat für Inneres hatte die Nachfolge der Staatlichen Politischen Verwaltung (GPU) und der Außerordentlichen Kommission, der Tscheka, des ersten Staatssicherheitsdiensts der Sowjetmacht, angetreten. Diese Tradition sollte später der KGB ungebrochen fortsetzen.
Der Geheimdienstler riss die Tür des einzigen Schranks im Zimmer auf, nach und nach flog dessen Inhalt auf den Boden. Hemden, Hosen, Jacken … Lorenz schaute stumm zu. Er dachte daran, dass Lotte ihn zum Frühstück erwartete, ihn und Friedrich. Doch das würden sie wohl jetzt allein einnehmen müssen. Lotte und Wolf.
Lorenz holte den Koffer unter dem Bett hervor, packte Wäsche und einen dicken Pullover ein. Auf die Frage, für wie lange die Sachen reichen sollten, kam die trockene Antwort:
«Sie brauchen nur das Nötigste. Dort, wohin wir Sie bringen, ist für Sie gesorgt.»
Der Mann in der Lederjacke schaute nun das Bücherbord über dem Bett durch. Lorenz wusste, was er suchte. Und einiges davon stand auf dem Brett. Lenin, Marx und Luxemburg bedeuteten keine Gefahr. Aber Kautsky? Dazu noch in deutscher Sprache? Irgendwie hätte man es vielleicht erklären können. Lenin hatte sich viel mit dem «Renegaten» herumgeschlagen, Quellenstudium wäre also eine Begründung, etwas schlicht zwar, aber immerhin. Bei Sinowjew und Bucharin, zwei überführten «Abweichlern», der eine zu «links», der andere zu «rechts», gab es dagegen nichts zu erklären. Den einen erschossen sie nach einem Schauprozess, obwohl er Stalin bei seinen Intrigen gegen Trotzki tatkräftig unterstützt hatte, der andere wartete darauf, dass mit ihm das Gleiche geschah. Wer Bücher von beiden in seinem Haus hatte, konnte kein guter Genosse sein.
Einen Band nach dem anderen warf der Mann vom Bücherbrett. Doch weder Bucharin noch Sinowjew schienen ihn zu interessieren. Lorenz konnte das nicht verstehen. Für einen Moment vergaß er fast die Bedrohlichkeit der Situation, gebannt schaute er zu, wie seine Bücher bewertet wurden. Nur ein einziges dünnes Heft blieb in den Händen des Geheimdienstlers und wurde für wichtig genug befunden, um mitgenommen zu werden: Reden und Aufsätze J.W. Stalins aus den zwanziger Jahren.
Ungläubig sah Lorenz den NKWD-Mann an. Stand jetzt auch Stalin auf dem Index? Das passte nicht zusammen. Hatte seine Verehrung nicht längst alle bis dahin bekannten Dimensionen gesprengt, ja religiöse Formen angenommen? Nun sollte also selbst der Führer aller friedliebenden Völker ein verbotener Autor sein? Vielleicht war der NKWD-Mann ja übergeschnappt. Stalin verdächtigen? Unmöglich. Lange genug hatte er selbst zu jener kritiklosen Masse gehört, die, wenn es um die Schuld an all den grausamen Vorgängen ging, sie namenlosen Funktionären zuschrieb, aber nicht doch «Väterchen» Stalin. Das war vorbei. Dennoch konnte sich Lorenz das Verhalten des NKWD-Mannes nicht erklären.
Erst viel später sollte er begreifen, warum gerade dieses unscheinbare, in grauen Umschlagkarton gepresste Büchlein unbedingt aus der Öffentlichkeit zu verschwinden hatte. Es stammte aus der Zeit, als Stalin öffentlich Buße tun musste. Nach Lenins vernichtender Kritik in seinem als «Testament» bekannten Brief, in dem er die Grobheit und den Machtmissbrauch des Georgiers offen anprangerte, gelobte dieser Besserung. Stalin gestand Fehler ein, schwarz auf weiß. Davon konnte in der Sowjetunion des Jahres 1937 keine Rede mehr sein.
Als Lorenz sich angezogen hatte, drängten ihn die Wachleute zum Ausgang. Sie wollten offensichtlich weg sein, noch ehe die ersten Hausbewohner zur Arbeit gingen. Zeugen, Fragen, Aufsehen, das mochten sie nicht. Kaum traten sie aus der Haustür, ließ der LKW-Fahrer den Motor heulen. Doch in keinem Fenster der umliegenden Häuser flackerte Licht auf. Neugier konnte in diesen Zeiten tödlich sein. Auch so wusste jeder, was da gerade geschah. Lorenz wandte sich zögernd an den Offizier.
«Sie haben mich den Geburtstag seelenruhig feiern lassen und sind erst am Morgen gekommen. Warum?»
«Wir sind doch keine Unmenschen!»
Der NKWD-Mann grinste, die Soldaten bedeuteten dem Gefangenen, endlich in den vergitterten Kasten zu steigen.
Der «Schwarze Rabe» setzte sich knatternd in Bewegung.
Eine kurze Fahrt. Das Auto bog ein letztes Mal ab, dann hörte man die Flügel eines Eisentors aufeinanderschlagen. Die Soldaten sprangen aus dem Wagen. Lorenz fand sich auf einem von Scheinwerfern grell erleuchteten Hof. Obwohl sich der Tag gerade erst zaghaft über den Dächern andeutete, herrschte aufgeregte Geschäftigkeit. Er war offensichtlich nicht der Einzige, den sie in dieser Nacht geholt hatten. Am «Empfang», wo man die wenigen Habseligkeiten der Ankömmlinge durchkämmte, ihnen Gürtel, Schnürsenkel und Taschenmesser abnahm, gab es Gedränge. Die Wachen hatten Mühe, die Gespräche zwischen den Gefangenen zu unterbinden. Ihr «Schnauze halten!» beherrschte den Raum.
Als die Personalien aufgenommen waren, verlangte Lorenz, die Anklage zu hören und einem Richter vorgeführt zu werden. Der diensthabende Offizier schaute ihn erst verwundert an, dann belegte er ihn mit einem derben Fluch. Auch die Frage nach dem Namen des Staatsanwalts, der den Haftbefehl unterschrieben hatte, blieb unbeantwortet. Stattdessen rief der Diensthabende einen Wachmann.
«Nimm den Intelligentik mit, sonst vergesse ich mich!»
Der Wachmann packte Lorenz am Ellenbogen und schob ihn auf den Gang hinaus.
«Wenn du nicht willst, dass sie dir die Zähne gleich hier ausschlagen, dann halt das Maul.»
Er führte ihn über dunkle Korridore, Treppen hinauf und wieder hinunter. Dann endlich standen sie vor der gesuchten Tür. Das Schloss knarrte. Lorenz trat ein.
Die Tür schlug zu.
II
«… der Mistkerl blutete wie eine angestochene Sau. Ich hatte ihm das Messer bis zum Anschlag unter die Rippen gejagt …»
Ein glatzköpfiger Fettwanst, der breitbeinig direkt auf dem Steinboden saß, machte trotz seiner Fülle eine blitzartige Bewegung, so als würde er gerade in diesem Augenblick jemanden abstechen. Auf seinem entblößten Oberkörper glänzte der Schweiß im fahlen Licht. Die Speckringe und der schwabbelige Bauch ließen vermuten, der Mann saß noch nicht lange hier. Um ihn herum hockten dicht gedrängt zehn oder zwölf weitere Gestalten, alle nur mit Hosen bekleidet. Das Ganze erinnerte an ein kannibalisches Ritual.
Lorenz starrte wie gelähmt auf die Gruppe. Da waren sie, die Urki, wie die Kriminellen im Volk hießen. Er hatte einiges von ihren grausamen Sitten gehört. Trotz des endlosen Geredes vom neuen sozialistischen Menschen blühte im Heimatland aller Werktätigen die Kriminalität. Menschen wurden für ein paar Rubel umgebracht, der Schwarzmarkt erreichte nie gekannte Ausmaße, von der Streichholzschachtel bis zum Professorentitel, alles wurde verschoben, und die Unterwelt verdiente daran. Kein Wunder, die Staatsmacht war mit dem täglichen Terror gegen die eigene Bevölkerung ausgelastet. Oft genug dienten die Kriminellen als Druckmittel gegen die Politischen. Wie zum Hohn hießen Mörder, Kinderschänder und Diebe im offiziellen Jargon der Partei «Freunde des Volkes», während jeder, der nach einem politischen Paragraphen verurteilt war, als «Feind des Volkes» galt. Dementsprechend fiel die Behandlung in den Gefängnissen und Lagern aus. Die Kriminellen bekamen Posten, die das Überleben sicherten. Sie herrschten über die Kammern, in denen die Sachen getrocknet wurden oder wachten darüber, dass das Feuer im Kanonenofen der Baracke nicht ausging. Die Politischen rückten aus in die vereiste Taiga, Holz einzuschlagen.
Die bevorzugte Stellung der Ganoven hinderte diese aber nicht daran, sich untereinander blutig zu befehden. Die Urki teilten sich in zwei Syndikate: die «Sutschenye», «die Hündischen», und die «Sakonniki», «die Diebe im Gesetz», die nach einem strengen inneren Kodex lebten. Die ersten dienten sich beim Gefängnis- oder Lagerpersonal an, kollaborierten mit dem NKWD. Die anderen weigerten sich oft genug, überhaupt zu arbeiten, jegliche Beziehung zu Miliz oder Geheimpolizei lehnten sie ab. Geschickt spielte das Gefängnispersonal die einen gegen die anderen aus und beide zusammen gegen die Politischen. Wer nicht spurte, kam «zufällig» in die falsche Zelle. Das bedeutete den sicheren Tod.
In den Syndikaten selbst herrschte eine eiserne Hierarchie. An der Spitze standen die Atamane, die sich ihren Titel von den Kosaken ausgeliehen hatten. Als Fußvolk dienten die «Schpana». Die Bezeichnung könnte aus dem Deutschen entliehen sein. Ein Schpana hatte seinem Chef bedingungslos zu gehorchen, wurde also «eingespannt» und der geringste Widerspruch grausam bestraft.
Waren das nun «Diebe im Gesetz» oder doch die anderen, denen sich Lorenz jetzt gegenübersah? Er wusste es nicht. Woher auch? Im Grunde war es egal. Es gab kein Entrinnen. Die einen waren mit Sicherheit so gefährlich wie die anderen. Unentschlossen blieb er stehen, die Tür im Rücken. Der Fettwanst fuhr mit seiner Erzählung fort.
«Ich hatte einem Freier gerade die Hose abgenommen, passte wie angegossen. Der alte Bock war froh, dass ich ihm die Unterwäsche ließ, so musste er nicht nackig auf die Straße.»
Die Zuhörer johlten.
«Aber leider hatte ich Pech. Da lief mir doch dieser Einäugige über den Weg. Unglaublich, die Kanaille traute sich in mein Revier. Da gab’s nur eins: Messer raus. Im Nu war alles von oben bis unten voller Blut. Es lief warm am Bein runter. Eklig. Hab vor Wut gleich noch mal und noch mal zugestochen. Könnt ihr euch das vorstellen? Die neue Hose …»
Der Mann machte eine Pause und drehte sich um.
«He, du da, was gaffst du hier rum?»
Lorenz zuckte zusammen. Sein Plan, so unauffällig wie möglich einen Platz zu finden, ging nicht auf.
«Unter die Pritsche mit dir, Hundesohn. Und wag ja nicht vorzukommen», knurrte der Urka.
Die Eisentür im Rücken, konnte Lorenz hoffen, wenigstens den ersten Ansturm zu überstehen. Auch wenn er unterlegen war, ganz ohne Widerstand wollte er sich dem Schicksal nicht fügen.
Für einen Moment herrschte Stille. Alle Blicke waren auf den Neuen gerichtet. In der Zelle, die vielleicht für vier oder fünf Sträflinge ausgelegt war, mochten fast zwanzig sitzen. Sie standen auf und rückten langsam auf ihn zu. Näher und immer näher. Nach den Wärtern zu rufen hatte keinen Sinn. Die waren lange weg. Er hatte gehört, wie ihre Schritte auf dem Gang immer leiser wurden. Außerdem bezweifelte er, dass sie ihm zu Hilfe kämen. Bis jemand mitkriegte, was hier ablief, wäre es vorbei.
«Lorenz?!», hörte er plötzlich aus der anderen Ecke der Zelle etwas unentschlossen seinen Namen.
Die Urki beiseiteschiebend, kam ein Mann auf ihn zu. Er war untersetzt und ging dennoch leicht, ja fast elegant. Die schwarze Haarpracht und der Rauschebart ließen ihn südländisch und sehr vertraut erscheinen.
Ein bekanntes Gesicht. Hier? Hier in der Zelle? Kein Zweifel, Lorenz kannte den Mann. Er dirigierte das Sinfonieorchester von Engels und stand in dem Ruf, ein begabter Interpret Tschaikowskis zu sein, sogar in Moskau hatte er schon ein, zwei Gastspiele gegeben. Man traf sich im Theater, wechselte ein paar Worte, grüßte die Gattin. Für den Dirigenten war es von Vorteil, den Feuilletonchef der wichtigsten Zeitung am Platze in seinem Bekanntenkreis zu wissen. Die Arbeit als Theaterkritiker gefiel Lorenz, ohnehin versäumte er keine Premiere in der Stadt. So stimmte der Chefredakteur dem Wechsel vom Posten des Redaktionssekretärs ins Kulturressort zu. Seine Kritik der «Nora»-Aufführung, in der Regie von Maxim Vallentin, brachte ihm weit über Engels hinaus Anerkennung.
Das freute Lorenz, er schrieb Geschichten und Gedichte. Während des Studiums hatte er damit begonnen, unter den Exilliteraten in Moskau galt er bald als Talent. Der Preis, den er für eines seiner Gedichte erhielt und die Ermunterung eines Egon Erwin Kisch, dem er nach einer Vorlesung ein paar Manuskriptseiten in die Hand gedrückt hatte, unbedingt dem Schreiben treu zu bleiben, bestärkten ihn. Er saß nun immer in der ersten Reihe, wenn der Meister der Reportage am Pult zu reden anhob. Und das, obwohl Kischs Vorlesungen die schiere Langeweile verströmten. Wie vielen exzellenten Schreibern fiel dem Naturtalent aus Prag das Referieren vor Publikum schwer. Er quälte sich, stotterte etwas und hoffte mit dem Auditorium, die Stunde möge bald vorüber sein. Wenn die Unruhe im Hörsaal zu groß wurde, holte Kisch die korrigierte Fahne eines neuen Textes hervor und begann zu lesen. Schlagartig wurde es still. Jetzt begriff jeder, warum Kisch Kisch war.
Friedrich Wolf war da ein ganz anderer Typ. Das wusste Lorenz schon seit ihrer ersten Begegnung im «Lux». Ernst Thälmann hatte zu einem Abend geladen, und Lorenz rutschte in der Gesellschaft eines Freundes hinein. Eine gute Gelegenheit, endlich wieder einmal richtig zu essen, die Verpflegung in der Mensa der Westuniversität war grässlich bis ungenießbar. Natürlich konnte man an solchen Abenden auch wichtigen Leuten begegnen. So wurde Lorenz tatsächlich dem Gastgeber vorgestellt und fiel sogleich unangenehm auf. Er sprach Thälmann nicht mit dem unter deutschen Genossen üblichen «Du», sondern vorsichtshalber mit «Sie» an, was den KPD-Vorsitzenden in Rage versetzte.
«Wieso Sie? Bin ich dir der Kaiser von China?!»
Lorenz stotterte eine Entschuldigung, aber da war Thälmann schon weiter. Im Hintergrund stand Wolf und grinste.
«Mach dir nichts draus, der ist heute nicht gut aufgelegt. Die Genossen in Moskau haben ihm wieder einmal erklärt, wie es in Deutschland wirklich aussieht. Du kennst sie ja. Die wissen schon aus Prinzip alles besser. Dabei ist die Lage beschissen. Und das ist noch geprahlt. Die Weisheit der Moskauer Genossen verkraftet man nicht jeden Tag. Glaub mir, mit dir hat seine Laune nichts zu tun.»
Wolf fand Interesse an dem jungen Mann aus dem Pott, vor allem weil er wusste, dass Lorenz nach dem Studium bei der Zeitung in Engels anfangen sollte. Er konnte einen Getreuen in der Redaktion gut brauchen. Schließlich war das Theater an der Wolga einer der Hauptabnehmer seiner Stücke. Später gingen der Schriftsteller und der frischbestellte Redakteur auf ausgedehnte Reportagereisen. Lorenz hatte zwei wichtige Vorzüge: Er konnte Russisch, und er konnte noch besser die Klappe halten. Denn neben den jungen Schauspielerinnen förderte Wolf gerne auch die jungen Kolchosbäuerinnen. Lorenz sollte es recht sein. Alles, was die Bande zwischen Friedrich und Lotte schwächte, kam ihm gelegen. Es war kein Zufall, dass, wann immer sie in einer Kolchose abstiegen, um das Heldenepos der Arbeit zu singen, Lorenz beim Kolchosvorsitzenden und Wolf im Wohnheim für ledige Bäuerinnen nächtigte. Während die Frau des Kolchos-Chefs den Redakteur mit Piroggen mästete, wurde Wolf anderweitig verwöhnt. Das hieß dann bei den beiden Reisenden: den Kolchosbäuerinnen die Beschlüsse der Komintern erklären. Manchmal dauerte so ein Seminar Tage.
So kam es, dass Lorenz nicht nur die Literaten und die Regisseure, sondern das gesamte Ensemble des Theaters, einschließlich der Musiker, zu seinem erweiterten Bekanntenkreis zählte. Sie alle gehörten zur örtlichen Intelligenzija, von der es in einem Provinznest wie Engels nicht all zu viel gab. Jemanden aus dieser Welt in einer schmutzigen, stickigen Zelle wiederzutreffen, das schien unwirklich und eine Erleichterung zugleich. Er war also nicht allein.
«Haben Sie keine Angst, Lorenz Lorenzowitsch», der Dirigent lächelte dem Neuen zu, «das sind keine Urki. Wie überhaupt in dieser Zelle keine Kriminellen sitzen. Ausnahmslos Politische. Und das Theater bei Ihrem Einzug ins Schloss, das müssen Sie schon verstehen, ist eine reine Vorsichtsmaßnahme gegen ungebetene Gäste. Sie können es sich ja vorstellen, die kennen nur eine Sprache.» Er deutete mit der flachen Hand auf seinen Hals.
Plötzlich sah Lorenz lauter freundliche Gesichter um sich. Selbst der Dicke, der gerade noch martialisch in seine Richtung vorgerückt war, nickte freundlich. Der Dirigent fing seinen immer noch skeptischen Blick auf.
«Glauben Sie mir, Lorenz, Anton tut keiner Fliege etwas. Im Gegenteil. Normalerweise ist er Mediziner, hier, im städtischen Krankenhaus. Oder sagen wir es genauer, er war es bis vor kurzem. Bis zu seiner Verhaftung. So wie ich noch vergangene Woche Orchesterleiter war …»
Er schluckte, für einen Moment schien er die Fassung zu verlieren, aber dann fuhr er in abgeklärtem Ton fort:
«Wir haben beschlossen, dass er am überzeugendsten einen Verbrecher geben kann. Natürlich ist die Geschichte, die er vorhin aufgetischt hat, frei erfunden. Seien Sie sicher, er hat keinen aufgeschlitzt. Hauptsache, so ein Ganove, falls er sich denn in unsere Herberge verirrt, hat gleich die Hosen voll. Verstehen Sie?»
«Aber warum sitzen die hier alle halbnackt? Gehört das auch zur Maskerade?»
«Nein, nein. Das ist echt. Die vielen Menschen auf so engem Raum heizen auch ohne Ofen. Sie werden es schon merken, Lorenz Lorenzowitsch, es wird hier sehr warm. Wenn Sie so wollen: ein animalisches Kraftwerk.»
Die Erklärung schien überzeugend, dennoch blieb Lorenz vorsichtig. Vielleicht waren unter den Insassen doch Kriminelle. Von zwanzig Leuten konnten nicht alle unschuldig sein. Unmöglich.
Der Dirigent sah sein Misstrauen.
«Nu, so ist es richtig. Bleiben Sie wachsam. Die Feinde lauern überall.» Er neigte sich mit verschwörerischer Miene zu Lorenz.
«Sie wissen doch, der Klassenkampf, der spitzt sich immer mehr zu. Von Tag zu Tag. Wo der Genosse Stalin recht hat, hat er recht. Er tut ja auch nach Kräften etwas dafür. So gesehen, sollten Sie Ihre Verhaftung nicht persönlich nehmen. Die große Geschichte spaziert gerade durch Ihr Leben. Wo gibt es so etwas sonst noch? Kostenlos? Aber glauben Sie mir, in ein paar Tagen sind Sie schlauer. Uns allen ging es so oder so ähnlich.»
Die Männer hatten sich wieder auf ihre Plätze gesetzt, sie wollten nun Neuigkeiten von draußen hören. Was gab es im Theater? Wen hatten sie noch verhaftet? Auch die Lage in Spanien interessierte die Gefangenen. Wie stark war Franco? Und die Interbrigaden? Trotz ihrer misslichen Lage ließ sie die politische Entwicklung nicht kalt. Der Spanienkrieg elektrisierte das Land, hoffte man doch, die Isolation Sowjetrusslands könne endlich aufgebrochen werden. Aber der Traum war längst ausgeträumt, es würde kein sozialistisches Spanien geben. Wer zu denken vermochte, wusste das. Es offen auszusprechen, wagte niemand.
So hoffnungsvoll ihn die Häftlinge auch anstarrten, Lorenz hielt «die Zunge hinter den Zähnen», wie es ein russisches Sprichwort dringend riet. Seine Antworten klangen wie Verlautbarungen aus der «Prawda». Die Gefangenen winkten bald ab. Der war zwar ein Redakteur, aber etwas Vernünftiges aus ihm herauszukriegen schien unmöglich.
Der innere Lernprozess dauerte genau drei Tage. Dann war auch Lorenz klar, dass alle, ausnahmslos alle, die mit ihm in der Zelle saßen, genauso schuldig waren wie er. Also unschuldig. Drei Tage, das war gut. Andere brauchten länger. Manche glaubten bis zuletzt, dass der große Stalin von all den Verbrechen nichts wusste. Ja, nichts wissen konnte. Viele bezahlten diesen Irrtum mit dem Leben.
So saßen in der Zelle außer dem Dirigenten und dem Arzt ein Buchhalter des Stadtsowjets, ein Filmvorführer aus dem Kino, ein Instrukteur der örtlichen Feuerwehr und auch ein Mathematiklehrer. Letzterer war ein sonderbarer Mensch, der sich stets etwas abseits hielt, soweit dies auf dem engen Raum möglich war. Er hatte ein fahles, längliches Gesicht, mit einer für seine magere Gestalt bemerkenswerten Nase. Aus seinem grauen Unterhemd – das karierte Oberhemd hatte er säuberlich gefaltet auf der Pritsche liegen – stachen an der Brust und unter den Armen ganze Büschel von Haaren hervor. Er fragte nichts, er sagte nichts. Den ganzen Tag hockte er auf den Knien, gebeugt über einen Holzschemel. Er schrieb, verwarf das Geschriebene und schrieb aufs Neue.
Es war ein Brief an den Genossen Stalin. Die zehnte, die fünfzehnte oder die fünfzigste Fassung – keiner wusste es. Er auch nicht. Grigori Maximowitsch, mit Nachnamen Krütschkow oder Krükow, hatte für seine letzten Rubel einem Wärter ein Heft und einen zerbissenen Kopierstift abgekauft. Der Besitz von Schreibzeug war Gefangenen verboten, aber wenn es um ein Geschäft ging, konnte man bei der Wachmannschaft alles bekommen. Vorausgesetzt, man hatte es geschafft, ein paar Scheine in die Zelle zu schmuggeln.
So kauerte der Lehrer vor dem Hocker und überlegte, mit welchen Worten er wohl am ehesten das Herz des Vaters aller Völker erweichen könnte. Er war tief davon überzeugt, dass der geniale Bannerträger der Menschheit nicht wusste, ja, nicht wissen konnte, welche Ungerechtigkeit ihm und vielen anderen ehrlichen Erbauern des Kommunismus widerfahren war. Also galt es, ihm im fernen Kreml eine Botschaft zu übermitteln. Dann würde der Zorn des Genossen Stalin die Missetäter mit aller Härte treffen, und er, Grigori Maximowitsch, würde als Held in die Geschichte eingehen. Vielleicht sogar als Held der Arbeit. Manchmal, vor dem Einschlafen, sah er sich mit dem Orden an seiner Brust über den Boulevard spazieren. Und alle Menschen grüßten ihn freudig. Der Glaube an den guten Zaren im fernen Moskau, dieser Glaube schien in diesem Volk unausrottbar.
Auf den Spott seiner Zellennachbarn reagierte der Lehrer nicht. Auf ungebetene Empfehlungen auch nicht. Er kannte seine ganz persönliche Mission und war ihr mit seinem ganzen Wesen verfallen. Mochten sie nur lachen, ohne seinen Brief kämen sie aus dem Loch nie mehr heraus. So blieb er auch ungerührt, als der Veterinär Schukow, den in der Zelle alle nur Tolik nannten, auf seinem täglichen Marsch von einer Zellenwand zur anderen vor dem Schreibtischhocker stehen blieb.
«Grischa, ah, Grischa? Hörst du mich? Grischa?»
Doch Grigori Maximowitsch hörte ihn nicht. Oder er wollte ihn nicht hören. Jedenfalls zuckte er nicht. Der Tierarzt, der eher wie ein Preisboxer aussah, ließ nicht locker. Lorenz verstand schnell, es war nicht das erste Gespräch zwischen den beiden, vielmehr klang es wie ein Stück aus einem Fortsetzungsroman.
Tolik gehörte zu den Starostas, den Ältesten der Zelle. Er saß seit mehreren Monaten, ohne dass sich in seiner Sache etwas bewegt hätte. Sein Vergehen war die Maul- und Klauenseuche. Die konnte er in den Kolchosen südlich von Engels, auf der Wiesenseite der Wolga, nicht besiegen. Wie hätte er das auch schaffen können? Die Bauern hielten seine Hygienevorschriften für neunmalkluges Gerede. Solch dummes Zeug konnte nur einem Städter einfallen. Es begab sich, dass er eine Horde von ihnen im Stall mit einer Flasche Selbstgebranntem erwischte. Ein schmächtiges Kerlchen in verdreckter Wattejacke schwang gerade eine große Rede: «Schau an, die Obrigkeit hat sich einen Viehdoktor zugelegt», kam es aus dem zahnlosen Mund. «Extra für die Rindviecher. Und, was hat’s genutzt? Sie sterben wie die Fliegen. War früher so, wird auch so bleiben …» Der Tierarzt schmiss die Schnapsflasche an die Wand und jagte die Bande hinaus an die Arbeit. Die Säufer revanchierten sich mit einem Wink an den NKWD. Der Rest war Routine.
«Grischa, ich weiß, dass du mich hörst», der Tierarzt suchte den Blick des Lehrers.
«Grischa, glaube mir, mit deinem Schrieb wird sich der Gefängnisdirektor, auf dessen Tisch das Ding mit Sicherheit landet, nicht einmal den Hintern abwischen. Im Gegensatz zur Zeitung ist das Papier zu glatt. Man reibt sich nur den Arsch wund. Und weiter, Brüderchen, das kannst du mir glauben, kommt dein Brief nicht. Die fischen alles raus. Jeden Zettel, verstehst du?»
Der Lehrer schaute traurig auf. Für einen Moment schien er zu überlegen, ob es Sinn hätte, alle Hoffnung in das Stückchen Papier zu stecken. Dann sah er wieder auf sein kariertes Blatt, auf die einzige Zeile, die ganz oben am Rand stand, und flüsterte die drei Worte:
«Hochverehrter Genosse Stalin!»
Allein über die Anrede und das Ausrufungszeichen hatte er zwei Tage nachgedacht. Wie spricht man solch eine bedeutende Persönlichkeit an? In der Schule lernt man das nicht. Genosse Stalin ist ja nicht die Schwiegermutter. Der kannst du schreiben: «Liebe Darja Iwanowna, Dein Paket mit den Wollsocken und der Kirschkonfitüre ist angekommen. Leider erwies sich das Glas als nicht ganz dicht …»
Es ist ja auch kein Antrag an den Stadtsowjet, in dem man den Vorsitzenden um ein etwas geräumigeres Zimmer für seine fünfköpfige Familie bittet. Solange die Kinder klein waren, ging es ja noch. Aber jetzt? Sechzehn Quadratmeter sind wirklich nicht viel. Daneben residiert die Witwe des Buchhalters Pankin und denkt nicht daran, sich etwas zu bescheiden. Pankin ist gestorben, dem standen sicherlich zwanzig zu. Aber doch nicht der Witwe …
Vielleicht «Teuerster»? Geht auch nicht. «Teuerster» ist zu familiär. Das kann er seinem Vetter auf dem Lande schreiben, wenn er ihn bittet, aus dem Garten der Großeltern von den Antonowka-Äpfeln etwas zu schicken. Aber für den großen Führer, nein, für den ist das nichts. Also «Hochverehrter Genosse Stalin». Erst hatte er danach ein Ausrufungszeichen gesetzt. Aber das sah ganz unmöglich aus. Ein Ausrufezeichen war das Mindeste, etwas für einen normal Sterblichen. Aber dieser Brief ging an Stalin. An STALIN! Er setzte noch eins dazu. Das sah schon deutlich besser aus. Auch die Großbuchstaben. Ja, STALIN konnte man eigentlich nur in Großbuchstaben schreiben. Kleine Buchstaben waren etwas für kleine Leute. Aber er schrieb an den großen STALIN. Was wäre mit einem dritten Ausrufezeichen? Die Kirche hatte es ja nicht umsonst mit der Drei … Vater, Sohn und dann noch der Heilige Geist. Ist der Genosse STALIN etwa weniger?
Grigori Maximowitsch seufzte tief. Die Anrede war schon schwer genug, wie sollte da der erste Satz gelingen? Und auf den kam es an. Der entschied alles. Sicher lag es an dem falschen ersten Satz, dass all seine anderen Briefe ohne Antwort geblieben waren. Wenn der große Lenker, der sich täglich um die Geschicke der ganzen Welt, um den Aufbau des Kommunismus, um das Ausmerzen der Feinde der Arbeiterklasse kümmerte, den Brief auf seinem Schreibtisch vorfand, dann musste der erste Satz klar und deutlich sein. Er musste alles Wesentliche beinhalten. Nach diesem Satz musste Genosse STALIN zum Telefonhörer greifen und sagen:
«Genossin Telefonistka, verbinden Sie mich mit Engels, dem örtlichen NKWD-Gefängnis, dem Oberst Bulka! Ja, ja, sofort! Ahh, da sind Sie ja …
Der Schreiber blickte durch den Tierarzt hindurch zum Fenster, als sei von dort Hilfe zu erwarten. Da wusste der Veterinär, jedes weitere Wort war sinnlos.
Unter anderen Umständen hätte Lorenz die Geschichte brennend interessiert. Aber jetzt hörte er die Wortfetzen wie durch einen Nebelschleier, weit in der Ferne. Er saß auf dem Boden mit dem Rücken zur Wand und dachte nach.
War das alles falsch?
War es falsch, Deutschland zu verlassen?
War es falsch, nach Russland zu gehen?
War es falsch zu studieren?
Journalist zu werden?
Hierzubleiben?
Seine Freunde, die er damals zurückgelassen hatte, kämpften jetzt im Untergrund. Einige waren verhaftet worden. Anderen war die Gestapo auf der Spur. Doch sie alle wussten genau, wer der Feind ist, wo er steht. Das war hier anders. Ganz anders. Der Feind war mitten unter ihnen. Und wer Feind, wer Freund war, wie sollte man das noch unterscheiden.
Trotzdem, in Deutschland wäre er das geblieben, was er war: ein Schlosser, ohne jegliche Chance, mehr daraus machen zu können. Universität? Vergiss es. Tolstoj, Dostojewski, Flaubert, France – nie wäre er mit ihnen in Berührung gekommen. Arbeit in einer Redaktion, Theater, eigene Gedichte? Daran wäre nicht zu denken gewesen. Und noch war ja seine Geschichte nicht zu Ende.
Obwohl, die Hoffnung des ersten Tages, bald würde sich alles aufklären, diese Hoffnung war nicht mehr. Die Erzählungen der anderen, zumindest soweit sie von ihrer ganz persönlichen «Sache» wussten, klangen so unglaublich wie seine eigene. Nun saßen sie und warteten darauf, was kam. Hin und wieder führten die Wachen einen zum Verhör in den Keller. Der kehrte dann schweigsam zurück. Manche wurden auch gebracht. Die Wachleute schmissen ihre reglosen, von Tritten und Schlägen gezeichneten Körper auf den Boden. Wer sich aus eigener Kraft auf die Pritsche ziehen konnte, war noch einmal davongekommen. Für gewöhnlich passierte das vor Mitternacht. Und jeder, der nicht aufgefordert wurde, mit den Wachen zu gehen, war froh. Dann war es nicht mehr so schlimm, auf der Pritsche Körper an Körper mit zwei anderen zu liegen.
Wie man sich beim ersten Verhör verhalten sollte, darüber gingen die Meinungen in der Zelle auseinander. Die einen rieten Lorenz, wenn es nur irgendwie ginge, zu schweigen. Jedes überflüssige Wort ergab ein Dutzend neuer Fragen. Bis man am Ende nicht mehr wusste, was man am Anfang gesagt hatte. «Meine Zunge ist mein Feind», die alte russische Weisheit konnten sie nicht oft genug wiederholen. Die andere Fraktion lehnte diese Verteidigungslinie ab und schwor darauf, dass man sich für das Verhör eine gute Geschichte zurechtlegen und, komme, was da wolle, dabei bleiben solle. Schweigen bringe die Ermittler nur in Rage, dann konnte man froh sein, wenn sie einen nur mit den Fäusten schlugen. Der Mann, der diese Meinung am heftigsten vertrat, ein Archivar, machte allerdings nicht den Eindruck, als wäre seine Taktik aufgegangen. Ihm fehlten alle Vorderzähne, oben und unten. Das klaffende Loch im Gebiss sah sehr frisch aus.
Verhöre, Schläge, Folter … Was lag eigentlich gegen ihn vor? Lorenz zermarterte sich den Kopf, er fand nichts. Die Ungewissheit dauerte volle acht Tage. Dann holten sie ihn, am späten Abend, kurz bevor das Licht ausgeschaltet wurde. Jetzt, schoss es ihm durch den Kopf, mussten sie ihm endlich sagen, was er verbrochen hatte. Jetzt konnte er endlich selbst Fragen stellen. Und jetzt würde sich alles aufklären. Endlich.
Sein Untersuchungsführer trug den schönen Namen Schrottkin. Wie Schrott, eigentlich zum Lachen. Schrottkin, Nikolaj Petrowitsch. Und: Schrottkin war dumm. Primitiv und dumm. Daran konnte es bereits nach der ersten halben Stunde ihrer Bekanntschaft keinen Zweifel geben. Bei seinem grausamen Handwerk vertrat er die Auffassung, das einzig Richtige sei, den Willen des Häftlings sofort zu brechen. Sei es mit Drohungen, sei es mit Gewalt. Er galt als besonders brutal und skrupellos. Was seine Vorgesetzten schätzten: Es hatte ihm den Rang eines Hauptmanns und mehrere Urkunden vom Kommissariat des Inneren eingebracht.
Groß, wenn auch etwas krumm gewachsen, hatte Schrottkin ein spitzes, von frühen Falten zerfurchtes Gesicht, das ein dünnes, in täglicher Kleinarbeit ausrasiertes Bärtchen umrahmte. Wenn er brüllte, sah man die Stahlkronen seines Gebisses glänzen. Dazu musste er die Kasbek-Papirossa, auf der er ansonsten ständig kaute, aus seinem linken Mundwinkel nehmen. Die Schirmmütze seiner Uniform, die der rote Stern mit Hammer und Sichel zierte, setzte Schrottkin nur ab, um sich in Momenten der Erregung mit der Hand über die dunkle Haartolle zu streichen. Er roch kräftig nach süßlichem Parfüm. Hieß es «Rotes Moskau»?, fragte sich Lorenz. Aber dann wäre es ja ein Damenduft. «Schipr», das die Herren als Rasierwasser bevorzugten, war es jedenfalls nicht.
Noch bevor Lorenz etwas fragen konnte, schrie ihn der Untersuchungsführer an:
«Leugnen ist zwecklos! Sie sind überführt! Die Liste mit den Namen der Verräter ist fertig! Von Ihnen brauche ich nur die Bestätigung!»
Sie saßen sich an einem Tisch gegenüber, Auge in Auge, der Raum nur von der Schreibtischlampe erleuchtet. Im Schatten duckte sich ein Protokollant über seinem Papier, an der Tür lehnte ein Soldat.
Der NKWD-Mann hatte den Tag bis dahin gut verbracht. Ausgeschlafen, anschließend in der «geschlossenen Stolowaja», einer Kantine, zu der normale Menschen keinen Zutritt hatten, reichlich gegessen. Gegen Abend tauchte Schrottkin in seinem Büro auf, ging die Liste seiner potenziellen Kunden durch und blieb bei dem Deutschen mit dem unaussprechlichen Namen stehen. Irgendwas musste man mit ihm machen. Nur was? Schrottkin mochte die Deutschen nicht. Nicht die von der Wolga und erst recht nicht die aus dem Reich. Alles Klugscheißer, alles Leute, die einem Scherereien machten.
Da half nur eins: Die Verhältnisse sofort klären. Schrottkins Stimme überschlug sich. Von Spionen, Schädlingen, Verrätern war die Rede. Von Agenten, die es auf Stalins Leben und die Sowjetmacht abgesehen hätten. Doch er, Schrottkin, werde sie alle erkennen, sie wie Wanzen zerquetschen, und wenn es sein musste, mit heißem Eisen ausbrennen. Er fuchtelte mit einem Zettel in der Luft herum, auf dem, so viel hatte Lorenz verstanden, sein Name und die Namen weiterer Verdächtiger standen.
«Sie sind Mitglied einer weitverzweigten Verschwörung trotzkistischer Elemente! Ich sage noch einmal: Leugnen ist zwecklos! Geben Sie alles zu! Um so eher sind wir hier fertig. Umso geringer fällt Ihre Strafe aus.»
Er? Umsturz? Stalin umbringen? Lorenz hatte so etwas wie Spionage erwartet. Schließlich war er Deutscher, verdächtig genug. Vielleicht unterstellten sie ihm ja, er sei Agent der Weltbourgeoisie. Aber das? Umsturz der Sowjetmacht. Er? Der Mann musste verrückt sein. Vollkommen irre. Dessen unerwarteter Wutausbruch, das laute Geschrei hatte den Häftling nicht zu Widerspruch angestachelt, sondern eher apathisch auf dem Stuhl zusammensinken lassen. Die grelle Lampe, unter deren Lichtkegel mal Schrottkins volles Gesicht zu sehen war, mal nur die Stahlzähne im geifernden Mund, ließ einen vernünftigen Gedanken ohnehin nicht aufkommen. Was sollte man auf einen solchen Unsinn auch sagen?
«Gib es zu! Abstreiten ist zwecklos!», ratterte der Mann wie ein Maschinengewehr ununterbrochen Worte aus sich heraus. Dass er zum Du übergegangen war, empörte Lorenz, aber er hatte keine Zeit, darüber nachzudenken. Schrottkin beugte sich drohend über den Tisch, der rote Stern auf seiner Mütze blitzte für einen Moment auf:
«Willst du nicht endlich gestehen? Das erspart dir und uns viel Ärger. Warum sich quälen? Wer sind deine Komplizen? Nur keine Scheu vor hohen Namen. Es ist egal, woher sie kommen, ob aus Engels oder Saratow. Moskau wäre auch nicht schlecht. Du bist doch so ein Schreiberling, ja, ein Journalist, da kennt man doch Hinz und Kunz bei der Komintern. Denkst du nicht, dass es auch dort Verräter und Spione gibt? Da hat doch jeder Zweite einen Auftrag von der Gestapo oder dem Intelligence Service. Hier, ein Blatt Papier und ein Stift. Schreib auf, wen du kennst. Aber flott. Wir brauchen Namen. Vor allem Namen.»
Er schob Lorenz das Papier über den Tisch.
«Nur zu, das erleichtert deine Lage deutlich. Und keine Angst: Wenn die Leute nichts verbrochen haben, passiert ihnen auch nichts. Bei uns geht alles nach Recht und Ordnung. Nach dem proletarischen Recht. Oder glaubst du nicht, dass die Weltbourgeoisie unseren Untergang wünscht? Aber da haben sich die Herren Roosevelt und Chamberlain verrechnet. Also, was ist? Geben Sie es zu?! Und ich kümmere mich persönlich darum, dass Sie nicht nach Sibirien kommen. Da ist es kalt. Sehr kalt. Das ist doch nichts für einen Deutschen. Das halten selbst Russen kaum aus. Und?»
Schrottkin machte eine Pause. Er war vom Herrschafts-Du wieder zum Sie gewechselt, aber das hielt nicht lange.
«Namen! Ich brauch N-a-m-e-n! N-a-m-e-n, verstehst du?»
Doch der Gefangene schwieg. Schwieg schon die ganze Zeit. Langsam erkannte Schrottkin, dass sein erster Ansturm nichts gebracht hatte. Nun schwieg auch er. Man sah es an seinem nach innen gerichteten Blick, er dachte nach. Es dauerte zwei, drei Minuten, dann stürzte er sich mit neuer Energie auf den Häftling. Er zog ein weiteres Papier aus der braunen Mappe, die vor ihm lag, und begann, die Namen mehr oder weniger bekannter Parteifunktionäre aus Saratow, der Gebietshauptstadt auf der anderen Seite der Wolga, laut vorzulesen. Er wollte wissen, wann und wo der Angeklagte die Betroffenen das letzte Mal gesehen habe. Und natürlich, wie viele konspirative Treffen stattgefunden hätten.
Doch Lorenz schaute ihn nur fassungslos an und sagte auf Deutsch:
«Ich verstehe gar nichts.»
Dann schwieg er wieder. Seine ursprüngliche Absicht, endlich selbst Fragen zu stellen – welcher Richter seine Verhaftung angewiesen hatte, nach welchem Paragraphen ihm der Prozess gemacht werden sollte –, ließ er fallen. Das war mit Sicherheit nicht der Ort, an dem man vernünftig mit jemandem reden konnte. Und schon gar nicht mit diesem Choleriker. So schwieg er und wartete, was kam.
Im Gegensatz dazu schrie sich Schrottkin wieder in Rage. Leugnen sei sinnlos, sie hätten hier bisher jeden zum Reden gebracht. Übrigens komme es auf seine Aussage gar nicht an, die wichtigsten Geständnisse und Namen habe man längst protokolliert. Der NKWD werde diese Sache bald ermittelt haben. Schließlich gebe es noch mehr zu tun, als sich mit einem deutschen Überläufer, bei dem man noch einmal genau hinschauen müsse, was ihn in die Union der Sowjetrepubliken geführt habe, die Nerven zu strapazieren.
«Ich habe gegen die Faschisten gekämpft», erwiderte Lorenz.
So ging es ein paarmal hin und her, bis Schrottkin, der offensichtlich der deutschen Sprache nicht mächtig war, restlos die Nerven verlor. Er rutschte immer mehr ins tumbe Fluchen ab. Seine Wörter stammten jetzt aus der dreckigsten Ecke der russischen Vulgärsprache. Derbe Flüche kennt man überall, aber der russische «Mat» ist ein sprachliches Paralleluniversum, in dem es nur so «fickt» und «hurt» und der «Chui», der Schwanz, das meistgebrauchte Wort ist. Und obwohl nahezu die Hälfte der Bevölkerung, vornehmlich Männer, kaum einen Satz ohne Fluch zu Ende bringt, findet sich keines der Wörter im Wörterbuch der russischen Sprache. Der Untersuchungsführer beleidigte die Mutter des sturen Deutschen, in der Hoffnung, vielleicht so etwas aus ihm herauszulocken. Doch Lorenz schwieg. Schwieg beharrlich. Und wenn er etwas sagte, dann nur in seiner Muttersprache.
«Ich weiß gar nicht, warum Sie sich so aufregen. Ich verstehe Sie überhaupt nicht. Ich spreche kein Russisch».
Und damit es auch Schrottkin begriff, wiederholte er radebrechend:
«Ja ne goworju po russki.»
Der NKWD-Mann sah den Angeklagten verdutzt an. Lorenz hatte das Gefühl, der Kerl würde gleich explodieren, so rot wurde sein Kopf. Es folgte eine neue Welle derber Mutterflüche. Dazwischen raunte er dem Protokollanten etwas zu, der sprang auf, um nach wenigen Minuten mit einem weiteren Offizier zurückzukehren.
Leutnant Hofer, Ewald Hofer, ein Wolgadeutscher und sowohl der russischen als auch der deutschen Sprache mächtig. Schrottkin befahl, die Anklagepunkte zu übersetzen. Aber kurz. So machte Lorenz die Bekanntschaft seines zweiten Untersuchungsführers, eines eher weichlichen Typs, gut einen Kopf kleiner als sein Vorgesetzter. Die dicke, rotbraune Hornbrille verlieh ihm etwas freundlich-verbindliches. Das mit Brillantine geglättete Haar und der unter dem Kinn zulaufende Bart ließen vermuten, man habe es allenfalls mit einem städtischen Angestellten zu tun. Wer ihn auf der Straße sah, kam nicht umhin, ihn freundlich zu grüßen.
Niemand hätte sich vorstellen können, dass ebendieser nette Mensch bisweilen einen am Stuhl festgebundenen Gefangenen ohne Grund und jede Vorwarnung ins Gesicht schlug. Dass er einem Kind ein brennendes Streichholz an die Wange halten konnte, um es zum Weinen zu bringen, damit die Mutter im Raum nebenan alles unterschrieb, was man ihr nur vorlegte. Hofer tat, was man ihm befahl. Tat es gründlich und mit jener inneren Befriedigung eines Angestellten, der wusste, dass alles nach Recht und Gesetz ging. Dass er nichts zu befürchten hatte.
Der Deutsche schien in der Tat kein Russisch zu verstehen. Es entspann sich ein zähes Frage-und-Antwort-Spiel, bei dem Hofer zwischen Schrottkin und Lorenz wie ein Pingpong-Ball hin und her wechselte. Schrottkin konnte daran keinen Gefallen finden. Seine Geduld reichte nicht lange, grob unterbrach er seinen Gehilfen und forderte Lorenz abermals auf, endlich zu sagen, welchen der hohen Parteifunktionäre aus Saratow er kannte, und, verflucht noch mal, zu gestehen, wie es zu der Verschwörung gekommen sei. Adressen, Namen, Daten der heimlichen Treffen, er wollte alles wissen.
«Sprechen diese Leute alle Deutsch?», fragte Lorenz jetzt Hofer. Der schüttelte den Kopf.
«Nein? Wie soll ich mich dann mit denen verschworen haben, wenn ich nicht einmal ihre Sprache kann?»
Die lakonische Antwort des Angeklagten leuchtete ein. Wenigstens Hofer. Schrottkin dagegen bekam wieder einen Wutanfall. Er sprang von seinem Stuhl und begann, an der Frontseite des Verhörtischs auf und ab zu laufen.
«Und dieser Faschisten-Chui kann kein Russisch?»
Mit einer abwertenden Bewegung zeigte er in Richtung Lorenz. Dann schnäuzte er sich lange und laut in ein ziemlich gebrauchtes Taschentuch, offensichtlich darüber nachdenkend, wie es nun weitergehen sollte.
«Was wollen all diese Schwachköpfe bei uns? Fressen sich am Busen von Mütterchen Russland fett, und nicht genug damit, sie konspirieren auch noch. Gegen die Sowjetmacht! Kaum hast du nicht aufgepasst, kriechen die Bestien aus ihren Löchern. Aber nicht mit uns! Nicht mit mir. Mit der Faust des NKWD werden wir sie erschlagen!»
Schrottkin blieb beeindruckt von der Gewalt seiner Rede stehen.