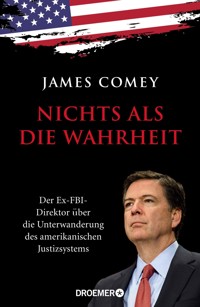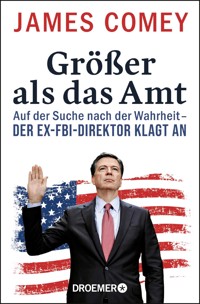
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Spektakulär von Donald Trump gefeuert, legt Ex-FBI-Direktor James Comey die politischen Machenschaften in Washington und das von Donald Trump korrumpierte System offen. Auch der Mueller-Report hat bewiesen: Mit Trump regiert seit 2017 ein Präsident, der wie ein Mafiaboss agiert. Mit scharfem Blick zeichnet Comey nach, wie Machtbesessenheit und Egomanie die demokratischen Grundwerte der USA aushöhlen. Ein Stück Zeitgeschichte, so spannend wie ein Thriller – nun gibt es den SPIEGEL-Bestseller endlich im Taschenbuch. James Comeys brisante Erinnerungen an die vergangenen 20 Jahre im Zentrum der Macht zeigen ihn als unbeugsamen Ermittler, der gegen die Mafia, gegen CIA-Folter und NSA-Überwachung, und zuletzt im Wahlkampf 2016 gegen Hillary Clintons Umgang mit dienstlichen Emails und Donald Trumps Russland-Verbindungen vorgegangen ist. Der Weg des New Yorker Vorzeigejuristen gleicht einer politischen Achterbahnfahrt: stellvertretender Justizminister unter George W. Bush, zum FBI-Direktor ernannt von Barack Obama und gefeuert von Donald Trump wegen angeblicher Illoyalität. Sein Buch ist ein eindrückliches Lehrstück über den aufrechten Gang in einer verantwortungslosen Regierung. Ein Sachbuch wie ein Kriminalroman der Extraklasse: »Comey schreibt mit der Präzision eines Staatsanwalts und dem Talent eines Romanciers.« – Der Spiegel
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 494
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
James Comey
Größer als das Amt
Auf der Suche nach der Wahrheit – der Ex-FBI-Direktor klagt an
Aus dem Amerikanischen von Pieke Biermann, Elisabeth Liebl, Werner Schmitz, Karl Heinz Siber und Henriette Zeltner
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Die Erinnerungen von Ex-FBI-Chef James B. Comey sind aktuell, brisant und spannend wie ein Krimi. 2017 von Präsident Trump gefeuert, schreibt Comey einen fesselnden Insider-Bericht über politische Machenschaften und das von Donald Trump korrumpierte US-amerikanische System.
Ein Sachbuch wie ein Kriminalroman der Extraklasse: James Comeys brisante Erinnerungen an die vergangenen 20 Jahre im Zentrum der Macht zeigen ihn als unbeugsamen Ermittler, der gegen die Mafia, gegen CIA-Folter und NSA-Überwachung, und zuletzt im Wahlkampf 2016 gegen Hillary Clintons Umgang mit dienstlichen Emails und Donald Trumps Russland-Verbindungen vorgegangen ist. Der Weg des New Yorker Vorzeigejuristen gleicht einer politischen Achterbahnfahrt: stellvertretender Justizminister unter George W. Bush, zum FBI-Direktor ernannt von Barack Obama und gefeuert von Donald Trump wegen angeblicher Illoyalität. Sein Buch ist ein eindrückliches Lehrstück über den aufrechten Gang in einer verantwortungslosen Regierung.
Inhaltsübersicht
Widmung
Vorwort zur Taschenbuchausgabe
Nachbemerkung aus aktuellem Anlass
Vorbemerkung
Einführung
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
Epilog
Dank
Meinen vormaligen Kollegen,
den Beamten des Justizministeriums und des FBI,
deren immerwährender Einsatz für die Wahrheit
die Größe unseres Landes ausmacht.
Vorwort zur Taschenbuchausgabe
Seit der Veröffentlichung der Hardcover-Ausgabe von »Größer als das Amt« bin ich häufig auf Reisen und spreche über Führungsethik. Fast überall höre ich die Frage: »Kommen wir da heil raus?« Die Formulierungen sind verschieden, aber gemeint ist immer dasselbe: Kann Amerika, wie wir es kennen, diejenigen, die es derzeit anführen, und den Treibsand, auf dem sie stehen, überhaupt überleben? Das wollen die Leute wissen, dringlich und mit banger Stimme, denn noch immer lodert der Flächenbrand der Trump-Präsidentschaft, den ich im Buch beschrieben habe, und ist eine Bedrohung für Amerikas Wertesystem, insbesondere für unser Bemühen um Wahrheit und Rechtsstaatlichkeit. Natürlich lässt sich schwer vorhersagen, wie viel Schaden ein zutiefst unethischer Präsident noch anzurichten vermag, aber eines lässt sich schon jetzt absehen: Aus der Asche des Flächenbrandes entsteht auch Gutes. Ich kann es sehen und spüren, und deshalb kann ich ohne zu zögern antworten: Ja, wir kommen da heil raus. Es könnte sehr lange dauern, aber ich bin optimistisch.
Amerika ist ein Land, das es nach üblichen historischen Maßstäben gar nicht geben dürfte. Amerikaner haben keine gemeinsame Herkunft, Sprache, Religion oder Kultur. Wir haben nicht das eine Bindemittel, das normalerweise ein Kollektiv von Menschen aus aller Welt zur Nation formt. Wir sind vielmehr ein Experiment: Was uns seit zweieinhalb Jahrhunderten zusammenhält, ist ein System von Werten. Auf die schwören wir, und selbstverständlich werden wir ihnen nie ganz gerecht – wir haben zum Beispiel Menschen als Sklaven gehalten, obwohl die Präambel zu unserer Unabhängigkeitserklärung verkündet, dass die Gleichheit aller Menschen für uns eine »ausgemachte Wahrheit« ist –, dennoch sind unser Bindemittel die Werte. Sie gelten uns gemeinsam als ausgemacht. Und einer der wichtigsten und heiligsten Werte ist Wahrheit: Sie existiert, und sie muss gesucht und ausgesprochen werden. Sie ist Grundpfeiler und Richtschnur. Die Gründerväter haben unser Regierungs- und Rechtssystem dementsprechend angelegt, sie sahen die größtmöglichen Chancen zur Wahrheitsfindung darin, die verschiedenen menschlichen Interessen aufeinanderprallen zu lassen. Die gesamte Struktur beruht auf Eiden und Versprechungen, also auf der feierlichen Selbstverpflichtung, die Wahrheit zu sagen.
Wie gut wir vorankommen, zeigt uns die Geschichte der Vereinigten Staaten. Gewiss, in der Realität blieben wir immer hinter unseren Werten zurück. Aber unsere Geschichte als Ganzes ist ein kontinuierliches Vorankommen. Leider steigt der andauernde Fortschritt nicht geradlinig aufwärts. Genau besehen ist er eine Kurve mit Zacken. Mal gibt es Fortschritte, mal Rückfälle, dann wieder Fortschritte.
Nehmen wir zum Beispiel die 1960er-Jahre, turbulente Zeiten mit gewaltigen Veränderungen – für Afroamerikaner und ihre Bürger- und Wahlrechte; für Frauen und die Gleichstellung in Familie, Bildung und Beruf; für junge Menschen jedweder Herkunft, die endlich auch gehört werden wollten. Die Reaktion darauf war, dass Richard Nixon mit seinem Versprechen, für Ordnung zu sorgen und die Abgehängten zu beschützen, zum Präsidenten gewählt wurde. Dann kam durch Watergate sein eklatanter Machtmissbrauch ans Licht, und danach ging die Kurve wieder steil nach oben. Bei uns sind die Aufwärtsentwicklungen immer größer als die Rückschläge, deshalb zeigt die gesamte Kurve seit 1776 nach oben. Aber eben mit Zacken. So ist Amerikas Geschichte.
In den letzten Jahren hat sich unser Land dramatisch verändert. Wir haben einen schwarzen Mann für zwei Amtsperioden zum Präsidenten gewählt, und 2016 hat eine Frau die meisten Wählerstimmen bekommen. Wir haben die Schwulenehe legalisiert, pflegen heutzutage einen markant anderen Umgang mit Arbeit, mit Technik, mit Religion, mit Familie, und es zeichnet sich langsam ab, dass die weiße Mehrheit in Amerika zur Minderheit werden wird. Aber wir haben aus der Vergangenheit auch gelernt, dass ab einem bestimmten Grad an Fortschritt und Wandel ein krampfartiger negativer Schub erfolgt, ein Backlash. Unsere Kurve hat eben Zacken.
Auf die natürlichen Rhythmen der Menschheitsgeschichte haben wir keinen absoluten Einfluss. Wir können aber sehr wohl steuern, wie lange es dauert, bis die Kurve wieder nach oben zeigt. Denn der Wahnsinn kommt zum Stillstand, wo immer anständige Amerikaner zur Verteidigung unseres Fortschritts und unserer Werte aufstehen und andere Menschen damit anstecken. Auch dieses Muster wiederholt sich, und das ist die Quelle meines Optimismus.
Ich will damit, um das klar zu sagen, die Bedrohung nicht kleinreden. Die Präsidentschaft von Donald Trump ist ein andauernder Frontalangriff auf die Wahrheit – auf den inneren Sinn des Begriffs »Wahrheit«. Sie ging schon gleich mit der Lüge los, bei seiner Amtseinführung seien mehr Zuschauer gewesen als bei Barack Obama. Seitdem haben wir derart viele Lügen gehört, dass wir aufpassen müssen, nicht taub dafür zu werden. Denn Taubheit gegenüber diesem Trommelfeuer aus falschen Behauptungen ist gefährlich – die Lügenflut könnte die Richtschnur, an der wir unsere Führungspersönlichkeiten stets gemessen haben, zerreißen, den Grundpfeiler namens Wahrheit unterspülen und abtragen wie eine Sandburg am Strand.
Aber ich kann etwas spüren bei meinen Reisen. }Wenn man sich die ideologische Einstellung der Amerikaner als Gauß’sche Glockenkurve vorstellt, dann liegen unsere Kernwerte sicher aufgehoben in der Mitte, in der riesigen Menge fleißiger, zumeist nicht sehr engagierter und mit anderen Dingen beschäftigter Leute. Sie sind Mitte-rechts- wie Mitte-links-Wähler und Nichtwähler, sie stellen bei Weitem die Mehrheit dieses Landes, in dem alles Gerede und Geschrei normalerweise ausschließlich auf Linksaußen- und Rechtsaußen-Flügeln betrieben wird. Aber immer mal wieder in unserer Geschichte fängt der Riese in der Mitte doch an sich zu regen. Watergate, zum Beispiel, hatte ihn aufgescheucht, ein Präsident trat zurück. 1963, ein Jahrzehnt zuvor, war es der Mord an den kleinen Sonntagsschülerinnen in der Sixteenth Street Baptist Church in Birmingham gewesen, daraufhin wurden Bürger- und Wahlrechtsgesetze verabschiedet, die unser Leben verändert haben.
Jetzt spüre ich wieder, wie sich der Riese regt. Er wacht wieder auf, langsam, aber sicher. Fackeln und Tod in Charlottesville. Kinder in Käfigen an der Grenze zu Mexiko. Lügerei, Misogynie, Rassismus, Angriffe auf den Rechtsstaat. All das reizt den Riesen. Es braucht eine Zeit, aber die Leute in Amerika regen sich. Das tun sie immer. Und wenn sie erst mal wach sind, kommt der Wahnsinn rasch an sein Ende. Es gab immer wieder Phasen, in denen das amerikanische Leben von Demagogen beherrscht wurde – manchmal über Jahre –, aber sie verschwinden auch wieder, sehr schnell, fast über Nacht, sobald wir aufwachen und uns wieder auf unsere Werte berufen.
Millionen Amerikaner haben die Bedrohung erkannt, und sie reagieren. Medien arbeiten an der Aufdeckung der Wahrheit und der Lügen. Die Antwort darauf ist ein Dauerstrom von Attacken aus dem Weißen Haus, der nur dazu da ist, die Glaubwürdigkeit der Medien zu zerstören, und damit die Idee, dass es die Wahrheit gibt und dass man sie wissen kann. Trotzdem machen Journalisten weiter. Sie bleiben dran, nicht zuletzt weil auch viele Leute in Amerika dranbleiben. Die Amerikaner stellen sich eben nicht taub und ziehen sich zurück oder lassen sich zu Handlungen provozieren, mit denen sie ihre Werte verraten würden, sondern sie treten vor. Eine überwältigende Mehrheit steht hinter der Arbeit eines Sonderermittlers, der das Gebaren des Präsidenten und seiner Mitarbeiter aufklären soll. An den Midterm-Wahlen von 2018 haben mehr Menschen als je zuvor an vergleichbaren Wahlen teilgenommen. Das Wahlvolk hat die Oppositionspartei mit der Mehrheit im Repräsentantenhauses betraut, damit die von den Gründervätern eingerichtete Balance – das Aufeinanderprallen von Interessen im Interesse der Wahrheit – wieder funktionieren und unsere Werte schützen kann.
Die Arbeit ist noch nicht getan. Offen über die Kernwerte unserer Nation diskutieren und die Wahrheit verteidigen, das sollten alle Amerikaner. Dafür war mein Buch gedacht, es sollte uns allen deutlich machen, was wir brauchen und verdienen: Eine ethisch geerdete Führungskultur, die Entscheidungen nicht aufgrund engstirniger Eigeninteressen, sondern anhand von Langzeitwerten trifft. Wer in Führungspositionen sitzt, muss selbst der Wahrheit verpflichtet sein. Ich bin zutiefst dankbar, dass so viele Menschen mein Buch nützlich finden. Die Taschenbuchausgabe soll es noch zugänglicher und nützlicher machen, vor allem für junge Menschen. Wie sie sich im öffentlichen Leben engagieren, ist ein Quell der Ermutigung und das Versprechen, dass die Entwicklung in Amerika aufwärtsgeht, aufwärts in eine gute Zukunft. Dank ihnen – und dank den vielen, vielen anderen, denen Führungsethik am Herzen liegt – werden wir da heil rauskommen.
JC
Virginia, 2019
Nachbemerkung aus aktuellem Anlass
Die Methode Trump: Wie der Präsident selbst hohe Politiker vereinnahmt
Ich werde oft mit der schwierigen Frage konfrontiert, was eigentlich mit politischen Schwergewichten in der Trump-Regierung passiert ist, insbesondere dem Justizminister William Barr, für den ich zunächst die Unschuldsvermutung reklamiert hatte.
Wieso eifert ein gestandener brillanter Jurist wie Barr neuerdings dem Präsidenten nach und hantiert auch mit Begriffen wie »no collusion« und FBI-»Spioniererei«? Wieso bagatellisiert auch er Trumps Versuche, die Justiz zu behindern, mit der Erklärung, der Präsident sei »frustriert und wütend« gewesen und das sei einfach die Folge davon? Er würde keine der zigtausend Tag für Tag juristisch verfolgten Straftaten je als bloßen Ausfluss von Frustration und Wut rechtfertigen.
Wie kommt es, dass Barr mündlich und schriftlich Dinge über den Bericht des Sonderermittlers Mueller behauptet hat, die offensichtlich so irreführend waren, dass der Sonderermittler persönlich ein Protestschreiben verfasste?
Wieso hat Barr sogar vor dem Justizausschuss des Senats noch heruntergespielt, dass Präsident Trump versucht hatte, Mueller zu feuern, bevor er seinen Bericht abschließen konnte?
Wie kommt der stellvertretende Justizminister Rod Rosenstein dazu – und zwar nach dem Erscheinen des Mueller-Reports, der detailliert aufführt, wie energisch Trumps die Justiz zu behindern versucht hatte –, eine Rede ausgerechnet mit einem Zitat von Trump über die Bedeutung des Rechtsstaats zu schmücken? Und wieso dankt er einem Präsidenten, der ihn persönlich und das Justizministerium unter seiner Leitung ununterbrochen attackiert hatte, für »die Höflichkeit und den Humor, die Sie bei unseren persönlichen Gesprächen oft gezeigt haben«?
Was ist denn bloß los mit diesen Leuten?
Ich weiß das auch nicht mit Sicherheit. Menschen sind kompliziert, also ist es wahrscheinlich auch die Antwort auf die Frage. Ich kann aber ein paar Beobachtungen aus den vier Monaten beisteuern, in denen ich in Trumps Nähe gearbeitet habe, und aus den vielen weiteren, in denen ich mitangesehen habe, wie er andere formt.
Amoralische Führungsfiguren haben das Talent, den wahren Charakter der Menschen in ihrer Umgebung freizulegen. Manchmal kommt dann etwas Inspirierendes ans Licht. Der ehemalige Verteidigungsminister James Mattis, zum Beispiel, trat aus prinzipiellen Gründen zurück, und Prinzipien sind Trump derart fremd, dass es ein paar Tage dauerte, bis er mitbekam, was da gerade passiert war, und mit Lügen über Mattis loslegen konnte.
Öfter ist das, was jemand in der Nähe einer amoralischen Führungsfigur von sich enthüllt, jedoch deprimierend. Ich glaube, das lässt sich zumindest teilweise an William Barr und Rod Rosenstein beobachten. Auch sehr fähige Leute haben ohne innere Stärke all den Kompromissen nichts entgegenzusetzen, die man eingehen muss, um Trump zu überleben, und tun am Ende Dinge, von denen sie sich nie wieder erholen. Nur jemand mit der Charakterstärke eines James Mattis kommt da unbeschädigt heraus, denn Donald Trump frisst einem die Seele weg, und zwar häppchenweise.
So fängt es an: Sie sitzen schweigend dabei, während er, öffentlich und privat, Lügen erzählt, und damit hat er Sie zum Komplizen durch Schweigen gemacht. Bei Besprechungen überflutet er Sie mit Floskeln wie »so denken ja alle«, und das und das sei »ganz offenkundig wahr« – so lief es bei meinem Abendessen mit ihm am 27. Januar 2017 –, ungebremst, er ist schließlich der Präsident, und von selbst hört er kaum je auf zu reden. Am Ende hat er jeden Anwesenden in einen Schweigekreis des Einverständnisses gezogen.
Trump redet im Schnellfeuerstil, lässt niemandem eine Chance, sich ins Gespräch einzuschalten, und macht auf die Weise jeden zum Mitverschwörer seiner Lieblingsfakten beziehungsweise Wahnvorstellungen. Ich habe das genau mitbekommen – dieser Präsident spinnt emsig ein ganzes Netz alternativer Realität aus Worten und fängt alle im Raum damit ein.
Ich muss wohl zugestimmt haben, dass zu seiner Amtseinführung die größte Menschenmenge der Geschichte erschienen war, denn ich habe ja nicht widersprochen. Genauso kann jedermann nur zustimmen, dass man sehr unfair mit ihm umgegangen ist. So spinnt er sein Netz immer weiter. Aus dem Schweigekreis des Einverständnisses in kleiner Runde werden bald Vasallenschwüre in aller Öffentlichkeit, zum Beispiel bei Kabinettssitzungen. Die Welt schaut zu, wie Sie am Tisch sitzen und tun, was alle um Sie herum tun – Sie erzählen, wie toll dieser Präsident sei und welche Ehre es sei, mit ihm in Verbindung stehen zu dürfen.
Natürlich fällt Ihnen auf, dass James Mattis den Präsidenten niemals lobt, sondern stets betont, ihm sei es eine Ehre, unsere Soldaten und Soldatinnen zu vertreten. Aber Mattis ist ja auch ein Sonderfall, nicht? Früher mal General der Marines und so. Unsereinem würde man so was niemals durchgehen lassen. Also loben Sie mit, und die Welt schaut zu, und wieder ist das Netz ein bisschen enger geworden.
Als Nächstes geht Trump auf die Institutionen und die Werte los, die Ihnen lieb und teuer sind – lauter unbedingt zu schützende Dinge, das haben Sie immer gesagt, Sie haben sogar früher Politiker kritisiert, sich zu wenig dafür einzusetzen. Sie schweigen trotzdem. Schließlich, was sollten Sie denn schon sagen? Er ist der Präsident der Vereinigten Staaten.
Sie bekommen genau mit, wie all das passiert. Sie sind auch besorgt, ein bisschen jedenfalls. Aber dann sagt Ihnen gerade Trumps unverschämtes Gebaren, dass Sie einfach dabeibleiben müssen, zum Schutz des Volkes und der Institutionen und Werte, die Ihnen lieb und teuer sind. Und Sie reden sich ein, wie so viele republikanische Kongressmitglieder, Sie seien zu bedeutend, als dass Sie der Nation verloren gehen dürften, gerade jetzt.
Laut sagen dürfen Sie das nicht – vielleicht nicht einmal in Ihrer Familie –, aber in einer Zeit, in der der Ausnahmezustand herrscht und ein Mensch ohne jede ethische Bindung an der Spitze der Nation sitzt, ist das Ihr Beitrag, Ihr persönliches Opfer für Amerika. Sie sind schließlich klüger als Donald Trump, Ihr Einsatz für das Land ist langfristig angelegt, Sie ziehen das durch, Sie scheitern nicht wie schwächere Führungspersönlichkeiten oder werden per Tweet gefeuert.
Natürlich müssen Sie, um dabeizubleiben, als Teil des Trump-Teams wahrgenommen werden, also gehen Sie weitere Kompromisse ein. Sie sprechen wie Trump, Sie loben seine Führungsqualität, Sie preisen, wie sehr er sich für Werte engagiert.
Und bald sind Sie verloren. Er hat Ihre Seele gefressen.
Dieser Text erschien im englischen Original am 2. Mai 2019 unter dem Titel »How Trump Co-opts Leaders Like Bill Barr« in der New York Times. From The New York Times. © 2019 The New York Times Company. All rights reserved. Used under license.
https://www.nytimes.com
Vorbemerkung
Wer bin ich, dass ich mir einbilde, ich sollte anderen Menschen etwas über Führungsethik erzählen? Jeder, der glaubt, darüber ein Buch schreiben zu müssen, läuft Gefahr, als anmaßend, gar scheinheilig wahrgenommen zu werden. Erst recht, wenn er selbst zufällig gerade geräuschvoll aus seinem Amt gefeuert wurde.
Aufgeschriebene Lebensgeschichten werden fast automatisch als Übung in Eitelkeit beargwöhnt, ich weiß das und hatte genau deshalb immer wieder die Idee verworfen, so ein Buch zu schreiben. Aber es gibt einen wichtigen Grund dafür, dass ich meine Meinung geändert habe. Wir durchleben in unserem Land gerade eine gefährliche Zeit, mit einem politischen Klima, in dem Fakten angezweifelt, fundamentale Wahrheiten infrage gestellt, Lügen für normal erklärt und unethisches Verhalten ignoriert, entschuldigt oder sogar belohnt werden. Das passiert nicht nur in unserer Hauptstadt und auch nicht nur in den Vereinigten Staaten. Vielmehr handelt es sich um einen besorgniserregenden Trend, der in Amerika und weltweit die verschiedensten Institutionen erfasst hat – die Vorstandsetagen führender Unternehmen ebenso wie die Nachrichtenredaktionen und Universitäten, die Unterhaltungsindustrie, den Profisport und die Olympischen Spiele. Ein paar Betrüger, Lügner und Verbrecher haben ihre Quittung erhalten. Andere kommen noch immer mit Entschuldigungen und Rechtfertigungen davon und können darauf bauen, dass ihr Umfeld auch weiterhin wegschaut oder ihr schlechtes Benehmen sogar erst möglich macht.
Wenn es also je einen richtigen Zeitpunkt gab, in dem das Nachdenken über einen ethisch integren Führungsstil von Nutzen sein könnte, dann genau jetzt. Ich bin kein Experte für Führungsethik, aber ich habe schon während des Studiums viel darüber gelesen und gegrübelt und mich jahrzehntelang damit herumgeschlagen, was das in der Praxis bedeutet. Es gibt ja nicht die perfekte Führungspersönlichkeit, die uns das beibringen könnte, das heißt, es obliegt uns, denen ethisch geerdetes Handeln wichtig ist, das Thema immer wieder ins Gespräch zu bringen und uns selbst und jedermann in einer politischen Funktion anzuhalten, es besser zu machen.
Der Ethik verpflichtete Führungspersönlichkeiten entziehen sich nicht der Kritik und Selbstkritik und gehen nicht in Deckung vor unbequemen Fragen. Sie sind froh über beides. Jeder Mensch hat Schwächen, ich auch – sogar viele. Zu meinen gehört, wie Sie aus diesem Buch erfahren werden, dass ich dickköpfig sein kann und zu übertriebenem Stolz, zu viel Selbstsicherheit und einem zu großen Ego neige. Damit schlage ich mich schon mein ganzes Leben lang herum. Sehr, sehr oft, wenn ich auf Situationen zurückschaue, wünsche ich mir, ich hätte mich anders verhalten, und manche sind mir regelrecht peinlich. Das geht den meisten von uns so. Wichtig ist aber, etwas daraus zu lernen und es beim nächsten Mal hoffentlich besser zu machen.
Ich finde es nicht angenehm, kritisiert zu werden, aber ich weiß, dass ich mich irren kann, auch wenn ich mir meiner Meinung noch so sicher bin. Denen zuzuhören, die anderer Meinung sind, und sich Zeit für Kritik zu nehmen, ist unerlässlich, wenn man der verführerischen Kraft allzu großer Selbstgewissheit nicht erliegen will. Zweifeln ist Klugheit – das habe ich gelernt. Und je älter ich werde, desto weniger Gewissheiten habe ich. Wer in einer Führungsposition ist und glaubt, nie falschzuliegen, wer sein Urteil oder seinen Standpunkt nie infrage stellt, ist eine Gefahr für die Organisationen und die Menschen, die er führt. In manchen Fällen ist so jemand eine Gefahr für sein Land und die ganze Welt.
Der Ethik verpflichtete Führungspersönlichkeiten sind nach meiner Erfahrung Menschen, die über kurzfristige Ziele und dringliche Anforderungen hinausdenken und sich bei ihrem Handeln an bleibenden Werten orientieren. Die einen beziehen ihre Werte aus einer religiösen Tradition, andere aus einer moralischen Weltanschauung oder sogar aus einem Verständnis für Geschichte. Jedenfalls dienen Werte wie Wahrheit, Redlichkeit und Achtung für andere – um nur einige zu nennen – als äußere Bezugspunkte, nach denen man ethisch integre Entscheidungen trifft, vor allem die schweren, bei denen es keine einfachen oder guten Lösungen gibt. Solche Werte sind wichtiger als das, was Schwarmintelligenz oder Fraktionsdenken gerade vorgeben mögen. Sie sind wichtiger als die spontanen Ideen eines Bosses oder die Vorlieben seiner Untergebenen. Sie sind wichtiger als die Profitabilität und die Bilanzen einer Firma. Ethisch geerdeten Führungspersönlichkeiten ist die tiefe Treue zu fundamentalen Werten wichtiger als der eigene Vorteil.
Der Führungsethik geht es auch um ein Verständnis für Menschen und unser aller Bedürfnis nach Sinngebung. Sie will Arbeitszusammenhänge schaffen, an denen hohe Ansprüche und wenig Angst herrschen, eine Kultur, in der Menschen keine Scheu haben müssen, Wahrheiten offen auszusprechen, und die besten Leistungen herausholen, aus sich selbst und aus ihrer Umgebung.
Ohne ein grundsätzliches Bekenntnis zur Wahrheit – vor allem vonseiten unserer öffentlichen Institutionen und von denen, die sie leiten – sind wir verloren. Um einen juristischen Leitsatz zu formulieren: Unser Rechtssystem kann nur funktionieren, wenn sich Menschen der Wahrheit verpflichten; ohne das zerfällt jede auf Rechtsstaatlichkeit gründende Gesellschaft. Und einen führungsethischen Leitsatz: Jemand in einer Führungsposition, der nicht die Wahrheit sagt oder die Wahrheit nicht hören will, kann keine guten Entscheidungen treffen, er kann sich nicht weiterentwickeln, und er kann kein Vertrauen schaffen bei denjenigen, die ihm folgen.
Erfreulicherweise lassen sich Redlichkeit und die Bereitschaft, Wahrheiten offen auszusprechen, durchaus fördern und tragen ihrerseits bei zu einer Kultur der Ehrlichkeit, Offenheit und Transparenz. Ethisch integre Politiker prägen das kulturelle Klima mit allem, was sie sagen und, noch wichtiger, was sie tun, denn sie stehen unter ständiger Beobachtung. Unglücklicherweise prägen aber auch unehrliche Politiker eine Kultur, indem sie ihrem Wahlvolk Unehrlichkeit, Korruption und Täuschung vorleben. Der Unterschied zwischen einem ethisch geerdeten Politiker und solchen, die nur zufällig auf einer Führungsposition gelandet sind, besteht darin, dass der erstere sich einer tiefen Loyalität gegenüber der Wahrheit verpflichtet fühlt, die größer ist als das Amt. Der Unterschied ist unübersehbar.
Ich habe lange über einen Titel für dieses Buch nachgedacht. In gewissem Sinn ist A Higher Loyalty das Fazit eines seltsamen Abendessens im Weißen Haus, bei dem der neue Präsident der Vereinigten Staaten von mir verlangte, meine Loyalität gegenüber ihm – persönlich – über meine Pflichten als FBI-Direktor gegenüber dem amerikanischen Volk zu stellen. In einem anderen, tieferen Sinn spannt der Titel einen Bogen über vier Jahrzehnte meiner juristischen Tätigkeit als Strafverfolger, als Wirtschaftsjurist und während ich mit drei US-Präsidenten eng zusammenarbeitete. Auf all diesen Posten habe ich von den Menschen um mich herum eines gelernt und anderen weiterzugeben versucht, nämlich dass es in unser aller Leben eine Loyalität gibt, die größer ist als die Treue zu einer Person, einer Partei oder irgendeiner Gruppierung. Und das ist die tiefe Loyalität gegenüber höheren, bleibenden Werten, allen voran der Wahrheit. Ich hoffe, dass dieses Buch uns alle anregen kann über die Werte nachzudenken, die uns tragen, und nach der Art Führung zu streben, die diese Werte verkörpert.
Einführung
Des Menschen Sinn für Gerechtigkeit macht Demokratie möglich, seine Neigung zur Ungerechtigkeit aber macht Demokratie notwendig.
Reinhold Niebuhr
Zwischen der Zentrale des FBI (Federal Bureau of Investigation) und dem Capitol Hill liegen zehn Häuserblocks, die Strecke hat sich mir bei unzähligen Dienstfahrten die Pennsylvania Avenue hinauf und hinunter tief ins Gedächtnis gegraben. Die Fahrten waren zu einer Art Ritual geworden, vorbei an den Touristenschlangen vor dem Nationalarchiv mit Dokumenten zur Geschichte der Vereinigten Staaten und dem Newseum mit der Steinplatte, auf der der Erste Zusatzartikel zur Verfassung eingraviert ist, vorbei an T-Shirt-Ständen und Imbisswagen.
Jetzt, im Februar 2017, fuhr ich im Fond eines gepanzerten schwarzen Chevrolet Suburban des FBI. Die Mittelbank war entfernt worden, ich saß auf einem der beiden Plätze ganz hinten. Die Welt durch schusssichere kleine Seitenfenster vorbeiziehen zu sehen, war mir zur Gewohnheit geworden. Es ging wieder mal zu einer geheimen Anhörung im Kongress über eine mögliche russische Einflussnahme auf die Wahlen 2016.
Ein Auftritt im Kongress war schon an normalen Tagen schwierig und meistens eher deprimierend. Fast jeder Abgeordnete schien fest auf einer der beiden Seiten zu stehen und nur zuzuhören, um irgendein Goldkörnchen zu finden, das in die jeweils gewünschte Richtung passte. Sie stritten gegeneinander, indem sie durch mich hindurchredeten: »Herr Direktor, wenn jemand das und das behaupten würde, wäre der nicht ein Idiot?« Auch die Gegenposition wurde über mich bezogen: »Herr Direktor, wenn jemand sagen würde, dass jemand, der das und das behauptet, ein Idiot ist, wäre dann derjenige nicht der eigentliche Idiot?«
Stand jene Wahl vor ein paar Wochen auf der Agenda, die allen als die bis dato umstrittenste galt, war der Diskussionsstil unmittelbar danach noch übler; kaum jemand war willens oder imstande, seine jeweiligen politischen Interessen beiseitezuschieben und sich auf die Wahrheit zu konzentrieren. Die Republikaner wollten immer nur bestätigt bekommen, dass Donald Trump nicht von den Russen gewählt worden war. Die Demokraten, noch schwer angeschlagen vom Wahlergebnis, wollten das Gegenteil hören. Gemeinsame Nenner waren Mangelware. Das Ganze hatte etwas von einer Familie, die höchstrichterlich zum gemeinsamen Thanksgiving-Essen verdonnert worden ist.
Das FBI klemmte mitten im Parteiengezänk, auch ich als sein Direktor. Das war eigentlich nichts Neues. Wir waren schon im Juli 2015 in den Wahlkampf hineingezogen worden, als unsere gestandenen FBI-Profis strafrechtliche Ermittlungen zu Hillary Clintons Umgang mit geheimen Informationen über ihr privates E-Mail-Konto eingeleitet hatten. Damals konnten schon die bloßen Wörter »strafrechtlich« und »Ermittlungen« sinnlose Kontroversen auslösen. Ein Jahr später, im Juli 2016, nahmen wir die Ermittlungen zu der Frage auf, ob es massive russische Wahlbeeinflussung gegeben hatte, um Clinton zu beschädigen und Donald Trump ins Amt zu verhelfen.
Dies war für das FBI eine unglückliche, wenngleich unvermeidbare Situation. Eigentlich soll sich das FBI, das ja der Exekutive angehört, aus der Politik heraushalten. Sein Auftrag ist, die Wahrheit herauszufinden, und dafür darf es auf keiner anderen Seite als der des Landes stehen. Natürlich dürfen Mitarbeiter des FBI private politische Ansichten haben wie jeder andere auch, aber wer vor Gericht oder im Kongress aussagt, darf dort nicht als Republikaner oder Demokrat oder Angehöriger sonst irgendeiner Fraktion auftreten. Der Kongress hat, eigens um die Unabhängigkeit dieser Behörde zu untermauern, vor vierzig Jahren die zehnjährige Amtszeit für den FBI-Direktor eingeführt. In der Hauptstadt, überhaupt in einem vom Parteienstreit zerrissenen Land, wirkt eine derart selbstständige Behörde jedoch wie ein wesensfremder Störfaktor und wird ständig herausgefordert. Dadurch waren die Beamten in dauernder Anspannung, besonders, weil ihre Beweggründe ständig infrage gestellt wurden.
Mit mir im Dienstwagen saß Greg Brower, der zukünftige Leiter der Abteilung für Kongressangelegenheiten. Greg war dreiundfünfzig, blond-graumeliert, aus Nevada. Wir hatten ihn 2016 aus einer Anwaltskanzlei abgeworben. Davor war er Staatsanwalt und später in Nevada politisch tätig gewesen. Er kannte den Strafverfolgungsapparat ebenso wie das davon sehr unterschiedliche komplizierte politische Geschäft. Auf seinem neuen Posten hatte er das FBI im Haifischbecken des Kongresses zu vertreten.
Mit einem derart aufreibenden Durcheinander hatte Brower allerdings nicht gerechnet, und es war nach dem schockierenden Wahlausgang Ende 2016 sogar noch heftiger geworden. Da Greg noch nicht allzu lange beim FBI war, machte ich mir Sorgen, dass ihm der Irrsinn und Stress langsam an die Nieren gehen könnte. War er womöglich kurz davor, die Tür des Suburban aufzureißen und das Weite zu suchen? Auf solche Ideen würde ich wahrscheinlich kommen, wenn ich jünger wäre und nicht schon so oft am Zeugentisch des Kongresses gesessen hätte. Ich sah ihn an. Ganz offenbar dachte er dasselbe wie ich: »Wohin hat es mich denn hier verschlagen?«
Ich sah Brower an, wie besorgt er war, und brach das Schweigen.
»DAS IST DOCH DER GIPFEL!«, platzte ich heraus. Die Beamten vorn im Auto konnten es mit Sicherheit hören.
Greg Brower sah mich an.
»Wir stecken in der SCHEISSE«, sagte ich.
Er schien irritiert. Hatte der FBI-Direktor eben »Scheiße« gesagt?
Ja, tatsächlich.
»Wir stecken bis zum Hals in der Scheiße«, sagte ich noch einmal, lächelte ein bisschen zu breit und demonstrierte mit den Armen, bis wohin. »Wo wären Sie denn lieber?« Die Frage garnierte ich mit einem verunglückten Shakespeare-Zitat aus der St.-Crispins-Tag-Rede: »Die Leut’ in England, jetzt im Bett, ersehnen einst, sie wären hier gewesen.«
Er lachte, und seine Miene hellte sich auf. Meine ebenfalls. Ich war zwar sicher, dass ihm die Idee mit dem Sprung aus dem fahrenden Auto noch immer durch den Kopf ging, aber die Spannung war gelöst. Wir holten beide tief Luft. Einen Augenblick lang waren wir einfach zwei Männer in einem Auto irgendwohin. Alles würde gut.
Dann war der Augenblick vorbei, und wir fuhren zum Kapitol hinauf, um über Putin und Trump und mutmaßliche geheime Absprachen und Geheimdossiers und wer weiß was sonst noch zu sprechen. Es war einfach wieder so ein Augenblick unter absolutem Hochdruck in einer der verrücktesten, folgen-, ja sogar lehrreichsten Phasen meines Lebens – man könnte auch sagen: des ganzen Landes.
Und mehr als einmal ertappte ich mich bei dem Gedanken: Wohin hat es mich denn hier verschlagen?
1
The Life
Nicht ans Sterben denken heißt nicht ans Leben denken.
Jann Arden
Das Leben beginnt mit einer Lüge.
Diesen Satz hörte ich 1992, als Staatsanwalt in New York. Gesagt hat ihn ein Führungsmitglied eines der berüchtigtsten kriminellen Clans der Vereinigten Staaten, und gemeint war das, was sie The Life nennen.
Salvatore »Sammy the Bull« Gravano war der ranghöchste amerikanische Mafioso, der je Zeuge der Anklage wurde. Er hatte die Seiten gewechselt, weil er nicht lebenslänglich hinter Gitter gehen wollte und nachdem er auf Tonbändern aus den Ermittlungen gehört hatte, wie schlecht sein Boss John Gotti hinter seinem Rücken über ihn redete. Jetzt saß Gravano bei uns in Gewahrsam und führte mich in die Regeln des Mafialebens ein.
Wer als Mitglied bei der Cosa Nostra – noch einer ihrer Begriffe: »Unsere Sache« – aufgenommen werden wollte, musste vor dem Boss, dem Unterboss und dem Consigliere der »Familie« einen Schwur ablegen. Danach war er ein Made Man. Die Initiation erfolgte in einer geheimen Zeremonie, und die erste Frage lautete: »Weißt du, warum du hier bist?« Der Anwärter hatte mit Nein zu antworten. Dabei musste einer schon ein ziemlicher Idiot sein, wie Gravano erklärte, wenn er nicht wusste, warum er sich mitsamt lauter Familienoberhäuptern irgendwo in einem Nachtklubkeller befand.
Fast zwei Jahrzehnte lang hatte die amerikanische Mafia keine neuen Mitglieder mehr aufgenommen. 1957 hatten sich die Bosse darauf verständigt, »die Bücher zu schließen« – die Formulierung verrät, dass sogar echte Unterlagen über die Deck- und Klarnamen der Mitglieder zwischen den Mafiaclans hin und her gingen –, sie waren ernsthaft in Sorge, dass die Geschäfte nicht mehr gut liefen und sie von Informanten infiltriert würden. 1976 kamen sie überein, dass jeder Clan zehn neue Mitglieder aufnehmen durfte und dann die Bücher wieder geschlossen werden sollten. Neue Mitglieder waren nur als Ersatz für verstorbene erlaubt. Diese zehn Neulinge waren in jedem Clan die abgebrühtesten, weil jahrelang gestählten Star-Gangster. Gravano gehörte zu dieser »Spitzenklasse«, als er zur Mafia kam.
Natürlich bedeutete die Aufnahme von zehn neuen Mitgliedern nach so langer Pause zusätzliche Belastungen für die kriminellen Geschäfte. Üblicherweise wurde dem Anwärter beim Einweihungsritual ein Heiligenbildchen mit Blutstropfen von seinem »Abzugsfinger« – dem Zeigefinger – in die offenen Hände gelegt und angezündet. Er musste dazu sagen: »Möge meine Seele brennen wie dieser Heilige, wenn ich je die Cosa Nostra verrate.« Gravano erinnerte sich, dass er am dramatischen Höhepunkt der Zeremonie diese Worte nur über einem brennenden, blutbefleckten Stück Stoff sprechen konnte: Der Gambino-Clan hatte nicht genügend Heiligenbildchen besorgt.
Gravanos Aufnahmeritual begann nicht nur mit einer Lüge, es endete auch mit Lügen. Der Boss las ihm die Regeln der amerikanischen Cosa Nostra vor: »Wir töten nicht mit Sprengstoff, wir töten keine Polizisten, wir töten andere Made Men nur mit Erlaubnis von oben, wir schlafen nicht mit der Frau eines anderen Made Man, und wir handeln nicht mit Drogen.« Die beiden ersten Regeln wurden im Allgemeinen korrekt befolgt. Der Staat hätte jeden vernichtet, der mit Sprengkörpern Unschuldige verletzte oder Angehörige der Strafverfolgungsbehörden tötete. Der Rest des Gelöbnisses – andere Mafiosi nicht zu töten, nicht mit deren Frauen ins Bett zu gehen, nicht mit Drogen zu dealen – war glatt gelogen. Diese drei Regeln wurden von Gravano und seinen Mafiosi regelmäßig gebrochen. Es war, erklärte der mit mir zusammen ermittelnde Staatsanwalt Patrick Fitzgerald, wie beim Hockey: Schubsen und Blocken ist zwar theoretisch verboten, aber auf dem Feld üblich.
Die mit der amerikanischen eng verbundene sizilianische Mafia hatte noch eine Regel, und sie wirft ein Licht auf die fundamentale Funktion der Unehrlichkeit innerhalb der gesamten organisierten Kriminalität auf beiden Seiten des Atlantiks. Neu aufgenommenen Mitgliedern war es verboten, einen anderen Made Man – in Sizilien hieß er »Ehrenmann« – anzulügen, es sei denn, er sollte damit in den Tod gelockt werden. Ein schwerwiegendes »Es sei denn«. Ich habe einmal Francesco Marino Mannoia, einen sizilianischen Mafiakiller, der auch zum Zeugen geworden war, danach gefragt:
»Das heißt also, Franco, Sie können mir vertrauen, es sei denn, wir haben vor, Sie zu töten?«
»Ja«, meine Frage irritierte ihn, »Made Men dürfen nur über die wirklich wichtigen Sachen lügen.«
Leben im Lügengestrüpp. Ein Schweigekreis des Einverständnisses. Totale Kontrolle durch den Boss. Treueschwüre. Eine Weltanschauung nach dem Prinzip »Wir gegen die«. Kleine und große Lügen im Dienst eines verqueren Loyalitätskodex. Solche Regeln und Normen waren charakteristisch für die Mafia, aber ich sollte mich während meiner ganzen Laufbahn immer wieder wundern, wie oft sie auch anderswo galten.
Meine Anfangsjahre als Staatsanwalt, vor allem meine Rolle im Kampf gegen die Mafia, bestärkten mich in der Überzeugung, den richtigen Beruf gewählt zu haben. Die Juristerei war mir nicht in die Wiege gelegt worden. Aber letztlich entschloss ich mich zur juristischen Laufbahn, weil ich glaubte, dadurch anderen Menschen am besten helfen zu können, vor allem denen, die unter den Mächtigen zu leiden hatten, unter Verbrecherbossen und Tyrannen. Vielleicht war meine Entscheidung dafür unausweichlich, aber das war mir damals mit sechzehn nicht klar, als jemand mit der Pistole auf mich zielte. Eine Erfahrung, die mein Leben veränderte.
Der Mann mit der Pistole wusste nicht, dass ich an dem Abend zu Hause war. Er hatte durch ein Souterrainfenster beobachtet, wie sich meine Eltern von einer Gestalt verabschiedeten, die im flackernden Fernsehlicht auf dem Wohnzimmerboden lag. Vermutlich hatte er die Gestalt für meine Schwester Trish gehalten. Es war aber mein jüngerer Bruder Pete (Trish war nach den Herbstferien wieder ins College gefahren, und unser jüngster Bruder Chris war bei einem Pfadfindertreffen). Ein paar Minuten nachdem meine Eltern davongefahren waren, trat der Mann die Tür unseres bescheidenen Bungalows ein und ging geradewegs nach unten.
Der Tag, der mein Leben veränderte, war der 28. Oktober 1977, ein Freitag. Die meisten Menschen in New York und Umgebung erlebten die Monate davor als den Summer of Sam, in Angst vor einem Serienmörder, der in der Stadt und den Vororten Pärchen in Autos überfiel. Für die Menschen im nördlichen New Jersey dagegen war es der Sommer – und Herbst – des Ramsey Rapist. Der Täter wurde so genannt wegen eines Dutzends Vergewaltigungen, die im Städtchen Ramsey begonnen hatten. Unser verschlafenes Städtchen Allendale lag gleich südlich davon.
Pete hörte schwere Schritte auf der knarzenden Treppe und ein leises Knurren von unserem Hund, sprang hoch und ging in Deckung. Aber der Einbrecher wusste, dass er da war. Er hielt die Pistole in seine Richtung und herrschte ihn an, er solle aus dem Versteck kommen. Dann fragte er, ob noch jemand im Haus war. Nein, log Pete.
Ich war damals im vierten Highschool-Jahr und ein Nerd, ich hatte kaum Freunde. Wie zum Beweis war ich an diesem Freitagabend zu Hause, um einen Text für die Schülerzeitung zu Ende zu schreiben. Es sollte eine brillante Satire werden, über coole Kids, Mobbing und den erdrückenden Gruppenzwang in der Highschool. Der Text war überfällig und noch nicht gerade brillant, aber ich hatte an diesem Freitagabend nichts anderes vor. Also saß ich in meinem kleinen Zimmer am Schreibtisch und schrieb.
Unten im Keller zwang der Einbrecher Pete, ihm das Schlafzimmer zu zeigen. Kurz darauf hörte ich ihre Schritte, direkt vor meiner Tür gingen zwei Personen in Richtung des Elternschlafzimmers. Dann kamen andere Geräusche, der Wandschrank und die Kommode wurden auf- und zugemacht. Ärgerlich und neugierig stand ich auf und öffnete die Schiebetür zum Bad, das zwischen meinem Zimmer und dem meiner Eltern lag. Dort brannte helles Licht. Ich sah Pete auf einer Seite des Bettes liegen, mit dem Kopf in meine Richtung, aber fest geschlossenen Augen.
Ich ging hinein, sah nach rechts und versteinerte. Ein mittelalter, gedrungener Mann mit Strickmütze und einer Pistole in der Hand starrte in den Kleiderschrank. Dann dehnte sich die Zeit, auf eine Weise, wie ich es nie wieder erlebt habe. Zuerst sah ich gar nichts mehr, dann kam meine Sehkraft wieder, aber seltsam vernebelt, und mein ganzer Körper pulsierte, als wollte mir das Herz im Leibe zerspringen. Als der Mann mit der Pistole mich sah, lief er zu Pete, drückte ihm ein Knie in den Rücken und hielt dem Fünfzehnjährigen mit der linken Hand den Lauf seiner Waffe an den Kopf. Dann sah er mich an.
»Keine Bewegung, Kleiner, oder ich puste ihm das Hirn weg.«
Ich rührte mich nicht.
Der Pistolenmann fing an, Pete zu beschimpfen. »Hattest du nicht gesagt, hier ist sonst keiner im Haus?«
Dann ließ er von ihm ab und befahl mir, mich neben ihn aufs Bett zu legen. Er wollte wissen, wo Geld zu finden wäre. Ich erfuhr erst später, dass Pete die ganze Zeit Geld in der Hosentasche hatte und nicht hergab. Ich gab sofort alles her. Ich nannte jeden Fundort, der mir einfiel – Sparschweine, Portemonnaies, Münzen, die uns unsere Großeltern für Unternehmungen zugesteckt hatten, einfach alles. Mit meinen Informationen versehen, machte sich der Mann auf die Suche und ließ uns auf dem Bett liegen.
Kurze Zeit später war er wieder da, baute sich vor dem Bett auf und richtete seine Waffe auf uns. Ich weiß nicht, wie lange er auf uns zielte, ohne dass etwas zu hören war, aber der Moment war lang genug, um mich zu verändern. Ich war sicher, ich würde gleich sterben. Hoffnungslosigkeit, Panik und Angst schnürten mir die Luft ab. Ich fing an, stumm zu beten, in dem Bewusstsein, dass mein Leben gleich zu Ende sein würde. Im nächsten Moment wurde ich überschwemmt von einer seltsamen Kältewelle, und meine Angst war weg. Ich fing an, logisch zu denken, und überlegte, wenn er zuerst auf Pete schoss, würde ich eine Hechtrolle vom Bett machen und versuchen, ihm die Beine wegzureißen. Und dann redete ich los – genauer gesagt: Ich log los. Die Lügen sprudelten einfach heraus. Ich erzählte ihm, wir seien spinnefeind mit unseren Eltern, ja, wir hassten sie regelrecht, und es sei uns völlig egal, wenn er sie beklaute, wir würden niemandem sagen, dass er hier gewesen war. Ich log ihm die Hucke voll.
Der Pistolenmann befahl, ich solle den Mund halten, und wir sollten aufstehen. Dann schubste er uns über den engen Flur, hielt vor jedem der anderen Zimmer und durchwühlte alle Schränke. Inzwischen glaubte ich zumindest phasenweise an ein Überleben und sah ihm immer wieder direkt ins Gesicht, um ihn später der Polizei beschreiben zu können. Und immer wieder rammte er mir die Pistole in den Rücken und herrschte mich an, wegzugucken.
Wieder sprudelte ich los, beteuerte noch mal und noch mal, er könnte uns doch irgendwo einsperren, wir würden auch bestimmt da bleiben, und er könnte entkommen. Ich zerbrach mir den Kopf, wo im Haus ein passender Raum dafür war – einer, den man zuschließen konnte. Wider alle Vernunft schlug ich das Klo im Souterrain vor, das Fenster da sei klein und lasse sich nicht öffnen, weil mein Vater es winterfest gemacht habe. Das war nur die halbe Wahrheit: Er hatte den Rahmen mit Klarsichtfolie überklebt, damit es nicht so zog, aber es ging ganz einfach auf, man musste nur die untere Scheibe hochschieben.
Der Pistolenmann brachte uns nach unten, schubste uns ins Klo und sagte: »Ihr könnt Mommy und Daddy sagen, dass ihr artige kleine Jungs wart.« Dann verkeilte er die Tür von außen, damit wir nicht abhauen konnten.
Wir hörten die Garagentür auf- und wieder zugehen, als er sich davonmachte. Ich fing an zu schlottern, das Adrenalin ließ nach. Zitternd sah ich zu dem kleinen Fenster, und plötzlich tauchte sein Gesicht darin auf. Der Pistolenmann untersuchte das Fenster von außen. Ich schnappte nach Luft. Als das Gesicht wieder weg war, sagte ich zu Pete, wir sollten lieber hier abwarten, bis Mom und Dad wiederkamen. Pete sah das anders. »Du weißt doch, wer das ist. Der tut den nächsten Leuten was an. Wir müssen Hilfe holen.« Ich glaube, in meinem wackeligen Zustand war mir nicht wirklich klar, was Pete meinte oder wie der Abend hätte verlaufen können, wenn unsere neunzehnjährige Schwester Trish zu Hause gewesen wäre.
Ich war trotzdem dagegen. Ich hatte Angst. Pete stritt noch kurz mit mir, dann sagte er, er werde jetzt gehen. Er zog die Plastikfolie ab, drehte den halbmondförmigen Riegel und schob das Fenster auf. Dann schwang er sich mit den Füßen voran in den Garten. Wahrscheinlich waren es nur ein, zwei Sekunden, aber in meiner Erinnerung stand ich ewig lange vor dem offenen Fensterchen und der Dunkelheit dahinter und grübelte. Sollte ich hierbleiben oder Pete folgen? Dann schwang auch ich die Beine aus dem Fenster. Genau in dem Moment, als meine nackten Füße auf dem kalten Boden im Garten meiner Mutter auftrafen, hörte ich den Pistolenmann brüllen. Ich warf mich auf Hände und Knie und krabbelte wie wild ins dichte Gebüsch hinter unserem Haus. Er hatte Pete erwischt und schrie jetzt in meine Richtung: »Komm da raus, du Knirps, oder deinem Bruder passiert was.« Ich kroch hervor, und der Mann beschimpfte mich, weil ich ihn angelogen hatte. Mir fiel spontan eine andere Lüge ein: »Wir gehen sofort wieder rein«, sagte ich und wollte auf das Klofenster zugehen.
»Zu spät«, sagte er, »an den Zaun.«
Zum zweiten Mal an diesem Abend dachte ich, ich würde sterben. Bis ich hörte, dass Sundance in unseren Garten gesprungen kam, der riesige sibirische Husky unseres Nachbarn, mitsamt seinem Herrchen Steve Murray, unserem Deutschlehrer und Footballtrainer an der Highschool.
Die nächsten Sekunden sind wieder vernebelt in meiner Erinnerung. Ich weiß noch, dass Pete und ich von dem Pistolenmann weg und ins Haus rannten, dicht gefolgt von Coach Murray, und wie hinter uns die Tür zuknallte. Wir schlossen sie ab. Der Pistolenmann war noch draußen und versetzte jetzt Coach Murrays Frau und seine Mutter, die wegen des Tumults bei uns aus dem Haus gekommen waren, in Angst und Schrecken. Noch heute, Jahrzehnte später, quälen mich heftige Schuldgefühle deshalb.
Pete und ich rannten nach oben, machten überall das Licht aus und bewaffneten uns. Ich hatte ein langes Schlachtermesser. Damals gab es bei uns noch keine Polizei-Notrufnummer, also rief ich das Fernamt an und ließ mich mit der Polizei verbinden. Der Telefonist sagte immer wieder, ich solle mich beruhigen. Ich erklärte ihm, ich könne mich nicht beruhigen, ein Mann mit einer Pistole sei vor unserem Haus, der würde gleich wieder reinkommen, wir brauchten jetzt sofort Hilfe. Dann warteten wir im Dunkeln hinter der Haustür und diskutierten, ob wir den Pistolenmann selbst angreifen sollten. Endlich tauchte ein Polizeiwagen vor dem Haus auf. Wir blinkten mit der Außenbeleuchtung, und der Wagen hielt. Wir rissen die Haustür auf und rannten hin, ich barfuß, mit dem Schlachtermesser in der Hand. Der Polizist stieg sofort aus und griff nach seiner Waffe. Ich schrie: »Nein, nein!«, und zeigte auf das Nachbarhaus. »Da ist er. Er ist bewaffnet!« Der Einbrecher löste sich von der Haustür der Murrays und verschwand im nahe gelegenen Wald.
Dann kamen Polizeiwagen aus allen möglichen Bezirken in unsere kleine Straße gerast, und ich strampelte auf meinem Zehngang-Rad barfuß einen halben Kilometer bis zum Gemeindehaus, in dem meine Eltern gerade Tanzstunde hatten. Ich sprang vom Rad, ließ es einfach fallen, riss die Tür auf und schrie aus Leibeskräften: »Daddy!« Alle hörten auf zu tanzen und kamen auf mich zu, vorneweg meine Eltern. Als meine Mutter mein Gesicht sah, fing sie an zu weinen.
Der Ramsey Rapist wurde in jener Nacht nicht gefunden. Ein paar Tage später nahm die Polizei einen Verdächtigen fest. Er wurde nie angeklagt, sondern später wieder freigelassen. In jener Nacht aber hörten die Gewalttaten abrupt auf, es gab keine Raubüberfälle und sexuellen Angriffe des Ramsey Rapist mehr.
Meine Begegnung mit ihm trug mir jahrelange Qualen ein. Mindestens fünf Jahre lang musste ich jeden Abend an ihn denken – buchstäblich jeden –, und noch sehr viel länger schlief ich mit einem Messer in Griffweite. Damals konnte ich es noch nicht erkennen, aber auf ihre Art war diese schreckliche Erfahrung auch ein unglaubliches Geschenk. Ich hatte geglaubt – innerlich »gewusst« –, dass ich gleich sterben würde; nun hatte ich überlebt, und das ließ mich das Leben als kostbares, zartes Wunder empfinden. Schon in jungen Jahren, noch auf der Highschool, sah ich gern der Sonne beim Untergehen und den Bäumen beim Knospen zu und bekam ein Gefühl für die Schönheit unserer Welt. Das ist bis heute so, auch wenn dies für Menschen, denen solch eine elementare Bedrohung glücklicherweise erspart geblieben ist, kitschig klingen mag.
Durch den Ramsey Rapist habe ich auch sehr früh gelernt, dass vieles von dem, was wir für wertvoll halten, keinen Wert hat. Wenn ich vor jungen Leuten spreche, empfehle ich immer eine scheinbar abwegige kleine Übung. Ich sage ihnen: Schließt die Augen. Sitzt einfach da und stellt euch vor, ihr seid am Ende eures Lebens. Von dieser Warte aus zerstiebt die Wolke aus Gier nach Anerkennung und Reichtum. Häuser, Autos, Medaillen als Zimmerschmuck? Wen interessiert das? Ihr werdet gleich sterben. Was für ein Mensch möchtet ihr gewesen sein? Und ich erzähle ihnen von meiner Hoffnung, dass einige von ihnen dann gern ein Mensch gewesen sein möchten, der seine Fähigkeiten genutzt hat, um denen zu helfen, die sie brauchten – denen, die sich abstrampeln, die schwächer sind, verängstigt, die drangsaliert werden. Für etwas zu stehen. Etwas zu bewirken. Das ist wahrer Reichtum.
Ich bin nicht wegen des Ramsey Rapist Jurist geworden, jedenfalls nicht bewusst und nicht sofort. Damals wollte ich immer noch Arzt werden, ich studierte Chemie am William-and-Mary-College, zur Vorbereitung auf das Medizinstudium. Aber auf dem Weg zum Labor fiel mir eines Tages auf einem Anschlagbrett das Wort TOD ins Auge. Ich blieb stehen. Es ging um einen Kurs bei den Religionswissenschaftlern, die im selben Gebäude saßen wie wir Chemiker. Ich belegte den Kurs, und das änderte alles. Hier konnte ich mich intensiv mit einem für mich sehr wichtigen Thema beschäftigen und erfahren, wie die Religionen der Welt mit dem Tod umgingen. Ich nahm Religion als zweites Hauptfach dazu.
Bei den Religionswissenschaftlern lernte ich die Werke des Philosophen und Theologen Reinhold Niebuhr kennen, die mich tief berührten. Niebuhr sah das Böse in der Welt, er begriff, dass niemand seinen Nächsten lieben kann wie sich selbst, weil unsere menschliche Begrenztheit das verhindert, gleichzeitig aber beschrieb er bezwingend und einleuchtend, dass es gerade in einer unvollkommenen Welt unsere Pflicht ist, immer wieder nach Gerechtigkeit zu suchen. Natürlich hat Niebuhr nie Billy Currington gehört, den Country-Musiker, und die Songzeile: God is great, beer is good, and people are crazy. Aber sie hätte ihm gefallen, und vielleicht hätte er, auch wenn das nicht gerade ein hitverdächtiger Text ist, hinzugefügt: »Und trotzdem musst du versuchen, unsere fehlerhafte Welt wenigstens einigermaßen gerecht zu machen.« Und diese Gerechtigkeit, davon war Niebuhr überzeugt, ließ sich am besten mit den Instrumenten des staatlichen Gewaltmonopols erreichen. Ganz langsam dämmerte mir, dass ich doch nicht Arzt werden wollte. Juristen können viel direkter zur Suche nach Gerechtigkeit beitragen. Vielleicht, dachte ich, wäre das der beste Weg, um etwas zu bewirken.
2
Unsere Sache
Bleib nah dran an deinen Freunden, aber noch näher dran an deinen Feinden.
Al Pacino (als Michael Corleone), Der Pate, Teil II
Die Vereinigten Staaten sind in vierundneunzig Gerichtsbezirke aufgeteilt. Jedem dieser Bezirke steht ein US-Bundesanwalt (United States Attorney) vor, vom Präsidenten nominiert und vom Senat bestätigt. Die Gerichtsbezirke unterscheiden sich in ihrer Größe und ihrem Zuständigkeitsbereich sehr stark voneinander. Das Bezirksgericht New York Süd hat seinen Sitz in Manhattan und ist eine der größten und die angesehenste Justizbehörde der USA. Es ist berühmt für seine Tatkraft und sein unerschöpfliches Selbstvertrauen, wenn es darum geht, Ermittlungsverfahren einzuleiten. Ein seit Langem gegen diesen Gerichtsbezirk scherzhaft erhobener Vorwurf lautet, seine Anwälte würden ihre Zuständigkeit nur an der einen Frage festmachen: »Geschah es auf Erden?«
Ich trat 1987 in die Dienste des Gerichtsbezirks New York Süd in Manhattan. Es war mein Traumjob. Ich würde für einen Chef arbeiten, der auf dem besten Weg war, zur Legende zu werden – Rudy Giuliani.
Als ich 1985 mein Jurastudium an der Universität von Chicago abschloss, wusste ich noch nicht sicher, welche juristische Laufbahn ich anstreben wollte. Nach meinem zweiten Studienjahr hatte ich mich um eine Stelle als Assistent an einem Bundesgericht beworben – eine ein- oder zweijährige Lehrzeit als rechte Hand eines Bundesrichters. In meinem letzten Studienjahr bekam ich schließlich eine solche Stelle, bei einem neu berufenen Bundesrichter in Manhattan.
Dieser Richter, John M. Walker jun., ermunterte uns immer wieder, uns in den Gerichtssaal zu setzen, so könnten wir der einen oder anderen spannenden Verhandlung zusehen. Im Frühjahr 1986 startete die Bundesjustiz den Versuch, auf der Grundlage eines neuen Gesetzes einem Angeklagten die Freilassung gegen Kaution zu verweigern mit der Begründung, er sei eine Gefahr für das Gemeinwesen. Es handelte sich nicht um irgendeinen Angeklagten, sondern um Anthony »Fat Tony« Salerno, den Boss des Genovese-Clans, einer der fünf italienischen Mafiabanden in New York.
Fat Tony war eine Figur, die direkt aus einem Gangsterfilm hätte stammen können. Er war übergewichtig und hatte eine Glatze, er ging am Stock und hatte immer eine kalte Zigarre im Mundwinkel hängen, auch im Gerichtssaal. Seine Reibeisenstimme gebrauchte er vor Gericht immer wieder dazu, Aussagen seines Anwalts lautstarken Nachdruck zu verleihen. »Das is ne Schande, Euerehr’n«, schmetterte er in den Saal. Meinen fünfundzwanzigjährigen Augen kam sein Mitangeklagter Vincent »Fish« Cafaro mit seinem schmalen Gesicht und seinen dunklen Augen tatsächlich wie ein Fisch vor. Zum Beweis dafür, dass Salerno eine Gefahr für das Gemeinwesen darstelle und nicht auf Kaution freikommen dürfe, spielten die Bundesanwälte Tonbandaufnahmen vor, die das FBI mittels einer Wanze angefertigt hatte, angebracht unter einem Tisch im Lokal Palma Boys Social Club, einem Treffpunkt von Fat Tonys Leuten in einer italienischen Enklave in East Harlem. Man hörte auf den Aufnahmen, wie Salerno über von ihm angeordnete Prügelstrafen und Morde schwadronierte und dabei keinen Zweifel an seiner eigenen Rolle ließ: »Wer ich bin? Ich bin der Scheißboss.«
In dem Verfahren zeigte sich, dass in einem Mafiaclan der »Boss« die unanfechtbare oberste Instanz war. Wenn er vom Tod sprach, bedeutete das, dass jemand sterben würde. Die größte aller Sünden war es, den Clan zu verraten, eine »Ratte« zu werden. Treue war das heiligste Gebot der Mafia: Man verließ seinen Clan erst, wenn man die Welt der Lebenden verließ, sei es auf natürliche oder auf andere Weise. Nur Ratten verließen die Mafia lebend.
Ich saß wie hypnotisiert auf meinem Stuhl, während die zwei Anklagevertreter, beide Staatsanwälte, ihre Beweise gegen Fat Tony vorlegten. Sie hatten Tonbandmitschnitte und Zeugenaussagen, die belegten, dass Fat Tony und der Fisch einen Mafiaclan anführten, dass sie ihren Leuten befohlen hatten, »zuzuschlagen«, bestimmten Personen die Knochen zu brechen und Gewerkschafter einzuschüchtern. Die Verteidigung behauptete, die Angeklagten hätten nur »geprotzt«, doch die Ankläger konnten überzeugende Belege vorweisen, die diese lächerliche Schutzbehauptung ad absurdum führten.
Die beiden Staatsanwälte waren nur wenige Jahre älter als ich. Sie standen aufrecht, redeten deutlich und sprachen Klartext. Sie überzeichneten nichts, plusterten sich nicht auf. Sie machten den Eindruck, von nichts anderem beseelt zu sein als dem Wunsch, gegen Unrecht vorzugehen und die Wahrheit ans Licht zu bringen. Mich traf es wie ein Blitz. »Genau das will ich aus meinem Leben machen«, dachte ich. Ich würde in eine New Yorker Anwaltskanzlei eintreten und das zusätzliche Jahr Praxiserfahrung sammeln, das ich brauchte, um mich um das Amt eines Staatsanwalts bewerben zu können. Es sollte ein Jahr werden, das ich nie vergessen würde, vor allem dank einer Person.
Ich war nun ein junger Jurist bei einer Anwaltskanzlei in New York, die mir den großen Gefallen tat, mich für den größten Teil jenes Jahres nach Madison in Wisconsin zu schicken und mich an einem unglaublich komplizierten und langweiligen Versicherungsfall arbeiten zu lassen. Es war dennoch ein Glück, denn als sogenannter lokaler Rechtsbeistand arbeitete an dem Fall, der vor dem Gerichtshof des Staates Wisconsin verhandelt wurde, Richard L. Cates. Den damals einundsechzigjährigen Cates hatte man hinzugezogen, damit er den weltgewandten Großstadtjuristen, die das Verfahren durchziehen sollten, mit seiner Kenntnis der örtlichen Verhältnisse zur Hand ging. Ich lernte Dick Cates als einen freundlichen Menschen kennen, der durchsetzungsstark und selbstbewusst war. Ich sollte Jahrzehnte brauchen, bis mir klar wurde, dass diese Begriffspaare den Wesenskern guter Führung ausmachen. Dick war ein Mann mit sicherem Urteil, der mir auch durch sein leidenschaftliches Eintreten für Ausgewogenheit imponierte.
Dick starb 2011 nach einem glücklichen Leben, das in einem New Yorker Waisenhaus begonnen hatte und erfüllt war vom Streben nach seiner Freude an Arbeit und seinen Freunden und seiner Familie gewidmet war. Er heiratete die Liebe seines Lebens, hatte fünf Kinder, kehrte immer wieder in den öffentlichen Dienst zurück (darunter zweimal in die Marine, jeweils in Kriegszeiten) und wurde, um seinen Sohn zu zitieren, nie müde, »die Schwachen davor zu schützen, von den Starken kleingetreten zu werden«. Er zog mit seiner Familie auf eine Farm in der Nähe von Madison, damit aus seinen Kindern keine Weicheier würden, und fuhr viele Kilometer mit dem Fahrrad ins Büro. Er spielte unzählige Stunden mit seinen Kindern und später mit seinen vielen Enkeln.
Trotz aller Abgründe, in die er geblickt hatte, hatte Dick ein unerschöpfliches Interesse am Leben und an den Menschen und konnte über beides herzlich lachen. Wenn er die Aussage eines Zeugen aufnahm, hatte er normalerweise nichts vor sich liegen, nicht einmal einen Notizblock. Er leitete das Verhör ein, indem er dem Zeugen ein breites Lächeln schenkte und zu ihm sagte: »Erzählen Sie von sich.« Allein mit der Kraft seines Verstandes und seines Gedächtnisses vermochte er die Geschichte seines Gegenübers zu erfassen, wenn nötig, durch stundenlanges Nachfragen.
Ich glaube nicht, dass Dick Cates mir in dem Jahr, in dem wir zusammenarbeiteten, auch nur eine einzige ausdrückliche Lektion erteilt hat, jedenfalls kann ich mich an keine solche erinnern. Es genügte, dass ich als frischgebackener Jurist und demnächst Ehemann an seiner Seite arbeitete und ihn beobachtete. Ich erlebte mit, wie er auf Großspurigkeit ebenso mit Lachen reagierte wie auf Druck. Ich war dabei, wenn er Entscheidungen nach gesundem Menschenverstand traf, während eingeflogene Großstadtjuristen sich in den komplizierten Ausgeburten ihrer juristischen Arroganz verhedderten. Ich beobachtete, wie seine Augen bei der bloßen Erwähnung seiner Frau, seiner Kinder und seiner Enkel aufleuchteten; wie er Himmel und Erde in Bewegung setzte, um an ihren Familienfeiern, ihren Abendessen, ihren Unternehmungen teilnehmen zu können. Ich erlebte, wie egal es ihm war, dass er nur einen Bruchteil dessen verdiente, was die in den Fall eingebundenen Anwälte aus New York und Los Angeles bezahlt bekamen. Er war ein glücklicher Mensch.
»So wie er möchte ich auch einmal werden«, dachte ich mir. Mein Versuch, das Leben eines anderen zu kopieren, ist nicht durchgängig gelungen, aber was ich von Dick gelernt habe, war unbezahlbar: was es bedeutet, aufrecht durchs Leben zu gehen. »Ich bin so froh, dass ich in eine große Anwaltskanzlei eingetreten bin«, ist ein Satz, den man nicht oft zu hören bekommt, aber in meinem Fall trifft er zu.
Als Staatsanwalt ist man ein Beamter fern von der Politik, der in seinem Gerichtsbezirk die Vereinigten Staaten in strafrechtlichen oder zivilrechtlichen Verfahren vertritt. Ich landete in der Strafkammer. Meine Aufgabe bestand darin, Vollzugsbeamte des Bundes – vom FBI, von der Drogenvollzugsbehörde DEA (Drug Enforcement Administration), vom Amt für Alkohol, Tabak, Schusswaffen und Sprengstoffe ATF (Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives), vom Secret Service oder von der US-Postbehörde – bei der Aufklärung von unter Bundesrecht fallenden Verbrechen zu unterstützen und gegebenenfalls Anklage zu erheben und die Fälle vor Gericht zu bringen. In den folgenden sechs Jahren bearbeitete ich als Ermittler und Anklagevertreter Fälle aller Art, von Postdiebstählen über Drogenhandel und Banküberfälle bis hin zu verwickelten Fällen von Betrug, Waffenexport, Schutzgelderpressung und Mord. In meinem ersten Verfahren ging es um die versuchte Ermordung von Bundesbeamten des ATF durch Mitglieder einer Drogenbande während der Vollstreckung eines Durchsuchungsbefehls. Die Dealer hatten die Beamten von einer Feuertreppe aus unter Beschuss genommen, als diese versuchten, in eine Drogenfestung einzudringen.
Im Zuge eines Versuchs, eine wankelmütige Zeugin zur Aussage gegen die Drogenbande zu bewegen, fuhr der ermittelnde Beamte mit mir zu einem Apartmentgebäude im nördlichen Manhattan – einem von Drogenbanden beherrschten Terrain. Wenn die Zeugin, so meinte er, Vertrauen zu dem Staatsanwalt fasste, der sie vor Gericht befragen würde, könnte dies sie zu einer Aussage bewegen. Wir erklommen im Treppenhaus die sechs Stockwerke zur Wohnung der Frau, und der Ermittlungsbeamte klopfte an die Tür. Sie öffnete und ließ uns in ihre kleine Wohnung ein. Sie führte uns durch das vordere Zimmer, in dem ein Mann im Alter zwischen zwanzig und dreißig mit dem Rücken zur Wand auf einem Hocker saß. Er rührte sich nicht und sagte kein Wort, starrte uns aber durchdringend an. In einem hinten gelegenen Zimmer führten wir ein ruhiges und ungestörtes Gespräch mit der Frau. Ich versuchte alles, um sie zu überzeugen, doch sie ließ sich nicht zur Zusammenarbeit bewegen. Als wir die Wohnung verließen, saß der Mann noch immer bewegungslos auf dem Hocker und starrte uns an. Als der Beamte und ich das Gebäude verließen und über den Gehweg zu seinem Wagen gingen, äußerte ich die Vermutung, der junge Mann auf dem Hocker, der auf mich ziemlich bedrohlich gewirkt hatte, habe vermutlich eine Waffe im Hosenbund stecken gehabt.
»Gut, dass der Kerl wusste, dass wir bewaffnet waren, sonst hätte er vielleicht etwas angestellt«, sagte ich. Staatsanwälte trugen keine Feuerwaffen. Das war Sache der Ermittlungsbeamten.
Der Beamte drehte sich ruckartig zu mir um. »Sie hatten eine Pistole dabei? Ich habe meine nämlich unter dem Fahrersitz vergessen.« Er langte ins Auto und holte seine Waffe hervor.
Meiner Frau erzählte ich erst viel später von dieser kleinen Exkursion.
Die Arbeit in der Behörde von Rudy Giuliani stand im Zeichen einer ungeschriebenen Grundregel, wie es sie vermutlich in den meisten Organisationen gibt. In diesem Fall besagte die Regel, dass Rudy der Star an der Spitze des Apparats war und die Erfolge der Behörde grundsätzlich ihm ans Revers geheftet wurden. Wer gegen diese Regel verstieß, tat es auf eigene Gefahr. Giuliani war ein Mann mit übergroßem Selbstbewusstsein, und ich als junger Strafverfolger fand sein großspuriges Auftreten aufregend – nicht zuletzt deswegen hatte ich mich von seiner Behörde angezogen gefühlt. Ich fand es toll, dass mein oberster Chef auf den Titelseiten von Zeitschriften zu sehen war, wie er mit in die Hüfte gestemmten Armen auf der Freitreppe des Gerichtsgebäudes stand, als wäre er der Herrscher der Welt. Das stachelte mich an.
Als einfacher Strafverfolger begegnete man dem Boss fast nie persönlich; umso größer war mein Herzklopfen, als er, nicht lange nachdem ich mein Amt angetreten hatte, in mein Büro hereinschaute. Kurz zuvor hatte man mich mit Ermittlungen betraut, die eine bekannte New Yorker Persönlichkeit betrafen, die sich in der Öffentlichkeit gerne in Hochglanz-Jogginganzügen zeigte und eine Medaille in Nobelpreisgröße um den Hals trug. Der Staat New York ermittelte gegen Al Sharpton wegen der mutmaßlichen Veruntreuung von Geldern aus den Kassen seines Wohltätigkeitsvereins, und mein Auftrag lautete, zu überprüfen, ob der Fall Bundesrecht berührte. Ich hatte Rudy Giuliani nie auch nur auf meinem Stockwerk zu Gesicht bekommen, und jetzt stand er in der Tür meines Büros. Er wollte mich wissen lassen, dass er persönlichen Anteil an dem Ermittlungsverfahren nahm und sicher war, dass ich das gut machen würde. Mir schlug das Herz vor Aufregung und Euphorie, als er mich von der Tür aus so anfeuerte. Er gab mir zu verstehen, dass er auf mich zählte. Schon halb im Gehen, wandte er sich noch einmal um. »Ach ja, und ich will die verdammte Medaille«, sagte er und zog von dannen. Es kam freilich nie zu bundesrechtlichen Ermittlungen gegen Sharpton; die Behörden des Staates New York erhoben Anklage gegen ihn, doch der Prozess endete mit einem Freispruch. Die Medaille blieb bei ihrem Träger.