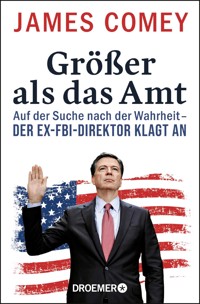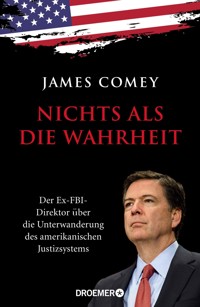
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Der amerikanische Rechtsstaat ist nach Ende der Ära Donald Trump am Abgrund. Zum Beginn der Amtszeit von Präsident Joe Biden zeigt der Ex-FBI-Direktor James Comey, wie eine gerechte Justiz funktionieren muss. Egal, ob der Gegner die Mafia, Drogendealer oder die Führungszirkel im Staatsapparat sind: Nur die Wahrheit kann jetzt die USA noch retten. »Der Sturm auf das Kapitol ist unser Tschernobyl-Moment.« - James Comey »Es ist Zeit, dass Amerika einen gefallenen und korrupten Präsidenten hinter sich lässt und mit dem Wiederaufbau beginnt. Es gibt viel zu tun, aber das Rezept ist einfach: Sagt dem amerikanischen Volk die Wahrheit, und nichts als die Wahrheit.« - James Comey - - Beeindruckende Fälle aus der Laufbahn des großen Juristen und Kriminalisten James Comey - - New York City, Langley und Washington D.C. - der Staatsanwalt und FBI-Direktor auf der Suche nach der Wahrheit - - James Comey ist Trump-Kritiker #1 und zeigt, wie ein zerrissenes Land unter Joe Biden seine Wunden heilen kann »Als ehemaliger Staatsanwalt weiß ich, dass Opfer von Betrügern oft die Letzten sind, die den Betrug realisieren wollen. Ich hatte Fälle, wo die Opfer sich noch vor Gericht für den Täter verwandt haben, weil dessen Lügen Teil ihrer Identität geworden waren und sie das nicht zugeben konnten. Unsere Langzeit-Aufgabe wird es sein, die Menschen, die Trumps Lügen verfallen sind, wieder zurück in die Realität zu holen.« - James Comey Die Rechtsstaatlichkeit ist das Fundament der Demokratie, sie schützt ihre Bürger. Doch nach vier Jahren Trump hat dieses Fundament tiefe Risse - der Rechtsstaat steht auf dem Spiel. James Comey, Ex-Direktor des FBI und einer der bekanntesten Kritiker des US-Präsidenten Donald Trump, ist überzeugt: Nur der unbedingte Wille zur Wahrheit und Transparenz kann das Land nach den Trump-Jahren noch retten. So zeigt James Comey anhand seiner spektakulärsten Fälle als Staatsanwalt und FBI-Chef ganz konkret, wie Ermittlungsbehörden, Strafverteidiger, Richter und Jurys in den USA gemeinsam für Gerechtigkeit kämpfen. Zugleich legt er offen, wie die Trump-Administration dieses Justiz-System angreift und die Wahrheit bekämpft - mit undurchsichtigen Manövern, alternativen Fakten und Hinterzimmer-Deals. Comeys Buch ist nicht nur eine mitreißende Darstellung von Kriminalfällen, sondern ein leidenschaftlicher Appell gegen die Rechtsbeugung und die Unterwanderung der Justiz: das Vertrauen in das Recht muss nach Trump wieder zum Fixstern allen staatlichen Handelns werden. »Dieses Buch ist der Versuch, uns daran zu erinnern, wie unsere Justiz funktionieren sollte und wie sich die führenden Köpfe verhalten müssen.« - James Comey
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 353
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
James Comey
NICHTS ALS DIE WAHRHEIT
Der Ex-FBI-Direktor über die Unterwanderung des amerikanischen Justizsystems
Aus dem amerikanischen Englisch von Pieke Biermann, Elisabeth Liebl, Karl Heinz Siber, Karsten Singelmann, Hella Reese, Christiane Bernhardt, Gisela Fichtl, Stephan Kleiner und Monika Köpfer
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Die Rechtsstaatlichkeit ist das Fundament der Demokratie, sie schützt ihre Bürger. Doch nach vier Jahren Trump hat dieses Fundament tiefe Risse – der Rechtsstaat steht auf dem Spiel. James Comey, Ex-Direktor des FBI und einer der bekanntesten Kritiker des US-Präsidenten, ist überzeugt: Nur der unbedingte Wille zur Wahrheit und Transparenz kann das Land noch retten. So zeigt er anhand seiner spektakulärsten Fälle als Staatsanwalt und FBI-Chef ganz konkret, wie Ermittlungsbehörden, Strafverteidiger, Richter und Jurys in den USA gemeinsam für Gerechtigkeit kämpfen. Zugleich legt er offen, wie die Trump-Administration dieses Justizsystem angreift - mit undurchsichtigen Manövern, alternativen Fakten und Hinterzimmerdeals. Comeys Buch ist nicht nur eine mitreißende Darstellung von Kriminalfällen, sondern ein leidenschaftlicher Appell gegen die Rechtsbeugung und die Unterwanderung der Justiz: das Vertrauen in das Recht muss wieder zum Fixstern allen staatlichen Handelns werden.
Inhaltsübersicht
Einführung
Erster Teil
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
Zweiter Teil
9. Kapitel
10. Kapitel
Dritter Teil
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
Vierter Teil
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
Epilog
Dank
Einführung
Der US-Bundesanwalt ist nicht der Repräsentant einer Partei in einem Rechtsstreit, sondern der des Souveräns, und gleichermaßen zwingend zu unparteiischem Handeln wie zum Handeln überhaupt verpflichtet.
United States Supreme Court, 1935
Wir haben ein paar der schönsten Huren der Welt‹, hat Putin zu mir gesagt.« Donald Trump saß wie eingerahmt zwischen Bill Clintons goldenen Oval-Office-Vorhängen, mit Hintergrundbeleuchtung durch das schwindende Licht eines späten Februarnachmittags. Er war erst seit siebzehn Tagen im Amt und noch nicht fertig mit dem Umdekorieren, aber weil er Gold liebte und Obama hasste, hatte sein Stab vermutlich beschlossen, dass es die alten Clinton-Vorhänge auch erstmal taten. Sie hingen jetzt zu beiden Seiten seines grellgoldenen Kopfs, und er erzählte mir von Putins Ansichten über russische Prostituierte.
Ich war Direktor des FBI, im vierten meiner vorgesehenen zehn Dienstjahre. Laut Amtsauftrag hatte ich das Land vor seinen Gegnern zu schützen, unter anderem vor einem aggressiven Russland, das aktiv mitgeholfen hatte, diesen Mann auf den Stuhl des Resolute Desk zu bringen, auf dem er jetzt mir gegenüber thronte und in Erinnerungen an eine schlüpfrige Unterhaltung mit dem russischen Machthaber schwelgte.
Zwei Wochen zuvor und nur ein paar Schritte entfernt hatte Donald Trumps Nationaler Sicherheitsberater FBI-Beamte über seine Gespräche mit den Russen belogen. Das Justizministerium war führungslos, nachdem meine Chefin, die geschäftsführende Justizministerin Sally Yates, von Trump gefeuert worden war, weil sie sich geweigert hatte, den von ihm per Dekret verfügten »Muslim Ban« umzusetzen, einen Einreisestopp für Muslime, der noch immer für Chaos auf den Flughäfen sorgte. Der neue Präsident hatte die ersten Angriffe auf die Intelligence Community, die Gemeinschaft der US-Nachrichtendienste, zu der das FBI gehörte, gestartet. Über kurz oder lang würde er sich den kompletten Justizapparat vornehmen, der versuchte, die Gründe für all die Lügerei und all die Verbindungen zwischen Trump und Russland herauszufinden. Aber das war erst der Anfang des Generalangriffs auf die Justiz und ihre Werte. Er sollte sich noch Jahre hinziehen und einer unentbehrlichen amerikanischen Institution gravierenden Schaden zufügen.
Seit seinen Anfängen hat Amerika Institutionen geschaffen und gepflegt, in denen es um die Wahrheitsfindung geht. Seit Jahrhunderten trägt Justitia auf allen Darstellungen eine Augenbinde. Sie strebt danach, die Wahrheit allein durch die Gewichtung der Fakten und ohne Ansehen der Person zu finden. Die Verfassung will es, dass Bundesrichter ihr Amt auf Lebenszeit bekommen, damit sie nicht in Gefahr geraten, aufgrund von politischem Druck die Augenbinde abzunehmen. Das Justizsystem wurde auf dem Grundsatz errichtet, dass die Bundesanwaltschaft, wie es der Supreme Court 1935 formuliert hat, die Rechtsvertretung für eine Idee – nämlich der Gerechtigkeit – ist, und nicht für einzelne Mandanten. Ebenso wenig ist der Justizminister, der als »General Attorney« den Titel des Generalstaatsanwalts trägt, der persönliche Anwalt des Präsidenten. In den Worten von Robert Jackson, der kurz selbst Justizminister gewesen war, bevor er zum Richter am Supreme Court ernannt und nach dem Zweiten Weltkrieg als amerikanischer Hauptanklagevertreter zu den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen gesandt wurde: Der Justizminister »hat eine Verantwortung gegenüber anderen Menschen als dem Präsidenten. Er ist der Rechtsvertreter der Vereinigten Staaten.«
Das Justizministerium und das Justizsystem im Allgemeinen sind alles andere als vollkommen, was das Streben nach inspirierenden Idealen betrifft. Das gilt seit Langem und für Amerika insgesamt. Menschen und die von ihnen geschaffenen Institutionen sind geprägt von Voreingenommenheit, Ängsten und abwegigen Leidenschaften und bleiben immer hinter den Erwartungen zurück.
Die Justiz ist da keine Ausnahme. Unschuldige werden verurteilt, Schwarze Menschen kommen viel zu oft ins Gefängnis, arme Menschen werden viel zu selten anständig vertreten, dabei hängt in unserem System die Gerechtigkeit oft von der Qualität des eigenen Anwalts ab. Es ist sehr vieles falsch an der Rechtsprechung in Amerika. Aber eines war immer richtig an der amerikanischen Justiz, nämlich ihre in Generationen durch das Justizministerium geschaffene Realität und ihre Reputation. Jahrzehntelang und insbesondere in den fünfundvierzig Jahren seit Watergate wurde Justizmitarbeitern eine Art Sonderstellung zugedacht – als Menschen, die zwar Fehler haben wie alle anderen auch, und doch irgendwie anders sind, vertrauenswürdig. Ihnen traute man zu, schwierigste Situationen zu klären, gegen Politiker zu ermitteln, schmerzhafte ethnische Konflikte in Angriff zu nehmen, nach der Wahrheit zu suchen und dem amerikanischen Volk die Wahrheit zu sagen.
Wenn diese Sonderstellung im amerikanischen Leben für die Mitarbeiter der Justiz nicht mehr gilt, verlieren wir alle an Sicherheit. Wenn Staatsanwälte von Geschworenen, Richtern, Opfern, Zeugen, Polizisten und gesellschaftlichen Gruppen als Angehörige einer politischen Clique angesehen werden, denen man entsprechend weniger trauen kann, dann geht etwas Wesentliches verloren.
Donald Trump hat zusammen mit seinem Justizminister William P. Barr das Vertrauen der Nation in die Justiz massiv zersetzt. Trump hat nie viel auf die Reihe gekriegt, aber er war immer außergewöhnlich gut darin, erbarmungslos gegen Menschen und Institutionen vorzugehen, die er als Bedrohung empfand. Anfangs wurden seine Lügen nach dem Prinzip des Tods durch tausend Stiche noch durchkreuzt, denn Jeff Sessions, sein erster Justizminister, stand bei all seinen Fehlern treu zu den altgedienten Regeln. Er ordnete vom Präsidenten gewünschte Ermittlungen nicht an und zog sich aus den Ermittlungen zur russischen Wahleinmischung 2016 zurück, weil er selbst eine Schlüsselfigur in Trumps Wahlkampagne gewesen war. Trump feuerte ihn, ersetzte ihn durch Bill Barr, und der erwies sich als weniger sensibel für die Werte der Justiz. Barr war von Anfang an das Echo des Präsidenten, er plapperte dessen unlautere Aussagen über die Arbeit des Ministeriums nach und agierte offenkundig gemäß den eigennützigen Forderungen des Präsidenten nach Ermittlungen und Anklagen. Das Justizministerium hat dadurch Schaden genommen. Und es wurde weiter beschädigt, als sein Chef Barr das amerikanische Volk über die Arbeit des Sonderermittlers Mueller in die Irre führte. Und noch einmal, als er intervenierte, um im Prozess gegen einen Freund des Präsidenten die von den Beamten im Ministerium empfohlene Verurteilung zu hintertreiben. Und ein weiteres Mal, als er massiv intervenierte, um einen Prozess gegen einen politischen Verbündeten des Präsidenten zu torpedieren, der sich bereits zweimal schuldig bekannt hatte.
Wenn unser Land wieder gesund werden soll, muss dieser Schaden behoben werden. Mein Buch ist ein Versuch, etwas zu dieser lebenswichtigen Aufgabe beizutragen – ich möchte meinen Landsleuten in Erinnerung rufen, wie die Justiz als Institution funktionieren und wie ihre Führungspersönlichkeiten sich verhalten sollten. Ich hatte das große Glück, unter Republikanisch wie Demokratisch geführten Regierungen Ämter innezuhaben – als Staatsanwalt, als US-Bundesanwalt, als Beamter des Justizministeriums und als Direktor des FBI –, und ich möchte anhand von Geschichten aus meiner Arbeit beleuchten, welche lebensnotwendigen Kernwerte die amerikanische Justiz hat und warum wir die heftige Korrosion überwinden und reparieren müssen, die ihr Trump und seine Unterlinge mit ihrer Unehrlichkeit, ihrem Klüngel, ihrer politischen Geschäftemacherei und ihrer moralischen Skrupellosigkeit zugefügt haben.
Meine Justizkarriere begann als Staatsanwalt in Manhattan, wo ich sechs Jahre lang eine Menge Fälle bearbeitet habe und – durch Vorgesetzte, Kolleginnen und Kollegen und eigene Fehler – schmerzhaft lernen durfte, dass das Justizsystem dazu verpflichtet, immer und vollständig die Wahrheit zu sagen, auch die Zeugen dazu zu bringen und sich mehr um die Schaffung von Gerechtigkeit zu kümmern als ums Siegen. Danach lernte ich während drei Jahren in einer privaten Rechtsanwaltskanzlei, dass Strafverteidigung harte Arbeit ist, und erfuhr noch einmal neu, dass ein Staatsanwalt keinen Mandanten im üblichen Sinn des Wortes, sondern das ganze Konzept Gerechtigkeit zu vertreten hat. Als ich danach zur staatlichen Justiz zurückkehrte, war ich sechs Jahre lang Bundesanwalt in Virginia und wieder Ankläger – und lernte, dass zum Aussprechen der Wahrheit das Halten von Versprechen gehört –, aber meine Arbeit drehte sich bald mehr um Mitarbeiterführung und die gesellschaftlichen Auswirkungen unserer Arbeit. Das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Justiz war alles, das wurde mir sehr klar, ohne dieses Vertrauen konnten wir unsere Kernaufgabe nicht erfüllen: Sicherheit für die Menschen. Es musste gepflegt werden, und nur im Gerichtssaal die Wahrheit zu sagen, reichte nicht. Wir hatten auch die Pflicht, transparent zu agieren und unseren Landsleuten zu erklären, was wir tun und warum.
Nach dem 11. September 2001 wurde ich erst leitender Bundesanwalt in Manhattan und dann Stellvertretender Justizminister in Washington – die Nummer zwei im Ministerium. Hier lernte ich, dass es ein für das Vertrauen der Öffentlichkeit entscheidender Faktor ist, dafür zu sorgen, dass Politik bei unseren Entscheidungen keine Rolle spielt. Zwar wurden die Führungskräfte von der Politik ernannt – ich selbst auch zum ersten Mal in New York und dann in Washington –, aber unsere Arbeit hatte apolitisch zu sein. Wenn wir effektiv arbeiten wollten, mussten wir als von politischen Interessengruppen getrennt und unabhängig gelten können und unsere Entscheidungen allein aufgrund von Tatsachen und Gesetzen fällen. Und wenn wir die Öffentlichkeit davon überzeugen wollten, mussten wir unsere Arbeit nach außen vertreten.
Ich wurde zu einer Zeit FBI-Direktor, als Amerika stark polarisiert war, und es notwendiger denn je für das Vertrauen des Landes war, unsere Arbeit transparent zu machen und die Wahrheit zu sagen – auch über erschütternde eigene Fehler. Wenn es in Amerika gerecht zugehen sollte, durften wir weder zu irgendeinem Team gehören, noch irgendeiner Führungsfigur persönlich zu Loyalität verpflichtet sein, auch nicht dem Präsidenten.
Die Geschichten in diesem Buch handeln von Erfolgen und Niederlagen, Fakten und Lügen, Sachzwängen und Versehen. Sie bieten schmerzhafte Lektionen darüber, dass im Zentrum unseres Justizsystems die ganze Wahrheit stehen muss und eine von Menschen geschaffene Institution auch grauenhafte Fehler macht. Und dass man als Rechtsvertreter des amerikanischen Volkes, das eben kein üblicher Mandant ist, eine andere Art von Verpflichtungen hat. Die Geschichten illustrieren, dass auch politisch ernannte Juristen getreue Sachwalter einer apolitischen Justiz sein können und wie hoch der Preis ist, wenn sie dieser Verpflichtung nicht gerecht werden. Meistens sollen sie aber vor allem zeigen, dass Wahrheit etwas Reales ist und gesucht, gefunden und ausgesprochen gehört – im Gerichtssaal, in Konferenzräumen, bei Vernehmungen –, ohne Ansehen von Privilegien, Beziehungen oder Parteizugehörigkeiten.
Hier überall den Primat der Wahrheit wieder durchzusetzen und in der Zeit nach Trump das Vertrauen wieder herzustellen, darum geht es in diesem Buch. Donald Trump wird nach dem 20. Januar 2021 nicht mehr Präsident sein.Die Justizinstitutionen, die er zu desavouieren versucht hat – mit seiner Attacke auf die Wahrheit an sich –, müssen repariert und gestärkt werden. Die Lügenpandemie wird wiederkommen wie ein Virus – durch sie sind zu viele aalglatte Leute zu Macht und Geld gekommen, sie werden wieder darauf setzen. Um darauf vorbereitet zu sein, müssen unsere Institutionen stärker und widerstandsfähiger werden. Dieses Buch ist nicht für Rechtsexperten oder Historiker gedacht, sondern für normale Bürgerinnen und Bürger – denn mit dem Thema sollten wir uns alle auskennen –, und es handelt davon, warum und wie wir daran arbeiten müssen.
Erster Teil
Gerechtigkeit lernen
Als Staatsanwalt in Manhattan wurden mir die Werte unserer Justiz bewusst: immer und vollständig die Wahrheit zu sagen, auch Zeugen dazu zu bringen, egal wie sehr sie sich dagegen sträuben; nie eine Argumentation aufbauen oder einen Fall übernehmen, wenn man nicht daran glaubt; sich seiner Grenzen und Möglichkeiten stets bewusst sein. Doch all dies führte immer wieder zum Essenziellen: Wessen Sache vertrittst du eigentlich? Ich hatte begriffen, dass ich nicht einen Ermittler, nicht einen Zeugen, nicht meine Vorgesetzten vertrat, ja nicht einmal mich selbst. Ich vertrat etwas Größeres und Wichtigeres – die Gerechtigkeit. Das amerikanische Volk erwartete von mir nicht so sehr, dass ich einen Prozess gewinne, sondern dass ich mich mehr darum kümmere, zum richtigen Ergebnis zu gelangen.
1
Die guten Tage
Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden.
Reinhold Niebuhr
Der Mann auf dem Moped packte sie einfach und fuhr mit ihr davon. Ihre kleine Schwester rannte schreiend ins Haus, um die Mutter zu verständigen, die umgehend zur Auffahrt stürmte, wo die Mädchen gespielt hatten. Aber die Straße lag still da, ihre wunderhübsche sechsjährige Tochter, die mit den schulterlangen braunen Haaren und den großen Kulleraugen, war verschwunden.
Entführungen durch Fremde sind selten, aber an diesem Mittwochnachmittag, dem 14. September 2016, geschah eben dies am Ende einer Auffahrt in einer vorstädtischen Wohngegend von Wilmington, North Carolina. Ein überführter Sexualstraftäter, der nach Verbüßung einer Haftstrafe von 16 Jahren wegen eines Übergriffs auf eine andere Sechsjährige in der Nähe wohnhaft war, hatte sich des kleinen Mädchens bemächtigt. Er fuhr in Richtung eines dichten Waldstücks und passierte einen Schulbus, kurz bevor er von der befestigten Straße abbog und zwischen den Bäumen verschwand.
Entführungen durch Fremde enden außerdem oft tödlich. Die Polizei weiß, dass die Wahrscheinlichkeit, ein entführtes Kind lebend zu bergen, äußerst gering ist, wenn es nicht schnell aufgespürt wird. Eine fieberhafte Suche begann, unter Beteiligung der örtlichen FBI-Dienststelle zur Unterstützung der lokalen Polizei. Nachrichtensender verbreiteten die Amber Alert-Meldung. Freiwillige und Beamte suchten die ganze Nacht im strömenden Regen.
Im FBI-Hauptquartier am nächsten Morgen erzählte mir Steve Richardson, der für die kriminalpolizeiliche Abteilung zuständige Stellvertretende Direktor, während der turnusmäßigen Leitungsbesprechung von dem kleinen Mädchen, das vor 16 Stunden in North Carolina entführt worden war. Er berichtete, dass unsere Leute in Wilmington die Nacht durchgearbeitet und alles getan hätten, um unseren Partnern vor Ort behilflich zu sein. Es gebe einen Verdächtigen – einen vorbestraften Kinderschänder, der ein Moped besitze –, aber dieser Fall würde aller Wahrscheinlichkeit nach schlimm enden. Ich sagte: »Was für eine Welt«, und bat ihn, mich auf dem Laufenden zu halten.
Zwei Stunden später kam Richardson in mein Büro gestürmt. »Man hat sie gefunden.« Er legte mir ein großformatiges Farbfoto auf den Tisch. »Und sie lebt.« Ich betrachtete das Bild. Das kleine Mädchen sah mich an. Ihre auffallend großen Augen waren weit aufgerissen, ihr Gesicht, immer noch wunderhübsch, obwohl von Mückenstichen übersät, war ausdruckslos, als begriff sie nicht, was mit ihr passiert war. Sie blickte hoch zu dem Beamten, der das Geschehen festhielt, während andere Beamte nur wenige Zentimeter von ihrem Kopf entfernt mit einer Elektrosäge hantierten, um die dicke Kette, die sie in Halshöhe an einen Baum fesselte, zu durchtrennen. Der Rest ihres Körpers war von der Regenjacke eines Beamten eingehüllt, um die wunde Haut zu schützen, die eine ganze Nacht lang dem Regen und den Insekten ausgesetzt gewesen war.
Mir kamen die Tränen. Ich konnte den Blick nicht von dem Foto abwenden. Ich hob die Hand, die Innenfläche Richardson zugekehrt, um ihm zu danken und ihn zu bitten, mich allein zu lassen, alles ohne Worte. Er sagte: »Chef, das hier ist einer von den guten Tagen«, dann ging er. Ich starrte weiter auf das Foto. Ich dachte an das Mädchen und seine Schwester und ihre Eltern, an meine eigenen Kinder und all die Kinder, die nicht gefunden und nicht gerettet werden.
Dieses Kind konnte dank eines Hinweises gerettet werden. Nach der nächtlichen Suchaktion im Regen hörten die Ermittler von einem Schulbusfahrer, der sich erinnerte, am Nachmittag zuvor einen Mann und ein kleines Mädchen auf einem Moped in der Nähe eines Waldgebietes gesehen zu haben. Zwei Mitarbeiter des Sheriffs begaben sich zu dem angegebenen Ort. Sergeant Sean Dixon führte seinen Hannoverschen Spürhund Dane mit sich. Er ließ Dane an der katholischen Schuluniform und einem Kissenbezug des Mädchens schnuppern, bevor sie sich in den Wald schlugen. Doch dann war es Lieutenant J.S. Croom, ohne Hund unterwegs, der sie nach zweihundert Metern zuerst erblickte, in Embryohaltung zusammengerollt, Arme und Beine in ihr rosa Hemd gewickelt, mit einer dicken Kette um den Hals, die sie an eine Eiche fesselte. Überzeugt davon, dass sie tot war, rief er nach Dixon und rannte auf den scheinbar leblosen Körper zu. »Schon an der Stimme und wie er meinen Namen rief, hab ich erkannt, dass er was gefunden hatte«, berichtete Dixon. »Mir ist ein bisschen das Herz in die Hose gerutscht.« Croom sagte später aus, er habe die reglos auf dem Boden liegende Gestalt berührt. »Und sie riss den Kopf herum, ihre Augen waren ganz groß, und sie fragte: ›Sind Sie hier, um mir zu helfen und mich zu meiner Mama zu bringen?‹« Durch die Bäume hörte Dixon Croom erneut rufen: Das Kind sei am Leben, das Mädchen lebe.
»Sie war das tapferste kleine Mädchen, das ich je erlebt habe«, sagte Dixon aus. »Sie starrte mich einfach nur an. Ich fragte sie, ob sie friere, und sie sagte, ja. Sie war klitschnass. Sie hatte Mückenstiche am ganzen Körper.« Beamte hielten einen vorbeifahrenden Baulaster an und liehen sich eine akkubetriebene Säbelsäge aus. Dixon hielt seine Finger zwischen Baum und Kette, und Croom sägte sie durch. Das Kind wurde mit Blaulicht ins Krankenhaus gebracht. Croom stand neben der Eiche und weinte. Ich saß in meinem Büro, starrte auf das Bild des kleinen Mädchens, und auch ich weinte.
Der 46-jährige Douglas Nelson Edwards wurde schuldig gesprochen und wegen Entführung, versuchten Mordes und sexuellen Missbrauchs eines Kindes zu einer langjährigen Gefängnisstrafe verurteilt. Er wird sich nie wieder an einem Kind vergehen. Ja, dies war einer der guten Tage. Er zeigte uns, warum wir diese Arbeit machen.
Ich hatte nie geplant, einmal Teil des Justizapparats zu werden. Ich wusste nur, dass ich meinen Jura-Abschluss machen und Menschen helfen wollte. Ich hatte allerdings keine Ahnung, wie ich das anstellen könnte. Mein erster Job nach dem Examen half mir auf die Sprünge. Ich wurde Rechtsreferendar – ein hochtrabender Ausdruck für »Assistent des Richters« – bei einem Bundesrichter im Bezirksgericht New York Süd, zu dem Manhattan und weite Teile der Stadt und ihrer nördlichen Vororte gehören. Meine Aufgabe bestand darin, dem Richter ein Jahr lang bei der juristischen Recherche und dem Abfassen von Schriftstücken zu helfen.
So ein Referendariat war eine prestigeträchtige Sache für junge Juristen, in der Regel nur den akademischen Stars vorbehalten. Ich hatte mich zwar gut geschlagen an der juristischen Fakultät, war aber absolut kein Star, was erklärt, warum Dutzende von Richtern meine Bewerbung abgelehnt hatten. Der Richter, der mich schließlich engagierte, John M. Walker jr., war ganz neu im Amt, ernannt erst während meines letzten Studienjahres. Er hatte als Stellvertretender Finanzminister gedient, bevor Ronald Reagan – dessen Vizepräsident George Herbert Walker Bush ein Cousin des Richters war – ihn zum Bundesrichter bestimmte. Das Timing war für mich sehr günstig, denn Richter Walker hielt Ausschau nach seinen allerersten Referendaren zu einem Zeitpunkt, als die akademischen Stars schon mit guten Stellen versorgt waren. Er war bereits ein bisschen verzweifelt, und, um ehrlich zu sein, das galt auch für mich. Später, sprich: in den folgenden Jahrzehnten, engagierte er Absolventen mit besseren Zeugnissen.
Wie es bei neuen Bundesrichtern so ist, war Walker sehr bestrebt, seine Sache gut zu machen. Und obwohl er durchaus eindrucksvolle Referenzen vorzuweisen hatte, hing über seiner Berufung doch ein Hauch von Vetternwirtschaft, den er naturgemäß schnell zu vertreiben suchte. Der Richter verbrachte während der Woche zwölf Stunden pro Tag im Gericht und arbeitete meist auch an mindestens einem Tag des Wochenendes. Von mir und meinem Referendarkollegen wurde erwartet, dass wir immer, wenn er da war, ebenfalls auf der Matte standen, also praktisch durchgehend.
Ich war fünfundzwanzig, und es machte mich fertig. Wir fanden, er sollte – und wir sollten – mal ein bisschen rauskommen. Der Richter war ein 45-jähriger Single in der Großstadt – gutaussehend, mit Geld in der Tasche und einem Job, der ihm laut Verfassung auf Lebenszeit sicher war. Besser geht’s doch gar nicht, oder? Immer wenn er seine Robe anzog, um auf dem Richterstuhl Platz zu nehmen, ließ er seine Anzugsjacke im Büro zurück. Unter dem Vorwand, ihm ein Memo über einen Fall auf den Tisch zu legen, schlich ich mich dann hinein und zog seinen in Leder gebundenen Taschenkalender aus dem Jackett, um nachzusehen, ob er für den Abend eine Verabredung hatte. Wenn ja, konnten auch wir ausgehen.
Im Sommer unseres Referendariats war er einmal einen ganzen Tag lang auswärts auf einer Fortbildung. Mein Kollege und ich saßen an unseren Schreibtischen, die sich in einem kleinen Raum gegenüberstanden. Nachdem ich eine Weile in einem dicken Wälzer mit mikroskopisch kleinem Schriftbild gelesen hatte, blickte ich auf.
»Lass uns zum Strand fahren.«
Jack schnaubte belustigt.
»Nein, ganz im Ernst. Wir gehen zu mir, packen ein paar Sachen ein und nehmen mein Auto.« Meine Wohnung in Hoboken, New Jersey, lag auf dem Weg nach Spring Lake, einem Strandort, wo wir mit einem Dutzend Freunden zusammen ein Sommerhaus gemietet hatten. Wir hatten den Kalender des Richters eingesehen; er würde heute nicht mehr ins Büro kommen. »So eine Chance kriegen wir so schnell nicht wieder.«
»Ja, du kannst deine Sachen packen. Ich hab keine Sachen.« Da hatte er recht; seine Wohnung lag weitab in der verkehrten Richtung, hoch im Norden, in der Nähe der Columbia University. Ich konnte ihm Shorts und ein Shirt leihen, aber meine Schuhe waren ihm viel zu groß.
»Moment mal, ich hab eine Idee.« Jack und der Richter hatten die gleiche Größe. Ich schlüpfte ins Büro des Richters und borgte seine Laufschuhe aus, mit denen er manchmal joggen ging, bevor er zum Gericht musste. »Jetzt hast du auch Sachen. Auf geht’s.«
Es war ein unglaublicher Strandtag in New Jersey, mitten unter der Woche. Ein Tag wie aus dem Film »Ferris macht blau«. Wir schwammen, warfen auf Basketballkörbe, joggten am Strand. Und keiner kam uns je auf die Schliche. Sehr, sehr früh am nächsten Morgen stellte ich die Laufschuhe dem Richter wieder in den Schrank.
Rückblickend wäre es vielleicht klüger gewesen, ich hätte, bevor ich das Gebäude betrat, die Schuhsohlen ordentlich ausgeklopft. Noch viele Jahre lang sollte Richter Walker sich fragen, wie es kam, dass seine Nikes, die er noch nie außerhalb der Stadt getragen hatte, eines schönen Morgens plötzlich eine rätselhafte Sandspur auf dem dunkelblauen Teppich seiner Diensträume hinterließen. Er sprach seine Sekretärin darauf an, die nur mit den Achseln zuckte, aber zu unserem großen Glück kam er nie auf die Idee, uns danach zu fragen.
Zu Beginn seiner juristischen Laufbahn war Richter Walker als Staatsanwalt im Bezirksgericht New York Süd tätig gewesen. Er erzählte gern Geschichten aus dieser Zeit, mit einer Mischung aus Freude und Bedauern. Es war der beste Job seines Lebens gewesen. Die Arbeit, die Freundschaften, die Fallbeispiele. Es gab nichts, was dem gleichkam. Fast verklärte sich sein Blick, wenn er andachtsvoll über »das Amt« und seine Rolle darin sprach.
Wenn wir im Gerichtssaal saßen, um die Verhandlungen zu beobachten, die er leitete, konnte ich nachvollziehen, was er meinte. Wir sahen jede Menge schlechter Anwälte – oft waren sie nachlässig gekleidet, schlecht vorbereitet, verspätet, aalglatt, sogar respektlos. Ganz anders dagegen die Frauen und Männer von der Bundesanwaltschaft. Sie waren fast immer jünger als die anderen Anwälte, standen gerader, knöpften sich schneller das Jackett zu, antworteten mehr auf den Punkt, hielten sich an Fristen und gaben offen zu, wenn sie etwas nicht wussten. Wurden sie korrigiert oder ermahnt, antworteten sie: »Ja, Euer Ehren«, und taten nicht wieder, was der Richter beanstandet hatte.
Aber es war viel mehr als nur eine Frage des Stils. Mir fiel auf, dass der Richter – und sogar die Anwälte der Gegenseite – glaubten, was die Bundesanwälte sagten. Wenn sie die Fakten darlegten oder Schlüsse aus einem bestimmten Präzedenzfall zogen oder beschrieben, was während eines Telefonats passierte, hielten alle Anwesenden ihre Ausführungen für stichhaltig, selbst die, die sie nicht kannten. Etwas nicht Sichtbares schien für sie zu bürgen. Es war seltsam, und im Alter von fünfundzwanzig konnte ich es mir nicht erklären. Aber ich fühlte mich zu dieser Arbeit hingezogen. Ich wollte auch so ein Leben führen. Mit sechsundzwanzig bekam ich dann die Chance und kostete dieses Leben aus, mit kleineren Unterbrechungen dreißig Jahre lang, in verschiedenen Funktionen für den Justizapparat, bis ich schließlich als FBI-Direktor von Donald Trump gefeuert wurde.
Ich liebte meine Tätigkeit im Justizministerium und im FBI, welches nur eine der Untergliederungen des Ministeriums darstellt. Die Organisationsstruktur ist außerordentlich komplex, sie umfasst mehr als 100000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im In- und Ausland. Es sind:
Sonderermittler und Deputy Marshals;
Staatsanwälte, die meisten davon einem der 94 Bundesgerichte in sämtlichen 50 Bundesstaaten und den US-Territorien zugeordnet;
Zivilanwälte, die die Regierung bei Gerichtsverfahren vertreten und die ebenfalls im ganzen Land tätig sind;
Analytiker, Wissenschaftler, Rechtsassistenten, Sekretärinnen, Sachbearbeiter, Handwerker, Lehrer, Wachleute und Tausende mehr, die den weitgespannten Betrieb am Laufen halten.
Das ist das Justizministerium. Es ist eine ganz vielfältige Ansammlung von Menschen, die sich alle auf die gleiche Sache stützen – die Sache, von der ich als junger Rechtsreferendar in Richter Walkers Gerichtssaal eine erste Ahnung bekam: eine Gabe, die ihnen mit dem Eintritt ins Ministerium zuteilwurde. Es ist eine Gabe, die ihnen vielleicht gar nicht bewusst war, bis sie sich zum ersten Mal erhoben, sich als Angehörige des Justizwesens auswiesen und den Mund aufmachten – sei es in einem Gerichtssaal, einem Tagungsraum oder bei einer Grillparty – und feststellten, dass vollkommen fremde Menschen ihnen zuhörten und glaubten.
Man glaubte ihnen, weil sie, wenn sie das Wort ergriffen, nicht als Republikaner oder Demokraten wahrgenommen wurden. Sie wurden als etwas angesehen, das im amerikanischen Leben ganz für sich steht – als eine Gruppe von Personen, die versuchen, das Richtige zu tun. Oft beschreibe ich diese Gabe, die so viel von dem Guten ermöglicht, das sie bewirken, als ein Reservoir des Vertrauens und der Glaubwürdigkeit, ein Reservoir, das für sie angelegt und Tropfen für Tropfen aufgefüllt wurde von denen, die ihnen vorausgingen – und die sie zum größten Teil nie kennengelernt haben. Es waren Menschen, die Opfer brachten und Versprechen hielten, um diesem Reservoir etwas hinzuzufügen. Es waren Menschen, die Fehler machten und diese eingestanden. Es waren Menschen, die schwere Entscheidungen trafen ohne Rücksicht auf Privilegien oder politische Erwägungen, Menschen, die Fakten zu bestimmen suchten und das Gesetz auf diese anwandten.
Es ist die Verpflichtung aller Justizmitarbeiter, dieses Reservoir zu schützen, es weiterzugeben an jene, die ihnen nachfolgen und wahrscheinlich nicht mal ihre Namen kennen werden. Das Problem mit solchen Reservoirs ist, dass man ungeheuer viel Zeit und Mühe braucht, es aufzufüllen, doch schon ein einziges Loch in einem Damm reicht hin, um es binnen Kurzem leerlaufen zu lassen. Der Schutz dieses Reservoirs erfordert Wachsamkeit, ein unbeirrbares Einstehen für die Wahrheit und die Erkenntnis, dass die Handlungen eines Einzelnen die unschätzbare Gabe beschädigen können, die allen zugutekommt.
Als frischgebackenen Bundesanwalt erwarteten mich schmerzliche Lektionen hinsichtlich dessen, was ich schuldig war: zum einen der Institution – unabhängig von jedem Einzelfall – und zum anderen dem ständigen Einsatz dafür, dass immer die ganze Wahrheit ans Licht komme.
2
The Fly
Der Edle trachtet nach der Wahrheit.
Konfuzius
Sonderermittlerin Alina Sacerio-Polak war im achten Monat schwanger, weswegen sie instinktiv ihren Bauch abschirmte, während sie die Rückseite des Hauses überwachte. Die Dunkelheit der Oktobernacht bot etwas Schutz, dennoch presste sie sich dicht an eine der hintersten Ecken der Klinkerwand eines Apartmentgebäudes in Manhattan. Ihre Waffe hielt sie mit beiden Händen, sie drückte sich fest an die Wand, einsatzbereit, und beobachtete die Feuertreppen über der Durchfahrt.
Sie hörte den Lärm, der zeitgleich losbrach, als ihre Kollegen bei der Vollstreckung der Durchsuchungsbefehle in klassischer Drogendealer-Manier »Poliziei« riefen und gegen die Türen zweier identischer, nach hinten gelegener Apartments hämmerten, eines direkt über dem anderen: Die Nummer acht war die Verkaufsstelle, die zwölf das wehrhafte Geheimversteck. Das Ganze spielte sich in New York City in den späten 1980er Jahren ab. Erfolgreiche Crack-Dealer waren vorsichtig und gewaltbereit, sogar gegenüber der Strafverfolgung. Sie drückte sich noch enger an die Wand.
Wenige Sekunden nachdem der Lärm begonnen hatte, kletterten zwei Männer aus dem als Verkaufsstelle dienenden Apartment auf die Feuertreppe. Sacerio-Polak und ihr Partner brüllten, sie sollen stehenbleiben. Als Antwort ertönten fünf Schüsse von oben. Sofort presste sie ihre Wange gegen die Ziegelsteine, lugte jedoch so weit um die Ecke, dass sie das Mündungsfeuer im Blick behalten konnte. Ziegelsteinsplitter prasselten auf ihre Wange, als eine Kugel in dem Backstein direkt neben ihrem Auge steckenblieb. Sie erwiderte das Feuer, verfehlte aber den Schützen. Doch der Dealer ließ seine Waffe in die dunkle Seitengasse fallen und folgte seinem Partner nach oben. Mit ihrem Funkgerät machte sie Meldung und alarmierte die auf dem Dach stationierten Ermittler, die die beiden festnahmen.
Der Schütze, der behauptete, er sei Verkäufer in einem erfundenen Spirituosengeschäft, trug Schmuck im Wert von 3100 Dollar und hatte Hunderte Dollar Bargeld in seinen Taschen. Er wurde einer der Angeklagten in meinem ersten Strafprozess als Staatsanwalt, in einem Prozess mit fünf Beschuldigten, die sich wegen Drogendealerei, Waffenbesitz und des versuchten Mordes an FBI-Ermittlern zu verantworten hatten. Das waren ziemlich aufregende Themen, aber der Fall brachte ein paar ernsthafte Probleme mit sich – im Bezirksgericht New York Süd bezeichneten wir diese als »Angelegenheiten«, ein Wort mit etwas optimistischerem Klang.
Eine dieser Angelegenheiten war »The Fly«. Er war der bezahlte Informant, der zu Apartment Nummer acht gegangen war und in den Tagen vor der Razzia das Geld der Steuerzahler benutzt hatte, um »kontrollierte Einkäufe« von Crack-Röhrchen zu tätigen. The Fly, ein Schwarzer, der wohl so um die vierzig sein mochte, verdiente seinen Lebensunterhalt damit, sich an Orte zu begeben, die für einen verdeckten Ermittler zu gefährlich waren, und so zu tun, als wäre er ein Süchtiger auf der Suche nach dem nächsten Kick. Er brauchte dafür kein sonderlich großes Schauspieltalent. The Fly selbst war Suchtpatient auf Entzug und bekam damals Methadon verabreicht, doch die Drogen, die er kaufte, konsumierte er nicht; sie sollten als Beweismittel in den strafrechtlichen Ermittlungen der Bundesbehörde dienen. Die Nummer acht in der Edgecombe Avenue Nr. 165 in Manhattan war ein gefährlicher Ort, der von einer jamaikanischen Drogenbande kontrolliert wurde; eine andere Kundin war dort mit vorgehaltener Waffe vergewaltigt worden, und zwar von einem der Männer, die später über die Feuertreppe nach oben fliehen sollten, während ihr Gangster-Kollege versuchte, die FBI-Ermittler aus dem Weg zu räumen. Es war genau diese Art von Gefahr, weswegen das FBI den Umschlagplatz dichtmachen wollte und The Fly einsetzte, der Drogen kaufen sollte.
Das von The Fly gekaufte Crack diente als Beweismittel in meinem Fall, und er sollte als wichtiger Zeuge auftreten. Ich traf ihn einige Male, um ihn auf die Zeugenaussage vorzubereiten. The Fly, dessen echter Name Steve war, bestand darauf, The Fly oder einfach nur Fly genannt zu werden, aber ich fühlte mich mit keiner der beiden Optionen wohl. Er war kein idealer Zeuge, aber alles, was er für mich tun sollte, war, den Geschworenen von seinen Botengängen zur Nummer acht zu erzählen, und wie er danach die von ihm gekauften Crack-Röhrchen mit einem Filzstift kennzeichnete, den ihm die Ermittler aushändigten, wenn er zu ihrem Auto zurückkehrte. Ich legte ihm verschweißte Beutel mit Beweismittelaufklebern vor, in denen sich die Röhrchen befanden. Er erkannte seine Initialen. Ich überlasse sie Ihnen als Beweismaterial, Euer Ehren. Fertig.
Am Nachmittag vor der geplanten Aussage meldete sich The Fly beim Bezirksgericht New York Süd und wartete im Empfangsbereich im siebten Stock auf einem blauen Kunstledersofa darauf, dass ich aus dem Verhandlungssaal zurückkehren würde, um seine Aussage ein letztes Mal mit ihm zu üben. An jenem Morgen nahmen die Ermittler und ich, wie es während eines Prozesses unsere Gewohnheit war, zwei Metallkörbe, in denen die Beweismittel – die Pistole und die Drogen – lagen, aus der riesigen Asservatenkammer der Behörde. An diesem Tag nahmen wir nur einen der Körbe mit vor Gericht. Den zweiten, der das von The Fly gekaufte Crack enthielt, würden wir erst benötigen, wenn er aussagte. Aber ich brauchte den Korb später für meine Probe mit The Fly. Als ich mich zum Gericht aufmachte, befand sich der Korb also von einer Gruppe FBI-Ermittlern bewacht in meinem Büro.
Dann spielten sich zwei Dinge ab. Zum einen nahm jeder der Ermittler an, es sei die Aufgabe eines anderen, die Drogen zu bewachen, und so schlenderten sie aus meinem Büro. Zum anderen wurde es The Fly langweilig, er stand von dem blauen Kunstledersofa auf und schlenderte auch ein bisschen, und zwar in Richtung meines Büros, um jemanden für ein Schwätzchen zu finden. Und so stießen The Fly und das von The Fly gekaufte Crack ohne Aufsicht aufeinander. In diesem Augenblick beschloss The Fly, kein genesender Süchtiger mehr zu sein, er stopfte sich die verschweißten Plastikbeutel in die Hose und verließ das Gebäude, um sich in einem abgewrackten Motel in der Nähe des Flughafens LaGuardia zuzudröhnen. Es sollte mehrere Tage dauern, bis ich davon erfuhr.
Was ich nach einem langen Tag bei Gericht hingegen bemerkte, war, dass in dem Beweismittelkorb in meinem Büro Drogen fehlten. Während die Ermittler und ich überall suchten, schnürte sich mir allmählich die Kehle zu. Denn ich kannte da eine Geschichte. Ich hatte gehört, dass vor etwas mehr als einem Jahr, kurz bevor ich meine Stelle als Staatsanwalt im Bezirksgericht New York Süd angetreten hatte, ein anderer Staatsanwalt festgenommen worden war, weil er Drogen aus der Asservatenkammer gestohlen hatte und diese mit Prostituierten, die bei ihm in der Wohnung lebten, konsumiert und geteilt hatte. Ich wusste, dass Rudy Giuliani, der US-Bundesanwalt, der sich eine strahlende Zukunft als Person des öffentlichen Lebens ausmalte, sehr wütend auf den Staatsanwalt wurde und ihn mit Handschellen an einen Stuhl gefesselt in den öffentlichen Lobby-Bereich des Büros beorderte, wo der junge Mann wartete und schluchzte, bis seine Verhandlung begann. Der schluchzende Staatsanwalt mit den gestohlenen Drogen wanderte für drei Jahre ins Gefängnis. Rudy hatte eine Haftstrafe von 12 Jahren gefordert.
Ich hatte Schluckbeschwerden, als mir mein Vorgesetzter sagte, Rudy Giuliani erwarte mich am Abend in seinem Büro. Dort waren Rudy und sein Stellvertreter, die wissen wollten, was mit den Drogen meines Falls geschehen war. Ich erklärte ihnen, dass es mir ein Rätsel sei. Sie sagten, sie wollten diesbezüglich eine eidesstattliche Erklärung von mir. Natürlich, sagte ich und kehrte in mein Büro zurück, um die Stellungnahme zu tippen, in der ich schwor, die Drogen nicht entwendet zu haben. Ich konnte tippen, aber das Schlucken war mir vergangen.
Meine Vorgesetzten sagten mir auch, ich müsse den Bundesrichter unverzüglich in Kenntnis darüber setzen. Die gestohlenen Drogen waren die Grundlage für die Anklagepunkte in dem gerade angelaufenen Prozess. Während meines Eröffnungsplädoyers hatte ich von den Einkäufen des Informanten gesprochen, und die Strafverteidiger erwarteten, dass der Informant als Zeuge auftreten würde. Sie mussten Bescheid wissen. Am nächsten Morgen ging ich also zum Richter und erzählte ihm und den Verteidigern die ganze Geschichte, außer das Ende, das ich ja noch nicht kannte. Es sollte meine Karriere retten: Ermittler fanden The Fly halb bewusstlos in seinem Motel-Zimmer in Queens, um ihn herum verstreut die aufgerissenen, leeren, nun nicht mehr zugeschweißten Beweismitteltüten.
Ich rief The Fly nicht als Zeugen auf, legte keinen seiner Crack-Käufe aus der Nummer acht als Beweismittel vor und ließ die Anklagepunkte fallen, die mit den Käufen in Verbindung standen. Der Fall überlebte The Fly.
Aber bald schon kamen weitere Angelegenheiten auf mich zu.
The Fly trat also nicht als Zeuge in Erscheinung, wohl aber eine tapfere junge Frau, die beschrieb, dass sie – Anfang des Jahres, vor der Razzia der Bundesbehörde – Stammkundin in Apartment Nummer acht gewesen war, bis zu dem Tag, als sie unter vorgehaltener Waffe von einem der Angeklagten meines Falls vergewaltigt worden war, von einem der beiden, die aus dem Fenster auf das Dach geflohen waren. Nicht von dem, der in der Seitengasse versucht hatte, die Ermittler zu ermorden, sondern dem anderen. Nach dem Übergriff rannte sie aus dem Apartment und rief die Polizei, die auf die beiden Männer stieß, die das Unternehmen anführten. Der für meinen Fall zuständige Richter erlaubte der Frau nicht, den sexuellen Übergriff zu beschreiben, weil es sich dabei um ein Delikt handelte, das nicht in eine Bundesanklage einbezogen werden durfte. Er gewährte ihr jedoch, den Geschworenen von dem florierenden Drogengeschäft zu erzählen und von den beiden Männern, die es leiteten.
Und natürlich sagten auch die Bundesbeamten darüber aus, was sie gesehen, gehört und gefunden hatten bei der Hausdurchsuchung damals in der Oktobernacht. Die Beweismittel – allerlei Drogen, Pistolen und Hunderte Patronen Munition –, das alles lief ausgezeichnet. Bis ich mich bei meinem Schlussplädoyer vor den Geschworenen für besonders clever hielt.
Es handelte sich wirklich um eine Trivialität. Wie war den Geschworenen klarzumachen, dass der Schütze auch Drogendealer war? Weil er keinen Job hatte, Schmuck im Wert von 3100 Dollar trug und Hunderte Dollar Bargeld – allesamt in kleinen Scheinen – bei sich hatte. »Wenn man etwas für den [Straßen-]preis verkauft«, sagte ich zu den Geschworenen, »bekommt man keine großen Scheine.« Ich war mit meinem ersten Schlussplädoyer ziemlich zufrieden.
Ich hatte geübt, was ich sagen würde; war in unserem winzigen Wohnzimmer nachts auf und ab gelaufen und legte meinen Auftritt als Anwalt vor meiner schwangeren Frau hin, die auf unserem braunen Kordsamt-Sofa als Geschworene herhalten musste.
»Sehr gut«, sagte sie. »Aber warum läufst du immer vor und zurück?«
»Das machen Anwälte so«, sagte ich. »Du weißt schon, so wie im Fernsehen.«
»Hm, lass das lieber sein. Du siehst wie eine brünstige Giraffe aus. Du bist zwei Meter groß. Du jagst Menschen Angst ein. Bleib stehen, tritt einen Schritt zurück.«
»O je, das ist ganz schön brutal.«
»Ja, tut mir leid. Ich liebe dich wirklich sehr, aber beweg dich besser nicht.«
Am darauffolgenden Tag fühlte ich mich auf meinen wie angewurzelt stillstehenden Füßen dermaßen wohl, dass ich sogar improvisierte, als ich bemerkte, dass ein Geschworener in der ersten Reihe eingeschlafen war, während ich davon erzählte, wie die Angeklagten aus dem Fenster auf die Feuertreppe geflohen waren. Anstatt wie geplant zu sagen, dass der Angeklagte fünf Schüsse auf die Ermittler abfeuerte, sagte ich: »Er sah von der Feuertreppe auf sie herunter«, dann machte ich eine Pause und schrie: »PENG, PENG, PENG, PENG, PENG.« Das rüttelte den Schläfer wach.
Zufrieden damit, dass der Fall recht gut verlaufen war, dass The Fly, die Drogen und meine Karriere allesamt mehr oder weniger in trockenen Tüchern waren, entspannte ich mich im Gerichtssaal, während die Geschworenen sich zur Beratung in den Konferenzraum hinter der Richterbank zurückzogen. Der für den Fall zuständige Ermittler kam zu mir angeschlichen, sagte, ich hätte einen guten Job gemacht und er würde mich gerne unter vier Augen sprechen. Meine Aussage bezüglich der kleinen Scheine in der Tasche des Angeklagten habe ihm etwas vor Augen geführt, wovon er mir erzählen wolle.
Als die Angeklagten schon verhaftet waren, aber noch bevor mein Gerichtsverfahren begonnen hatte, war es in einem anderen, nicht mit diesem in Beziehung stehenden Fall, zu einer Krisensituation gekommen: Eine Gruppe von Drogendealern in Brooklyn entführten die Mutter von jemandem, den sie im Verdacht hatten, ihre Bande zu hintergehen. Sie drohten, die Frau umzubringen, es sei denn, der Überläufer würde gestehen. Ein anderer Informant erzählte den Ermittlern, er könne sie zu der entführten Frau bringen. Allerdings wollte der Informant zuerst Geld sehen. Es war Samstagnacht, nach 24 Uhr. Wo sollten sie das Geld hernehmen, um den Informanten zu bezahlen? Der für den Fall zuständige Ermittler ging in sein Büro, schloss die Asservatenkammer auf und nahm etwas von dem Geld, das während der Razzia in den Apartments Nummer acht und zwölf beschlagnahmt worden war, darunter auch das Geld aus den Taschen des Schützen auf dem Dach. Er nutzte es, um an die Information zu kommen, die es dem Einsatzkommando ermöglichte, die entführte Frau zu retten. Montagmorgens bekam er Bargeld aus den Mitteln der Behörde und ersetzte damit das Geld, das er am Wochenende entwendet hatte.
Während der Ermittler im Gerichtssaal saß und zuhörte, wie ich den Geschworenen erzählte, die kleinen Scheine in den Taschen des Schützen bedeuteten, dass er ein Dealer gewesen sei, wurde ihm klar, dass er ein Problem hatte: Er hatte nicht auf die Stückelung der Scheine geachtet, die er in der Wochenendnacht mitgenommen hatte, und auch nicht auf die des Ersatzgeldes. Er dachte, die Beträge seien in etwa richtig, aber er konnte nicht sicher sagen, ob das Geld aus den Taschen des Schützen aus Einern, Fünfern oder Zehnern bestanden hatte. Vielleicht waren es erst jetzt kleine Scheine, weil er genau die von der Nebenkasse des Gerichts bekommen und als Ersatz in den Beweismittelumschlag gelegt hatte. Vielleicht waren es aber auch Zwanziger gewesen, bevor er das Geld angefasst hatte. Oder Fünfziger. Er wusste es nicht, und genau darum erzählte er es mir.
Ich wollte einfach nur, dass es vorbei wäre. Ich hatte The Fly überlebt. Die Geschworenen berieten sich. War es die Sache wirklich wert, den gesamten Fall wegen meiner einen nebensächlichen Bemerkung platzen zu lassen? Noch immer war der Kerl ein arbeitsloses Schmuckmodel mit viel Bargeld in den Taschen, nachdem er aus einer Drogenhöhle geklettert war. FBI-Ermittler hatten ihm zugesehen, wie er versuchte, sie umzubringen. Er war sowas von schuldig. Wer sollte sich also schon groß daran stören? Mein Vorgesetzter störte sich daran. Als ich ihm mitteilte, was mir der Ermittler erzählt hatte, wies er mich an, auf der Stelle zum Bundesrichter zu gehen und ihm davon zu berichten. Ich könne noch immer argumentieren, dass es keine Bedeutung habe, dass man daraus keine Konsequenzen ziehen müsse, aber das Gericht müsse die Wahrheit wissen, und zwar sofort.