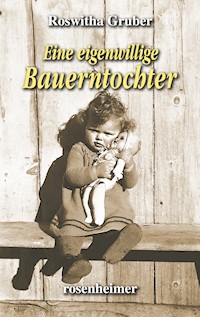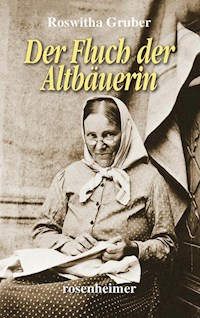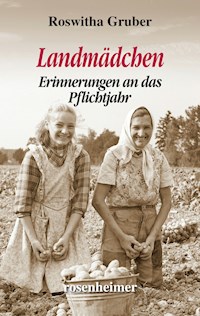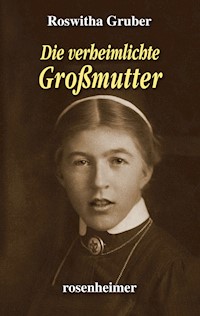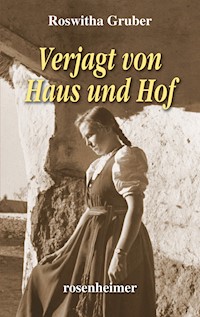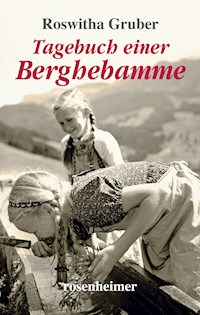16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rosenheimer Verlagshaus
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
In Einzelgesprächen sorgfältig recherchiert und erzählerisch wertvoll aufbereitet, schildert die Autorin Geschichten aus der guten alten Zeit. Es ging natürlich nicht immer friedlich und sorgenfrei zu. Wir erfahren mehr über das Leben in kinderreichen Familien, über den Schulbesuch, der vielen Mädchen nur kurze Zeit möglich war, über den anstrengenden Alltag in der Landwirtschaft, aber auch über das Leben in der Stadt als Dienstmädchen. Roswitha Gruber widmet sich der Schilderung starker Frauen mit außergewöhnlichen Lebensgeschichten. Für jeden ihrer Romane recherchiert sie dafür ausführlich und nähert sich in langen, intensiven Gesprächen dem Schicksal ihrer Protagonistinnen an. Roswitha Gruber lebt und arbeitet in Reit im Winkl.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Allen Großmüttern gewidmet
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Rosenheimer Verlagshaus erschienenen Originalausgabe 2012
© 2014 Rosenheimer Verlagshaus GmbH & Co. KG, Rosenheimwww.rosenheimer.com
Titelfoto: © Bundesarchiv, Bild 183-20728-0003 /
Fotograf: Biscan
Lektorat und Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
eISBN 978-3-475-54374-6 (epub)
Worum geht es im Buch?
Roswitha Gruber
Großmütter erzählen
Geschichten aus der guten alten Zeit
In Einzelgesprächen sorgfältig recherchiert und erzählerisch wertvoll aufbereitet, schildert die Autorin Geschichten aus der guten alten Zeit. Es ging natürlich nicht immer friedlich und sorgenfrei zu. Wir erfahren mehr über das Leben in kinderreichen Familien, über den Schulbesuch, der vielen Mädchen nur kurze Zeit möglich war, über den anstrengenden Alltag in der Landwirtschaft, aber auch über das Leben in der Stadt als Dienstmädchen.
Roswitha Gruber widmet sich der Schilderung starker Frauen mit außergewöhnlichen Lebensgeschichten. Für jeden ihrer Romane recherchiert sie dafür ausführlich und nähert sich in langen, intensiven Gesprächen dem Schicksal ihrer Protagonistinnen an. Roswitha Gruber lebt und arbeitet in Reit im Winkl.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Die Schweinchenschmugglerin
Große Liebe zu kleinen Tieren
Auf dem Rittergut
Heimweh
Eine überschattete Kindheit
Schäferstündchen
Die Fehlprognose
Ein vorlautes Kind
Viermäderlhaus
Familie anno 1920
Dirndl vom Einödhof
Vorwort
Aus den Märchen ist sie uns seit frühester Zeit vertraut: die gütige, die verständnisvolle, manchmal auch die sorgende Großmutter. Doch nicht nur die Märchen haben sich dieser liebevollen Figur angenommen. Auch in anderer Literatur begegnet sie uns immer wieder. Nicht ohne Grund, denn die Großmutter spielt in unserem Leben eine wichtige Rolle.
Davon wird in diesem Buch nur am Rande die Rede sein. Diesmal wollen wir die Großmutter aus einer anderen Perspektive betrachten: Großmütter waren auch einmal jung, sie waren auch einmal Kinder. Auch sie hatten ihre Wünsche und Träume, ihre Hoffnungen und Sehnsüchte. In diesem Buch erzählen die Großmütter selbst aus ihrer Kindheit. Wir werden erfahren, wie sie gelebt haben und wie ihr Umfeld gewesen ist.
Bei meinen Recherchen zu diesem Buch traf ich auf sehr unterschiedliche Großmütter. Es gab solche, die gleich munter von der Leber weg erzählten. Andere zierten sich: »Ach, ich weiß nicht, was ich Ihnen da erzählen soll. Von früher weiß ich gar nichts mehr.« Nachdem ich aber durch gezielte Fragen nach der Kindheit einen Quell angezapft hatte, sprudelte es nur so aus ihnen heraus.
Wahre Erinnerungsschätze sind dabei zu Tage getreten. Erstaunlich war für mich, wie unterschiedlich die Erinnerungen der Großmütter an ihre Kindheit waren. Offenbar hatte jede beim Speichern ihrer eigenen Geschichte andere Schwerpunkte gesetzt. Viele Episoden aber zeigen Parallelen – nicht in der Sprache, wohl aber im Inhalt.
In diesem Buch sind lebendige, authentische Geschichten von Großmüttern gesammelt, deren Kindheit und Jugendzeit vom Leben auf dem Lande, von gesellschaftlichen Gegebenheiten in der Stadt und vom Moralkodex der unruhigen Jahre der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts geprägt wurden. Sie sind so aufregend und so bunt wie das Leben selbst.
Ich hoffe, die Leser empfinden ebenso viel Vergnügen wie ich beim Zuhören dieser Lebenserinnerungen. Und sie können die Freude nachempfinden, die die Großmütter selbst beim Erzählen hatten.
Die Schweinchenschmugglerin
Nandl, Jahrgang 1930, aus Bichlach/Tirol
Ich kam schon wenige Monate nach meiner Geburt von zu Hause weg. Denn meine Eltern waren beide ernstlich krank. Durch einen Unfall mit einem Pferd hatte mein Vater einen Lungenriss davongetragen. Und meine Mutter litt an Rotlauf, einer Krankheit, die häufiger bei Schweinen vorkommt, aber ganz selten beim Menschen. Woher Mutter diese Krankheit hatte, ist allen ein Rätsel geblieben. Unsere Schweine waren nämlich gesund.
Meine Großmutter war mit ihrer jüngsten Tochter für eine Zeit lang zu uns ins Haus gekommen, um sich um meine Eltern, das Haus und den Hof zu kümmern. Sobald es meinen Eltern wieder besser ging, packten die Großmutter und meine Tante wieder ihre Reisetasche. Bei der Verabschiedung beschloss meine Großmutter spontan: »Das Dirndei nehm ich jetzt mal mit.« Damit meinte sie mich. Sicher wollte sie meine genesende Mutter entlasten, die ohnedies noch vier Kinder im Alter von anderthalb bis sechs Jahren zu versorgen hatte. Vielleicht dachte meine Großmutter aber auch an mich. Vielleicht wollte sie mir ein besseres Leben bieten, als ich es unter den gegebenen Umständen zu Hause gehabt hätte.
Ich blieb auf dem Hof meiner Großeltern, bis ich fast neun Jahre alt war. Bei meinen Eltern waren inzwischen zwei weitere Geschwister auf die Welt gekommen. So war es für meine Mutter bestimmt eine Entlastung, dass ich bei der Großmutter blieb.
Mehr noch denke ich aber, dass die Großmutter mich nicht wieder hergeben wollte. Anfangs war ich nämlich das einzige Kind, vor allem das einzige Mädchen auf dem Hof. Es gab da noch meinen Großvater und die vier fast erwachsenen Söhne, meine jungen Onkel. Alle liebten und verwöhnten mich, besonders mein ältester Onkel, der Pepi. Sie haben mit mir gespielt, gelacht und herumgealbert, wie das nur halbwüchsige Burschen fertig bringen.
Dass mein Großvater in dieser Zeit starb, weiß ich noch, obwohl ich erst zweieinhalb Jahre alt war. Das ist fast nicht zu glauben. Deutlich sehe ich noch vor mir, wie der Postbote kam und ein Paket auf den Küchentisch legte. Diesen Vorgang kann mir niemand erzählt haben, denn es war niemand dabei, als er das Paket abstellte. Neugierig umkreiste ich den Tisch, bis die Großmutter kam. Gespannt beobachtete ich, wie sie das Paket öffnete. Zu meiner Enttäuschung kamen aber nur die Sterbebilder vom Großvater heraus.
Nach seiner Beerdigung habe ich immer in seinem Bett geschlafen, neben der Großmutter. Sie mochte nicht allein sein. Ich nannte sie Mutter – wie alle hier im Haus. Sicher, wir sprachen auch von meinen Eltern. Großmutter nannte sie Mami und Dati. Ich wusste, wo sie wohnten, und wir besuchten sie gelegentlich. Aber ich hatte keine wirkliche Beziehung zu ihnen. Sie waren für mich fremde Leute geworden.
Nach und nach verließen meine erwachsenen Onkel ihr Elternhaus. Nun wurde es daheim stiller und stiller, und das Verhältnis zwischen Großmutter und mir wurde noch enger. Der Letzte, der aus dem Haus ging, war Onkel Pepi. Aber eigentlich ging er gar nicht aus dem Haus. Er zog nur innerhalb des Hofes in eine eigene Wohnung, weil er geheiratet hatte. Seine Frau, die Resi, hat mich sehr gern gemocht. Aber so nach und nach kamen bei Resi vier Buben an. Damit war Pepis Frau voll beschäftigt. Sie war immer dankbar, wenn ich ab und zu die Kindsmagd machte und ihr den einen oder anderen Buben für ein paar Stunden abnahm.
Meine Großmutter brachte mir schon früh das Stricken bei. Mit sechs, sieben Jahren konnte ich schon Strümpfe stricken. Jeden Abend nach der Arbeit strickte ich. Auch an Regentagen. Das habe ich aber nie für Arbeit angesehen. Es hat mir Spaß gemacht. Die ›Mutter‹ und ich saßen dann so nett beisammen. Wir strickten beide um die Wette, und sie erzählte mir Geschichten von früher.
Es war gar keine Rede mehr davon, dass ich bei meiner Großmutter lebte, oder ob oder wann ich wieder nach Hause gehen würde. Ich fühlte mich äußerst wohl in ihrer Umgebung. Ich mochte alle, und alle mochten mich. Meine Großmutter, der Pepi, seine Frau, die vier Buben und ich lebten miteinander, als seien wir eine einzige Familie. Alles verlief harmonisch, ein geradezu paradiesischer Zustand. Aber in jedem Paradies gibt es eine Schlange. Bei mir trat diese in Form eines harmlosen, kleinen Balles in Erscheinung. Ein roter Gummiball mit weißen Tupfen sollte mein Leben grundlegend verändern.
Onkel Pepi hatte mich von klein auf mit allerlei Geschenken verwöhnt. Von ihm bekam ich bereits ein Paar schwarze Lackschuhe, als noch kein Kind im Dorf welche hatte. Mal brachte er mir eine Orange mit, mal Schokolade, mal Kekse. Auch als er schon eigene Kinder hatte, machte er keinen Unterschied. Er bedachte uns alle gleichermaßen.
Eines Tages nun brachte er besagten Gummiball mit. Der war kaum größer als eine dicke Apfelsine und sollte doch zum Zankapfel werden. Es war klar, dass er für uns fünf Kinder nicht fünf Bälle mitbrachte, wie das heute üblich ist, wo jedes Kind seinen eigenen Ball bekommt.
Damals musste ein Ball für fünf Kinder reichen. Wir hatten das Geld nicht so üppig, und wir spielten eh gemeinsam.
Der Fehler in meinen Augen war, dass der Onkel den Ball nicht mir, der Ältesten, überreichte, sondern seinem erstgeborenen Sohn. Ich fühlte mich arg zurückgesetzt. Bestimmt hatte sich Onkel Pepi nichts Böses dabei gedacht. Er wollte bestimmt keinen Unterschied zwischen mir und seiner eigenen Familie machen. Wahrscheinlich hatte er angenommen, dass ich mit meinen fast neun Jahren gar nicht mehr an einem so kindlichen Spielzeug interessiert war. Ich aber war in meiner tiefsten Seele noch ein Kind und von dem heißen Verlangen beseelt, mit diesem Ball zu spielen. Außerdem fühlte ich mich durch die Handlungsweise meines Onkels ausgegrenzt.
Also reagierte ich heftiger, als ich das üblicherweise zu tun pflegte. Ich wollte unbedingt diesen Ball von meinem kleinen Cousin haben. Er war nicht bereit, mir den Ball zu geben, also versuchte ich, ihm den Ball zu entreißen. Der Kleine aber verteidigte ihn wie ein Löwe. Und so kam es zu einem harmlosen kindlichen Gerangel zwischen einem Vierjährigen und einer Achtjährigen.
In diesem Moment betrat unsere Großmutter die Szene.
»Nandl, ich meine, es ist jetzt an der Zeit, dass du wieder heim zu deinen Eltern kommst.«
Dieser Ausspruch traf mich wie ein Keulenhieb. War denn mein kleines Vergehen so schlimm, dass ich dafür gleich in die Verbannung gehen musste? Nicht anders empfand ich dieses Nach-Hause-geschicktwerden. Mein Cousin Peperl muss das ähnlich gesehen haben. Unter Tränen flehte er Großmutter an: »Bittschön, schick die Nandl nicht weg. Sie kann ja den Ball haben.«
Auch Peperls Mutter mischte sich nun ein.
»Mutter, deswegen brauchst die Nandl doch nicht gleich heimschicken. Das war doch wirklich nicht schlimm. Ich mag sie doch so. Warum bist du so hart gegen das Dirndei?«
»Das weiß ich auch nicht«, brummte sie vor sich hin. »Die Nandl hat ja auch noch Eltern.«
Großmutters Antwort, die zu dem Zusammenhang gar nicht passte, und ihr trauriger Gesichtsausdruck haben mich später oft über diese Geschichte nachdenken lassen. Ich kam schließlich zu der Überzeugung, dass meine Eltern wahrscheinlich schon lange um meine Rückkehr gebeten hatten. Vermutlich hatte Großmutter aus eigennützigen Motiven diese Bitte immer wieder hinausgezögert. Womöglich hatte sie dabei auch mein Wohl im Auge gehabt. Vielleicht wollte sie mir die unbeschwerte Kindheit so lange wie möglich erhalten. Vielleicht hatte sie es nicht übers Herz gebracht, mich einfach nach Hause zu bringen, und deshalb auf einen triftigen Trennungsgrund gewartet. Den hatte ihr der harmlose ›Zankapfel‹ nun beschert. Diese Erkenntnis kam mir, wie gesagt, erst später. Damals aber war ich todunglücklich über die Härte meiner Großmutter.
Weinend packte ich mein Zeug zusammen. Weinend saß ich neben Onkel Pepi auf dem Wagen, als er mit mir vom Hof fuhr. Meine Großmutter ließ sich zum Abschied nicht blicken, und meine Tante hatte alle ihre Kinder ins Haus geholt. So sah niemand meine Tränen.
Unterwegs genoss ich die Fahrt durch die grüne Sommerlandschaft, zumal Pepi mich durch kleine Scherze aufzuheitern wusste.
Der Empfang zu Hause war eigenartig. Er war nicht dazu angetan, mir ein Gefühl von Wärme und Geborgenheit zu vermitteln.
»Da bist du ja«, bemerkte mein Vater und ging ins Feld.
»Pass auf, dass der Luggi und der Hansi nicht miteinander raufen«, lautete die Anweisung meiner Mutter, ehe sie im Stall verschwand.
Da stand ich nun: mit zwei kleinen Brüdern, drei und sechs Jahre alt, die ich kaum kannte. Natürlich ließen sie sich von mir, der völlig Fremden, nichts sagen und rauften trotzdem.
Beim Abendessen starrten mich meine älteren Geschwister an, als sei ich ein Marsmensch. Da half es auch nichts, dass meine Mutter mich vorstellte.
»Das ist eure Schwester Nandl, sie wohnt jetzt auch bei uns.« Misstrauisch beäugten mich die Schwestern, als wollten sie ausdrücken: ›Die hat uns gerade noch gefehlt.‹
Im Mädchenzimmer standen zwei Betten. Das eine davon wurde mir zugewiesen. Burgi schlüpfte zu Leni ins andere Bett. Statt den Luxus zu genießen, ein Bett für mich allein zu haben, weinte ich still in meine Kissen, denn ich fühlte mich wieder einmal ausgegrenzt.
Nach einigen Wochen wagte ich einen Vorstoß bei meinen Schwestern.
»Es kann doch auch mal eine von euch bei mir schlafen.«
Einmütig lehnten die beiden das ab, ›weil ich so mager sei‹. Sicher, ich war ein dünnes Mädchen. Aber das war nicht der wirkliche Grund. Mir war klar, dass die beiden trotz des Altersunterschiedes von drei Jahren eine geschwisterliche Einheit bildeten. Altersmäßig hätte Burgi besser zu mir gepasst. Sie war nur ein Jahr älter als ich. Aber die beiden akzeptierten mich nicht als Schwester. Sie sahen in mir nur die störende Dritte. Deshalb ging mein Sehnen und Trachten nur danach, wieder von hier wegzukommen.
Manchmal, wenn ich allein in der Stube war, legte ich mich auf die Ofenbank und grübelte betrübt: ›Was kann ich tun, damit ich wieder zu Großmutter komme? Was mach ich nur? Wie kann das gehen?‹ Aber mir fiel nichts ein. Also blieb mir nichts anderes übrig, als mich an die neue Situation zu gewöhnen. Anfangs habe ich noch oft geweint. Es ist nicht so einfach, plötzlich ein ungeliebter Teil einer Großfamilie zu sein, wenn man acht Jahre lang quasi mit der Pflegemutter allein gelebt hat. Ich musste es erst verdauen, von heute auf morgen mitten in einer siebenköpfigen Geschwisterschar zu sein, wo ich doch noch bis vor kurzem den Status eines Einzelkindes genossen hatte. Hier fühlte ich mich als Eindringling. Alle in der Familie kannten sich untereinander. Sie waren seit Jahren miteinander vertraut. Ich aber war ein Fremdkörper – und blieb es.
Erst als im Jahr darauf meine Schwester Cilli geboren wurde, änderte sich etwas für mich. Cilli war jetzt ›meine Schwester‹. Von Anfang an betraute mich unsere Mutter, die ja Arbeit genug hatte, mit der Aufgabe, dieses Kind zu versorgen und zu hüten. Cilli wurde ›mein Kind‹, die zog ich für mich auf. Das füllte mich aus und lenkte mich von meinem Kummer ab.
Und da gab es noch ein anderes Problem: die schulische Umstellung. Neue Lehrpersonen, an die ich mich gewöhnen musste, neue Mitschüler, andere Lehrmethoden. Ich sackte leistungsmäßig plötzlich stark ab. Dieser Leistungsabfall mag aber auch darin begründet gewesen sein, dass ich in meinem neuen Zuhause todunglücklich war.
Auch in der Schule fand ich keinen Kontakt. Die Banknachbarin wollte mit mir nicht reden, in der Pause wollte niemand mit mir spielen. Betrübt schaute ich zu, wie die anderen Kinder Kreisspiele machten oder Fangen spielten.
Mir wurde schnell klar, dass ich bei den Mädchen zu Hause und in der Schule keine Chancen hatte. Deshalb habe ich aufgehört, deren Gesellschaft zu suchen. Ich hielt mich fortan mehr an die Buben, bei denen ich schnell Anklang fand.
Auch als ich älter wurde, hatte ich keine Freundinnen. Vielleicht es lag daran, dass ich von klein auf nur mit Buben zu tun gehabt hatte. Zuerst waren meine halbwüchsigen Onkel meine Spielkameraden gewesen, später meine kleinen Cousins. Jedenfalls fand ich unter meinen Klassenkameraden eine ganze Menge Freunde. Die waren mir nach kurzer Zeit wichtiger als meine eigene Familie.
Wenn die Schule aus war, blieb nicht viel Zeit zum Traurigsein. Meine kleine Schwester war ja zu versorgen. Und daneben warteten noch viele andere Tätigkeiten im Haushalt auf mich. Mit zunehmendem Alter wurden meine Pflichten auch auf Feld und Stall ausgedehnt. Schon früh musste ich mich um die Rösser kümmern. Musste sie ausputzen, striegeln und mit ihnen fuhrwerken wie ein Rossknecht. Pferde waren bald mein Leben.
Mittlerweile war Krieg. Jeder Mann, der einigermaßen arbeiten konnte, war eingezogen worden. Zu Hause blieben nur die alten Männer, die Invaliden und die Frauen zurück. Auf den Höfen aber musste die Arbeit weitergehen. Deshalb griff man auf die Kinder zurück. Schon die zwölfjährigen Schulkinder ließ man im Sommerhalbjahr zu Hause, weil jede Hand gebraucht wurde. Da hieß es arbeiten, arbeiten, arbeiten.
Als ich vierzehn war, ist mir nicht mal die Idee gekommen, dass ich einen Beruf erlernen könnte oder müsste. Vor lauter Arbeit habe ich nicht nach rechts und nicht nach links geschaut. Ich wusste gar nicht, dass es außer Landwirtschaft auch noch etwas anderes gab. Selbst im Spätherbst gab es genug Arbeit für mich. Wie ein Fuhrknecht musste ich mit den Rössern in den Wald und Brennholz für den Winter einfahren.
Als der Zweite Weltkrieg beendet war, begann ein völlig neues Leben für uns. Die Grenze zwischen Deutschland und Österreich wurde wieder geschlossen. Es herrschte Notzeit, hüben wie drüben. Deshalb blieb es nicht aus, dass die grenznahen Bewohner versuchten, für sich und ihre Familien Nahrungsmittel zu beschaffen. Es gab Sachen, die sie drüben hatten und die wir brauchen konnten, und solche, die wir hatten, die man aber in Deutschland brauchte. Deshalb entstand bald ein lebhafter ›kleiner Grenzverkehr‹. Wir Kinder wurden rechtzeitig abgerichtet zu schweigen. Die Eltern schwiegen sowieso über ihre illegalen Grenzgänge.
An den offiziellen Stellen konnte man die Grenze für Schmuggelgänge natürlich nicht überschreiten. Aber die grüne Grenze war ja lang genug, und es gab ausreichend Schlupflöcher. Die kannten aber nicht nur wir – das war auch den Grenzbeamten bekannt. Deshalb patrouillierten sie in unregelmäßigen Zeitabständen Tag und Nacht entlang der Grenze. Wollte man etwas über die Grenze schmuggeln, galt es also einen Zeitpunkt zu erwischen, an dem die Grenzer die ausgewählte Stelle gerade passiert hatten. Dann konnte man davon ausgehen, dass man für eine kurze Zeit vor ihnen sicher war.
Kurzum: Schmuggeln war bald alltäglich und gehörte bei allen ›Anrainern‹ zum Alltag. Auch meine älteren Geschwister hatten ihre ›Grenzerfahrungen‹ gemacht. Einige von ihnen hatten sogar Spaß an dem Schmuggelgeschäft und machten sich einen gewissen Sport daraus. Für sie war das ein gewisser Nervenkitzel: Komme ich durch oder werde ich erwischt?
Ich war bis zu meinem fünfzehnten Geburtstag vor solchen Schmuggelgängen verschont geblieben. Aber kurz danach war ich dran.
»So, Nandl, jetzt bist du an der Reihe«, bestimmte der Vater. »Du gehst zum Moosbauern und holst zwei Ferkel.« Er drückte mir mit der mageren Erklärung: »Da tut der Moosbauer die Schweindl rein«, einen Rupfensack in die Hand. Alles andere hatte er wohl mit dem Moosbauer schon abgesprochen.
Bei diesem Auftrag war mir gar nicht wohl, ich wagte aber nicht, dem Vater zu widersprechen. Wir hatten ja nicht nur im Religionsunterricht gelernt: ›Du sollst Vater und Mutter ehren.‹ Es war mir auch von der Großmutter und von der Mutter eingeimpft worden.
Bevor mich Vater mit dem Sack in die eisige Nacht entließ, beschrieb er mir noch genau, wo und wie ich zu gehen hatte. Er hatte eigens eine mondhelle Nacht abgewartet, damit ich mich besser zurechtfinden sollte. Vater trat mit mir vors Haus und schaute sich wie ein witterndes Wild nach allen Seiten um. Nichts Verdächtiges war zu sehen oder zu hören. Um aber ganz sicher zu sein, ging er zurück ins Haus und holte den Hund. Den nahm er an die lange Leine. Sofort sauste der Hund in Richtung Grenze, zerrte an der Leine und bellte ganz fürchterlich. Der Vater hatte Mühe, ihn wieder zurück zu ziehen. Ohne ein Wort zu sagen, bedeutete mir der Vater, dass ich wieder ins Haus gehen sollte. Erst hinter der geschlossenen Stubentür klärte er mich auf.
»Das hat jetzt keinen Wert. Die Grenzer sind ganz in der Nähe. Sonst hätte der Hund nicht angeschlagen.«
Nach einer halben Stunde wagte mein Vater den zweiten Versuch. Mein Herz schlug bis zum Hals. In der Wartezeit war mein bisschen Mut bis auf den Nullpunkt gesunken. Aber den Auftrag abzulehnen, wagte ich nicht. Diesmal blieb der Hund ruhig.
»Du kannst gehen«, entschied der Vater. »Die Luft ist jetzt für mindestens eine halbe Stunde rein. In der Zeit kannst du den Hin- und Rückweg leicht schaffen.«
Zaghaft tappte ich in die Nacht hinaus. Unter mir lag ein halber Meter Schnee. Aber ich sank nicht ein. Mein Vater hatte mit Absicht eine sehr frostige Nacht gewählt, in der der Schnee verharscht war. Das erleichterte mir nicht nur das Gehen, es verhinderte auch, dass ich Spuren hinterließ. Schnell hatten sich meine Augen an das Halbdunkel gewöhnt. Bald schritt ich auf dem Schnee so zügig voran, als ginge ich über Beton. Ich hatte den Eindruck, es sei taghell, denn das Mondlicht wurde vom Schnee reflektiert. ›Wenn ich aber so gut sehe, so werden mich die Grenzbeamten ebenso gut sehen können‹, fürchtete ich. Meine Angst steigerte sich. Immer schneller hastete ich meinem Ziel entgegen.
Unbehelligt erreichte ich den beschriebenen Bauernhof. Auch dort wurden keine überflüssigen Worte gemacht. Der Moosbauer steckte, ohne dass ich danach fragen musste, die beiden entzückenden Schweinchen in den Sack, band ihn zu und hängte ihn mir so geschickt über die Schulter, dass eines der Ferkel auf meiner Brust zu liegen kam, das andere wärmte meinen Rücken.
Wortlos marschierte ich wieder hinaus in die Kälte. War es das Schütteln bei jedem Schritt? War es die Finsternis in dem Sack? Oder war es die Kälte? Nach wenigen Metern jedenfalls fingen die Schweinchen fürchterlich an zu quieken. Mir blieb das Herz fast stehen. ›Du lieber Gott‹, dachte ich, ›was wird denn jetzt? Jetzt brauchen die Zöllner mich gar nicht erst zu sehen, sie werden mich schon von der Ferne hören.‹
Wie ein gehetztes Wild jagte ich vorwärts. Nicht nach rechts und nicht nach links wagte ich zu schauen. Sobald mich die Beamten erblickt haben würden, gab es keine Fluchtmöglichkeit mehr für mich. Meine quiekende Last würde ihnen auf jeden Fall meinen Standort verraten. Also schaute ich immer nur stur auf den Boden, damit ich nicht in eine Vertiefung geriet oder über einen Buckel stolperte. Dann wäre ich ohnedies verloren gewesen. Alle Heiligen im Himmel rief ich an. Ich flehte, sie mögen mir beistehen, damit ich unbehelligt mit meiner Beute nach Hause komme.
Es war wirklich nicht weit vom Moosbauern bis zu uns. Aber diese Viertelstunde kam mir vor wie eine Ewigkeit. In der mondhellen Nacht, auf dem strahlenden Schnee, mit den quiekenden Ferkeln war ich die ideale Zielscheibe der Grenzer. Nie in meinem ganzen Leben, weder vorher noch nachher, habe ich eine solche Angst ausgestanden. Ich hatte keine genaue Vorstellung davon, was geschehen würde, wenn man mich erwischte. Auf jeden Fall aber etwas Furchtbares. Deshalb hastete ich, wie von Furien gejagt, weiter und weiter. Rundum blieb alles still. Nur das impertinente Quieken hinter mir und vor mir gellte durch die Nacht. Mein Herz pochte so heftig, dass ich mir einbildete, man könnte es hören. Aber ich hatte Glück. Es kam niemand. Es rief niemand. Es schoss niemand.
Mit Schweißperlen auf der Stirn, völlig außer Atem, erreichte ich unser Haus, erreichte ich die Stube. Sichtlich angespannt saß der Vater auf der Ofenbank. Ich nahm den Sack von der Schulter und legte ihm die Ferkel vorsichtig vor die Füße.
»Vater, da hast du deine Schweinderl«, keuchte ich, »aber das eine sag ich dir: Ferkel über die Grenze tragen, das tu ich nimmer.«
Das brauchte ich auch nicht mehr. Denn noch bevor ich meinen sechzehnten Geburtstag beging, nahm mein Leben erneut eine Wende.
Wie ein Märchenprinz stand einige Monate nach dem Schweinchenschmuggel mein Onkel Pepi vor mir. Ich hätte mir diese Situation selbst in meinen kühnsten Träumen nicht ausmalen können. Deshalb kam es mir vor, als wäre er gekommen, um die verwunschene Prinzessin zu erlösen.
»Ach, Nandl, ich tät dich halt so notwendig brauchen, zum Stallgehen«, sagte er die inhaltsschweren Worte.
Es war, als hätte der Himmel ihn geschickt. Gerade jetzt war ich seit der Schweinchengeschichte in einem besonderen seelischen Tief, das mir das Leben in meinem Elternhaus, in dem ich mich noch immer nicht wohlfühlte, noch schwerer machte.
Am liebsten wäre ich stehenden Fußes mit meinem ›Märchenprinzen‹ auf und davon gegangen. Aber das war unmöglich. Onkel Pepi musste erst noch mit meinen Eltern reden. Meine Mutter, die ja seine Schwester war, jammerte, dass sie mich im nächsten Sommer dringend auf der Alm bräuchten. Der Pepi versicherte ihr, dass ich im nächsten Frühjahr wieder zurück sei. Da gab sie ihr Einverständnis.
Diese Aussicht erfreute mich natürlich nicht. ›Aber erst bist du mal für eine Weile weg‹, redete ich mir gut zu und packte hastig meine Sachen zusammen. Auf dem Weg nach Bichlach war ich der glücklichste Mensch, den man sich denken konnte.
Mit offenen Armen nahm mich die Großmutter wieder auf, und ich bezog wieder das Bett an ihrer Seite. Wohnen tat ich also wieder bei ihr, aber zur Arbeit ging ich zu meinem Onkel. Ja, war das schön! Kaum war ich dort, waren meine alten Wurzeln wieder neu entflammt. Es war, als sei ich nie weg gewesen.
Meine Cousins waren zu patenten und lebhaften Buben herangewachsen, zwischen neun und zwölf waren sie jetzt. Sie zogen ihre Freunde herbei, und grad lustig war’s. Was haben wir für Spaß miteinander gehabt! Auch noch, als die Buben dann älter wurden. Da sind die jugendlichen Freunde zum Kartenspielen gekommen. Der eine oder andere hätte schon Interesse an mir gehabt.
Vorsichtig fragten sie bei Peperl an.
»Du kannst es versuchen«, war jedes Mal seine Antwort. »Da geht aber nix.« Auf diese Weise blieb die Harmonie in der Gruppe erhalten. Keiner brauchte auf den andern eifersüchtig zu sein. Und ich war die ›Henne im Korb‹ und vor Zudringlichkeiten sicher.
Während ich auf dem Hof meiner Eltern für die Pferde zuständig gewesen war, musste ich mich auf dem Hof des Onkels um die Kühe kümmern. Die Umstellung fiel mir nicht schwer. Zu Hause war ich daneben noch Kindsmagd gewesen und bei Bedarf Köchin. In absehbarer Zeit sollte ich auch noch Sennerin werden.
So ging das über mehrere Jahre hin: Im Winter arbeitete ich bei meinem Onkel als Stallmagd, im Sommer arbeitete ich auf der elterlichen Alm als Sennerin. Mir kommt es heute so vor, als sei ich immer herumgereicht worden. Ich habe mich herumreichen lassen. Jeden Posten, der mir zugeteilt wurde, habe ich voll und ganz ausgefüllt.
Die Arbeit auf der Alm hat mir Freude gemacht, weil ich mein eigener Herr war. Faulenzen konnte ich nicht dort oben, es musste ja alles erledigt werden. Aber ich konnte mir meine Zeit einteilen, und niemand redete mir drein.
Der Nachteil des Almlebens war die Einsamkeit. Den ganzen Tag über hatte ich niemanden zum Reden. Deshalb grübelte ich viel und wurde vielleicht ein bisschen schwermütig. Vielleicht wirkte in meinem Unterbewusstsein auch noch nach, dass ich als Achtjährige fortgeschickt worden war, und dass ich mich zu Hause nie akzeptiert und immer ausgegrenzt gefühlt hatte. Jetzt war ich auf der Sennhütte wirklich ausgegrenzt. Fernab von der Familie, fernab von allen Verwandten und Freunden hockte ich mutterseelenallein auf der Alm.
Die einzige Abwechslung des Tages war, wenn ich am Abend die Sahne zu Tal brachte. Das machte mir nicht nur Freude, es ersparte mir auch die Mühe des Butterstampfens. Weil die Alm nicht allzu weit von meinem Elternhaus entfernt lag, konnte man die Sahne leicht jeden Abend hinunterbringen. Das Buttern übernahm die Mutter selbst. Sie war nämlich schon so fortschrittlich, dass sie einen Motor an ihrem Butterfass hatte. So war das Buttermachen auch für sie nicht mehr so anstrengend und zeitraubend. Wenn ich unten war, nahm ich am gemeinsamen Essen teil. Das ersparte mir nicht nur das Hinaufschleppen von meinen Lebensmitteln, es ersparte mir auch das Kochen auf der Alm. Kochen hätte ich eh nicht können dort. Es gab keinen Herd. Nur Brot nahm ich auf dem Rückweg zur Alm mit, damit ich was fürs Frühstück und für die Brotzeit hatte.
In meinem zweiten Almsommer wurde es besser. Da war meine Schwester Burgi immer wieder mal eine Woche lang bei mir auf der Alm. Dort kamen wir uns ein bisschen näher. Endlich hatte ich das Gefühl, eine Schwester in ihr zu haben. Leider blieb es bei dem einen Sommer. Mit achtzehn heiratete sie nämlich, und ich war wieder verlassen.
Dass ich fast die Hälfte des Jahres auf der Alm verbrachte und die andere Hälfte bei meinem Onkel, war nicht dazu angetan, die Familienbande zu festigen. Meine Mutter mochte mich sicher, aber sie blieb mir fremd. Mein Vater ebenso. Und ganz zu schweigen von meinen Geschwistern. Nur zu meinem ältesten Bruder, dem Matthias, entwickelte sich ab einem gewissen Alter so etwas wie ein geschwisterliches Verhältnis. Doch davon später.
Wenn mir die Tage auf der Alm lang und langweilig wurden, war die Aussicht auf den Winter mein einziger Trost. Im Winter hatte ich wieder ›meine Familie‹, meine Wärme, meine Geborgenheit im Hause der Großmutter.
Inzwischen war ich in dem Alter, wo ein Mädchen auch mal gerne ausgehen mochte. Aber Großmutter war in diesem Punkt streng und unerbittlich. Sie hütete mich wie ihren Augapfel. Da ich ja nach wie vor in dem Bett neben dem ihren schlief, war an ein heimliches Ausbrechen nicht zu denken.
In dieser Zeit wurde mir mein Bruder Matthias ein Freund und eine große Hilfe. An manchen Samstagabenden durfte er mich zum Tanzen oder Ausgehen abholen. Wenn ich mit ihm ausging, hatte meine Großmutter nichts dagegen. Matthias führte mich zu verschiedenen Festlichkeiten mit Musik und Tanz. Wie jedes junge Mädchen genoss ich es, umschwärmt zu werden. Vielleicht genoss ich es noch ein bisschen intensiver als andere, weil ich schon früh die Erfahrung gemacht hatte, ausgestoßen, abgeschoben und abgelehnt zu werden. Jetzt gehörte ich dazu, endlich. Ich war wer. Ich wurde geschätzt. Diesen Zustand fand ich so himmlisch, dass ich mich an keinen meiner Verehrer binden wollte. Immer neu umworben zu werden, das genoss ich auf jedem Ball.
Dieser herrlichen Leichtigkeit, der ich mich nach einer schweren, arbeitsreichen Kindheit hingeben wollte, bereitete mein Bruder mit einem Machtwort ein Ende.
Es gab da einen Burschen, der schon seit längerer Zeit ernste Absichten mir gegenüber bekundete. Er war mit meinem Bruder befreundet. Eines Tages machte mir mein Bruder Vorhaltungen.
»Was du bis jetzt mit den Burschen gemacht hast, war mir egal. Mit dem Adi aber spielst du nicht. Der meint es ehrlich. Der ist ein Mann fürs Leben.«
›Red du nur‹, dachte ich.
Kurz nach dieser Verwarnung waren Matthias und ich zu einer Hochzeit eingeladen. Auch der Adi war da. Ich beachtete ihn kaum. Es gab ja so viele andere, die mich zum Tanzen holten und mir schmeichelhafte Worte zuflüsterten. Auch ein ganz Verwegener war dabei. Einer, der sogar schon ein Motorrad besaß! Er schwärmte mir unablässig von seiner tollen Maschine vor. Das machte mich neugierig, und ich bat ihn um eine Probefahrt. Den Wunsch erfüllte er mir nur gar zu gerne.
Wir fuhren aber nicht nur ins Blaue, sondern der junge Mann steuerte einen kleinen Gasthof im Nachbarort an. Dort trank er ein Bier und ich eine Limonade. Es war alles völlig harmlos. Wir plauderten eine Zeit lang, und dann traten wir die Rückfahrt an.
Als wir von unserem Ausflug zur Hochzeitsgesellschaft zurückkamen, war mein Bruder bereits aufgebrochen. Nun schlug mir das Gewissen aber doch ein wenig. Deshalb bat ich meinen Begleiter, mich mit dem Motorrad nach Hause zu bringen.
Wir waren natürlich lange vor Matthias zu Hause, der den Weg zu Fuß zurückgegangen war. Ich empfing ihn spöttisch.
»Ja, wo warst du denn so lange? Ich bin schon seit einer Ewigkeit daheim.«
Matthias ging auf diesen Scherz nicht ein. In erschreckend ernstem Ton sagte er nur einen einzigen Satz.
»Das hast du nur einmal gemacht.«
Diese Worte beeindruckten mich zutiefst. Von dieser Stunde an waren alle anderen Männer für mich abgeschrieben. Für mich existierte nur noch der Adi. Dass ich mich so entschieden habe, habe ich nie bereut. Deshalb bin ich meinem Bruder für seine Zurechtweisung dankbar bis auf den heutigen Tag.
Was ich in meiner Kindheit und Jugend an Bildung alles versäumt habe, merkte ich erst im Erwachsenenalter. Erst da sah ich, dass es noch viele andere Dinge gab, von denen nichts bis zu uns auf den Bergbauernhof gedrungen war. Trotzdem hatte ich genug Selbstbewusstsein, um nicht darunter zu leiden. Mein Leben lang hatte ich das Gefühl, dass das, was ich mache, richtig ist. Alles, was mir aufgetragen wurde, erledigte ich mit großer Selbstsicherheit. Diese Haltung verdanke ich meinem Vater. Er hat zwar wenig geredet, und wir hatten auch nur wenige Berührungspunkte. Aber den einen entscheidenden Satz von ihm habe ich mir gemerkt, und der war wegweisend für mein ganzes Leben:
»Kinder, an dem Stecken, an den man gebunden wird, muss man ziehen.«
Große Liebe zu kleinen Tieren
Sieglinde, Jahrgang 1925, aus München
Drei große Hobbys hatte ich mein Leben lang: den Garten, meine Tiere und das Lesen. Das fing alles schon in meiner Kindheit an.
Mein Vater war Lehrer in München gewesen. Deshalb wurde ich dort geboren. Bei meiner Geburt war mein Vater maßlos enttäuscht darüber, dass ich kein Junge war. Er schaute mich nicht mal an. Meine Mutter war so sehr gekränkt, dass sie in Tränen ausbrach und immer wieder bat: »Schau dir das Kind doch wenigstens mal an.« Schließlich tat er das, damit sie endlich Ruhe geben sollte. In diesem Moment muss ich einen Mundwinkel verzogen haben, wie das bei Neugeborenen öfters vorkommt. Er hielt es für ein Lächeln. Darüber war er so glücklich, dass er mich aus der Wiege nahm. Er drückte mich so fest an sich, dass die Mutter jetzt wieder Angst bekam, er könnte mich gar zerdrücken.
Mein erstes Wort war nicht Mama oder Papa, wie das normalerweise bei Kindern üblich ist. Mein erstes Wort war ›Rüssel‹. Da muss ich gerade ein Jahr alt gewesen sein, und wir waren zu Besuch bei meiner Tante in Nürnberg. Die Tante besaß einen kleinen Hund. Wegen seiner langen Schnauze hieß der ›Rüssel‹. Von diesem Hund muss ich so fasziniert gewesen sein, dass ich zum Staunen aller Anwesenden auf einmal »Rüssel, Rüssel« krähte.
Schon bald nach diesem Erlebnis wurde mein Vater nach Roth bei Nürnberg versetzt. Deshalb habe ich keine Erinnerung mehr an die Münchener Zeit.
In Roth war es herrlich. Das war ein sehr kleiner Ort, in dem absolut nichts los war. Wir wohnten in einer Sackgasse. Der ganze Verkehr dieser Straße war das Postauto, das morgens wegfuhr und abends wiederkam.
Wir wohnten in der ersten Etage eines Zweifamilienhauses, das von einem großen Garten umgeben war. Im Erdgeschoss lebte noch ein anderes junges Ehepaar. Deren Tochter Helga war in meinem Alter und wurde bald meine beste Freundin.
Gleich hinter unserem Garten schloss sich der Wald an. Auch der Bach war nicht weit weg. Das war schon sehr idyllisch. Und einen Haufen Kinder gab es in der Nachbarschaft auch. Das war etwas für mich als Einzelkind! Mit denen konnte ich überall nach Herzenslust spielen, auf der Straße, im Wald, am Bach. Es war das reinste Kinderparadies.
Wie gesagt, tierverrückt war ich von Anfang an. Schon als ganz kleines Putzele brachte ich es fertig, mit Helga vor einem Ameisenhaufen zu hocken. Es wurde uns nie langweilig, zuzuschauen, wie die fleißigen Tiere hin und her liefen und kleine Äste oder Blätter herbeischleppten. Hatte einer unserer Spielkameraden, aus Unachtsamkeit oder mit Absicht, einen Ameisenhaufen gestört, konnte ich in Tränen des Mitleids und der Wut ausbrechen. Dann setzte ich mich vor den Bau und beobachtete das geschäftige Treiben der Ameisen, wie sie ihre Eier in Sicherheit brachten, und wie sie sich abmühten, den Schaden wieder zu beheben.
Als wir beide, die Helga und ich, schon in die Schule gingen, hatten wir einen neuen ›Sport‹. Wir setzten Weinbergschnecken in eine Reihe und warteten voll Spannung, welche als Erste ›losrannte‹ und welche Sieger wurde. Wir haben die Tiere bestimmt nicht gequält. Aber meine Mutter machte unserem Spaß bald ein Ende. Das wäre Stress für die Tiere, behauptete sie.
Uns Kindern erging es damals viel besser als den heutigen Kindern. Heute ersticken sie an Übersättigung und haben trotzdem Langeweile. Langeweile war für uns ein Fremdwort. Wir spielten Fangen, Verstecken; wir waren Räuber und Gendarm und Indianer mit Wigwam und Marterpfahl. Mit einer primitiv gemachten Peitsche brachten wir Holzkreisel zum Tanzen. Aus Eichenblättern bastelten wir uns Kronen, setzten sie aufs Haupt und fühlten uns wie die Könige. Wir waren rundum glücklich. Und Süßigkeiten, wann bekamen wir schon mal Süßigkeiten? Die Kinder heute haben Süßigkeiten im Überfluss, und können nicht nachvollziehen, was für eine Bedeutung diese für uns hatten.
Mein Glück war riesig, wenn ich mir ein ›Viertel Liliput‹ kaufen durfte. Das waren kleine, saure Bonbons. Hundertdreizehn Stück passten in eine Tüte und kosteten siebzehn Pfennig. Die bekam ich immer dann, wenn wir nach Nürnberg fuhren. Das kam vielleicht zweimal im Jahr vor.
An Weihnachten stand als Einziges auf meiner Wunschliste: ein Viertel Goldnüsse für fünfunddreißig Pfennig. Ist das heute noch vorstellbar?
Apropos Weihnachten. Da fällt mir eine Geschichte ein, die ereignete sich, als ich zwischen vier und fünf Jahre alt war. Es war am Nachmittag des Heiligen Abends. Die Gans für das Abendessen war schon im Ofen. Meine Mama wollte schnell noch etwas besorgen. Ich solle schön brav beim Papa bleiben, war ihre Ermahnung. Dem fiel aber kurz danach auch noch ein, dass er noch mal fort müsse. Ich solle schön brav in meinem Zimmer bleiben, sonst käme der Pelzmärtl und hole mich, warnte er mich beim Weggehen.
Den Pelzmärtl kannte ich. Bei uns in Franken ist es der Brauch, dass der am 11. 11., also am Martinstag, die Kinder besucht – so wie das anderswo am 6. 12. der Nikolaus tut. Den Brauch, dass der Nikolaus kommt, kennt man bei uns dagegen nicht. Der Pelzmärtl ist ebenso gewandet wie der Nikolaus und ebenso ausgestattet mit Sack und Rute. Die braven Kinder bekommen kleine Geschenke, wie Äpfel und Nüsse. Die bösen Kinder dagegen erwartet Bestrafung durch Sack und Rute.
Durch die gut gemeinte Ermahnung meines Vaters war ich so verängstigt, dass ich am ganzen Leibe zitterte. Völlig allein in meinem Zimmer fühlte ich mich so verlassen, dass ich unters Bett kroch. Wenig später klingelte es an der Haustür. In meiner Angst befürchtend, dass das der Pelzmärtl sei, wagte ich mich nicht aus meinem Versteck hervor. Es war jedoch meine Mama, die den Hausschlüssel vergessen hatte. Da niemand aufmachte, ging sie um das Haus herum. Unter meinem Zimmerfenster rief sie, ich solle aufmachen.
»Ich kann nicht aufmachen«, rief ich zurück, »sonst kommt der Pelzmärtl!«
Immer wieder rief meine Mutter: »Mach bitte auf! Ich bin es doch, die Mama.«
Da ich mich trotzdem nicht rührte, ging sie nach einiger Zeit weg, um meinen Vater zu suchen. Sie fand ihn jedoch nicht. Sie kehrte zurück und rief wieder unter meinem Fenster.
»Nein, ich mach nicht auf«, war meine erneute Antwort.
Sie wollen wissen, wie es weitergeht?Dann laden Sie sich noch heute das komplette E-Book herunter!
Weitere E-Books von Roswitha Gruber
Vom Zauber der Kindheit
Großtüter erzählen
eISBN 978-3-475-54371-5 (epub)
Kindheit und Jugend früher – wie erging es den Großmüttern von heute? Roswitha Gruber schildert anschaulich das Leben in der »guten alten Zeit«, welches natürlich auch nicht immer frei von Sorgen und Nöten war. Auf dem Land gab es viel harte Arbeit. Es galt Kriegs- und Nachkriegsnöte zu überstehen. Daneben erzählen die Geschichten von Kinderstreichen, von lustigen und traurigen Begebenheiten, Glücks- und Unglücksfällen, der Suche nach einem passenden Beruf oder der großen Liebe.
Wunderbare Kindertage
Großmütter erzählen
eISBN 978-3-475-54342-5 (epub)
Roswitha Gruber erzählt die bewegenden Geschichten und Schicksale einer Generation, die ohne technische Hilfsmittel und ohne viel Luxus groß geworden ist. Das persönliche Glück musste in dieser Zeit oftmals zugunsten wirtschaftlicher oder familiärer Interessen zurückstehen. Eine unbeschwerte Kindheit blieb den meisten verwehrt. Und dennoch blicken viele von ihnen mit Freude und Sehnsucht zurück in die Vergangenheit und erinnern sich gerne an den Zauber ihrer Kindertage.
Besuchen Sie uns im Internet:www.rosenheimer.com