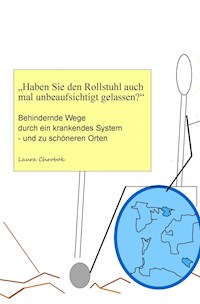
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Ist man eine Behinderung, wenn man eine Behinderung hat? Eine provokante, aber in Zeiten, in denen viel über Inklusion diskutiert wird, nicht unberechtigte Frage. Manchmal lautet die ehrliche Antwort auf diese Frage wohl "ja"! Manchmal glaube ich, in der Wahrnehmung Außenstehender mit meinem Rollstuhl zu verschmelzen. Nicht immer wird zwischen dem Menschen und dem "Problem" unterschieden. Ich bin Rollstuhlfahrerin, also ist mein Leben (wie das vieler anderer Behinderter) nicht ganz normal. Stattdessen war es bereits sehr ereignisreich. Dieses Buch handelt von vielen schwierigen Situationen, aber auch von schönen Reisen, welche ich als Körperbehinderte (auch in unwegsames Gelände) unternehmen konnte. So z. B. Israel, London und New York City... Ich schrieb über den Umgang eines Kindes mit der Krebsdiagnose der Mutter. Über Therapie(un)möglichkeiten. Vor allem bezogen auf meine Zerebralparese, aber auch auf ihren Klatskin-Tumor. Über die langjährige, bisweilen frustrierende Jobsuche trotz guter Qualifikationen, um die (trotz Gleichstellungsgesetz) hart gekämpft werden musste. Hoffentlich werden meine kurzen Berichte von Menschen mit und ohne Behinderung als kurzweilig und informativ, im Idealfall auch als hilfreich wahrgenommen. - Danke fürs Durchblättern!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 82
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
"Haben Sie den Rollstuhl auch mal unbeaufsichtigt gelassen?": Behindernde Wege durch ein krankendes System – und zu schöneren Orten
ImpressumVorwort Der Start: Warum einfach, wenn es auch schwer geht?Das „System für intensive neurophysiologische Rehabilitation“Therapien und Alternativen?Murmeltier trifft KrankenkasseFürs Leben lernen – auch im latenten Chaos Ein Rollstuhl auf ReisenNoch etwas mehr Chaos Langzeitarbeitslos, aber nicht wirklich ohne ArbeitNew York City - If I can make it there, I‘ll make it anywhere!Am seidenen FadenLondon calling! Ende offenKlappentextHerausgeberin & COPYRIGHT FÜR BUCH & COVER: Laura Chrobok
32825 Blomberg
Vorwort
Dieses Buch schreibe ich eher aus einer gewissen Ratlosigkeit, denn aus einer bestimmten Motivation heraus. Fremden Menschen erzähle ich eigentlich nicht gerne meine Lebensgeschichte. Das tut mein Vater (wie bereits von Kindheit an) zur Genüge für mich. Aber das scheint mir besser zu sein, als gar nichts zu tun.
Ich heiße Laura Maria Chrobok, wobei mich niemand „Maria“ nennt. Ich bin Rollstuhlfahrerin. Stärker definiere ich mich aber darüber, arbeitssuchende Bürokauffrau zu sein. Aufgewachsen mit drei älteren Brüdern, vielen Pflege-Geschwistern und einer krebskranken Mutter, eignete ich mir früh eine kommunikative, diplomatische, aber auch direkte Umgangsform an. So agierte ich auch während meiner Ausbildungszeit in einem Berufsbildungswerk in Hannover. Dort absolvierte ich meine Ausbildung, da ich auf dem „freien Markt“ aufgrund meiner Behinderung keinen Ausbildungsplatz fand. Ohne wehleidig klingen zu wollen: Damit befand ich mich, trotz guter Bildung (und anerkannter Berufsausbildung) quasi automatisch auf einem Abstellgleis ... Und das ist nicht etwa die Schuld der Berufsbildungswerke (BBWs), sondern vielmehr die des freien Marktes.
Nun bin ich fast dreißig und nach wie vor arbeitssuchend. Deshalb sitze ich abends im Halbdunkeln hier im Wohnzimmer meines Vaters und seiner zweiten Ehefrau und schreibe ein Buch. Über mich. Mein Leben. Was dafür, dass ich ein Durchschnittsmensch bin, gar nicht mal so uninteressant ist. Ich schreibe es, um die Initiative zu ergreifen, meine mich zeitweilig überkommende Resignation abzuschütteln. Und, um anderen Menschen mit ähnlichen Erfahrungen ein wenig Hilfestellung, vielleicht auch etwas Hoffnung, zu geben. Ich möchte über den Umgang eines Kindes mit der Krebsdiagnose der Mutter schreiben. Über Therapie(un)möglichkeiten. Vor allem bezogen auf meine Zerebralparese, aber auch auf ihren Klatskin-Tumor. Über das Reisen als Körperbehinderte auch in unwegsames Gelände. Über die langjährige, bisweilen frustrierende Jobsuche trotz guter Qualifikationen, um die (trotz Gleichstellungsgesetz) hart gekämpft werden musste. Ohne meine Eltern gäbe es mich logischerweise gar nicht. Da diese Grundvoraussetzung gegeben ist darf ich sagen, ohne den Kampfeswillen meiner Mutter wäre es heute wohl noch sehr viel schlechter um mich bestellt. Daher möchte ich am Beginn meiner Geschichte auch ihre erzählen.
Der Start: Warum einfach, wenn es auch schwer geht?
Meine Eltern stammen aus Oberschlesien und kamen 1981 als Spätaussiedler ins Ruhrgebiet, wo der Bruder meines Vaters bereits mit seiner Familie lebte (und es noch heute tut). Vor ihrer Ausreise aus Polen hatte mein Vater Leonhard Chrobok eine leitende Position im Bereich Transportwirtschaft in der Kommunalverwaltung Oberschlesien inne. Meine Mutter Aniela Chrobok war als Grundschullehrerin tätig gewesen und hatte auch meine Brüder Thomas und Arkadius unterrichtet. (Eine lustige Tatsache, wie ich finde, denn in Deutschland wäre so etwas vermutlich undenkbar. Angeblich lag die Intention dahinter aber nicht in einer Bevorzugung, sondern vielmehr einer besonderen Strenge.) Meine Eltern wiederum hielten es für undenkbar, dass die polnischen Behörden ihnen eine als endgültig anzusehende Ausreise aus Polen genehmigen würden. Um also den Anschein einer bloßen Urlaubsreise zu wahren, ließen sie beide Kinder, elf und zwölf Jahre alt, in der Obhut unserer Großmutter väterlicherseits zurück. Erst nach mehreren Monaten wurde den beiden gestattet, ihren Eltern zu folgen. Als wenige Jahre später unsere Großmutter mütterlicherseits verstarb, planten unsere Eltern, zu ihrer Beerdigung nach Polen zu fahren. Davon riet ihr Schwager, damals Vize-Chef der Kriminalpolizei in Beuthen, ihnen allerdings energisch ab. Aus Sorge darüber, dass sie an einer erneuten Ausreise gehindert werden könnten. Ob seine Bedenken berechtigt waren oder nicht, vermag ich nicht zu beurteilen. Unsere Eltern jedenfalls wohnten der Beerdigung nicht bei. Kurz nach der Geburt meines knapp sieben Jahre älteren Bruders Sebastian zogen sie von Herten nach Barntrup in Ostwestfalen-Lippe. Im „Westfälischen Kinderdorf Lipperland“, nicht zu verwechseln mit den SOS-Kinderdörfern übrigens, arbeiteten sie zunächst ehrenamtlich als Pflegeeltern. Ein „24/7-Job“. Sie ließen sich zu Erziehern umschulen, noch bevor die Leitung des Kinderdorfs begann, ihre Mitarbeiter zu bezahlen. Wir lebten in einem nicht sehr großen Haus mit bis zu acht Kindern unterschiedlicher sozialer und ethnischer Herkunft und unterschiedlichen Alters. Ich vermag nicht zu sagen, wie vielen Kindern mein Vater in ca. dreißig Jahren Tätigkeit ein Zuhause auf Zeit gab, gemeinsam mit unserer Mutter und später unserer Stiefmutter. Daher kann ich mich kaum erinnern, wer wann ins Haus kam oder wieder ging. Gleiches gilt in ähnlicher Weise für die Mitarbeiter. Schwerlich hätte mir aber entfallen können, dass mein ältester Bruder Arkadius zeitweise als Erzieher bei uns arbeitete. Verschiedene Menschen kennenzulernen, erweiterte von frühster Kindheit an meinen Horizont. Mein Bruder Sebastian und ich, wir wuchsen als Nachzügler der leiblichen Familie aber auch mit einer gewissen Demut auf. Denn wir wussten wertzuschätzen, was wir hatten, da uns vor Augen geführt wurde, dass es Kindern andernorts fehlte. Im Laufe der Jahre wies die Kinderdorf-Leitung unserer Familie, d. h. insbesondere Vater, verstärkt die „Schwererziehbaren“ zu. Es war oft laut, manchmal chaotisch bei uns, doch er wusste mit diesen Jungs umzugehen. Einige Male informierte er auch die Polizei darüber, dass ein Jugendlicher nachts – oder auch tags nach der Schule – unbemerkt getürmt war. Weil ich dort hineingeboren wurde, empfand ich dies nie als sonderlich herausfordernd. Aber es hat mich dahingehend geprägt, bei Auseinandersetzungen stets bemüht zu sein, Lösungen zu finden, die möglichst keinen Beteiligten gänzlich unzufrieden zurücklassen. Und ich lernte schnell, mich ungeachtet äußerer Umstände zu fokussieren. Die Kehrseite der Medaille ist vielleicht, dass ich äußerst ungern bei absoluter Stille arbeite.
Mein Leben erscheint mir als ziemlich verworren und bei näherer Betrachtung erkennt man, glaube ich, dass es das immer schon war. So weiß ich z. B. nie so recht, welches Horoskop ich eigentlich lesen sollte. Das, meines errechneten, oder meines tatsächlichen Geburtstermins? Im Januar 1989 wurde ich drei Monate zu früh durch einen Not-Kaiserschnitt entbunden. Glaubte ich wirklich fest an Astrologie, müsste es mich eventuell beunruhigen, dass scheinbar schon meine Geburt „meine“ Sterne in Konfusion gebracht hat.
Infolge des bei der Geburt erlittenen Sauerstoffmangels war es zu Hirnblutungen gekommen, welche meinen Bewegungsapparat geschädigt hatten. Es dauerte mehr als acht Wochen, bis ich aus dem Krankenhaus entlassen wurde. Jedoch blieb schwer absehbar, wie gravierend sich meine Geburtsschädigung auf meine frühkindliche Entwicklung auswirken würde. Bald diagnostizierte man bei mir eine spastische Lähmung, im Fachjargon als Zerebralparese bezeichnet. Doch im Grunde sind Betroffene nicht „paralysiert“. Sie können ihre Gliedmaßen spüren, bewegen und wissen, zumindest theoretisch, welche Bewegungsabläufe zum Ausführen bestimmter Tätigkeiten notwendig sind. Der Bewegungsapparat wird jedoch durch unkontrollierbare Muskelkontraktionen, also Spasmen, je nach Ausprägung der Krankheit mehr oder minder stark beeinträchtigt. Die mich behandelnden Ärzte waren der Ansicht, dass ich das Laufen lernen könnte, wenn ich lernte die Verkrampfungen eigenständig zu lösen. Beispielsweise beim Aneignen von feinmotorischen Fertigkeiten oder Gleichgewichtssinn würde ich lediglich langsamere und kleinere Fortschritte machen, als andere Kinder meines Alters.
Besagte Fortschritte waren tatsächlich sehr klein, trotz physiotherapeutischer Maßnahmen bereits als ich noch ein Baby war. Eines Tages sah mein Vater zufällig eine Talksendung im Fernsehen. Darin sprach ein ukrainischer Professor namens Wladimir Kozijavkin über seine Behandlungsmethode für Menschen, vor allem Kinder, mit ähnlichen Krankheitsbildern wie meinem. Im Alter von fünf Jahren, ich konnte mein Gleichgewicht nicht einmal gut genug halten um frei zu sitzen, flog ich mit meiner Mutter erstmalig zu einem Therapie-Aufenthalt nach Truskavets (internationale Schreibweise) im Westen der Ukraine. Mal für Mal landete eine große Teilnehmergruppe in Lwiw (dt.: Lemberg) und wir fuhren von dort aus mit zwei Bussen in den zu Sowjet-Zeiten überaus beliebten Kurort. Die Straßen dorthin bestanden – und bestehen vielleicht noch heute – vor allem aus Schlaglöchern. Die Busse verfügten nicht über Anschnallgurte und unsere Kolonne wurde stets von der örtlichen Polizei eskortiert. Ob der Schlaglöcher wegen, oder aus Angst vor etwaigen Übergriffen, weiß ich nicht. Dem Kurhotel selbst sah man an, dass es mal sehr ansehnlich gewesen war, seine besten Tage allerdings hinter sich hatte. In aller Regel fiel mindestens einmal im Laufe eines typischerweise zweiwöchigen Aufenthaltes der Strom aus, wodurch auch die Fahrstühle stecken blieben – mit im Rollstuhl sitzenden Kindern darin. Insgesamt war ich neunmal dort, die ersten zwei Male in Begleitung meiner Mutter. Beim allerersten Ukraine-Aufenthalt stellte sich auch der allergrößte Erfolg ein. Ich konnte, quasi von einer Sekunde auf die andere, frei auf der Toilette sitzen und forderte meine Mutter sogar auf, das nicht-behindertengerechte Badezimmer zu verlassen, solange ich „mal musste“.
Das „System für intensive neurophysiologische Rehabilitation“
Den wichtigsten Faktor bei der Therapie könnte man salopp auch als „Knochenbrechen“ bezeichnen. Gelenk- und Wirbelkörper werden manipuliert – also von Hand so durchbewegt, wie ein Patient selbst es nicht könnte – und auf diese Weise neurologische Blockaden und Spasmen in der Muskulatur gelöst. Die Folge solcher Einrenkungen, wie ich es nennen möchte, ist tatsächlich völlige Entspannung. Wie lange diese jedoch anhält, ist von Patient zu Patient verschieden. Parallel zu solchen (etwas rabiat anmutenden) Maßnahmen werden Massagen, Krankengymnastik, Ergotherapie und Ähnliches durchgeführt. Zu meiner Zeit wurden auch noch die "Verabreichung" wärmender Bienenwachsumschläge und Bienenstiche praktiziert. Ähnlich einer Akupunkturnadel wurde der Stachel einer Biene an den Gelenken unter die Haut gedrückt, wodurch die jeweilige Gelenkfunktion verbessert werden sollte.
Als Kind waren diese Bienenstiche für mich ungleich schlimmer als das eigentliche Knochenbrechen, unabhängig davon, dass die Therapeuten sofort bemüht waren, meine Schmerzen durch großzügiges Auftragen von Wundsalbe zu lindern. Eine regelmäßige Folge der Therapie waren für mich auch Kopfschmerzen zu Beginn eines jeden Turnus, da meine Muskulatur den Zustand der Entspannung offenbar schon im Kindesalter nicht mehr gewohnt war.
Später, als solche Reisen meiner Mutter aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr zuzumuten waren, flog ich in Begleitung ihrer Nichte Anna, „Ania“ genannt, und meines Vaters. Und schließlich mit ihm und meiner Stiefmutter, die ich nur Angela nenne. Immer empfand ich es als Opferung von einem Drittel meiner Sommerferien. Doch dies geschah (zum Glück, aus meiner damaligen Sicht) zumindest nicht in neun aufeinander folgenden Jahren.





























