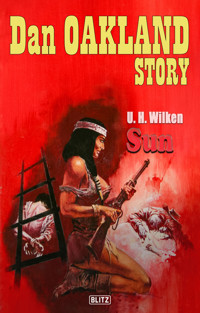Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blattwerk Handel GmbH
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Der Autor steht für einen unverwechselbaren Schreibstil. Er versteht es besonders plastisch spannende Revolverduelle zu schildern und den ewigen Kampf zwischen einem gesetzestreuen Sheriff und einem Outlaw zu gestalten. Er scheut sich nicht detailliert zu berichten, wenn das Blut fließt und die Fehde um Recht und Gesetz eskaliert. Diese Reihe präsentiert den perfekten Westernmix! Vom Bau der Eisenbahn über Siedlertrecks, die aufbrechen, um das Land für sich zu erobern, bis zu Revolverduellen - hier findet jeder Westernfan die richtige Mischung. Lust auf Prärieluft? Dann laden Sie noch heute die neueste Story herunter (und es kann losgehen). »Wir knallen den Marshal ab! Dann holen wir die Jungs aus den Zellen und haun ab! Los, fang an!« Gleich darauf läuteten die Glocken im Turm der altehrwürdigen Kirche von Las Lagrimas. Am Rand der mondhellen Straße verstummte das harte Klirren stählerner Sporen. Reglos lauschte US Marshal Coogan. »Was für ein verdammter Narr läutet da«, knurrte er ärgerlich. Noch hielt er die Winchester gesenkt, doch das Repetiergewehr schussbereit. Coogan rechnete mit jeder Teufelei – und das musste er auch in dieser Nacht! In den engen Zellen hinter dem Sheriffs Office harrten die Gesetzlosen aus zwischen Hoffen und Verzweifeln, Zuversicht und Todesangst. Denn sie alle waren zum Tod durch Erhängen mittels eines Hanfstricks verurteilt. Alles würden sie tun, um aus Las Lagrimas herauszukommen. Mit dem Ausbruch war es nicht getan, sie brauchten ausgeruhte Pferde, weil sie einen zähen und auch gegenüber sich selber harten Verfolger haben würden, eben diesen US Marshal Coogan. Wenn Coogan erledigt war, hatten sie nur noch einen einzigen Mann zu fürchten, und das war der junge schweigsame Sheriff von Las Lagrimas. Doch der konnte nur im kleinen County rund um Las Lagrimas tätig werden. Die Glocken läuteten für sie, als sei dies ihre letzte Stunde. Und die einzige Hoffnung der eingesperrten Banditen war der todesmutige Befreiungsversuch ihrer drei Komplizen, die weit draußen im wilden Grenzland dem Marshal und dem Aufgebot hatten entrinnen können. Der Marshal senkte den Kopf, als wollte er wie ein zorniger Büffel losstürmen und angreifen. Kalt funkelten die Augen, langsam schweifte sein Blick umher, tastete die Häuserfronten ab und versuchte, das Dunkel der Hofeinfahrten zu durchdringen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 140
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die großen Western – 415 –Halbblut Black Rose
U.H. Wilken
»Wir knallen den Marshal ab! Dann holen wir die Jungs aus den Zellen und haun ab! Los, fang an!«
Gleich darauf läuteten die Glocken im Turm der altehrwürdigen Kirche von Las Lagrimas.
Am Rand der mondhellen Straße verstummte das harte Klirren stählerner Sporen.
Reglos lauschte US Marshal Coogan.
»Was für ein verdammter Narr läutet da«, knurrte er ärgerlich.
Noch hielt er die Winchester gesenkt, doch das Repetiergewehr schussbereit. Coogan rechnete mit jeder Teufelei – und das musste er auch in dieser Nacht!
In den engen Zellen hinter dem Sheriffs Office harrten die Gesetzlosen aus zwischen Hoffen und Verzweifeln, Zuversicht und Todesangst.
Denn sie alle waren zum Tod durch Erhängen mittels eines Hanfstricks verurteilt.
Alles würden sie tun, um aus Las Lagrimas herauszukommen.
Mit dem Ausbruch war es nicht getan, sie brauchten ausgeruhte Pferde, weil sie einen zähen und auch gegenüber sich selber harten Verfolger haben würden, eben diesen US Marshal Coogan.
Wenn Coogan erledigt war, hatten sie nur noch einen einzigen Mann zu fürchten, und das war der junge schweigsame Sheriff von Las Lagrimas. Doch der konnte nur im kleinen County rund um Las Lagrimas tätig werden. Sie mussten das County also auf dem schnellsten Weg verlassen …
Die Glocken läuteten für sie, als sei dies ihre letzte Stunde.
Und die einzige Hoffnung der eingesperrten Banditen war der todesmutige Befreiungsversuch ihrer drei Komplizen, die weit draußen im wilden Grenzland dem Marshal und dem Aufgebot hatten entrinnen können.
Der Marshal senkte den Kopf, als wollte er wie ein zorniger Büffel losstürmen und angreifen.
Kalt funkelten die Augen, langsam schweifte sein Blick umher, tastete die Häuserfronten ab und versuchte, das Dunkel der Hofeinfahrten zu durchdringen. Dann blickte Coogan wieder auf die hellen vergitterten Fenster des Sheriffs Office und der Zellen.
»Pass auf, Sheriff!«, sprach er dumpf in den raunenden Nachtwind, während die Glocken laut hallten. »Lass dich nicht überrumpeln, sonst machen sie dich fertig.«
Er meinte mit diesen warnenden Worten den jungen Vertreter des Gesetzes in Las Lagrimas, diesen schweigsamen Hombre, der irgendwann aus der Wildnis des Indianerlandes in diese Town gekommen war und den Stern an seine wildlederne Fransenjacke geheftet hatte.
Coogan meinte Staccato! Staccato, das Naturtalent mit dem Colt.
Das wollte Staccato allerdings nicht hören. Staccato war ein bescheidener und in sich gekehrter Mann, der von Ruhm nichts wissen wollte. US Marshal Coogan hatte jedoch längst erkannt, dass Staccato das Zeug zu einem großen Kämpfer hatte.
Noch immer läuteten die Glocken.
Drüben war am Fenster des Sheriffs Office sekundenlang der Schatten des jungen Staccato zu sehen.
Niemand kam aus dem vollen Saloon, vielleicht hörten die Männer wegen des Krachs die Glocken nicht.
Langsam setzte Coogan sich wieder in Bewegung und ging sporenklirrend über die Main Street.
In diesem Moment gab er ein deutliches Ziel ab. Er wusste das und war deshalb höllisch wachsam.
Nichts geschah.
Die drei Banditen, die ihm nach dem Leben trachteten, lauerten anderswo – nicht hier, so nahe am Office des Sheriffs. Darüber hatte Coogan Klarheit haben wollen.
Ohne Zwischenfall erreichte er den Plankensteg und mied die herausfallende Lichtbahn. An der Tür des Office blieb er kurz stehen, blickte umher und sah nachdenklich auf den Glockenturm der Kathedrale, die in der Mitte der Town mit grauen Mauern und Wänden in den Sternenhimmel ragte.
Es war nicht möglich, dass die Glocken zum Gebet riefen, nicht zu dieser Stunde.
Coogan drückte die Tür auf und trat ein. Sofort schloss er sie wieder, um nicht von draußen unter Feuer genommen werden zu können, und legte die Winchester dann auf den alten und von vielen Schnitzereien verunzierten Tisch.
»Warum läuten die Glocken, Staccato?«
Ernst und offen blickte der junge Staccato ihn an. Der Schein der Petroleumlampe ließ die braunen Augen grünlich schimmern wie Wolfslichter in der Dämmerung. Blondes Haar fiel lang und strähnig unter dem alten Champie-Hut hervor und berührte kräuselnd die Schultern. Die große schlanke Gestalt warf einen langen Schatten an die verräucherte Wand, neben der die Zellentüren begannen.
Dahinter hockten die vier zum Tode verurteilten Outlaws und Mörder einzeln in Zellen.
Der Kampf gegen diese Bande und die Festnahme von vier Mitgliedern war sicherlich der größte Erfolg im Leben des US Marshals Coogan, doch allein hätte er das nicht geschafft: Staccato und ein Aufgebot hatten ihn dabei unterstützt. Die Vernichtung dieser Mordbande hatte Opfer gekostet: Zwei Mann des Aufgebots mussten sterben. Und auch zwei Banditen waren während des Kampfes in den Bergen umgekommen.
Gerechtigkeit und Friede verlangten ihren Preis.
»Hast du gehört, Staccato?« Coogan drückte den Stetson in den Nacken. »Wer läutet da? Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Padre betrunken ist. Andererseits kenn ich ihn nicht.«
»Er trinkt nicht«, antwortete Staccato mit dunkler, sehr ruhig klingender Stimme. »Vielleicht ist sein Hausverwalter betrunken. Ich habe gehört, dass der Whisky für Medizin hält.«
»Nehmen wir an, der Mayordomo ist besoffen und reißt im Glockenturm am Strick. Warum scheucht ihn dann der Padre nicht aus dem Turm? Ob besoffen oder nicht – heut ist keine Messe.«
Staccato griff sich in den Nacken und strich über sein blondes Haar. In den braunen Augen war die Melancholie eines Einsamen.
»Vielleicht eine Totenmesse für irgendeinen, der im Moment noch lebt, Marshal.«
In einer Zelle lachte plötzlich ein Bandit schrill und irr auf.
Coogan bedachte ihn mit einem strafenden Blick und sagte: »Was soll der Lärm?«
Der Angesprochene hieß Paul, seinen Nachnamen kannte er wahrscheinlich selber nicht.
Paul brach ab, schluckte und fasste sich an den Hals. Die anderen drei Banditen grinsten kurz und brüteten dann wieder stumpfsinnig vor sich hin. Sie alle hofften inbrünstig auf Rettung und konnten andererseits nicht daran glauben.
Mit fiebrig glänzenden Augen blickten sie unstet zwischen Coogan und Staccato hin und her und schwiegen.
»Totenmesse?« Coogan schüttelte den Kopf.
Staccato lauschte dem Klang der Glocken und schüttelte dann kaum merklich den Kopf, deshalb fragte Coogan: »Du glaubst selber nicht daran? Du bezweifelst, dass es der Mayordomo ist?«
»Ja.« Staccato straffte den schlanken, sehnigen Körper. »Der Glockenschlag ist anders, so ist noch niemals geläutet worden.«
Coogan griff nach der Winchester.
»Dann will ich mir das mal ansehen! Pass hier auf! Drei Halunken sind noch auf freiem Fuß. Und unter diesen drei Banditen ist der Anführer: Iron Cobb. Ich bin schon lange hinter ihm her. Iron Cobb ist schlimmer als ’ne Gila-Eidechse. Diesen Viechern kann man hundertmal den Schwanz abhauen, und immer wieder wächst er nach.«
»Ich will steinalt werden, Marshal.«
»Dann ist es ja gut.« Coogan ging zur Tür zurück und drehte sich dort noch einmal um. »Stimmt das, was die Leute hier über dich sagen?«
»Was, Marshal?«
»Dass es keine einzige herumstreunende Katze mehr in Las Lagrimas gibt. Die Leute sagen, du hättest Schießübungen auf sie veranstaltet.«
»Die Leute müssen immer etwas zu reden haben.«
»Aber es stimmt, wie? Du kannst Katzen nicht leiden, heißt es. Weil sie sanft und gleichzeitig heimtückisch sind. Da es hier keine verwilderten Katzen gibt, kann ich mir gut vorstellen, dass an dem Gerede was dran ist – denn du schießt niemals vorbei, Staccato.«
Staccatos sonnengebeiztes Gesicht blieb ausdruckslos.
»Indianer mögen keine Katzen, Marshal. Ich bin unter Indianern aufgewachsen. Das kriegt man nicht mehr aus sich heraus.«
»Das stimmt sicher.«
Coogan ging. Vielleicht würde er nicht mehr zurückkommen.
Denn draußen lauerte im Dunkel der Nacht der Tod. Banditen wollten Coogan über den Haufen schießen.
Staccato war wieder allein im Office mit den skrupellosen Banditen in den engen Zellen. Er setzte sich nicht hin, blieb am Gewehrständer stehen und nahm nacheinander die drei Gewehre zur Hand, überprüfte sie und stellte sie langsam zurück.
Dann streiften die Hände sanft die Colts an den Oberschenkeln, locker steckten die schweren Waffen in den tief hängenden und fest geschnürten Halftern. Schließlich traf er einige Vorbereitungen, wobei die eingesperrten Banditen ihn lauernd beobachteten und schwiegen, weil alles, was er tat, gegen sie gerichtet war. Wenn der Anführer, Iron Cobb, sie jemals herausholen wollte, dann musste er sich schon etwas einfallen lassen.
Ohne Kampf und Mord ging es nicht …
Auf langen Beinen stakste Staccato durchs Office ans Fenster, zog die alte Gardine zusammen und verwehrte damit jedem, der vorbeigehen sollte, den Blick ins Innere.
Als er sich den Zellen zuwandte, lächelte er seltsam und betrachtete die Halunken abschätzend.
»Du«, sagte er plötzlich zu einem der Banditen, der in etwa seine Figur hatte, »steh auf. Du kommst raus.«
»Was?«, flüsterte der Bandit mit belegter Stimme. »Was soll das?«
»Das wirst du schon sehen. Komm – erheb dich.«
Zögernd stand der Bandit auf, kam näher und umfasste die Eisenstangen der Tür. Fest krampften sich seine Hände darum, als wollte er sie verbiegen. Im trüben Schein der blakenden Lampe glänzten die Schweißperlen auf dem zuckenden und bleichen Gesicht. Der Gesetzlose hatte Angst, vielleicht befürchtete er, vom Sheriff erschossen zu werden.
Das hatte es schließlich schon gegeben, dass Gesetzeshüter durchdrehten, sich in die Enge getrieben fühlten oder aus ganz persönlichem Hass nicht anders reagieren konnten. Schließlich waren Sheriffs auch nur Menschen.
»Nein«, murmelte Staccato beruhigend, »nicht das.«
»Damn’d, was dann?«, krächzte der Bandit, und seine Fingerknöchel zeichneten sich hell ab. Heftig arbeitete es in dem verzerrten Gesicht, und der Angstschweiß begann zu rinnen. »Was hast du vor mit mir, verdammt noch mal! Du willst mich doch kaltmachen!«
Staccato antwortete nicht sofort. Er zog die Schlüssel hervor und schob den passenden Schlüssel ins Schloss.
»Keine Dummheiten, verstanden?«, sagte er warnend. »Los jetzt, rauskommen! Langsam, mit erhobenen Händen!«
»Verflucht!«, schnappte der junge schwarzhaarige Bandit Jon in der Nebenzelle, sprang auf und kam wie ein gefangenes Raubtier an die Tür. »Sag dem verfluchten Padre, dass er aufhören soll mit dem Läuten! Noch hängen wir nicht!«
»Ja, noch nicht!«, schrie der Bandit Remember und stieg auf die Pritsche, um darauf herumzutrampeln. »Und wir werden auch nicht hängen!«
Paul – er machte einen geistesgestörten Eindruck – lachte blechern auf.
»Gib’s dem Sauhund, los, gib’s ihm! Wir kommen frei, und dann knallen wir hier alles ab!«
Staccato öffnete die Tür und trat dabei zurück. Beide Colts steckten in den Halftern. Er war so schnell, dass er die Waffen ruhig steckenlassen konnte.
»Bleib stehen.«
Der Bandit gehorchte widerwillig, und ständig geisterte sein flackernder Blick hin und her, als wollte er entgegen aller Vernunft zur Tür rennen und hinausstürzen – in der Hoffnung, von diesem jungen Sheriff nicht hinterrücks erschossen zu werden.
»So ist es vernünftig.«
Staccato packte ihn mit der Linken am Oberarm und zog ihn von der Zelle weg, drückte ihn auf den Stuhl hinter dem Tisch und befahl: »Nimm die Hände nach hinten, halte sie hinter der Lehne zusammen.«
»Ich – ich will zurück!«, fauchte der Bandit. »Zurück in die Zelle!«
»Nein.«
Staccatos Antwort war unwiderruflich. Wenn er erst einmal eine Entscheidung getroffen hatte, dann blieb er auch dabei. Und als der Bandit nun die Hände nach hinten streckte, schnürte Staccato ihm die Gelenke mit einem kurzen Strick zusammen.
Dann zog er seine lange lederne Fransenjacke aus und legte sie dem Banditen über die Schultern. Die Jacke verdeckte die gefesselten Hände.
Die Komplizen atmeten schwer in ihren Zellen. Keiner lachte mehr. Und alle sahen Staccatos ernsten Gesichtsausdruck. Noch nie in den Stunden ihrer Gefangenschaft hatten sie ihn so ernst gesehen.
»Und jetzt?«, stöhnte der Bandit und hob den Blick.
»Das«, sagte Staccato, nahm den Champie-Hut ab und setzte ihn dem Banditen auf, wandte sich ab und drehte den Docht der Lampe noch tiefer.
»He«, krächzte der Outlaw, »warum hast du mich zur Vogelscheuche gemacht? Was soll das alles?«
Staccato blickte ihn ernst und ruhig an. »Ich hoffe für dich, dass deine Freunde nicht kommen …«
Noch immer klang es vom Glockenturm, und irgendwo draußen klingelten Radsporen an alten Stiefeln.
*
Drei Mordgesellen lauerten.
Waffen waren geladen und lagen feuerbereit in Händen, an denen schon oft Blut geklebt hatte.
Die Dunkelheit der Nacht hüllte die Banditen im Hinterhalt ein. Alte und halb zerfallene Mauern gaben ihnen ausreichend Deckung. Über ihren Köpfen dröhnte es. Allmählich ließ das Läuten nach, und der lange dicke Glockenstrang schwang noch hin und her.
Bleiches Mondlicht fiel von oben her in den Turmschacht und auf die gewundene Holztreppe, die nach oben führte.
Kein Padre und kein Mayordomo befand sich auf dieser Treppe, und auch unten hielten sie sich nicht auf. Auch der Mozo, der mexikanische Diener, war nicht gekommen, um nach der Ursache des Läutens zu sehen …
Langsam ließ das Läuten nach, wurde leiser und leiser.
Und dann waren plötzlich rasselnde Radsporen zu hören, vorn auf der Plaza, wo der riesige steinerne Brunnen stand und wo tagsüber mexikanische Frauen wuschen, wo im Schatten von Oleander und Olivenbäumen geplaudert und palavert wurde, wo Kinder spielten und umhertollten.
»Da kommt er!«
Die Stimme klang wie das Zischen einer gereizten Giftschlange.
Das Gift, das sie verspritzen wollten, war aus heißem Blei, und dieses Blei sollte ein schlagendes Herz voller Mut und Tapferkeit zerfetzen und zum Stillstand bringen.
»Wir lassen ihn rankommen«, entschied Jon Cobb. »Immer die Nerven behalten, Jungs. Je näher, umso besser.«
Sie beobachteten ihn mit starren Augen.
Neben dem mächtigen Brunnen bewegte sich eine schemenhafte, große Gestalt, und sekundenlang reflektierte die Winchester das Mondlicht.
Marshal Coogan!
Schon war er wieder zurückgetreten und verschwunden – und die Gegner konnten nicht sehen, dass er sich in der Deckung des Brunnens davonschlich und drüben zwischen den Häusern in einer dunkel gähnenden Hofeinfahrt stehen blieb, um nach den Glocken im Turm zu blicken, die sich nun nicht mehr bewegten.
Verworren und dumpf drang Lärm aus dem Saloon, und in der nahe gelegenen Pulqueria, wo zumeist Mexikaner verkehrten, klapperten Kastagnetten und erklang eine Gitarre.
Nichts verhieß Gefahr.
Es war trügerisch ruhig und friedlich. Coogan spürte die Gefahr da drüben am Glockenturm.
Seine Feinde waren im Dunkeln.
Und weil er wusste, dass von dieser gefürchteten Bande der Anführer und zwei Mann hatten entkommen können, rechnete er auch mit drei Gegnern.
Doch wo sie genau steckten, konnte er nur ahnen, immerhin gab es in Las Lagrimas Hunderte von Nischen und Winkeln, die alle als Versteck geeignet waren.
Die Glocken waren verstummt, und diese Stille konnte nicht beruhigend, schon gar nicht einschläfernd wirken auf Coogan und Staccato, die genau wussten, um was es in dieser Mondnacht ging.
Coogan musste an den Glockenturm herankommen, und dazu war ein Umweg erforderlich. Er verlor keine Zeit und suchte die Hinterhöfe auf, um im Schutze der Häuser um die Plaza herumzukommen.
Tastend setzte er die Schritte und bewegte sich nahezu lautlos, die Sporen verrieten ihn nicht.
Aus dieser Mondnacht könnte eine Mordnacht werden, denn bei aller Wachsamkeit konnte Coogan sich Kugeln aus dem Hinterhalt nicht erwehren. Er würde erst dann den scharfen Knall der Schüsse hören, wenn sie ihn bereits getroffen hatten, und dann war es auch schon zu spät für ihn. Er würde ein toter Mann sein.
Vielleicht unterschätzten sie ihn doch, denn er hatte sich eines geschworen: Der Stern, den er trug, sollte niemals blutbefleckt in den Staub fallen …
Mit jedem Schritt kam er dem Glockenturm und der Kathedrale näher, und dann erreichte er das große Schattenfeld der Kirche und verharrte im raunenden Nachtwind.
Einige Männer lachten seltsam schrill, wahrscheinlich kehrten sie angetrunken und in bester Stimmung in ihre Behausungen zurück.
Draußen im Tal kläfften Kojoten, hungernd streiften sie über die mondhellen Talhänge und um die bizarren roten Felsklippen, wo der Wind den Sand rieseln ließ und in sonnenversengtem Gras harfte. Und nicht weit von der Stadt lag der Hügel, wo Kreuze und Grabsteine im Sternenlicht emporragten.
Coogan vermutete seine Feinde am Rande der Plaza in der Deckung des Glockenturms – doch zunächst drang er lautlos in jenes Adobegebäude neben der Kathedrale ein, in dem der Padre mit der Dienerschaft wohnte.
Er brauchte nicht lange zu suchen: In einem kleinen kahlen Gebetsraum stieß er auf die gefesselten Diener und dann nebenan auf den Padre, den die Banditen gnadenlos zusammengeschlagen und auch gefesselt hatten. Noch immer blutete der Geistliche aus klaffenden Wunden.
Coogan befreite ihn und die beiden anderen Männer von den Stricken und Knebeln. Sie zitterten, doch Angst hatten sie vor ihm nicht, weil sie ihn zuvor schon in Las Lagrimas gesehen hatten. Er war für sie der Retter, und als sie ihm danken wollten, gebot er ihnen sanft, zu schweigen und sich absolut still zu verhalten. Dumpf stöhnend unter Schmerzen nickten sie und sahen ihm nach, als er den Raum verließ.
Jetzt wusste er, dass nur die Banditen die Glocken geläutet haben konnten.
Damit hatten sie versucht, ihn anzulocken – und das war ihnen auch gelungen, aber nicht so, wie sie sich das wohl vorgestellt hatten. Rechtzeitig hatte er die Gefahr erkannt. Sie hatten ihn gewaltig unterschätzt, obwohl er den Ruf eines gefürchteten Staatenreiters hatte. Dennoch durfte er nicht glauben, dass er Dummköpfe vor sich hatte.
Iron Cobb, Pepper und Tecumseh – denn um diese Banditen musste es sich handeln – waren ungemein gefährlich!
Gefährlicher als die Halunken, die in den Zellen auf ihre Befreiung warteten und von Staccato bewacht wurden.