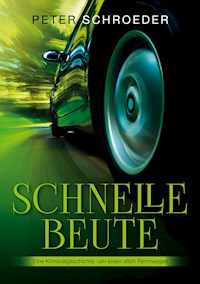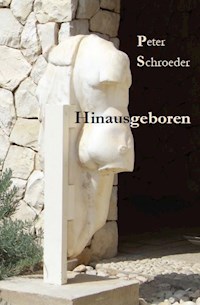
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Geboren im Krieg. Von der Mutter in ein Säuglingsheim gegeben. Mit vier Jahren zu Pflegeltern , mit elf ins Klosterinternat. Was soll aus so einem Jungen werden? Dieser versuchte sich als Exportkaufmann in Düsseldorf, Soldat bei der Bundeswehr und Buchhalter bei der Lufthansa. Er studierte BWL in Bochum, Publizistik und Psychologie in Berlin. Mit dreißig begann sein emanzipiert schwules Leben. Für eine Liebe übersiedelte er nach Holland, für eine andere kehrte er nach Berlin zurück. Heute, mit 75 Jahren, erzählt der Psychotherapeut pointiert und verdichtet vom Wesentlichen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hinausgeboren
Titel SeiteVorspielDie NachrichtKlein im KleinwalsertalImmaculataStella MarisLehrjahreSchulterklappen und BefehleVerstecken und SehnenHalbseidene StadtVater, VaterLiebesversucheRabenMutterLiebeOskars GeheimnisTitel Seite
Peter Schroeder
Hinausgeboren
COPYRIGHT ©
Der Titel ist bei Titelschutz.ch unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG (Deutschland) sowie § 80 UrhG, § 9 UWG (Österreich) in allen Schreibweisen und Darstellungsformen geschützt und im Online-Titelschutz- Anzeiger veröffentlicht worden.
Das Manuskript, einschließlich all seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verfassers unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikrovervielfältigungen und die Einspeicherung und/oder die Verarbeitung in elektronische Systeme.
Texte: © 2020 Peter Schroeder Umschlag:© 2020 Peter Schroeder
Vorspiel
Jeden Abend ermittelte Wilhelm Schroeder die genaue Länge des übrig gebliebenen Brotes. Die Zahl notierte er in einer Liste. Jeden Morgen maß er erneut. Fehlte etwas, verhörte er die Verdächtigen.
Mit seiner Frau, drei Töchtern und zwei Enkeln lebte er seit Juli 1943 auf einem verlassenen Gehöft im Klein-walsertal. Dort hatte die Familie nach der Bombardierung ihrer Heimatstadt Wuppertal Zuflucht gefunden.
Wilhelm Schroeder war vor seiner Pensionierung Korvettenkapitän gewesen. Viele Jahre hatte er als Kolonialoffizier der Kaiserlichen Marine in Neuguinea, Kiautschou und Samoa geherrscht. Er war gewohnt, dass man ihm gehorchte. Seine Frau Margarete fügte sich klaglos. Für die Bankierstochter war sozialer Abstieg keine neue Erfahrung.
Manchmal sagte sie: „Gott sei Dank, dass wenigstens Ilse es besser hat.“
Die älteste Tochter war als Angestellte der Deutschen Reichsbahn mit der Besetzung der Ukraine nach Kiew ab-kommandiert worden. Sie hatte über ihre Liaison mit einem Reichsbahnrat geschrieben und Karten von Urlaubsreisen aus Paris geschickt.
2
Die deutsche Reichsbahnangestellte Ilse Schroeder hatte den Reichsbahnrat verlassen und sich in Bela, einen ungarischen Arzt, verliebt. Von ihm erwartete sie ein Kind.
Im Frühjahr 1944 rückten die Sowjettruppen in die Ukraine vor. Die Besatzer flohen. Bela musste nach Győr in Ungarn, Ilse fuhr hochschwanger nach Wuppertal. Dort wähnte sie ihre Familie. Die war ausgebombt und lebte im Kleinwalsertal.
Unter Strapazen schlug sie sich dorthin durch.
Niemand freute sich über ihre Ankunft.
Der Patriarch entschied: „Willst du bleiben, dann nur unter der Bedingung, dass das Kind nach der Geburt zur Adoption freigegeben wird. Anders geht es nicht.“
Ilse wollte nicht bleiben. Sie hoffte auf eine Nachricht aus Győr.
Vergeblich.
Am 17. April 1944 brachte sie das Kind in einem Säuglingsheim zur Welt und ließ es dort.
Mich.
Die Nachricht
Das Erinnern an mein Leben begann mit einem Tod. Berlin, September 1991: „Wir hatten auf unserem Revier einen Anruf aus Mittelberg. Ihr Vater ist gestorben“, sagte der Polizist.
Mittelberg? Vater? Oskar? Oskar!
Seit fünf Jahren hatte ich ihn nicht mehr besucht. Nur ein paar Karten geschrieben, zu Weihnachten angerufen. Dabei wollte ich ihn noch so viel fragen!
Zu spät.
Jetzt konnte ich nur noch Abschied nehmen, den letzten. Ich ging meinen Kalender durch, rief Klienten an, verlegte Termine.
Am Nachmittag fuhr ich zu meiner Mutter.
„Oskar ist gestorben. Kommst du mit zur Beerdigung?“
„Nein, ich bin zu alt.“
Sie sah aus dem Fenster, erhob sich und sagte: „Gute Reise, ich muss mich hinlegen.“
Ich blieb sitzen.
„Willst du noch was?“
„Du hast mir nie erzählt, wie ihr euch kennengelernt habt.“
„Das hab ich dir erzählt.“
„Hast du nicht.“
„Das war 1948 oder 49. Ich wohnte schon allein in Riezlern. Sonntags ging ich mit Hella und Ruth oft zum Tanz in den Gasthof Zur Post. Dort verkehrten auch französische Besatzer …“
„Und da hast du Oskar gefunden?“
„Er hat mich gefunden“, sagte Mutter und erzählte, wie er nach jedem Tanz ihren Stuhl zurechtrückte und sein sanftes „Oui Madame“ sie beeindruckte. Von seinen Einladungen zum Essen und den Köstlichkeiten, deren Namen sie noch nie gehört hatte. Dass sie kaum Französisch sprach, er aber fließend Deutsch parlierte, sogar Walserdütsch. Wie er sie „Ille“ nannte. Wie sie sich verliebte in diesen Mann aus Marseille.
„Wann hast du ihm gesagt, dass es mich gibt?“
„Das hab ich ihm gesagt, als ich merkte, dass es ernst wurde“
„Wie hat er reagiert?“
„Als wir beschlossen, zusammen zu ziehen, sagte er: Ille, das ist unser Junge, den nehmen wir zu uns. Das ging aber nicht in diesem kleinen Zimmer. Das weißt du ja.“
„Ich weiß“, sagte ich.
„Leg ihm ein Blümchen von mir ins Grab.“
Am Abend saß ich im Zug Richtung Kleinwalsertal.
In meinem Kopf die Kindheitsbilder.
Klein im Kleinwalsertal
Ausgefranster Mund
Von den Jahren im Säuglingsheim weiß ich nichts. 1948 holte meine Tante Lilo mich dort heraus. Sie hatte das Ehepaar, in dessen Haus sie zur Untermiete wohnte, als Pflegeeltern gewonnen.
Die Frau hieß Margot, war Krankenschwester, betrieb aber einen Kolonialwarenladen. Ihr Mann Toni verdiente sein Geld im Sommer als Holzfäller und im Winter als Skilehrer, wie die meisten Männer des Kleinwalsertals. Ich sollte die beiden Tante und Onkel nennen.
Eigentlich wohnte ich bei Lilo, schlief in ihrem Zimmer unterm Dach. Lilo trug nie Kleider oder Röcke. Immer Hosen. Mit ihrem Pagenkopf wirkte sie männlich und herb. Dabei war sie zärtlich und sanft. Sie arbeitete als Managerin in einem Hotel.
Tante Margot führte ein strenges Regime. Abends vor dem Schlafengehen musste ich vor allen Diener machen, jedem die Hand geben und ein Küsschen auf die Wange drücken. Gute Nacht!
Bei Toni und Lilo fiel mir das nicht schwer. Ich mochte und roch sie gern. Die herrische und ständig missgelaunte Tante Margot stieß mich ab. Wenn ihr Wer-war-in-der-Speisekammer-Schrei durch das Haus lärmte, fühlte ich mich auch dann schuldig, wenn ich die Kammer nicht betreten hatte.
Saß ich auf dem Klo, donnerte sie an die Tür und keifte: „Wie lange willst du noch drin bleiben?!“
Mir verging alles.
Einmal, als sie mich herausgepoltert hatte und selbst hineingegangen war, pinkelte ich unter den Spülstein in der Küche. Sie wischte die Pfütze wortlos weg und nahm mich wie eine Inquisitorin in die Mangel. Ich blieb stumm und stellte mich taub, bis sie abließ.
Traktierte sie mich zu schlimm, griff Toni mit fünf Worten ein: „Lass den Jungen in Ruhe!“
Ihr konnte ich nichts recht machen. An allem nörgelte sie herum.
Ich hatte mir angewöhnt, vor dem Einschlafen leise zu singen. Das beruhigte mich, und Lilo störte es nicht. Sie sang mit oder lehrte mich andere Lieder.
„Peterlein, wenn du abends so viel singst, franst dir der Mund aus und du kannst nie wieder Apfelstrudel essen“, sagte Tante Margot.
Ich stellte mir einen ausgefransten Mund vor: Die Oberlippe hängt wie ein Vorhang über dem Kinn.
Lange sang ich nicht mehr.
Schneegestöber
„Ille, das ist unser Junge, den nehmen wir zu uns“, hatte Oskar gesagt.
„Zu uns“ hätte bedeutet, das kleine Zimmer über der Bäckerei mit mir zu teilen, in dem sie ihre „wilde Ehe“ führten. Unmöglich. Sie fanden neue Pflegeeltern auf der anderen Seite von Riezlern und brachten mich zu ihnen.
Mir ist die Fahrt durch Nacht und Schnee noch in Erinnerung.
Wo bin ich? Wer hat mich aus dem Schlaf gerissen?
Ich war in einem großen Auto. Der Motor brummte. Sterne glitzerten auf der Windschutzscheibe. Mitternacht. Schneegestöber.
Das Auto wurde beladen.
„Kein Platz mehr hier!“, sagte der Fahrer.
Träume ich? Nein. Bin ich wach? Nein.
“Los geht`s, Kleiner. Wir können fahren.“
„Wohin?“
„Zu deiner neuen Familie.“
„Warum?“
„Dort kommst du in die Schule“
Das Auto fuhr, ich schlief ein. Wach wurde ich wieder, als es anhielt. Stimmen murmelten. Ich ließ meine Augen geschlossen. Jemand trug mich ins Haus, legte mich in ein Bett. Eine Tür fiel ins Schloss. Die Stimmen verschwanden dahinter. Ich öffnete die Augen. Es war dunkel. Es war warm.
Ich hörte ein Lied. „Kling, kling, kling, glitzernd Ding. Güldene Reifen, kostbare Ringlein, kling, kling, kling…“, tönte es durch die Tür zu mir herein. Sind das Engel, die singen? Hier gibt es Engel! Sie tanzten einen Reigen um mich. Ich wiegte meinen Kopf, fühlte mich eingeladen zu ihrem Tanz.
Am Morgen lugte ich durch die Wohnzimmertür. Ob sie noch da sind? Ich sah niemand. Plötzlich wieder das „Kling, kling, kling …“.
Unter einer Glashaube drehte ein weißes Püppchen Pirouetten. Mein Engel in der ersten Nacht.
Sanft sagte jemand: „Guten Morgen, kleiner Mann!“
„Guten Morgen. Wo bin ich?“
„Zu Hause. Willkommen Peter, ich bin Fanny.“
„Bist du jetzt meine Tante?“
„Nein, ich bin das Hausmädchen bei Familie Bern. Deine neuen Pflegeeltern sind Tante Alice und Onkel Leopold. Du wirst sie heute Nachmittag sehen. Sie freuen sich auf dich. Und deine Mutter erst! Du kannst sie am Sonntag besuchen.“
Der Kopf auf dem Teller
Ein Sonntag bei Mutter.
Im Dachzimmer über der Bäckerei gab es kein Wasser. Mutter holte es vom Hof des Nachbarn. Ich schaute zu, wie sie den Holzeimer auf den Sims unter den Wasserfall setzte.
Der Brunnen war ein umgeleiteter Wasserfall. Das Wasser sprudelte aus dem Mund einer bemalten Holzplastik, die dem Kopf des Bauern nachgebildet war. Grüner Hut, roter Schnurrbart.
Mutter ging wieder hinauf, ich blieb im Hof, der vielleicht auch ein Garten oder ein Feld gewesen ist. Ich war sechs Jahre alt. Das Gras reichte mir bis zu den Schultern und verfing sich in den Trägern meiner Lederhose.
Ich untersuchte eine modernde Holzplatte, betrachtete die unter der Anfahrt zur Tenne hängenden Heu-Heinzen. Wenn sie auf den Wiesen standen und frisch gemähtes Gras an ihnen hing, sahen sie aus wie grüne Zwerge.
Ich schaute zum Heuboden hinauf. Zu hoch. Eine Leiter nicht in Sicht. Darunter der Stall, in dem die Kühe standen. In der Ecke eine Rolle Stacheldraht. Ich ging weiter, schlug mit einem Stöckchen nach den Brennnesseln, stocherte in dem Tonkrug herum, der Scherben einer zerbrochenen Kaffeekanne barg. Was die Erwachsenen als Müll ansahen, wurde für mich zu interessanten Studienobjekten.
Ich langweilte mich nicht, doch hätte ich gern jemand zum Spielen gefunden. Kaum gedacht, erfüllte sich der Wunsch: Ein großer bunter Vogel kratzte im Sand und gab glucksende Laute von sich. „Bist du aber schön. Wollen wir spielen?“
Ich imitierte das Glucksen, kratzte mit meinem Stöckchen und warf den Sand in seine Richtung.
Plötzlich lautes Geschrei und der Vogel stürzte sich auf mich. Ich rannte in den Stall hinein, suchte Schutz in der Stacheldrahtrolle. Vergeblich. Das Ungeheuer verfolgte mich, sprang mich an. Ich hielt Hände und Arme vors Gesicht, spürte seine Krallen auf der Brust, Stiche an der Stirn. Warmes Blut lief über meine Wangen. Ich schlug wild um mich und rannte ins Haus. Ermattet kroch ich die letzten Stufen bis zu Mutters Zimmer.
„Was ist passiert? Wer hat dich gehauen?“
Sie hob mich auf, setzte mich auf einen Stuhl, holte ein Tuch, tauchte es in warmes Wasser und wischte das Blut aus meinem Gesicht.
Stunden später nahm mich Mutter bei der Hand und ging mit mir zur Stacheldrahtrolle. Daneben stand der Bauer. In der Rolle lag der Kopf des Ungeheuers auf einem Blechteller. „Der wird dir nie wieder etwas tun“, sagte der Bauer.
Das Ungeheuer war einer seiner Hähne, der schon öfter Menschen angegriffen hatte.
Leben am Hang
Das kleine Haus von Alice und Leopold lag an einem Berghang. Auf der einen Seite blickten wir nach unten zur Skipiste. Auf der anderen hörten wir von oben Tennisplatzgeräusche.
Klein war es eigentlich nicht, es hatte sechs Gäste-zimmer. Mir schien es trotzdem winzig, weil wenig Raum für mich war.
„Peng! Zurück! Netz! Aus! Wechsel!“
Da spielten sie wieder. Ich stieg hinauf und sah den Bällen zu.
„Na Kleiner, willst mitspielen?“, fragte jemand.
„Der muss noch wachsen“, meinte ein anderer.
„Kannst die Bälle für uns holen, lernst was und kriegst 30 Pfennig die Stunde, was sagst?“
Ich überlegte nicht lange. An den Breitseiten des Platzes standen hohe Zäune. Nach vorn und hinten konnten die Bälle weiter fliegen. Na und? Ich war gerne draußen, mochte Bewegung, hatte eine gute Kondition, und der Verdienst kam mir gelegen.
Wenn die Sonne besonders stark brannte, dachten die Spieler, der Balljunge würde mindestens so erschöpft sein wie sie und gaben mir oft ein Zehnerl mehr als vereinbart.
Vermögend wurde ich nicht. Im Winter gab ich das Ersparte groschenweise wieder aus. So viel kostete eine Fahrt mit dem Skilift. Stundenlang sauste ich immer wieder den Hang hinab. Unten klemmte ich mich an das Seil und ließ mich vom Lift wieder bergauf ziehen. Das Seil war nass und kalt. Wenn der Abstand zwischen den „Gelifteten“ groß war, hing es auf der Erde und schleifte durch den Schnee. Mit klammen Fingern hielt ich mich fest. Oben entschied ich: noch einmal. Und noch einmal. War mein Geld aufgebraucht, stellte ich mich neben den Liftbetreiber.
“Kummst ja scho wiada“, lachte er, hängte mich ans Seil und ließ mich gratis hinauf.
Mein Leben im Hause Bern spielte sich vor allem außerhalb des Hauses ab. Im Sommer auf dem Tennisplatz. Oft Anstrengend, doch das brachte Geld ein. Im Winter auf der Skipiste. Purer Spaß, für den ich die Groschen gern bezahlte.
So verging die Zeit.
Immer gleich?
Nein.
Tante Alice liebte das Einzigartige. Im Sommer schmückte sie die Gästezimmer gern mit Enzian. Sie legte die dunkelblauen Blüten in Dessertschalen und dekorierte damit Tische.
Die Bewunderung der Besucher war ihr sicher. Viele hatten auf ihren Wanderungen selbst nach der seltenen und berühmten Blume gesucht. Vergeblich. Die in 1500 Meter Höhe gelegene Enzianwiese war unser Geheimnis. Auch von der gelegentlichen Ernte sollte niemand wissen, denn die Pflanze stand unter Naturschutz.
Wieder einmal kraxelten Tante Alice, Fanny und ich mit einer Tischdecke ausgerüstet den Berg hinauf. Mittags waren wir losgegangen, am frühen Abend kehrten wir mit der Beute heim. Kaum hatten wir die blaue Blumenpracht aus der Tischdecke geschält, trat der Dorfgendarm Brodinger auf die Veranda. Er hatte hinter dem Haus auf uns gewartet. Er war bekannt für seinen Eifer und konnte äußerst ungemütlich werden. Ein Dienstmädchen, das beim Stehlen erwischt worden war, hatte er persönlich über die Berge ins Bezirksgefängnis gebracht.
„Was haben wir denn da, Frau Bern?“
Mit verschränkten Armen stand er vor uns.
„Wer hat uns verpfiffen, Herr Brodlfinger, äh Herr Brotfinger, hm … Brodinger?“
Auf den Mund gefallen war Tante Alice nie. Den Brodinger beeindruckte sie nicht.
„Alle Enziane zählen!“
Das Bußgeld wurde teuer. Hätten wir doch weniger gefunden! Immerhin, ins Gefängnis mussten wir nicht.
Wir erfuhren nie, wer uns verraten hatte. Wahrscheinlich ein Neider. Ein Gerechtigkeitsapostel. Als ob die anderen immer gut und ehrlich wären! Wie war denn das mit Bauer Birgel? Der verdünnte Milch. „Sauba muaß die Kannen sei, gell“, sagte er und hielt mein Gefäß unters Wasser.
Oder der Metzger, der „Jawoll, Frau Bürgermeister“ dienerte und uns in der Schlange warten ließ.
Im Wirtshaus spotteten sie: „Die Alice hat mal oins uffs Maul braucht.“ Onkel Leopold focht das nicht an. Er kümmerte sich nicht um Gerede. Er schlürfte seine Leberknödelsuppe und dachte an Fanny, die Magd.
Einmal im Jahr zog Tante Alice für sieben Tage in ein Kloster am Bodensee, wo Rogeria, ihre ältere Schwester, als Nonne lebte. Sie verabschiedete sich von Leopold meist mit den Worten: „Deanas künnt dir au a moal nötig sei!“ (Das wäre für dich auch mal nötig!) und stapfte beckenschwingend den Wiesenpfad hinunter zur Bushaltestelle vor der Post.
Onkel Leopold blickte ihr verschmitzt nach. Fanny stand wie ein Zinnsoldat hinter ihm. Artig hatte sie ihrer Herrin eine gute Einkehrwoche gewünscht. Diese Schwester, munkelte man, würde einmal selig gesprochen werden. An ihren Handinnenflächen seien die Wundmale des Herrn erschienen. Sie galt als zweite Theresa von Konnersreuth.
Kaum war die Tante fort, zog Lebensfreude in das Haus. Onkel Leopold holte für sich ein paar Biere aus dem Keller, Fanny bekam Rosé-Wein. Ich durfte daran nippen und vor allem: abends länger aufbleiben. Fanny und Leopold lachten und scherzten in der einen Woche mehr als im ganzen Jahr davor und danach. Leopold legte seine Pranke zärtlich auf Fannys Hände, zupfte an ihrer dicken, roten Nase.
Allabendlich kam der Augenblick, in dem die beiden einander in die Augen schauten und Fanny zu mir sagte: „Peterle, es ist spät, jetzt musst du ins Bett!“
Alljährlich verging diese Woche viel zu schnell und mit Tante Alice kehrte die gedrückte Stimmung in das Haus zurück.
„Warum hat mich keiner vom Bus abgeholt?“. Onkel Leopold grummelte nur: „Deanas woischt du schon als wia du hoimkummscht ...“ (Du weißt doch selbst, wie du heimkommst).
Mein Vater ist Franzose
Ich mochte Oskar von Anfang an. Seine Haut war braun wie meine, seine Augen ebenso. Wir sahen nicht so blass aus wie die Leute hier.
Er holte mich manchmal von der Schule ab. Bei jeder Begegnung küssten wir uns auf die Wangen. Links, rechts, links. Die anderen Kinder fanden das komisch. „Mein Vater ist Franzose, in Frankreich ist das üblich“, erklärte ich zwischen Scham und Stolz.
Wir konnten einander wunderbar necken. Wenn er seine Baskenmütze wieder mal nach halblinks ins Gesicht gezogen hatte, zerrte ich sie zurecht. „Man trägt die Mütze grade, Okela!“
„Man kann sie tragen, wie man will, Keter, und ich trage sie, wie ich will, wenn du erlaubst.“
Ich erlaubte. Und das war wenig, gemessen an dem, was ich mir alles gestattete und er tolerierte. Einmal wurde ich des Diebstahls von Gummibärchen überführt, nachdem ich sie an Dorfkinder verteilt hatte.
Statt mich zu bestrafen, ging Oskar zum Besitzer des Kolonialwarenladens und sagte: „Wenn der Junge wieder einmal kommt und Süßes will, gib es ihm. Schreib es an, ich bezahle am Monatsende.“
Das ging nur einen Monat lang gut, denn ich konnte mein Privileg nicht geheim halten. Zuerst begleitete mich Emil. Später kamen weitere Kinder mit und ließen an-schreiben – auf Oskars Rechnung. „Das ist jetzt arg viel. Musst nicht mehr gehen, gell?“, sagte Oskar nur. Ich hatte verstanden.
Oskar brauchte nicht zu drohen. Es genügte, wenn er einen Wunsch äußerte.
Dabei war ich ansonsten nicht, was man einen artigen Jungen nennt. Lehrern fiel ich ins Wort oder lachte, wenn sie uns in ernstem Ton Wichtiges erläuterten. Hausarbeiten erledigte ich, wenn ich Lust hatte. Beim Völkerball trat ich den Jungs vors Schienbein. Mädchen zog ich an den Zöpfen. Alles weil, ... weil ich … ich hatte keine Ahnung.
Oskar hatte sich eingelebt in Riezlern. Die Einheimischen akzeptierten ihn. Die Sympathie der einen gewann er mit französischem Charme, die der anderen mit derben Witzen. Die Achtung aller erlangte er durch soziales Engagement gegen Missbrauch von Steuergeldern.
Mit seinem Privileg, in Spezialläden der französischen Kaserne einkaufen zu können, erwies er vielen Dörflern Gefälligkeiten. Als er seiner Ille eine adrette Nylon-Kittelschürze: bunt, ärmellos mit Taschen, geschenkt hatte, fragten andere Männer: „Hast mir net auch so oane wie dei Alte hat?“ Die meisten Frauen liefen damals auch sommers in dicken Leinensachen und waren doch auch gerne „chic“. Oskar besorgte die Schürzen. Oskar, der Schürzenjäger.
Oskar war klein, doch wenn sein gescheiteltes Haar sich bei starkem Wind aufrecht stellte, konnte er verwegen aussehen.
Kamen Franzosen ins Tal und brauchten einen Dolmetscher, wurde er gerufen. Er war kontaktfreudig und vermittelte gern zwischen Deutschem und Französischem. Seine akzentuierte Aussprache mit dem trockenen R mochten alle.
Ich liebte sein H. Er sprach es nicht so hart wie die Deutschen, doch anders als andere Franzosen artikulierte er es deutlich. Er konnte Bauer Herrmann richtig ansprechen und der Himmel wurde bei ihm auch zu keinem Immel.
Oskar kannte die Welt, alle Welt kannte Oskar. Mit Gerd Bucerius, Asta Nielsen, Resi Hammerer war er per Du. Sie verbrachten ihren Winterurlaub in Riezlern.
Bei einem Ausflug sprach er die Herbergsleute der Almgasthütte mit Vornamen an. „Der ist bekannt wie ein bunter Hund!“ sagte Mutter.
Er war nicht nur allbekannt, er wollte auch alles genau wissen. Wohin wir kamen, er lief auf jeden Fall in die Küche und kontrollierte: „Gell, du machst für uns mit guter Butter!“
Wenn Oskar etwas dachte, sprach er es aus: “Leopoldine, ma Belle, du kommst in die runden Jahre. Mach dir nichts draus, bei dir hängt‘s oben, bei mir hängt‘s unten.“
Mutter war seine Direktheit peinlich. Mit Augenrollen und empörtem: „Oskar, so was sagt man nicht!“, versuchte sie, seine Zügellosigkeit zu zügeln. Vergeblich.
Malen statt Zahlen
Emil rammte einen Ellenbogen in meine Rippen. Ihm war das Bleistiftgeklapper zwischen meinen Zähnen auf die Nerven gegangen. Wir saßen im Rechen-Unterricht bei Zwergschulleiter Fritz.
Alles an dem stieß mich ab.
Seine verkniffenen Augen.
Seine Lippen, diese schmalen Striche.
Sein akkurat gescheitelt morgens immer nasses
Haar.
Sein Mund, aus dem nur Gift kam und Gestank.
Seine großen krummen Hände.
Seine Besenstiel-Haltung.
Die schlechten Noten in Mathe verdanke ich der schwarzen Pädagogik dieses Paukers, der die Intelligenz seiner Schüler an Tempo und Genauigkeit beim Zusammenzählen, Abziehen, Teilen und Malnehmen von Zahlen maß, der seine Lieblinge hätschelte und die anderen drangsalierte.
Ich verstand sein Palaver nicht und es interessierte mich nicht. In seinem Unterricht zeichnete ich Rehe mit langen Beinen und Bäume mit sich biegenden Zweigen, auf denen Schnee lag. Schwer, blau, kalt.
Kalt erwischte mich sein schneidendes: „Peter, komm sofort nach vorne! Hinknien, hier!“
Wen er erniedrigen wollte, den ließ er knien und mit ausgestreckten Armen eine gefüllte Wasserschüssel halten, bis er um Gnade winselte.
Von dieser Foltermethode ließ er ab, als die Tochter des Alpenrose-Wirtes, einen Anfall simulierte und die Schüssel einfach fallen ließ. Durchnässt und scheinbar ohnmächtig wurde sie nach Hause gebracht. Der Wirt kam in die Schule und stellte Fritz zur Rede. Der entschuldigte sich stammelnd. Grausam war er nur zu Schwachen.
Gerecht handelten auch andere Lehrer nicht, besonders, wenn es um die „Zuagroasten“ ging.
Die hochdeutsch sprachen.
Dachstuhlzimmerchen bewohnten.
Aus Wehrmachtslumpen, zusammengeschneiderte
Knickerbockerhosen trugen.
Sich in den Läden immer wieder hinten
anstellten, wenn Einheimische herein kamen.
Die sich am Ende selbst als Parias, dumme und
unerwünschte Außenseiter empfanden.
Die Letzten im Gebirgstal.
Wie ich.
Bergab, bergauf
Klassenfahrt ist Schule ohne Schule. An so einem Tag gehörte die verschneite Skipiste am Parsennlift ganz uns. Siebzehn Achtjährige preschten den Hang hinab. „Usgstellt oder niedergschnellt!“, (Ausweichen oder umgefahren) riefen wir, das hieß: „Bahn frei!“
Das Schreien war nötig, denn im Flockenwirbel konnten wir nicht weit sehen. Skifahren war unsere zweite Natur. Ludwig Leitner, einer von uns damaligen Schneeflitzern wurde 1964 Olympiasieger bei den Winter-Spielen in Innsbruck.
Nach unten rasten wir auf Skiern, nach oben ließen wir uns ziehen. Die Seilbahnsessel ratterten zittrig um das große Zahnrad in der Talstation. Mit einer dreiviertel Drehung schaufelten sie neue Passagiere in die Schalen. Bei angeschnallten Skiern mussten wir uns paarweise und ohne Zögern in die Standspur unters Seil bewegen, um auf den daran hängenden Sitzen mitgenommen zu werden. Wenn das Gedränge zu groß war, wählten wir die einfachere Version: Metallbügel, die wie ein umgedrehtes T vom Seil herunterbaumelten. Wegen des Gleichgewichts mussten jeweils zwei von uns sie sich gleichzeitig unter die Hintern klemmen. Zügig bildeten sich die Paare. Alle wollten schnell wieder nach oben. Einmal war ich übrig geblieben.
„Stell dich zwischen meine Beine, schnell!“, befahl Klassenlehrer Kessler. Auf die andere Seite dirigierte er Musiklehrerin Moosmann als Gegengewicht. Unsicher und wacklig begann die Auffahrt. Mit angeschnallten Skiern hing ich zwischen den Schenkeln des Lehrers. Ich mochte seine sensible und kluge Art. Wenn er der lärmenden Meute zurief: „Jetzt hören wir alle zu!“, wurde es sofort still. Er musste nie mit Strafen drohen.
Still geworden war auch ich. Außen. In mir brodelte es. Er schien das zu bemerken. „Halt‘ dich fest, Peter!“, sagte er sanft.
Mit nach hinten gedrehten Armen umklammerte ich ihn. Langsam senkte ich meinen Kopf gegen seinen Bauch. Ich spürte seinen Atem, seine Hände auf meinen Schultern. Ich fühlte mich gehalten, schloss die Augen. Schneeflocken flogen kühl auf mein Gesicht.
Unter einer Decke
Weihnachtsabend in Familie. Mutter, Oskar, ich. Ich saß zufrieden auf der Couch und streichelte mein neues Fahrrad. Lange hatte ich es mir gewünscht. Dass ich es bekam, war eine Überraschung, denn Mutter wie Oskar hatten immer wieder abgewehrt: „Fahrradfahren darfst du erst mit zwölf!“
Ich war darauf hereingefallen, umso größer nun die Freude.
„Wirst du auch vorsichtig sein auf der Straße?“ warnte Oskar und kraulte meinen Rücken.
„Klar, ich bin doch groß!“