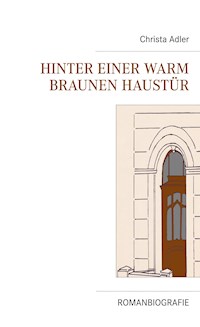
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Die Autorin beschreibt ihre Kindheit und Jugend in den zwanziger und dreißiger Jahren. Die privaten Erlebnisse stehen zwar im Vordergrund, aber die politischen Ereignisse, die sie in diesem Alter nur bedingt verstehen und einschätzen kann, schwingen überall im Hintergrund mit. Geboren und aufgewachsen in Bonn am Rhein erscheint das Leben zunächst unbeschwert mit allen Freuden, die ein Kinderherz höher schlagen lassen. Doch dann verändert sich das Leben. Die Mutter stirbt und eine neue Frau soll ihren Platz einnehmen. Ein neues zu Hause soll das alte ersetzen und der Umzug aus der Kleinstadtidylle am Rhein geht in die Großstadt. Doch es ist nicht irgendeine Großstadt, es geht nach Berlin und man schreibt das Jahr 1936. In Berlin sind die neuen politischen Verhältnisse allgegenwärtig. Die Olympiade lässt alles in einem besonderen Licht erscheinen. Beim großen Schwimmfest darf sie sogar Adolf Hitler persönlich die Hand geben. Doch der Glanz erlischt bald. Der Krieg kommt über das geliebte Vaterland und über die Familie. Die Brüder werden Offiziere, obschon sie das eigentlich nicht wollen, und fallen beide. Trotz aller Erschütterungen absolviert sie eine Ausbildung zur Fotografin und ist daneben täglich im Arbeitseinsatz. Auf diesem Weg lernt sie immer mehr die Absurdität des Krieges kennen und die verlogene Moral der Machthaber. Aber es gilt zu überleben. Sie findet eine Anstellung und arbeitet bis zum Schluß als Fotografin in einer Klinik in Breslau, von wo sie dann fliehen muss zurück nach Berlin. Als der Krieg aus ist, liegt nicht nur die Stadt in Trümmern. Doch es gibt einen Silberstreif am Horizont. Ein Brief kommt aus Rimini und nur wenige Jahre danach wird ein junger Offizier aus der Kriegsgefangenschaft entlassen. Sie heiraten und das Leben beginnt aufs Neue.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 372
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Heinzelmännchens Wachparade
Heimabend
Unser Töff
Weißer Sonntag
Glyzinienduft
Sonnendurchglühte Tage
Kater Möhrchen
Sturz von der Erpelei
Morgen, Kinder wird's was geben
Zigeunerblut
Die Wilden vom Großenbusch
Unruhige Nächte
Ende einer Freischar
Sommer 1934
Ferien am Braunsteich
Madamchen
Die dicke Berta
… und alle marschierten mit
Maria hat den guten Teil erwählt
Weintraubentorte
Abschlußball
Plicken liegt in Memelland
Charité
Eine Nette von der Lette
Floh im Ohr
Mein Försterbub
Auf einem weißen Schimmel
Bomben über Berlin
Ihr Kinderlein kommet
Fotoexamen
Breslau
Zurück nach Berlin
Kein Ausweg nach Krotoschin
Graue Kolonnen
Leipzig
Karfreitag 1945
Briefe aus Rimini
Epilog
Prolog
Lautlos kommen sie durch die Nacht, schwarze Vögel. Nur ein heiseres Krähen hallt von Ferne. Sie fliegen in weitem Bogen über die Birken am Rand des Gartens dem fast vollen Mond entgegen. Die Nacht trägt sie über das Land und langsam verlieren sie sich in der Dunkelheit. Der Mond läßt sein fahles Licht auf die dunklen Tannen scheinen. Noch einmal flattert es ganz in der Nähe, eine Fledermaus. Erschrocken vor dem Licht kehrt sie um in das schützende Dunkel.
Es gibt einen Garten, der da heißt Traum.
In Ihm steht ein immer grünender Baum.
Ob Sommer, ob Winter, sein Kleid ist grün,
zu seinen Füßen die Blumen blühen.
Im ewigen Wind seine Äste sich biegen,
darauf sich Vögel und Falter wiegen.
Der Frieden dort drinnen, er hüllt Dich ganz ein.
Nie möchtest Du wieder an anderem Ort sein.1
Wenn die Zeit gekommen ist zieht man Bilanz. Der eine früher, um zu sehen, ob er auf dem richtigen Weg ist. Der andere später, wenn es nichts mehr zu tun gibt und die Frage kommt: Was habe ich erreicht, habe ich genug gegeben?
Wenn ich einmal gestorben bin, hoffe ich, in das Paradies eingehen zu dürfen. Nicht etwa weil ich so gut war, oh nein, ich hätte Vieles besser machen müssen. Sondern ganz einfach nur, weil ich an Gottes große Güte glaube, weil ich an diesen Gott glaube, der einen zuweilen aus den Augen besonders gütiger Menschen anschaut.
Wie wird das sein, das Paradies? – Wie naiv diese Frage doch ist und wie schmerzhaft für den, der schon einmal dort war.
Wir alle halten das Paradies in den Händen, jeden Tag und wir verschenken jeden Tag davon. Aus Unachtsamkeit, aus Übermut, aus Verachtung, aus Unwissenheit. Und manchmal haben wir einfach keine andere Wahl. Dann müssen wir hergeben, hergeben, oft mehr als wir haben.
Der Weg in mein Paradies führt durch eine warm braune Haustür in ein schmales, hohes Bürgerhaus in der Bonner Altstadt in den zwanziger und dreißiger Jahren.
Dort sitzen wir in der großen Küche: Hänschen mit seinem Lauselümmel-Gesicht, Kurtchen mit seinen abstehenden Ohren und den so langen Fingern, die am liebsten nur über das schwarze Klavier getastet haben, die Muttel, immer etwas hilflos, freundlich lächelnd in dem großen Sessel. Vater ist noch oben im Badezimmer und wir können ihn hören, wie er mit viel Gefühl das Lied von dem armen Wandergesell, welcher seinem Mädchen gute Nacht sagt, singt. Gertrud schaut mit ihrer weißen, gestärkten Schürze zu uns herein und Frau Göttel kommt soeben mit einer schweren Tasche vom Einkaufen zurück.
Wir alle sind in meinem Paradies wieder beisammen.
1 Reiner Maria Rilke
Heinzelmännchens Wachparade
„Komm Hänschen, komm“, rief ich. „Komm, spiel‘ mir Heinzelmännchens Wachparade." Hänschen saß in seinem Zimmer über einem Buch. Noch war Mittagsruhe, wie jeden Tag von eins bis drei. Sie wurde penibel eingehalten, so wie andere festen Zeiten bei uns im Hause. Auch wenn Vater und Mutter nicht da waren, wurde sehr genau auf die Zeiten geachtet. Ich konnte es kaum erwarten, daß wir endlich lostoben durften.
Die große Uhr im Herrenzimmer schlug drei. Schon beim ersten Schlag war ich die Treppe hinauf gerannt, um das Hänschen zu holen. Nichts machte mehr Spaß, als wenn Hänschen Marschmusik machte.
Tarramtata, tarramtata machte das schwarze, glänzend polierte Klavier und manchmal schepperte es ganz herrlich im großen Geschirrschrank, wenn ich dazu hopste und tanzte. „Komm“, rief ich. „Komm Hänschen, Du hast es versprochen." Ich zog ihn an der Hand. „Wer als erster unten ist.“ Wir hasteten die Treppe hinunter, auch wenn wir das nicht durften. Aber außer Gertrud war niemand da und die lag noch oben in Ihrem Zimmer auf der Chaiselongue.
Ich riß die Tür zum Blauen Salon auf und stürzte zum Klavier. Leicht außer Atem schlug ich den Deckel gegen das Holz. „Los, hilf mir“, rief ich. Ich versuchte mit aller Kraft die Flügel der hohen Schiebetür zwischen Salon und Wohnzimmer zu öffnen. Hänschen faßte mit an, und wir schoben sie gemeinsam auf.
Der Blaue Salon lag zur Straße hin. Im Erker stand Muttels kleiner Nähtisch, gegenüber die Vitrine mit den Gläsern. Davor die kleine Sitzgruppe mit den blauen Sesseln. Alle Sitzmöbel in diesem Raum waren mit einem königsblauen Stoff bezogen. Auf der anderen Seite stand Muttels Schreibtisch, an dem sie ihre persönliche Korrespondenz erledigte. Durch die große Schiebetür gelangte man ins Wohnzimmer. Hier saßen wir abends, wenn Vater nach Hause kam.
Von hier aus ging man nach hinten in den Wintergarten, von dem eine Treppe hinunter in unseren Garten führte. Eigentlich war es unser Eß- Wohnzimmer. Auf der einen Seite stand der große Eßtisch, an dem wir alle Platz hatten. Meistens saßen wir da zu sechst. Vater saß am Kopfende und Muttel auf der rechten Seite neben ihm. In der Zeit als es Muttel so schlecht ging, streichelte er so ihre Hand. Ich saß neben Muttel und die Jungs saßen uns gegenüber. Am anderen Kopfende saß meist Frau Göttel. Sie gab das Essen auf und achtete darauf, daß wir uns gut benahmen. Nun, meistens taten wir das ja. Nur Hänschen erlebte hin und wieder den strengen Blick meines Vaters.
Auf der anderen Seite standen der flache runde Tisch und das breite Sofa. In der Ecke stand noch ein weiterer Sessel und auf dem kleinen Tischchen die Karaffe mit dem Weinbrand.
Wenn sie abends Schach spielten, zogen die Jungens schnell zwei Stühle rüber und setzten sich an den kleinen Tisch.
Vater griff zur Abendzeitung und manchmal, wenn er nicht allzu müde war, durfte ich bei ihm sitzen und mich mit ihm hinter der Zeitung verstecken. Dann las er mir leis daraus vor und ab und zu sagte er auch: „Ach Italein, lies Du mal, die Äugelein sind schon müd.“ Dann las ich. Manchmal las ich es etwas anders, als es dastand und ich wartete, ob Vati es merkte. Dann hob er streng die Augenbrauen und schaute mich prüfend an. Meist jedoch ließ er den kleinen Scherz geschehen und schmunzelte im Nachhinein. Das Hänschen setzte dann noch eins drauf und tat so, als sei er besonders empört und erzählte die Geschichte, die er ja bereits gelesen hatte noch wilder und unglaubwürdiger als ich es getan hatte.
Irgendwann veränderte sich etwas in unserem Zeitungslesen. Vater wurde dabei immer ernster. Ich verstand nicht, warum er zwischendurch besorgt dreinschaute und dachte an seine schwere Arbeit.
„Das ist nicht gut“, sagte er manchmal und ich fragte dann: „Was ist nicht gut?“ „Ach Italein“, seufzte er. „Weißt Du, die dumme, dumme Politik. Du redest da aber nicht drüber, hm.“ Ich begriff damals noch nicht, aber ich redete nicht drüber.
Tarramtata, tarramtata, jetzt war Platz genug. Das helle Parkett im Durchgang spiegelte in der Nachmittagssonne. Ich tanzte, wie es die Tanzmariechen beim Bonner Karneval machten.
"Heinzelmännchens Wachparade" war Hänschens Meisterstück. Flott und kräftig klang es, wenn er mit Schwung intonierte und ich spürte sofort, wenn er aus spitzbübischem Humor die linke Hand noch etwas heftiger auf die Tasten setzte, als es nötig war.
Danach spielte er "Der hohe Friedberger", "Reitermarsch", "Friedericus Rex unser König und Herr" und dem folgte ein Marsch nach dem anderen. „Ach bitte Hänschen, noch einmal!“ Ich tanzte für mein Leben gern. Ich warf die langen Beine hoch in die Luft, manchmal so verrückt, daß ich mir das Knie vor die Stirn stieß. Ich hatte nicht genug, auch wenn meine braunen Locken schon vor Schweiß an der Stirn klebten: Tanzen, tanzen, tanzen. „Ach bitte liebes Hänschen noch einmal!“ ... und noch einmal.
„Die Husaren kommen!“ Hänschen war aufgesprungen und schlug den Klavierdeckel zu. Dann galoppierte er wie ein Reiter durchs Wohnzimmer. Beim Fenster angekommen trabte er auf der Stelle, schnaubte durch den Mund wie ein Pferd, öffnete das Fenster und setzte mit einer Stützhocke über das Sims.
Hänschen hatte keine Lust mehr. Von draußen, von der Straße hörte man kurz darauf das Aufschlagen eines Fußballes. Hin und her, her und hin.
Ich stand schweißnass am Fenster. Ach, Hänschen. Er hatte es ja auch nicht leicht mit seiner kleinen Schwester. Immerhin war er sechs Jahre älter als ich und ging bereits auf die Oberrealschule in der Innenstadt. Doch, wann auch immer ich ihn um etwas bat, Hänschen kümmerte sich. Er half mir in der Schule, er war ein guter Schüler und wenn ich Sorgen hatte sagte er, „Ach Italein, Du machst ja mal wieder Sachen.“ Er steckte immer voller Streiche. Sein ganzes Gesicht war eine einzige Lausbüberei. Ach, liebes, liebes Hänschen.
Das Geräusch des aufschlagenden Fußballs hatte sich die Straße hinunter entfernt. Die großen weißen Türen schlossen sich wieder und es wurde still im Haus, sehr still. In diesen Tagen war es oft so. Die Nachmittage waren lang und einsam und wenn die Jungens loszogen, mußte ein achtjähriges Mädchen daheim bleiben. Dann drang das leise Weinen durchs Haus, verhalten, unterdrückt, so dass es gerade half den Schmerz zu lindern. Nie habe ich meine Mutter in dieser Zeit laut gehört. Nur in den Tagen, als es zu Ende ging, konnte sie den Schmerz kaum beherrschen.
Ich war sechs als ich zum letzten Mal zu meiner Mutter auf den Schoß kommen durfte. Damals kam sie aus dem Krankenhaus zurück. Vater führte sie ins Wohnzimmer und zeigte ihr wie fein sauber alles gehalten war. Die Nachmittagssonne fiel herein und Muttel wurde auf das große Sofa ganz an die Lehne gesetzt. Danach durften wir Kinder zu ihr kommen. Ich war zügellos und lief auf sie zu. Ich setzte mich auf ihren Schoß und merkte zu spät, daß ich ihr Schmerzen bereitet hatte. Trotzdem hielt sie mich und streichelte mich mit ihren geschwollenen Händen. Sie weinte. Sie weinte vor Schmerzen und weinte vor Sehnsucht nach uns Kindern. Ich war völlig verwirrt.
Muttel war eine natürlich hübsche Frau. Ihr schwarzes, volles, lockiges Haar hatte sie meist nach hinten gekämmt und zusammengebunden. Ihre blauen Augen schauten immer aufmerksam und ihr Lächeln war so liebevoll, wie ich es nie wieder bei einem Menschen erlebt habe. Bisweilen schien sie etwas unsicher zu sein. Sie war eine stille Frau, aber man spürte die Liebe in ihrem Blick. Wer ihr begegnete, erfuhr ihre Umsicht und ihr großes Vertrauen, das sie jedem entgegenbrachte. Die meisten Menschen, die uns besuchten, waren berührt von ihr und so kam es, dass sie ihr ihrerseits Vertrauen schenkten.
Geduld und Sorge um uns Kinder und unseren Vati prägten ihr tägliches Leben. Sie war selber die älteste von drei Geschwistern gewesen und hatte früh gelernt für andere da zu sein.
So machte sie sich Vorwürfe, dass sie nicht wie andere Mütter für uns Kinder sorgen konnte. Das Rheuma hatte ihre Beine, ihre Arme, ihre Füße, ihre Hände entstellt. Die Gelenke waren dick geschwollen, so dass sie sie kaum bewegen konnte und wenn, dann nur unter großen Schmerzen. Wenn sie die Treppe hinauf wollte, musste sie getragen werden.
Das Weinen, so schien es mir, drang auch durchs Haus, wenn sie ihre Tage im Krankenhaus verbringen mußte. Es waren verzweifelte Versuche, wenn mein Vater sie in das Johanniter Krankenhaus in Beuel brachte oder mit ihr auf den Venusberg ins Marienhospital fuhr.
Es musste an der Stille in diesen hohen Räumen liegen und an dieser widersprüchlichen Stimmung bei uns zu Hause, aber in den letzten Tagen war ihr Weinen immer zu hören, auch wenn sie nicht da war.
In dem Blauen Salon war es nun ruhig, oder doch nicht? Tanzten sie nicht die kleinen schwarzen Löwen und Tiger, welche in das Kirschbaumholz der Möbel eingelegt waren? Natürlich tanzten sie. Die Phantasie eines kleinen Mädchens ließ sie sich aufrichten, sich dehnen und strecken und durch das Zimmer streifen. In Sekunden verwandelte sich der feine Salon in ein Karussell. Ein leises Karussell, das wie im Traum anfuhr und langsam schneller wurde. Nun drehte es sich und leise kam die Musik zurück: „Tarramtata, tarramtata ...,“ mit Bläsern, mit klingendem Spiel, als Rausch in Flimmern und Farben. Ich drehte mich auf der Stelle, immer schneller, immer schneller. Ich legte den Kopf in den Nacken und ließ die langen Haare nach hinten fliegen, bis mir schwindelig wurde. Erschöpft sank ich auf den Boden. Ich genoß, daß sich das Karussell weiter drehte, wenigstens ein paar Sekunden.
Ich trat hinaus auf den Korridor. Ich lauschte nach oben. Gertrud stand sicher wieder oben am Fenster, wie alle Tage um diese Zeit. Ich stieg beide Treppen hinauf.
Gertrud war unser guter Geist. Ein einfaches Mädchen, das den Haushalt in Ordnung hielt. Sie mochte damals um die dreißig gewesen sein, aber ihre Haare waren schon grau. Ihr Gesicht war breit und freundlich und wenn sie lachte entblößte sie eine Reihe großer, gelber Zähne, die weit auseinander standen. Es wäre zum Erschrecken gewesen, wenn sie nicht ein grundgütiger und lieber Mensch gewesen wäre.
Oben unter dem Dach hatte sie eine eigene kleine Stube. Das Fenster schaute auf die Straße. Zur Mittagsruhe legte sie sich in der Regel auf ihr kleines Sofa. Nach dem Mittagsschlaf stand sie auf, wusch sich und legte eine frische Kittelschürze um. Dann roch sie nach Kernseife und Wäschestärke.
Als ich zu ihr hochkam, hatte sie es sich bereits am Fenster bequem gemacht. Sie legte sich meist ein Kissen auf das Fenstersims, damit es nicht so unter den Armen drückte und schaute auf die Straße. Ich schob sie ein wenig beiseite und bekam auch mein Plätzchen auf dem Kissen.
Gertrud war ein großes Kind. Sie mochte uns Kinder gerne und wenn die Eltern nicht in der Nähe waren, erlaubte sie uns manchen Unsinn. Ich nestelte an ihrer Schürzentasche. Dort hatte sie immer eine Handvoll Klümpchen verstaut, wenn sie am Nachmittag aus dem Fenster sah. „Willst Du auch eins“, fragte ich sie. „Gute Idee“, meinte sie und man sah ihr an, daß sie nur darauf gewartet hatte. Wir lutschten und kauten Klümpchen um die Wette und erzählten uns Geschichten.
Meist waren es Geschichten von den Leuten, die auf der Straße entlang kamen. Natürlich kannten wir die meisten Leute, und Gertrud wußte immer was Neues zu berichten.
Doch einige Leute kannten wir gar nicht, und sobald ein wohlbeleibter und vornehm gekleideter Herr vorbeikam, war er für uns ein Graf oder doch zumindest der spanische Botschafter.
Auf der Straße hatte den ganzen Tag die Sonne gelegen und die Luft war warm. Bonner Luft, eine besondere Luft. Ich sog sie tief ein.
Bis heute, wenn ich auf meinem Balkon sitze, hole ich bisweilen tief Luft, um sie zu riechen und zu schmecken, unsere Bonner Luft. Dann weiß ich, dass ich wieder hier bin, zu Hause, auch wenn kaum einer von den anderen mehr lebt.
So manches stille Gebet weht dann über die Baumkronen dem Rhein zu für die, die nicht mehr unter uns sind und die wenigen, denen ich heute im Alter wieder begegnen durfte.
Ganz weit in der Ferne sah man den Drachenfels. Die Sonne stand weit im Westen und das Grün der Rheinhöhen war wieder satter und saftiger als tagsüber, wenn sie direkt von Süden darauf schien. Selten war die Luft am Nachmittag noch so klar und wenn, dann schimmerte der Fels durch das Grün hindurch.
Ob wir wohl am Sonntag dorthin wandern würden? Wir, das waren meist nur Vati und ich. Muttel konnte das schon lange nicht mehr und die Jungs waren meist mit ihren Kameraden unterwegs. Am Freitagabend, wenn er spät von der Arbeit gekommen war, dann saßen wir nach dem Abendbrot noch alle beisammen. Die Jungens erzählten von der Schule oder von der Freischar und berieten ihre Pläne für das Wochenende. Wenn ich dann ins Bett sollte, schmiegte ich mich oft noch an ihn und wollte nicht. „Italein“, sagte er dann und verlieh seiner Stimme einen strengeren Ausdruck. „Du musst an morgen denken. Uns erwartet eine weite und beschwerliche Reise.“ Dann war ich glücklich und lag noch lange wach und träumte von der abenteuerlichen Reise, die uns bevorstand.
Natürlich war diese ganz harmlos. Vati nannte es seine „Abspecktage“, obwohl ich nie fand, dass er zu dick war.
Samstag in der Früh marschierten wir zum Anleger am Rhein. Dort wartete schon das „Bötchen“, wie Vati die Rheindampfer nannte und pünktlich um viertel nach elf legten wir in Königswinter an. Dort bestieg ich meist eines von den Eselchen, die dort warteten und nun ging es im gemächlichen Eselstrott hinauf zum Drachenfels. Vati marschierte den ganzen Weg nebenher und oben wanderten wir gemeinsam weiter über die Höhen.
Vati nahm seine „Abspecktage“ sehr ernst. Wir zogen bei Wind und Wetter hinauf, egal ob die Sonne schien oder ob es stürmte oder schneite. Vielleicht hätte man es auch besser „Abhärtetage“ nennen sollen. Nur manchmal, wenn das Wetter allzu arg war, kehrten wir auch bei einem „Wirte Wundermild“ ein und nahmen dort unser Mittagbrot, doch die meiste Zeit wanderten wir.
Nach einer solchen Wanderung, wenn wir abends durchsonnt oder auch durchgefroren und müde nach Bonn zurückkamen, gab es immer eine Belohnung. Bevor wir nach Hause gingen, kehrten wir in den „Bergischen Hof“ ein. Dort bekam ich einen „Halben Hahn“ und eine Limo. Ein „Halber Hahn“ ist in Bonn ein Brötchen mit Käse und Senf. Mein Vater bestellte sich das ersehnte Bier und aß dazu meist Sauerfleisch mit Bratkartoffeln. Für uns war es der krönende Abschluss.
Oft war es schon dunkel, wenn wir um die letzte Kurve in die Blücherstraße einbogen. Vati fasste mich an der Hand und wir schlenderten ganz gemächlich die Straße entlang. Er summte ein wenig vor sich hin und ich glaube, er war dann sehr glücklich. „Sehen wir uns morgen?“ fragte er bevor wir die Treppe zur Haustür hochgingen. „Du meinst, auf dem Drachenfels?“ fragte ich. Er drückte dann meine Hand und sagte: „Bis morgen, Italein.“
Heimabend
Die Klümpchen waren inzwischen alle. Die Sonne stand hinter den Hügeln und warf lange Schatten auf unser Haus. In der Blücherstraße wurde es jetzt lebendig. Die Jungens kamen, nicht nur unsere Jungens. Jeden Donnerstag um viertelacht traf man sich bei uns im Keller. Die Waschküche bot Platz genug und die Wäsche hing jetzt im Sommer sowieso draußen. „Hast Du schon gehört?“ Karlemännchen rief die Straße hinauf. „Am Samstag spielen sie gegen Troisdorf auf eigenem Platz. Ich geh da mit meinem Vater hin.“
Karlemännchen war Hänschens Freund. Sie spielten immer zusammen Fußball. Karlemännchen war etwas kleiner und etwas dick, aber er war immer sehr lustig. Er kannte sich im Fußball gut aus, und ich bewunderte manchmal wieviel er wußte. Wenn er mich sah, hatte er meist ein Klümpchen oder ein paar saure Drops dabei. Dann kam er zu mir. „Is jot för de Fejur“, sagte er und fügte verständnisvoll hinzu, „wenn man so 'ne Hongerhake is.“ und drückte mir eines in die Hand.
Ich war fürchterlich dünn damals, dünn und riesengroß. Mit zehn war ich bereits so groß wie andere mit 13 oder 14 und wog viel zu wenig. Muttel hatte meine Haare schulterlang wachsen lassen und so hielt es auch unsere Frau Göttel. Fräulein Sinemus meine Lehrerin in der Volksschule liebte es, wenn sie mir die Haare kämmen durfte und flocht sie entweder zu einem Zopf oder zu großen Affenschaukeln. Zu Hause gab es ja niemanden, der das tat und ich rannte meist auf den letzten Drücker morgens in die Schule und hatte mir dann nur flugs einen Reif ins Haar gesteckt.
Wenn man so früh so groß gewachsen ist, wird man oft viel älter eingeschätzt, als man ist. Manchmal hatte es ja seine Vorteile, aber sehr häufig trägt man Nachteile davon, denn die meisten Leute erwarten zu viel, weil sie Länge und Alter verwechseln, und wenn man diese Erwartungen dann nicht erfüllen kann, dann ist man sehr schnell nur noch lang und doof.
Mit Karlemännchen kam meist Kralle. Kralle hieß eigentlich Rüdiger. Er war lang und dünn und war der Tormann bei den Jungens. Daher hatte er auch seinen Spitznamen. Kralle war schüchtern und traute sich nur zusammen mit Karlemännchen zu uns rein.
Wolfgang kam aus der Bernauerstraße. Er war immer sehr besonnen und betrachtete die Dinge eher philosophisch. Mit ihm kam Kalla. Kalla war Klassenbester und ich glaube ziemlich intelligent, das mußte er wohl sein. Er war drei Jahre älter als ich und später in der Realschule, gab er mir Nachhilfe in Mathe und Französisch. Ich verstand das nie und er verstand alles.
Kalla verstand auch später alles und das war manchmal gut, gerade viele Jahre später, als der Krieg schon lange vorbei war und er nur noch einen Lungenflügel hatte, weil man ihm den anderen weggeschossen hatte. Damals ahnte ich nicht, daß es eine lebenslange Freundschaft werden sollte in der er alles verstand und ich ihm nie das wiedergeben konnte, was er mir gab. Kalla verstand immer was mich bewegte. Für alle hatte Kalla Rat und Hilfe, nur mit sich selber kam er oft nur schwer zurecht.
In unserem Vorgarten stand inzwischen ein gutes Dutzend Fahrräder. Die Jungens kamen teilweise von weit her, zu Fuß und zu Rad, aus ganz Bonn. Die „Freischar junger Nation“ hatte ihren Heimabend einmal in der Woche. Meist waren sie in unserem Keller aber gelegentlich auch in einem anderen. Die Heimabende dienten der vaterländischen Erziehung. Auf ihnen wurden die Aktivitäten für das kommende Wochenende besprochen, manchmal wurde aber auch über die Liebe zum Vaterland gesprochen oder über Tugenden wie Treue, Heimatliebe und Kameradschaft.
Mein großer Bruder kam als letzter. Mit ernster Miene, hoch erhobenen Hauptes schob er sein Fahrrad das Trottoir hinauf. Er war der Führer der „Freischar junger Nation“ des Bezirkes Bonn. Kurt war acht Jahre älter als ich. Er war überschlank, still und besonnen und mir schien, er war ernster als wir, aber das konnte auch am Altersunterschied liegen. Dabei war er ein fröhlicher Mensch und unendlich geduldig mit seiner kleinen Schwester. Richtig froh war er immer dann, wenn er bei seiner Musik sein konnte. Er liebte das Klavier und ich glaube er war wirklich begabt. Was immer man ihm vorlegte, er spielte alles vom Blatt, wirklich alles. Zum Üben musste er nie angehalten werden, eher schon zu den Hausaufgaben, wenn er sich wieder einmal Nachmittage lang „verspielt“ hatte. Und er liebte die Dichter. Seine Gedanken wanderten mit Hölderlin, Rilke, Fontane und Kleist und er glaubte fest daran, dass das Gute im Menschen Gutes für ein Volk hervorbringen musste. Sein letztes Jahr an der Oberrealschule jedoch absolvierte er ehr mit Ach und Krach. Beinahe hätte er sich nur verträumt, aber da hat Vati ihn noch rechtzeitig zusammengestaucht, und so hat er es dann doch noch ganz gut geschafft.
Im Gegensatz zu mir hatte er Muttel noch ganz gesund kennen gelernt, bevor dieses schlimme Gelenkrheuma von ihr Besitz ergriffen hatte. Und er half auch immer, wenn sie die Treppen getragen werden musste.
Seine Aufgabe als Führer der Freischar Junger Nation nahm er sehr ernst. Wer dazugehören durfte, war stolz darauf, denn er wählte nur „die Besten“ aus. Das hatte weniger was mit den Leistungen in der Schule oder im Sport zu tun, sondern es ging vielmehr um den ehrsamen Lebenswandel und Charakter. Jungen, die beim Lügen ertappt worden waren, Maulhelden oder welche, die mit Mädchen herumpoussierten, bekamen keine Möglichkeit. Karlemännchen und Kralle waren eher die Ausnahme, weil sie die besten Freunde vom Hänschen waren.
Es dauerte nicht lange und aus dem Keller erscholl das Lied von den Wildgänsen, die durch die Nacht rauschten. Ich gehörte nicht dazu, zum einen, weil dort gar keine Mädchen mitmachten, zum anderen, weil ich auch noch viel zu jung war. Doch die Jungens mochten mich und wenn ich mich still verhielt, durfte ich dabei sein.
Ich stieg die Treppe in den Keller hinunter und stand vor dem Raum aus dem das Lied erklang. Ein wenig andächtig lauschte ich, dann öffnete ich vorsichtig die Tür so, als öffnete ich einen geheimnisvollen Schrein. Da saßen die für mich so großen Jungens und sangen mit ernstem Gesicht und tiefer Inbrunst ihr Lied.
Es mochten ungefähr vierzig sein. Ein paar rutschten ein wenig an die Seite und ich durfte mich zu ihnen setzen. Es roch nach Jungensschweiß, trotz der Kühle des Kellers war es warm und stickig. Es störte mich nicht, es störte niemanden, denn die Sache, wegen der sie hier waren, war ihnen viel zu wichtig.
Mein großer Bruder war sehr ernst. Er hielt den Vorsitz und erhob sich als das Lied zu Ende war. Ich hätte mich erschrocken, wenn ich ihn nicht besser gekannt hätte. Die Jungens wurden mucksmäuschenstill. Er wartete fast eine Minute ehe er anhob. Dabei blickte er konzentriert an die gegenüber liegende Kellerwand.
„Kameraden!
Warum spreche ich zu Euch immer wieder über unser Vaterland? Warum?
Weil das Vaterland Euch alles gegeben hat, was Ihr heute habt.
Weil das Vaterland Euch alles gegeben hat, was Ihr heute seid.
Und weil ich fest daran glaube, daß alles, was man uneingeschränkt für das Vaterland tut, für sein Volk, für die Menschen, gut getan ist!“
Ich mußte schlucken. Aus den Augenwinkeln beobachtete ich, wie der eine oder andere Junge Mühe hatte die Tränen zu unterdrücken. Kurt sprach so eindringlich und jeder der Jungs fühlte sich persönlich angesprochen.
„Doch, was ist der Antrieb aus dem alles geschieht, was ist der Maßstab, nach dem alles geschieht? Kameraden, es gibt nur eine Antwort. Es ist die Liebe.
Die Liebe zu unserem Land, die Liebe zu unserem Volk, die Liebe zu unseren Freunden, die Liebe zu unseren Familien. Sie treibt uns voran, sie läßt uns nicht zur Ruhe kommen.“
Ich fühlte wie mir eine Gänsehaut nach der anderen über den Rücken lief. Meine Hände waren feucht. Keiner von uns ahnte, daß diese Schauer einmal in ein Frösteln und Zittern übergehen würden.
Wenn ich heute sein Tagebuch lese, das er später als junger Offizier geführt hat, dann möchte ich schreien und heulen. Alles steht dort drin. Der tiefe Glaube an die Ehre, die Liebe, an das Vaterland und daran, das nur engagiertes Handeln Probleme löst und nicht Feigheit und lamentieren. Nur eins steht nicht drin, nämlich daß diese jungen Menschen von damals schändlich mißbraucht wurden.
„Ihr seid die Auserwählten, die dann aufstehen, wenn das Vaterland ins Abseits gerät.“
Kurt sprach in die atemlose Stille hinein.
„Ihr seid die Auserwählten, die mit Ihrer Ehre dafür einstehen, wenn die Zeit gekommen ist.“
Er machte eine kurze Pause.
„Einige von Euch werden die Frage stellen, warum ich, warum wir?
Kameraden, weil die Liebe und die Treue jeden von uns bindet. Weil diese Liebe nicht uns selbst sondern den unsrigen gilt. Wir werden nicht reden, wir werden nicht prahlen, wir werden es tun.
Kameraden, das Tun zählt, nur allein das. Wenn die Zeit gekommen ist, werdet Ihr erkennen: Es gibt keine anderen!“
Er hielt noch einmal inne.
„Für Ehre, Volk und Vaterland!"
Donnernd brauste der Applaus auf. Es war ohrenbetäubend in dem kleinen Keller. Kurt blieb stehen und wartete. Als sich der Lärm gelegt hatte, sagte er nur knapp: „Wilde Gesellen“. Wie auf Kommando sangen sie das Lied von den grauen Kolonnen, die der Sturmwind durchweht hatte, und ich sang mit. Ich marschierte im Geiste mit, mit den Fürsten in Lumpen und Loden, die von Spöttern und Speiern verlacht wurden und denen dennoch die Sonne nicht unterging. Mein Gott, wir konnten alle nicht wissen, wie weit sie noch marschieren würden!
Es war spät und schnell machten sich die Jungens wieder auf den Heimweg. Gertrud war längst auf ihre Stube gegangen und meine Brüder verschwanden auf ihre Zimmer. Es war wieder ruhig im Haus Nr. 7 in der geliebten Blücherstraße.
Vater war immer noch nicht da, und ich saß auf den Treppenstufen vor dem Haus und wartete wie manchen Abend voller Sehnsucht, und ich dachte darüber nach, wie wichtig es doch war, daß man sein Vaterland so sehr liebte. Ich glaube, daß wir das tatsächlich auch alle taten. Es ist leicht zu lieben, wenn man glücklich ist.
Unser Töff
Die Treppenstufen waren immer noch warm und der Himmel hatte inzwischen sein Abendblau angezogen. Es würde noch eine Weile hell bleiben, bis die Sonne dann endgültig ihre Strahlen auf die andere Seite des Horizontes richtete. Da kam vom unteren Ende der Blücherstraße ein fröhlich tuckerndes Motorgeräusch herauf. Ein kleiner schwarzer Wagen mit einem grünen Streifen drum herum brummte um die Kurve, und wer saß am Steuer? - Unser Vati! „Vati kommt, Vati kommt!“ ganz aufgeregt war ich ins Haus zurück gerannt. „Er hat ein Auto!“ Die Jungens kamen die Treppe herunter und wir liefen Ihm entgegen. Selbst Gertrud, die ja oft froh war, wenn sie sich mal ausruhen konnte, kam aus Ihrer Stube.
Zügig näherte sich der kleine Wagen und Vati steuerte ihn ganz rechts an den Bordstein.
Das war unser erstes Auto. Es gehörte natürlich nicht uns, sondern der Firma für die Vati arbeitete, aber wir waren alle riesig stolz, als dieser kleine Opel nun direkt unter der Laterne vor unserem Haus hielt.
Natürlich wollten wir sofort eine Probefahrt machen. Aber es war schon spät und außerdem mußte Italein als erste zu Bett. So durften alle einmal einsteigen und richtig gemütlich Platz nehmen und sich wie erfahrene Chauffeure und Reisende fühlen. Auch Gertrud wurde unter großem Zureden und dem Versprechen, daß das Auto nicht plötzlich losknattern würde, auf den Beifahrersitz geschoben.
Das große Ereignis, die Probefahrt wurde auf den kommenden Samstag verlegt und so waren wir zwei Tage lang stolz und nervös in einer Tour.
Immer wieder schlich eines von uns Kindern hinaus und betrachtete das Gefährt von allen Seiten. Wir fragten unseren Vater und durften es waschen und pflegen, obschon wir das ja noch nie gemacht hatten. Eine Bürste für die Felgen, reichlich Seifenschaum für den Kühler und als alles gut getrocknet war, zog Kurtchen ein weiches Tuch hervor und polierte die dicken aufgesetzten Scheinwerfer. Was würden wir am Samstag funkeln und glänzen.
In der Schule hatte es sich schon längst herumgesprochen, weil unser Lauselümmel Hänschen natürlich geprahlt hatte, und am Freitagabend war wieder ein Horde von Jungens da, die alle einmal drin sitzen wollten. Sogar der Sohn vom Fleischermeister Binnewitz, der sonst nie in unsere Straße kam, gab sich die Ehre und ging bestimmt zehnmal um das Vehikel herum. „Nie hat der 23 PS”, konnte ich ihn hören. „Musste mal unseren Mercedes sehen.” Und mit Blick auf das Tachometer: „Der schafft niemals volle sechzig.” Ich bekam langsam die Wut, denn ich fand, daß unser Töff bei weitem das schönste Auto von allen war, und hier in der Blücherstraße war es sowieso das einzige.
Dann kam endlich der Samstagnachmittag, doch die Jungens waren nicht da. Karlemännchen hatte sie überredet mit zum Fußball zu kommen und so bekam ich den Vortritt. Dabei war natürlich klar, daß es morgen noch eine Probefahrt geben sollte.
Galant führte mich Vati zum Automobil. Er öffnete die Tür und verbeugte sich, wie ein echter Chauffeur. Ich nahm ebenso artig auf der gepolsterten Rückbank Platz und war stolz „wie Oskar“. Ich mit Vati allein im neuen Automobil!
Etwas holperig ging es los das Stückchen die Blücherstraße hinauf zur kleinen Kreuzung. Vati fuhr ganz vorsichtig mit mir als seinem ersten Passagier, vielleicht brauchte er ja auch noch etwas Übung.
Der kleine Opel tuckerte um die Kurve, und ich saß mit stolz geschwellter Brust auf dem Rücksitz und schaute nach links und rechts durch die Fenster nach draußen. Die Poppelsdorfer-Allee rollte gemächlich an mir vorbei. Ein Stückchen hinauf und dann wieder hinunter, hach war das schön. Dann ging es links in den Talweg hinein und schwupps auf die Weberstraße. An der nächsten Kreuzung mußten wir einen Augenblick stehen bleiben und ich hörte, wie das Getriebe ausgekuppelt wurde. Vati mußte etwas Zwischengas geben, dann fuhren wir wieder an. Es ruckelte wieder etwas. „Aha, so war das beim Autofahren: Es ruckelt halt ein wenig“, so dachte ich. Dann ruckelte es noch mal, etwas heftiger, dann hörte man ein kurzes, häßliches Kratzen. Das Auto rollte langsam weiter. Ein kurzes Aufheulen des Motors. Ein entschlossener Griff zur Handbremse. Ein Ruck fuhr durch das ganze Automobil und dann saßen wir fest.
Ich schaute aus dem Fenster. Etwas ungläubig blickte ich auf die rot weiß gestrichene Stange, die in kurzer Entfernung von uns gen Himmel ragte. Vor mir schien es, als ob Vati nervös zu werden begann. Ich für meinen Teil war mehr gespannt. Er betätigte den Anlasser und trat eines der Pedale. Nichts rührte sich. Ich betrachtete das Geschehen neugierig. Ich hatte ja keine Ahnung und dachte zunächst, das müsse so sein.
Vati stieg aus und holte eine Kurbel hervor. Seine Jacke hatte er ausgezogen und auf den Beifahrersitz gelegt. Er bückte sich vor der Motorhaube und ich wurde auf meinem Rücksitz mächtig durcheinander geschüttelt.
Außer einem kurzen „Plöff“ war nichts zu hören. Vati versuchte es noch einmal. Diesmal waren es zwei „Plöffs“, ansonsten blieb alles ruhig. Der Dritte Versuch wurde plötzlich begleitet von dem eindringlichen harten Läuten einer Glocke, welches Vatis Bewegung unwillkürlich beschleunigte. „Plöff, peröff, peröff“, war die Antwort des Motors. Dann stand alles wieder still. Die Glocke hämmerte weiter. Ein gellender Schrei wie eine Sirene übertönte plötzlich alles. Die Bahn würde kommen und uns zu Brei fahren.
Ich bekam einem riesigen Schrecken und sah schon alles vor mir. Ich schrie aus Leibeskräften. Ich wollte raus aus diesem Kasten und ich faßte den Türöffner und rüttelte daran. Die Türen waren vor Fahrtantritt sorgfältig von draußen geschlossen worden, oder fand ich den Griff nicht? Ich schrie, ich strampelte, ich rüttelte an allem was ich in die Hände bekommen konnte. Vati drehte wie wild draußen an der Kurbel, so daß ich noch mehr durcheinander geschüttelt wurde. Die Glocke hämmerte wie verrückt. Der Motor machte: „Plöff, peröff, peröff, peröff, töff, töff, töff, töff, töff, brmm, brmm, brmm“ und dann lief er endlich wieder.
Vati riß schnell die Kurbel heraus und sprang auf den Fahrersitz. Jetzt gab er so mächtig Gas, so daß der Motor qualmte. Er legte den ersten Gang ein, gab noch einmal Gas und brauste mit mir aus dem Bahnübergang hinaus.
Direkt hinter uns machte es ein letztes Mal „Ping!“ und dann stand die Schranke schaukelnd und quietschend quer über der Straße.
Den Rest der Fahrt erlebte ich nicht mehr. Ich schrie, ich wollte aussteigen und versuchte aufzustehen. Jetzt schrie Vati und gab noch mehr Gas. Mit atemberaubender Geschwindigkeit ging er in die nächste Kurve und noch eine Kurve und noch eine Kurve. Mir wurde ganz schwarz vor Augen und als ich wieder aufwachte, hievte mich Vati aus unserem Töff heraus direkt vor unsere braune Haustür, wo ich mit zittrigen Beinen und völlig verheult stehen blieb.
„Nun ja, nun ja.“ Unsere liebe Frau Göttel stand auch schon draußen und befühlte mich, ob denn alles in Ordnung sei. Dann brachten sie mich gemeinsam in die Küche, wo erst einmal eine Milch erwärmt wurde, um mir etwas Beruhigendes zu Trinken zu geben.
Ich glaube Vati hatte ein ganz schlechtes Gewissen, denn er ließ Frau Göttel die ganze Zeit mit mir alleine. Nur ab und zu schaute er zur Küchentür hinein und schien sich erst langsam zu beruhigen. Dabei konnte er ja gar nichts dafür. Wenn er damals gewußt hätte, wie viele Autoabenteuer ich noch in meinem Leben bestehen würde! Aber wer ahnte Ende der zwanziger Jahre schon, daß über fünfzig Jahre später ein silberglänzender A4 mit Italein am Steuer über die Rheinhöhen brausen würde?
Frau Göttel war unsere Haushälterin. Sie versorgte uns Kinder, kochte und kaufte ein. Sie selber hatte eine gescheiterte Ehe hinter sich. Ihr Mann und ihre Kinder lebten im fernen Kanada und sie lebte mit ihren Schwestern Paula und Birte ein paar Straßen entfernt in der Kirschallee. Sie mochte gepflegte, ordentliche Kinder und sie selber war immer sehr gepflegt.
Wenn sie zu uns kam trug sie eine gestärkte Bluse mit einem Spitzenkrägelchen. Ihr Haar wurde mit einen Haarnetz gehalten und um den Hals band sie immer ein schwarzes Seidenband. Sie verbarg darunter einen leichten Kropf, aber es machte sie zugleich auch ein wenig würdevoll.
Ihre Röcke waren immer bodenlang und am unteren Ende mit einer Borte abgesetzt. Auf den ersten Blick wirkte sie streng, aber wenn man sie kennenlernte merkte man bald, daß sie neben dieser Strenge, die einfach eine hohe Disziplin war, große Herzensgüte verbreitete. „Nun ja, nun ja“, sagte sie immer dann, wenn sie so fassungslos über die (Un-)taten von uns Kindern war, daß sie keine Worte mehr fand und ihr „Nun ja, nun ja“, kam so manches Mal über ihre Lippen. Sie fiel niemals aus der Rolle oder schimpfte uns gar. Vielmehr suchte sie Entschuldigungen für unsere Pannen und stand vor uns, wenn sie Vati von der einen oder anderen Missetat berichten mußte. Diesmal war sie allerdings fassungslos darüber, was unser Vati fertig gekriegt hatte.
Sie war zudem sehr weltoffen und obwohl sie keine wohlhabende Frau war, verkehrte sie in Bonn in den höchsten Kreisen. Gelegentlich nahm sie mich sogar mit, wenn sie zu den Konzerten im Beethovenhaus oder im Hause von Professor Stursberg eingeladen war oder auch nur, wenn sie die alte Frau Selve in ihrer Villa am Rhein besuchte. Dort wurde ich trotz meiner Jugend immer wie eine Dame behandelt.
Die Jungens waren inzwischen zurück, aber Frau Göttel verfrachtete mich erst einmal ins Bett. Die beiden Großen kamen und drückten mich und Hänschen konnte sich natürlich das Feixen nicht verkneifen. „Italein, Italein, wir konnten Dich bis nach Troisdorf hören, wat wa dann los?“ Ich aber grummelte nur. Doch als mich die warme Fühle umfing, atmete ich den Duft frischer Wäsche tief ein, genauso wie ich jeden Abend den Duft unseres Gartens, unserer Straße und unseres Rheintales tief einatmete. Ich war wieder geborgen. Während unten in der Küche in Vatis Erzählung noch immer „Plöffperöff „und „Ping“ um die Wette kämpften, träumte ich von unserem Vati, der ein widerspenstiges Töff bändigte und dabei ziemlich in Schweiß geriet. Lieber, lieber Vati.
Am nächsten Tag verlief die Fahrt natürlich ganz anders. Die Jungens baldowerten die Route aus und ich merkte bald, daß sie jeden Bahnübergang vermieden. Kurt als Ältester durfte vorne auf dem Beifahrersitz Platz nehmen. Hänschen und ich saßen hinten. Hätte es nicht am Tag zuvor diese Beinahe-Katastrophe gegeben, hätte er sicher versucht mich ein wenig auf den Arm zu nehmen, aber er blieb still und wollte erst einmal sehen, wie sich das Gefährt bewegte.
Diesmal war unser Ziel das Marien Hospital, um die Muttel zu besuchen und ihr von dem neuen Automobil zu berichten.
Wir hätten sie gerne auf eine kleine Fahrt mitgenommen, aber als wir ankamen fanden wir sie in einem Sessel und sie hatte Mühe sich zu bewegen. Mit den vielen Medikamenten ging es ihr etwas besser, aber ans Laufen war nicht zu denken.
Vati wurde sehr traurig und wir blieben bei ihr sitzen und erzählten, bis es draußen anfing dämmerig zu werden.
Es tat weh, sie an diesem Abend alleine zu lassen und als wir nach draußen traten, hatte ich das Gefühl, daß Vati beinahe geweint hätte. Die Jungens waren schon wieder bei einem anderen Thema, da hakte ich mich bei Vati ein und gab ihm einen kleinen Stubbs. „Auf geht’s jetzt, ab durch die Weberstraße.“ Ich zwinkerte zu ihm hinauf, und ich glaube er war so erstaunt, daß er beinahe losgeprustet hätte. Die Fahrt blieb dennoch still und als wir nach Hause kamen, blieb ein braves Töff draußen und drei stille Kinder und ein stiller Vati gingen hinein.
Weißer Sonntag
Auch am darauffolgenden Sonntag fuhr Vati wieder unsere Muttel besuchen. Er tat das an jedem Sonntag, wenn sie einen dieser Schübe bekommen hatte und im Krankenhaus lag. Wir konnten ihr auch überhaupt nicht helfen. Die Ärzte wussten ebenfalls keine Lösung. Im Krankenhaus wurde sie betreut und bekam Medikamente gegen die Schmerzen.
Muttel und Vati kamen nicht aus Bonn. Vati war in der Mark Brandenburg in einem kleinen Ort namens Köpernitz geboren, wo mein Opa einfacher Landarbeiter, ein Kätner beim Großgrafen gewesen war. Manchmal, wenn wir ihn fragten, dann erzählte Vati die Geschichte, von dem Pferdewagen, der ihn als einziges von 6 Kindern mit 14 Jahren in die nächste Stadt gebracht hatte, damit wenigstens eines der Kinder eine Lehre machen konnte. Das war Rheinsberg gewesen und in dem kleinen Kolonialwarenladen hatte er drei Jahre lang gelernt. Und dann hatte ihn sein Lehrherr mit einem guten Zeugnis in ein großes Kontor nach Hamburg geschickt, damit er auch Import und Export lernen konnte.
Sein Leben lang war Vati betrübt, dass er nur Volksschule gehabt hat und es verging später keine freie Minute, in der er nicht ein Buch las oder den Wirtschaftsteil in der Zeitung studierte, um sich weiter zu bilden.
Dann erzählte er, dass er seine erste richtig gute Stelle in Weißwasser in der Glashütte bekam und wie er es seiner Mutter versprochen hatte, als er aus Köpernitz wegfuhr, war er brav jeden Sonntag in die Kirche gegangen. Und da stand sie dann, vorne in der ersten Reihe im Kirchenchor und hatte so schön gesungen und hatte so schöne blaue Augen gehabt, die so ganz besonders zu diesen schwarzen Locken gepasst hatten, unsere Muttel. Ja und dann hatte er sich lange nicht getraut, so lange, dass unsere Muttel schon fast gedacht hatte, dass es nichts mehr werden würde mit ihnen. Und dann hatte er sich aber doch getraut und hatte sie nach der Kirche artig nach Hause begleitet und gleich nach der nächsten Chorprobe noch einmal. Und eines Tages hatte unsere Muttel gesagt, er solle zum Mittag bleiben. Das war aber nicht gleich beim ersten Mal, das war erst, als Vater Hoffmann gefragt hatte, ob sie denn den jungen Mann, nicht einmal vorstellen wolle.
Und Vati erzählte, wie er von unserer Muttel in die große Küche mitgebracht worden war und wie ihm dieses feine dunkelhaariges Mädchen so sanft und liebevoll einen Teller Suppe serviert hatte, dass er plötzlich gar nicht mehr hatte weg wollen. Und dann hatte er sich gedacht, dass er da noch einmal wieder kommen musste. Ja und das hat er dann auch gemacht und das junge Mädchen war unsere Muttel geworden. So war das gewesen.
Kurt und Hans waren beide noch in Weisswasser geboren, aber als ich in Wesel zur Welt kam, war die Geschichte schon längst weiter gegangen, bis eben Vati dann seine gute Stellung bei den Keramischen Werken bekam und wir später in dieses feine Bürgerhaus nach Bonn zogen.
Bonn war damals eine Gartenstadt, geprägt durch die Universität. Es lebten viele Rentner dort und viele wohlhabende Leute. Der Menschenschlag war freundlich, leicht dahinlebend. Die Sommer waren sehr warm und feucht, und diese verliehen der Stadt eine besondere Pflanzenpracht. Im Sommer wurden viele Sommerfeste mit Wein und Gesang gefeiert und in den Sommernächten duftete es überall nach Blumen. Man konnte stundenlang im Garten sitzen und den Duft der Blüten und des reifenden Obstes in sich einsaugen.
Von unserem Wintergarten hinunter führte eine Eisentreppe auf den Weg, der die gepflegte Rasenfläche unseres Gartens umrahmte. Die hinteren Gärten der Nachbarhäuser waren jeweils mit einer hohen Mauer voneinander getrennt und auch die Rückseite unseres Gartens wurde von eben dieser Mauer eingeschlossen. Um darüber zu sehen oder gegebenenfalls darüber klettern zu können, mußten wir uns an den kräftigen Stämmen des Fliederbaums, der hinten in der Ecke stand, hochziehen. Hatten wir uns mit viel Mühe hinauf manövriert, konnten wir über einen Kartoffelacker bis hin zur Bernauerstraße sehen.
Links und rechts an der Mauer hatte Vati jeweils Blumenbeete anlegen lassen. Am Haus rankten sich Weinstöcke an der Fassade hoch, die im Spätsommer Trauben hatten und die wir Kinder pflücken und essen durften. Im warmen Bonner Sommer reiften sie süß.
Unsere Schattenmorelle und den Pfirsichbaum streckten ihre Äste bis hinüber auf das Nachbargrundstück und als sei es ein gerechter Ausgleich schob des Nachbarn Aprikosenbaum seine Zweige in unsere Richtung; und es war natürlich klar, dass die Aprikosen aus Nachbars Garten süßer waren als unsere eigenen Pfirsiche.
An allen vier Ecken des Rasens hatte unser Gärtner Herr Albig weiße Stockrosen gesetzt, die fast den ganzen Sommer über blühten.
Ich saß auf unserer Eisentreppe und grübelte. Es war Weißer Sonntag in Bonn und es war ein warmer sonniger Tag. Weißer Sonntag war für ein evangelisches Mädchen ein langweiliger Tag. Die meisten anderen Mädchen durften bei einer dieser Prozessionen mitmachen. Ich liebte diese bunten Umzüge und wäre so gerne einmal mitgegangen. Der schönste war für mich immer dieser Weiße Sonntag.
Die katholischen Mädchen bekamen zu diesem Fest weiße, gerüschte Kleidchen an, und ein Körbchen mit Blumen wurde ihnen um den Hals gehängt. Ich beneidete sie sehr darum, wenn dieses Körbchen mit weißen Blütenblättern gefüllt wurde und diese dann auf der Prozession ausgestreut wurden.





























