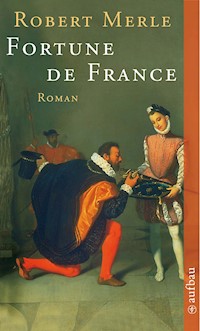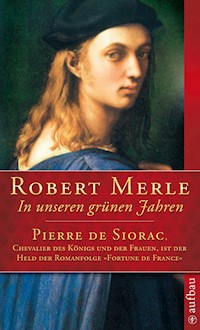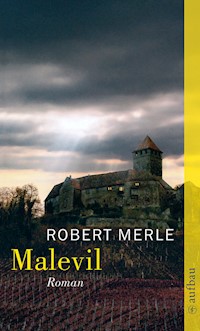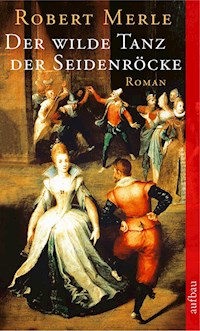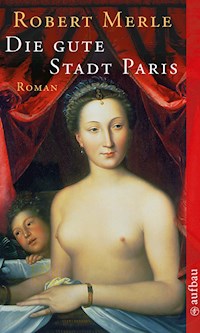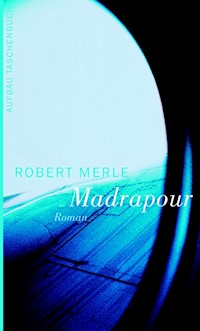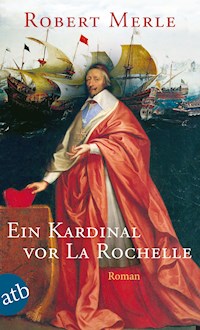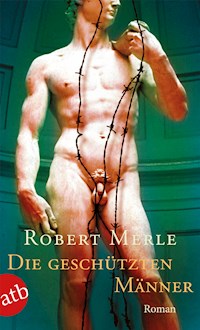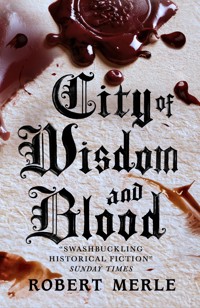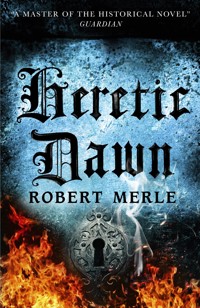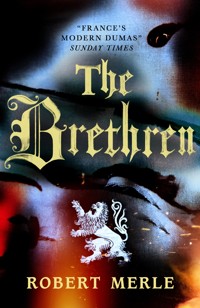8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
22. März 1968. Ort: Nanterre bei Paris. David Schultz, Soziologie-Student, steht am Fenster eines Seminarraumes und beobachtet die algerischen Arbeiter, die draußen in Kälte, Wind und Regen die Terrasse teeren. Nur durch eine Glasscheibe von ihnen getrennt, begreift er die tiefe Kluft, die in Wirklichkeit zwischen beiden Welten liegt. "Hier (in der Universität) wurde den ganzen Tag nur ultraleichte Materie gehandhabt, Ideen, und vermittels der Ideen die Menschen: oberste Funktion der herrschenden Klasse. Und die Beherrschten ... hatten ebenso wenig eine Chance, je in diese Welt hier einzudringen, wie ich in die ihre." Manche glauben, die Isolation durchbrechen zu können, wenn sie die bürgerlichen Normen und Tabus sprengen, wenn sie die Professoren zum Klassenfeind erheben und abenteuerliche Aktionen als revolutionäre Siege feiern. Andere, die Mehrzahl der Studenten, üben politische Abstinenz. Und wieder andere, noch sind es erst wenige, wissen sich eins mit der realen weltverändernden Bewegung: für sie gibt es keine trennende "Scheibe".
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 593
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Informationen zum Buch
22. März 1968. Ort: Nanterre bei Paris. David Schultz, Soziologie-Student, steht am Fenster eines Seminarraumes und beobachtet die algerischen Arbeiter, die draußen in Kälte, Wind und Regen die Terrasse teeren. Nur durch eine Glasscheibe von ihnen getrennt, begreift er die tiefe Kluft, die in Wirklichkeit zwischen beiden Welten liegt. »Hier (in der Universität) wurde den ganzen Tag nur ultraleichte Materie gehandhabt, Ideen, und vermittels der Ideen die Menschen: oberste Funktion der herrschenden Klasse. Und die Beherrschten … hatten ebenso wenig eine Chance, je in diese Welt hier einzudringen, wie ich in die ihre.« Manche glauben, die Isolation durchbrechen zu können, wenn sie die bürgerlichen Normen und Tabus sprengen, wenn sie die Professoren zum Klassenfeind erheben und abenteuerliche Aktionen als revolutionäre Siege feiern. Andere, die Mehrzahl der Studenten, üben politische Abstinenz. Und wieder andere, noch sind es erst wenige, wissen sich eins mit der realen weltverändernden Bewegung: für sie gibt es keine trennende »Scheibe«.
Robert Merle
Hinter Glas
Deutsch von Christel Gersch
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Vorwort
Kapitel I
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel II
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel III
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel IV
Kapitel V
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel VI
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel VII
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel VIII
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel IX
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel X
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel XI
Anmerkungen
Über Robert Merle
Impressum
Der Plan zu diesem Buch ist nicht erst während der Mai-Krise entstanden. Er war früher da. Im November 1967, einige Monate vor den Barrikaden also, vertraute ich meinen Studenten das Projekt dieses Romans an; ich wollte sie besser kennenlernen und bat sie, mir dabei zu helfen: für sie hieß das, ohne Maske und Tabu von sich zu erzählen. Sie willigten anfangs nur zögernd ein, fingen aber in dem Maße Feuer, wie unter ihnen bekannt wurde, welchen Sinn diese Gespräche hätten. Nicht ohne Selbstironie stellte ich fest, daß ein Professor nicht unbedingt den Mund aufzutun braucht, um Interesse zu wecken: es genügt bereits, daß er zuhören kann. Diese Aufmerksamkeit war übrigens kein Verdienst. Ich hatte Offenheit gefordert, und ihre Offenheit übertraf alle meine Vorstellungen. Ich muß sogar sagen, daß mir manchmal die Luft wegblieb.
Vielleicht hätte ich ohne diese Interviews auskommen können, immerhin stecke ich seit vierzig Jahren im Universitätsbetrieb und kenne die geheimen Winkel des Serails. Aber obgleich ich zu meinen Schülern seit jeher gute Kontakte hatte, schien mir der Anlaß geeignet, sie zu erweitern, um meine Kenntnisse aufzustocken. In den Gesprächen mit den Studenten gelang es mir, wie soll ich es ausdrücken, trotz meines Alters in einem gewissen Grade mich ihnen anzugleichen, zumindest im Denken und in der Sprache. Zugegeben, ich hatte zeitweilig sogar das erfrischende Gefühl, zu ihnen zu gehören. Selbstverständlich war das Illusion. Oder Bewußtseinsspaltung, die meinem Vorhaben zugute kam.
Die Mai-Ereignisse gaben meinem Unternehmen einen neuen Charakter, änderten es aber nicht von Grund auf. Mein Plan sah vor, das alltägliche Leben der Studenten in Nanterre zu beschreiben, und dieses Leben blieb für die meisten von ihnen auch dann alltäglich, als das Aufbegehren der auf Veränderung drängenden Kräfte plötzlich eine dramatische Wende nahm. Darum habe ich den Tagesablauf des 22. März 1968 zum Gegenstand meines Romans gewählt. Für die zwölftausend Studenten von Nanterre hatten diese vierundzwanzig Stunden nichts Außergewöhnliches. Für sie glich dieser Tag all den anderen Tagen eines schwierigen zweiten Trimesters, das bald vorüber war. Für hundertvierzig von ihnen endete der 22. März hingegen mit der Besetzung des Verwaltungsturms und des Konferenzsaales der Professoren.
Ich weiß sehr wohl, daß der 22. März, der damals einfach als eine Episode in der antiautoritären Guerilla der Gauchisten erlebt worden war, durch das, was danach geschah, seinen eigentlichen Ruhm erlangte und im Bewußtsein der Beteiligten zu einem wichtigen, einem ganz besonderen Tag wurde, der es verdiente, daß die Bewegung seinen Namen erhielt, die vorgab, den »Geist der Revolution« besser als jede andere zu verkörpern. Für den Romancier aber, der die Wahrheit des Augenblicks hinter den Daten, die Geschichte machen, sucht, gehört der 22. März in den Alltag von Nanterre hinein und darf nicht aus ihm herausgelöst werden.
Ich halte es für vertretbar, daß in meinem Roman reale Personen (Dekan Grappin, Assessor Beaujeu, Generalsekretär Rivière und, auf der Seite der Studenten, Cohn-Bendit, Duteuil, Tarnero, Xavier Langlade) und erdachte Personen (alle hier nicht angeführten) koexistieren. In Verlegenheit geriete ich nur, wenn man versuchen wollte, die letzteren zu entschlüsseln. Gewiß habe ich zwei oder drei völlig nebengeordnete Figuren in durchaus wohlwollender Absicht nach der Natur skizziert, so wie die Maler des Mittelalters sich den Spaß machten, ihren Nachbarn, den Bäckermeister, in einer Ecke ihrer Leinwand, auf der es von Männern und Frauen wimmelte, zu konterfeien. Aber alle entscheidenden Gestalten sind zusammengesetzte Porträts, für die verschiedene Vorbilder haben herhalten müssen, denen ich in meinem Professorendasein begegnet bin, und das keineswegs nur in Nanterre. Betonen möchte ich hier, daß die Figur des Nunc, die leider sehr authentisch wirkt, erfunden ist. Genauer gesagt, ich habe, was ich andernorts beobachten konnte oder argwöhnen mußte, nach Nanterre verlegt.
Um mein Vorhaben zu verwirklichen, habe ich mich – in erneuerter Form, wie ich hoffe – eines »altmodischen« Verfahrens bedient (ich erkläre weiter unten, weshalb ich das Wort in Gänsefüßchen setze), das in den dreißiger Jahren unseres Jahrhunderts angewandt und, wenn ich nicht irre, Simultantechnik genannt wurde. Mit dieser Technik können unverbunden unterschiedliche Existenzen von Menschen dargestellt werden, die zur gleichen Zeit am gleichen Ort, aber voneinander getrennt leben. Ich habe zu dieser Erzählweise gegriffen, weil ich nach allem, was mir in den Gesprächen anvertraut worden war, die Einsamkeit und die Unfähigkeit zur Kommunikation von Anfang an als das zentrale Thema des Studentenlebens in Nanterre ansah. Ich habe sie nicht aus eigenmächtigem Entschluß gewählt. Mein Gegenstand hat sie mir aufgezwungen.
Ich habe das Wort »altmodisch« hervorgehoben, weil 1962 ein Rundfunkkritiker dieses Epitheton in zweifellos abwertendem Sinn für die Technik meines Romans »Die Insel« gebrauchte. Und ich muß sagen, es wundert mich noch heute, daß ein Intellektueller die Mode als legitimes Kriterium für die Beurteilung eines literarischen Werkes betrachten kann.
In unserer Industriegesellschaft, in der es darum geht, immer mehr zu verkaufen, um die Profite zu steigern, wird durch eine aufdringliche Reklame beim Publikum ein unersättlicher Hunger nach Neuheiten geweckt. Durch Ansteckung, durch Denkgewohnheiten, denn wir sind tief in diese Mystik des Konsums verstrickt, erfaßt der Durst nach dem Niedagewesenen mehr und mehr Bereiche, die – wie Kunst oder Literatur – weitgehend außerhalb des technischen Fortschritts liegen. Und da erscheint die Mode dann um so tyrannischer und geheiligter, je willkürlicher sie ist. Im Roman zum Beispiel verlangt eine neue, inzwischen schon einige Jahre alte Religion, daß die Handlung gesprengt, die Situationen ausgelöscht und die Personen zerstückelt werden. Der Autor stellt sich infolgedessen selbst in Frage und gibt sich auf.
Ich mißtraue den Systemen, die ein Künstler sich fabrizieren zu müssen glaubt. Ich stelle fest, daß er dort, wo er am neuartigsten sein will, stets am schnellsten veraltet. Wenn sein Werk überdauert, so um anderer Verdienste willen. Nehmen wir Zola: sein übertriebener Naturalismus erscheint in unserer Zeit recht überholt. Aber sein Lyrismus hält stand. Umgekehrt sind die ästhetischen Anschauungen Oscar Wildes, die damals so kühn und »dernier cri« waren, heute ein alter Hut. Nicht aber der großartige Realismus der »Ballade«. Und hier ist das Gelingen tatsächlich eine Ironie, denn Wilde hat seine ganze künstlerische Höhe genau dort erreicht, wo er sein System verriet.
Ich habe gegen die Verfahren der Selbstzerstörung des Romans an sich nichts einzuwenden, obwohl ich sie als Leser ein wenig ermüdend, eintönig und paradoxerweise konformistisch finde. Der Tod des Romans wird in Abständen immer wieder verkündigt, und doch ist er ein so lebenskräftiges Genre, daß er sich durchaus wie Ugolino vom eigenen Fleisch ernähren kann. Aber in »Hinter Glas« verbot mir mein Anliegen eine solche Technik.
Ich bin nicht von einem leeren Plan ausgegangen, um ihn dann mit Negationen zu füllen. Ich wollte, wie gesagt, das alltägliche Leben in Nanterre am Verlauf eines gewöhnlichen Tages beschreiben, der aber mit einem Abend endete, den die, die ihn miterlebt haben, als außergewöhnlich empfanden. Darum brauchte ich glaubhafte Gestalten, wirkliche Situationen und die zusammenhängende Erzählung. Vor allem durfte ich mich keinesfalls aus lauter Narzißmus öffentlich selbst vernichten, denn wenn mein Fresko einen Sinn haben sollte, mußte ein Autor mit seinem Teil Subjektivität erhalten bleiben.
Nun verursacht mir aber gerade die Subjektivität in diesem Roman ein gewisses Unbehagen. Zum erstenmal seit »Der Tod ist mein Beruf« stehe ich den Ereignissen, die ich schildere, mit gemischten Gefühlen gegenüber. Das soll nicht heißen, daß ich bisher Manichäer war, weit gefehlt. In »Der Tod ist mein Beruf« zum Beispiel hinderte die unerbittliche Anklage gegen den Lagerkommandanten von Auschwitz nicht, daß die Figur von innen her beschrieben wurde, wodurch beim Leser manchmal ein Mitleid erzeugt wird, dessen er sich schämt. Trotzdem war, wie später in den Romanen »Die Insel« oder »Ein vernunftbegabtes Tier«, der Fall eindeutig, und die Sympathien des Autors zeigten sich unverhohlen. In »Hinter Glas« ist das nicht so.
Ich glaube, es war Tolstoi, der nach einem Lob auf das Beobachtungsvermögen Tschechows hinzufügte: »Aber sein Standpunkt gegenüber dem Leben ist noch recht unklar.«1 Als ich dies Urteil las, nahm ich es, wie ich mich entsinne, mit ungeteilter Zustimmung auf. Mir schien, daß eine minutiöse Beschreibung realer Personen nicht Selbstzweck sein dürfe, sondern, wenn auch unausgesprochen, zu einem »klaren Standpunkt« führen müsse. »Hinter Glas« führt mitnichten dazu und bringt mich also in Widerspruch zu meinem eigenen Credo.
Wenn das ein Fehler ist, plädiere ich schuldig. Ich habe mich bemüht, den Gefühlen treu zu bleiben, die ich angesichts der Wirklichkeit von Nanterre hegte, und von diesen Gefühlen läßt sich zumindest sagen, daß sie zwiespältig waren: Billigung und Antipathie, Mißbilligung und Einverständnis gingen Hand in Hand. Ich bin mir durchaus im klaren, daß die Vereinigung solcher Gegensätze mich an vielen Stellen dieses Romans eine ironische Position einnehmen läßt. Nun, man kann die Ironie ihrer Vielseitigkeit und Subtilität wegen als Betrachtungsweise schätzen und ihr gleichzeitig als Lebensphilosophie mißtrauen. Was mich betrifft, so zöge ich es vor, den Ereignissen, die ich beobachtet habe, eine schlüssigere Antwort entgegenzusetzen. Aber andererseits sehe ich nicht ein, weshalb und welcher Staatsräson zuliebe ich vorgeben sollte, nicht unsicher zu sein, wenn ich es bin.
R.M.
I
1
Wo heute die Kirche von Nanterre steht, beteten im Mittelalter die jungen Mädchen aus der Hauptstadt zur heiligen Geneviève, sie möge die ersten Anzeichen unerwünschter Schwangerschaft von ihnen nehmen. Manchmal erhörte die Schutzpatronin Lutetias, in deren Obhut auch diese Pariserinnen standen, solches Flehen. Im Lauf der Jahrhunderte aber verlor die Heilige allmählich ihre Macht oder ihren mitfühlenden Sinn. Die Pilgerschaften endeten, der Materialismus siegte. Und bald kamen die Pariser nach Nanterre nur noch, um seine Fleisch- und Wurstwaren, seine Kuchen und Weine zu probieren.
Dürftige Prosperität. Obgleich der Marktflecken sich rühmen konnte, daß unter Louis-Philippe Frankreichs erste Eisenbahn schnaufend und fauchend an ihm vorübergefahren war, dämmerte er dahin. Seine Feuerwehrleute blieben hinterm Ofen hocken. Die Händler verdienten spärlich, die politische Leidenschaft sank auf den niedrigsten Punkt, die Mädchen hielten es mit der Tugend, allen voran die Rosenjungfrau, die in jedem Jahr vom Stadtrat mit Einverständnis des Herrn Pfarrers gewählt wurde. Wie berechtigt aber das bäuerliche Mißtrauen sein mochte, das dem Beichtvater ein stilles Vetorecht zuwies – sein Eingreifen, man höre und staune, erregte Anstoß bei einem Präfekten des Zweiten Kaiserreichs. »Ich finde in den Schriften nichts«, schrieb er an den Bürgermeister, »was die Einmischung dieses Geistlichen in Ihre Beratungen rechtfertigen könnte.« Im Jahr darauf blieb der Abbé in seiner Pfarrei, und noch vor Antritt der Dritten Republik wurde in Nanterre die erste Rosenjungfrau ohne den Segen der Kirche gewählt.
Ein halbes Jahrhundert ging über die kleine Stadt hin, ohne daß irgendein Ereignis sie berührt hätte. Von Anbeginn der Dritten Republik bis zur Jahrhundertwende nahm die Bevölkerung gerade um ein paar tausend Seelen zu. Im Jahr 1900 war Nanterre ein nettes Städtchen mit krummen Straßen und einem Rokoko-Rathaus, riesigen Feldern ringsum, in denen da und dort Gehöfte, Weiler und Siedlungen verstreut lagen. Eine von ihnen, La Folie genannt, zählte kaum zehn Katen.
Nach und nach gelangten die Äcker und Wiesen Nanterres in Gemeindebesitz oder in die Hände der Spekulation und wurden Brachland. Boden, den niemand mehr kultiviert, fällt, bis er »bebaut« wird, einer langen tückischen Krankheit anheim und stirbt. Vom Menschen aufgegeben, bestimmunglos und leer, wird er zum gemiedenen Niemandsland. Als die Gemüsekulturen mit den letzten Gärtnereien verschwunden waren, erstreckte sich eine Ödnis von tausend Hektar um den alten Ort. Gestrüpp, Müll, Schutt, Autowracks und die windschiefen Lauben der letzten Kleingärtner machten sich in dieser »Zone« breit, die Nanterres Antlitz entstellte. Kahle Flächen, wüstes Gelände, wo einzig halb verfaulte niedrige Holzhütten, die im Winter im Schlamm versanken, auf Menschen deuteten, ließen die weitgedehnte Gemeinde wie das Fegefeuer erscheinen. Der Autofahrer sauste ohne Aufenthalt, ohne ihr auch nur einen Blick zuzuwenden, hindurch, heilfroh, wenn die lachenden Häfen: Chatou und Le Vésinet im Westen, Rueil-Malmaison im Süden, vor ihm auftauchten.
Indessen besaß die Wüste von Nanterre große Anziehungskraft für Maschinenbau und Hüttenindustrie, die Platz zur Ausbreitung in nächstmöglicher Nähe von Paris suchten. Zwischen den beiden Weltkriegen errichteten sie auf dem weiträumigen, bequemen Terrain entlang der großen Seine-Schleife, von Fluß und Treidelweg gleichermaßen profitierend, ihre Ziegelbauten gegenüber der Ile de Chatou, der Ile fleurie und der Ile Saint-Martin, drei Inseln, die, untereinander durch Anschwemmungen verbunden, eigentlich eine sind.
Der Einzug der Industrie ging weiter nach dem zweiten Weltkrieg. Paris sprengte seine Grenzen und begann im Westen, jenseits von Neuilly, mit der Eroberung seiner ferneren Banlieue.
Der Bedarf der Metropole an Bürohäusern war unermeßlich. Sie überschritt die Seine und kolonisierte das andere Ufer. Sie errichtete dort ihre fünfzehn- bis zwanzigstöckigen Gebäude, in denen die großen Unternehmen ihre obersten Priester, ihre Schreiber und heiligen Maschinen installierten: Maschinen, die sprechen, schreiben, fotokopieren, rechnen, denken, Anweisungen geben. Wenn es Nacht wird, ragen über dem Pont de Neuilly die Raster von Hunderten erleuchteter Fenster am schwarzen Himmel auf; kein einziges bleibt dunkel, denn in diesen Mönchszellen schläft keiner und sucht keiner Intimität.
Immer weiter westwärts fraß sich die große Stadt in die Ebene. Immer brauchte sie mehr: Flughäfen, eine Autobahn, Verkehrsverteiler, Parkplätze, eine riesige Ausstellungshalle. Der Rond-Point de la Défense wurde wie ein gigantischer Brückenkopf an das andere Seine-Ufer geworfen. Die Eroberung kannte kein Halten. Die Fabriken von Puteaux und Courbevoie, denen die Invasion auf den Leib rückte, schnürten ihre Bündel und flüchteten auf die nächstgelegenen leeren Hektar: die von Nanterre. Sie besetzten einen Teil – einen kleinen Teil – des freien Geländes, das sich vom Rond-Point de la Boule bis zum Rond-Point de Charlebourg erstreckte.
Aber das Bauland um Nanterre war noch immer riesengroß. Die Weingärten des 18. Jahrhunderts waren den Gemüsekulturen gewichen. Diese wiederum dem Brachland mit Kleingärten hier und da. Und als auch die verschwanden, kamen die Wellblechstädte, die Bidonvilles. Betonteile und Verschalungsbretter von den Baustellen, rostige Bleche, blinde Fenster aus Isorel – so breiteten sich die illegalen Behausungen der algerischen Arbeiter aus in Wind und Lehm, ohne Wasser, ohne Elektrizität, ohne Kanalisation. Die Industrie hatte die ausländischen Arbeiter kommen lassen, ohne ihnen, wie vorgeschrieben, eine Unterkunft zu sichern. Der Staat duldete diesen Verstoß gegen seine Gesetze. Die Stadtverwaltung von Nanterre war ohnmächtig, weil sie keine Polizeibefugnis hatte. Die Polizei erhielt keine Weisung: sie drückte die Augen zu. Und die Gesellschaften endlich, denen der Boden gehörte, scheuten die Kosten für Austreibung und Überwachung. So führte eine lange Kette von Ungesetzlichkeiten, Geiz, Machtlosigkeit und Schlamperei zu diesen Elendsquartieren. Eines Tages jedoch, wenn die Bauerlaubnis eingeholt, die Pläne fertig und das nötige Kapital beisammen sind, werden die Bulldozer kommen, die armseligen Siedlungen ohne vorherige Warnung dem Erdboden gleichmachen und die Familien hinausjagen in den Schlamm.
Ungenutztes Land bringt die Bidonvilles hervor. Ungenutztes Land in der Nähe von Paris aber ist auch ein unschätzbarer Reichtum. Inmitten der freundlichen Villenvororte verfügte Nanterre noch über einen solchen Schatz: Baugrund. Als Paris die Seine überquerte, wurde Nanterres Aussatz zu einem Vermögen. Die »Zone« öffnete der Stadt die Zukunft. Nanterre hatte »Grundstücke zu verkaufen«, wie man sagt, und es verkaufte tatsächlich ohne Ende an die Industrie, an die Büros, an den Sozialen Wohnungsbau. Denn es mußte gebaut und schnell gebaut werden, um die Bevölkerung unterzubringen, die zwischen 1900 und 1967 von 15000 auf 95000 Einwohner gewachsen war. Wenig oder kein Bürgertum: Arbeiter, Angestellte, Kleinhändler. 1935 entriß ein dreiunddreißigjähriger Kommunist den schlafmützigen Stadtvätern das Bürgermeisteramt und fügte so dem »roten Gürtel« um Paris ein festes Glied hinzu.
Zur gleichen Zeit, als die Hauptstadt ihre westliche Banlieue eroberte, platzte während der sechziger Jahre die Sorbonne aus ihren alten Mauern. Sie erstickte am Zustrom der Studenten, die eine halbe Stunde vor Beginn der Vorlesungen erscheinen mußten, um mit ein wenig Glück auf den Rängen der Hörsäle oder auch auf dem Fußboden noch einen Platz zu finden.
Rohstoff im Übermaß brachte die Maschine zum Stocken. Die Überfüllung paralysierte die Sorbonne. Es mußte ein peinlicher Beschluß gefaßt werden. Denn man mußte eingestehen, daß ein Teil der Kinder aus der Hauptstadt künftig nicht mehr in Paris studieren konnte. Widerwillig ließ sich die Universität zu diesem Eingeständnis herbei. Die Wissenschaften emigrierten. Die Philosophische Fakultät trennte sich, ein wenig spät schon, von einem Teil ihrer selbst, hielt Ausschau, wo er unterzubringen wäre, und verpflanzte ihn auf das freie Gelände von Nanterre. Die zukünftige Fakultät sollte zwischen der Rue de Rouen und dem kleinen Bahnhof La Folie ihren Platz finden. Außerdem war dort ein Institut für Staats- und Wirtschaftswissenschaften vorgesehen.
Gleichzeitig wurde beschlossen, daß die im Westen der Hauptstadt wohnenden Studenten ihre Examina in den neuen Instituten abzulegen hätten. Die Erregung in Passy, in Neuilly, in La Plaine-Monceau war groß. Was, sagten die Väter, unsere Töchter, die wir mit äußerster Sorgfalt erzogen haben, sollen in die Industrievororte verschleppt, von den Kommunisten verseucht, in den Bidonvilles vergewaltigt werden! Die Presse, erfinderisch wie je, schürte das Feuer. Blut, Blut, als wäre man selber dabeigewesen. Noch ehe die erste Studentin ihren Fuß nach Nanterre setzte, waren schon die Algerier schuld.
Trotzdem erklärten sich drei Professoren der Sorbonne freiwillig bereit auszuwandern und erregten durch ihren Pioniergeist Anstoß bei ihren seßhafteren Kollegen. Einer von diesen wollte sich im Frühjahr 64 das Übel aus der Nähe besehen. Er wagte sich im Auto bis Nanterre-La-Folie vor, fand aber nur mit Mühe den Bauplatz. Der Himmel war bleiern, es regnete. Er erblickte Betonklötze in einem Meer von weichem rötlichem Lehm, wo der Fuß knöcheltief einsank. Die Umgebung – Elendsbaracken, schmutzige Fabriken aus Ziegelstein, graue Häuserblocks des Sozialen Wohnungsbaus – war zum Weinen trübsinnig. Der Betrachter kehrte auf dem schnellsten Weg in seine majestätische Sorbonne zurück, und als er im Flur einen der Pioniere traf, sagte er voller Genugtuung zu ihm: lieber Freund, Sie werden im Dreck leben.
1964, im selben Jahr, in dem die neue Philosophische Fakultät den Studenten ihre schlammigen Wege mitten durch Baugelände öffnete, wurde in der westlichen Banlieue der Hauptstadt das Departement Hauts-de-Seine gebildet und Nanterre, die Fabrikstadt, die Schlafstadt, die Universitätsstadt, in den Rang einer Präfektur erhoben. Wie wenn alles, was in der ehemaligen »Zone« aufschoß, gleich von Gigantismus befallen sein müßte, brachte es die Fakultät in drei Jahren von zweitausend auf zwölftausend Studenten. Kaum fertig, war sie schon zu klein.
2
22. März. Sechs Uhr
Ich höre Kaddours Wecker, und das erste, was ich mache: ich mach mir Vorwürfe, weil ich seit einem halben Jahr nicht mehr zur Abendschule gegangen bin, nach der Arbeit habe ich einfach keinen Mut mehr. Ich habe mich für die Abschlußprüfung angemeldet, aber ich weiß jetzt schon, daß ich sie dies Jahr nicht schaffe. Ich zieh die Luft ein. Eiskalt. Am Körper bin ich warm, da hab ich den Schlafsack, und nachts mach ich mir einen Turban aus meinem Pullover, aber vorsichtig, damit er nicht knautscht, ich habe viel Geld für bezahlt, er ist sehr schön, rostrot mit großen schwarzen Mustern. Aber beim Aufwachen, mein Freund: alles, was aus dem Pullover rausguckt, Augen, Nase, Backen, Kinn, eiskalt. Dabei, ich und frieren! Im Januar im Aurès, ich kann dir sagen! Aber die Sonne, immer treu auf Posten. In meinem Dorf gibt es eine Mauer, die ist mit Kalk geweißt, und mittags setzen sich die Brüder da gerne hin. Man kauert sich nieder, wickelt sich in den Burnus, und auf der Stirn, den Händen, den Füßen hast du die Sonne. Es pikt, aber es ist klar. Keine Wolke, es singt in deinem Kopf, auch wenn du nichts zu fressen hast. Von Zeit zu Zeit sagt ein Alter was, keiner antwortet, wozu reden? Auf der anderen Seite ist eine Landstraße, und jenseits davon stehen Wildfeigen. Es kommt nicht oft wer vorbei. Mal ein Karren. Mal ein Junge, der lang auf seinem Esel liegt, mit dem Kopf nach hinten, eine Gerte in der Hand. Mal ein kleines Mädchen mit zwei kurzen, ganz steif geflochtenen Zöpfen und Glasketten um den Hals. Sie läuft vorüber, und ihre nackten Füße, die sie mit Henna rot gefärbt hat, heben ihr rotgrünes Kleid. Wenn ich an das alles nur denke, springt mir das Herz in der Brust. Trotzdem, heulen, jetzt, wo ich zwanzig bin, das will ich nicht. Manchmal überlege ich: in Frankreich hast du zu essen, ja, aber was dich tötet, ist das Grau, das Grau, das Grau. Die Tage auf der Uni-Baustelle, mein Lieber, das ist Mord. Die Traurigkeit, der Schlamm, der Regen, der nie aufhört. Da sag ich mir manchmal: Abdelaziz, was willst du hier? Bist du sicher, daß du hier richtig bist? Was ist mehr wert, die Sonne ohne Essen oder das Essen hier und die Kälte?
Von meinem Bett aus kann ich Kaddour nicht sehen, wir haben drei Doppelstockbetten, und ich schlafe oben. Aber an den Geräuschen, die er jeden Morgen macht, erkenne ich genau, was er gerade tut. Kaddour ist so was wie der Vertrauensmann bei den »Junggesellen«. In der Rue de la Garenne in Nanterre, weißt du, gibt es nicht bloß ein Camp, sondern drei: das Familiencamp, das Portugiesencamp und unseres, das »Junggesellencamp«. Na ja, es wird so genannt, ich bin zwanzig, ich hab keine Frau, aber die anderen Brüder sind fast alle verheiratet. »Junggeselle« soll heißen, daß deine Frau nicht mitgekommen ist von zu Hause und du dich hier recht und schlecht allein durchschlägst.
Du denkst vielleicht, Rue de la Garenne wär eine Straße? Nichts ist. Ein ansteigender asphaltierter Weg, von oben siehst du die, ganze Uni-Baustelle, und die ist von weitem nicht hübscher als von nah. Rechts und links von der »Rue« de la Garenne: nichts. Keine Häuser. Niemandsland. Wenn du den Weg hochgehst, sind da zwei Brunnen, du drehst eine Kurbel, fertig. Dort holen die drei Camps ihr Wasser. Zwei Hähne für dreitausend Menschen. Manchmal stehst du drei Stunden Schlange, bis du deine Kanister vollmachen kannst. Du fährst deine Blechtonnen hin auf einem Karren mit Fahrradrädern. Wenn du reich bist, hängst du ihn an ein Moped. Manche kommen sogar mit klapprigen alten Autos an. Und dann wartest du, die Füße im Matsch. Es regnet. Es regnet immer. Was für ein Land, dieses Frankreich mit seinem ewigen Regen! Die Straße ist auch matschig, trotz Asphalt, weil da die großen Laster fahren und spritzen und breite Lehmspuren hinterlassen. In der Gegend wird eben viel gebaut. Es heißt sogar, die künftige Präfektur von Hauts-de-Seine soll dahin, genau uns gegenüber. Na, wenn das stimmt, dann hat der Herr Präfekt eine hübsche Aussicht.
Längs der Rue de la Garenne, ein bißchen erhöht, stehen die Bidonvilleläden, ein arabisches Café, der Krämer und der Schlächter. In Nanterre, weißt du, ist es vielleicht nicht so teuer, aber unsere Händler hier geben auf Kredit, vor allem dem Familiencamp, weil die Beihilfen kriegen. Außerdem brauchen wir unseren arabischen Schlächter. Die Familien kaufen bloß die billigen Stücke. Hammelkeule oder Kotelett nie. Oder höchstens in ganz kleinen Mengen. Na, verlang mal bei einem französischen Schlächter für zwei Francs Hammel, der denkt, du willst ihn veralbern, der brüllt dich an. Ich sag dir, wenn das keine armen Hunde sind, diese Araber!
Zwanzig Meter hinter der letzten Pumpe, am Ende der Rue de la Garenne, steht ein Holzzaun mit fünf oder sechs großen Briefkästen. Der französische Briefträger will ja schließlich nicht bis zu den Knien im Dreck durch den Bidonville waten. Die Junggesellen haben einen großen Kasten mit. Vorhängeschloß, »150« steht drauf; den Schlüssel dazu hat Kaddour. Er verteilt die Post in unserem Lager. Denen, die nicht lesen können, liest er die Briefe vor. Für die, die nicht schreiben können, antwortet er. Immer wenn er frei hat, schreibt er. Er schickt die Geldanweisungen und die Pakete. Er nimmt nie ein Geschenk an. Er ist geduldig und höflich. Er ist mittelgroß, aber sehr kräftig, sein Gesicht ist mager, energisch. Er lächelt nicht. Die Augen, wenn er zornig ist, guckst du lieber nicht an. Er hat einen kleinen Schnurrbart, auf den er viel hält.
Wenn der Wecker klingelt, steht Kaddour auf, immer als erster. Ich merke, wenn er von seinem Hühnerbalken runterklettert, weil die Sprossen knacken. Mit einemmal seh ich Licht an der schmutzigen Isoreldecke. Er zündet die kleine Butanlampe an; ich mach die Augen zu, aber mit dem Ohr belausche ich ihn. Er zieht seine Schuhe an, nimmt einen von den Kanistern, gießt Wasser in eine Kasserolle, stellt die Kasserolle auf den Ofen, knittert Zeitungspapier zum Feuermachen, und während das Wasser heiß wird für den Kaffee, wäscht er sich in der kleinen roten Plasteschüssel. Zum Rasieren nimmt er die kleine Butanlampe, hängt sie an einem Draht auf, der von der Decke runterhängt, macht den kleinen Handspiegel an einer Leitersprosse von seinem Bett fest, und dann geht’s los, kratz, kratz. Er rasiert sich mit einem Säbel von Messer. Beim Schnurrbart braucht er lange. Oben, unten, die Spitzen ein bißchen aufgebogen, wenn du auf einer Seite zuviel wegnimmst, kannst du’s nicht mehr gutmachen, da mußt du die andere auch beschneiden. Darum habe ich’s bleibenlassen, aber Kaddour hat Geduld. Er hat Geduld für alles, für die Briefe, die er vorliest, für die Geldanweisungen, für das Leben, das er in Frankreich führt, für die Frau und die Kinder zu Hause. Ich frage mich, wozu der Schnurrbart gut sein soll, aber wer weiß, vielleicht ist er für Kaddour wichtig. Vielleicht steht er deswegen immer als erster auf, damit er ein bißchen Ruhe hat. Die Bude ist so klein, schon wenn da zwei sind, stört man sich dauernd.
Von meinem Bett aus höre ich Kaddours Säbelkratzen und die Pausen, die er macht. Ich warte, ich weiß genau die Sekunde, wann ich aufstehen muß: wenn das erste Tröpfchen Wasser von der Decke auf mich runterfällt.
Über Nacht ist die Feuchtigkeit auf dem Isorel zwischen den kleinen Balken gefroren, und morgens, wenn der Ofen anfängt, ein bißchen zu wärmen, schmelzen die kleinen Eiszapfen. Das regnet Tropfen für Tropfen, und kalt. Ich sag dir, es graust dich. Der Tag fängt an, und es regnet dir ins Bett. Ich zieh mich aus meinem Schlafsack, stelle mich auf die Leiter und rolle ihn zusammen, ich lege ihn in die Mitte von meinem Strohsack, rolle den Strohsack ein und lege ein Stück grüne Plane drüber, die ich auf der Baustelle gemaust habe. Ich klettere noch mal in mein Bett hoch und mach die Luke über meinem Fußende zu, eh ich mich anziehe. Ich habe sie gestern abend kaum einen Spalt aufgemacht, ein Hauch Luft, nicht mehr. Drei Doppelstockbetten, wir sind sechs, die Baracke ist sehr klein, man muß doch atmen, und trotzdem, wegen diesem bißchen Luft hätten Moktar und ich uns beinah umgebracht.
Moktar hat zu Anfang in dem Bett unter mir geschlafen. Er ist vielleicht fünfunddreißig, fünfundvierzig Jahre alt, er weiß es selber nicht. Er ist ein Fellache vom Land, und einen braveren Mann als ihn findest du nicht, aber Analphabet, starrköpfig, ein Charakter wie der Kaktus. Und Moktar war gegen meine Luft. Für Moktar, der aus seiner Hütte nie rausgekommen ist, ist die Luft der Feind. Na, nun erklär ihm mal. Eines Morgens schnappt er sich Hammer und Nägel aus dem Werkzeugkasten und schreit wütend: du bringst mich um mit der Kälte, deine Luke, die werd ich dir zunageln. Aber ich schnell hin, ich bin vor ihm bei der Leiter, und einen Fuß auf der Sprosse, ganz lässig, steh ich da. Moktar ist wütend. Er stottert, er schwingt den Hammer über meinem Kopf, und ich sage spöttisch zu ihm: na? Willst du mich zu Klump hauen? Und ich lächle ihm ins Gesicht, ich bin zwanzig, ich bin stark, ich bin flink wie der Panther, und er, er ist ein alter räudiger Dorfköter. Das ist alles drin in meinem Lächeln, und der arme Moktar fuchtelt weiter mit dem Hammer, aber er weiß nicht mehr, was er machen soll, er ist wütend und gedemütigt. Da sagt Kaddour, ohne die Stimme anzuheben: Moktar, bring den Hammer dahin, wo du ihn hergeholt hast. Moktar guckt ihn an, Kaddour sitzt vor seinem Kaffee, sein Gesicht ist von der kleinen Butanlampe beleuchtet, er ist nicht mal aufgestanden, er hat beide Hände flach auf dem Tisch liegen, er ist ruhig, er sieht nicht nach Zorn aus, er hat einen Befehl gegeben, das ist alles. Eine Sekunde vergeht, und Moktar verzieht sich, vielleicht weil er kapiert hat, daß Kaddours Befehl ihm geholfen hat, das Gesicht zu wahren. Jedenfalls, der Hammer liegt im Werkzeugkasten, und Kaddour sieht mich an. Mit einem Blick, mein Lieber! Und er sagt: findest du das in Ordnung, Abdelaziz, den Bruder herauszufordern? Ich dreh mich um, ohne was zu sagen, und weil ich mit dem einen Fuß noch auf der Sprosse stehe, steig ich hoch zu meinem Hühnerbalken, ich setz mich, laß die Beine baumeln, zünde mir eine Zigarette an, was ich sonst nie mache vor dem Kaffee, und von oben gucke ich auf die Brüder runter, die um den Tisch sitzen, im Schein der Butanlampe. Kaddour sieht mich nicht mehr an, und mir ist leichter. Ich schiele zu Moktar hin. Er sitzt neben Kaddour, er trinkt seinen Kaffee, aber sein Gesicht ist rot, und seine Hände zittern. Um den Tisch sitzen noch Ali, Youssef und Djaffar, und keiner sagt was. Youssef ist der andere Alte, der mit mir auf der Uni-Baustelle arbeitet, Djaffar ist jung und mein Kumpel. Mein Schemel steht neben seinem, leer, und ich sitze oben auf meinem Bett und ziehe an meiner Zigarette. Ich gucke zu Moktar hin, seine Hände zittern, und ich schäme mich so, daß ich mich nicht mal traue runterzuklettern.
3
Sieben Uhr
Der Wecker schrillte mit jäher Gewalt. Lucien Ménestrel fuhr aus dem Bett und knipste Licht an. Nach dem Klingeln kein Gedöse mehr, das zweite Trimester entschied über alles. Er griff unters Bett und tastete nach dem Krakeeler, brachte ihn brutal zum Schweigen und sagte laut: halt die Klappe, Dussel. Er warf den Pyjama aufs Bett und reckte seine warmen Muskeln. Eine Zwischenwand aus imitiertem Mahagoni trennte das Bett von dem kleinen »Bad«, wo aber nur ein Waschbecken war, sonst nichts. Nicht mal ein Bidet wie bei den Mädchen. Diskriminierung so was. Immerhin ziemlich bequem so ein Bidet, wenn man sich die Füße waschen will. Ménestrel machte Licht über dem Spiegel und kämmte sich sorgfältig. Er hatte wellige blonde Haare, die ihm bis zum Nacken wogten, und buschige Koteletten, ein wenig dunkler, bis zu den Kiefern herab. Als er gekämmt war, hielt er sein Gesicht schräg und betrachtete sich von der Seite, ich habe einen Kopf wie ein General des Kaiserreichs, dachte er, ich sehe aus wie Marschall Ney.
Er ging zurück ins Zimmer. Richtige Zellen, diese Zimmer im Studentenheim. Zwischen Bett und Kommode kamen zwei Leute mittleren Formats kaum aneinander vorbei. Ménestrel stellte sich nackt an die Wand, als würde er gleich seine eigene Hinrichtung befehlen. Über seinem Kopf, fast unsichtbar, ein dünner Strich: ein Meter fünfundsiebzig. Drei Zentimeter fehlten ihm. Gerade stehen, Atem anhalten, strecken. Eine gewaltige Anstrengung. Er wiederholte die Operation zehnmal, holte tief Luft und begann mit der zweiten Übung: Füße fest geschlossen am Boden, dann die Arme hochnehmen und mit den Händen nach der Decke langen. Auf keinen Fall die Fersen anheben. Mein lieber Mann, das ist Wissenschaft. Zwischen den Wirbeln ist ein Abstand, der sich um ein oder zwei Millimeter vergrößern kann; an sich ist das wenig, aber mit der Wirbelzahl multipliziert, kannst du’s auf zwei, sogar drei Zentimeter bringen. Zwischenfrage: willst du dich etwa dein Leben lang so auszerren? Ménestrel hob entschlossen den Kopf. Warum nicht? Warum nicht? wiederholte er laut und machte sich an die dritte Übung.
Nach seinen Dehnungsexerzitien ging er wieder in das winzige Waschkabinett, stellte sich vor den Spiegel und fing an, vor seinem Ebenbild zu hüpfen und ihm Faustschläge zu versetzen. Er täuschte, wich den Schlägen aus, die es ihm seinerseits zu verpassen suchte. Er probierte mehrere Kombinationen von Geraden, Kinnhaken und Uppercuts, kam zum Schluß aber auf seine Lieblingskombination zurück, zwei linke Gerade blitzschnell hintereinander, dann eine zerschmetternde Rechte.
Als sein Spiegelbild endlich k.o. war, langte Ménestrel die Teekanne aus dem Hängeschrank gegenüber dem Waschbecken, schaltete seinen Elektrokessel ein und seifte sich, während das Wasser heiß wurde, Oberkörper und Glied. Er war auf beide gleichermaßen stolz, mit dem Waschen erwies er ihnen eine Art Ehre. Außerdem war es einfach ein Vergnügen, nackt vor dem Spiegel zu stehen und zu spüren, wie einem das Wasser über den Leib rieselte. Und fast ein sträfliches Vergnügen. Der führende Clan im Studentenheim rasierte und wusch sich nicht mehr und trug speckige Pullover direkt auf der nackten Haut. Saubere Typen wie Ménestrel waren fast bourgeoisen und konterrevolutionären Denkens verdächtig. Komisch, daß etwas so Simples wie Wasser und Seife hier emphatisch mit der Weltanschauung vermengt wurde.
Ménestrel rasierte sich mit einer Spur Schuldgefühl, überdies seiner belastenden Herkunft bewußt (er hielt sie vor seinen Kameraden streng geheim), die ihm beinahe das Recht auf progressive Meinungen verwehrte: seine Mutter lebte im Tarn in einem hübschen Renaissance-Schloß und unterschrieb ihre Briefe nur mit Julie de Belmont-Ménestrel, um auch stets daran zu erinnern, daß es letztlich eine Art Verhängnis gewesen war, wenn sie zu Lebzeiten ihres Mannes, dieses Bürgerlichen, den Namen Ménestrel hatte führen müssen. Zum Kotzen so was. Dafür nennt sie Belmont nie anders als den »großen Schuppen«, im Unterton: nur Bourgeois reden von ihren Schlössern. Und das ist auch so ein Snobismus, nur noch widerlicher, von der miesesten Sorte, der so tut, als wäre er das Gegenteil. Ménestrel schwenkte seinen Rasierpinsel zornig im warmen Wasser (um diese frühe Stunde gab es noch welches auf seiner Etage), ich jedenfalls lebe ausschließlich von meinem Stipendium oder, wenn ich drauf warten muß, von Jobs, ich nehme keine milden Gaben von Frau Mutter, und mein Name ist Ménestrel. Ich, Madame, pfeife auf Ihre lange Ahnenreihe.
Der Kessel fing an zu summen, Ménestrel hätte ins Restaurant gehen und dort frühstücken können, es war ab halb acht geöffnet, aber der Weg war ihm zu weit. Erst Schuhe anziehen, durch den Matsch waten, dann der Rückweg, die Kälte, der Zeitverlust, und eigentlich war es doch jedesmal ganz angenehm, wenn er sich an seinen Tisch vor dem Fenster setzte, wo die grauen Vorhänge noch zugezogen waren und ihm die Kälte, den lehmigen Bauplatz, die Bidonvilles, den trüben Morgen draußen ersparten.
Vor sich die dampfende Teetasse, schnitt er sein Knüppelbrot längs auf, der Speichel lief ihm mit Macht im Munde zusammen. Eigentlich ist Essen eine Eroberung, man stürzt sich auf die Nahrung, man nimmt sie mit Gewalt, man assimiliert sie. Er kaute mit wachsender Begeisterung. Bei jedem Bissen fühlte er sich voller, männlicher, stärker, ein Sieger, ein Haudegen, ein römischer Zenturio, der eine Stadt plündert. Ménestrel zog durch die Straßen von Korinth, sein kurzes Schwert in der Hand, seine Brust unter dem Harnisch von Sonne und Siegesfreude geschwellt, er trat mit dem Fuß eine Tür ein, plötzlich steht eine Jungfrau vor ihm, und statt zu fliehen, versperrt sie ihm den Weg, entblößt ihre Brust und sagt auf griechisch mit einem unaussprechlichen Lächeln: stoß zu, Zenturio. Sie hat unerhörte Brüste, rund und prall wie das Barrikadenmädchen auf dem Gemälde von Delacroix. Ich werfe mein Schwert weg, ich lege die Arme um sie, presse sie gegen meinen Harnisch, sie wehrt sich. Eine Unschärfe trat ein, das Bild verlor seine leuchtenden Farben und verschwamm. Ménestrel zögerte. Im Prinzip müßte unter den gegebenen Umständen jetzt die Vergewaltigung kommen, aber da er noch nie mit einem Mädchen geschlafen hatte, fürchtete er, die Sache könnte zu schwierig werden. Die Jungfrau hörte mit einemmal auf, sich zu wehren, sie schmiegte sich in seine Arme, wurde sanft und fügsam, mehr noch, sie übernahm die Führung, und eigentlich war sie gar keine Jungfrau, sondern eine schöne junge Matrone. Daher die üppigen Formen, die Erfahrung, die Bereitwilligkeit. Es ertönten Stimmengeräusche, jemand lief durch den Flur, Ménestrel guckte auf die Uhr, leerte seine zweite Tasse Tee und stand auf.
Während er abräumte und seine Tasse ausspülte, nur die Tasse – er ließ die gebrühten Teeblätter aus Sparsamkeit immer in der Kanne, um im Lauf des Vormittags bei Zeit und Bedarf noch einen zweiten Aufguß in petto zu haben –, versuchte er, das Zenturiothema noch mal von Anfang an durchzunehmen. Aber den erhofften Genuß fand er daran nicht. Das Bild war blaß, die Peripetie lahm, das Gefühl kraftlos. Er bemühte sich, neue Details hinzuzufügen. Zum Beispiel, die junge Matrone hatte eine jüngere Schwester, er vergewaltigte sie eine nach der anderen, aber es wurde nichts mehr. Solche Sachen waren doch nur beim erstenmal gut, man improvisierte, ließ sich überraschen, dann machte das Spaß. Er ging wieder ins Zimmer, faßte den kleinen weißen Griff des rechten Zuges und ließ den anthrazitgrauen Vorhang zur Seite gleiten. Er wiederholte dasselbe mit dem linken Zug und setzte sich. Die Fensteröffnung nahm die ganze Breite der Zelle ein und gab an hellen Tagen viel Licht, aber im Moment war der Morgen dunkel und häßlich und die Aussicht jammervoll. In drei oder vier Jahren vielleicht könnte das ein hübscher Campus mit schönen Rasenflächen sein, aber noch war dort nur ein Bauplatz, weniger demoralisierend freilich als im vergangenen Jahr der riesenhafte, gähnende Schacht der Metro und der Krach von acht Uhr morgens an, die Bohrmaschinen, die Bulldozer, die Betonmischmaschinen, die Kipplaster, die ununterbrochen ihre Ladungen kippten.
Ménestrels Blick wurde streng, und von einem Blatt, das an die Wand geheftet war, las er laut:
1. Lat. Übers. fertigmachen.
2. J.-J.-Text vor Sem. durchlesen.
Das Blatt war mit Reißzwecken befestigt, eine Methode, die befürchtet und in der Heimordnung selbstverständlich verboten worden war. Im Studentenheim war alles verboten, sogar einen Aschenbecher zu verrücken, das Bett umzustellen oder die eigene Mutter auf dem Zimmer zu empfangen. Grundsätzlich. Darum. Freilich, Jungs wie Schultz, Jaumet oder Cigogne nahmen Mädchen zu sich, wann sie wollten, und gingen ebenso zu ihnen hin. Ménestrels Augen wanderten durch den kleinen Raum. Ein Mädchen haben, sie mit aufs Zimmer nehmen, sie eine ganze Nacht hierbehalten und morgens mit ihr frühstücken. Ménestrel ließ die Augen sinken und schaute auf seine Hände, die flach und regungslos auf dem lateinisch-französischen Wörterbuch lagen. Wenn ich ein Mädchen hätte, wäre ich dann noch zum Arbeiten fähig? Ich würde immerzu nur mit ihr reden, immerzu mit ihr zusammen sein, von morgens bis abends mit ihr Liebe machen wollen. Seine Schläfen hämmerten, er sah die Baustelle der Juristischen Fakultät am Horizont und seitlich die Betonblöcke der Phil-Fak. Glas, Beton, Aluminium, die Gebäude schön quadratisch, die Fenster rechteckig. Eine riesige Fabrik zur Herstellung von Lizentiaten, die Ausbeute war kläglich, sehr kläglich, siebzig Prozent fielen durch, und was wurde aus denen, die »abgeschossen« wurden, ich kann es mir nicht leisten, abgeschossen zu werden oder mein Stipendium zu verlieren oder Jahre als Einpauker zu verplempern.
Ménestrel setzte sich, schlug das Wörterbuch auf und fing an zu arbeiten. Es wurde Tag, die kleine Zelle war gut geheizt. Er fühlte sich wohl in seiner Haut, wie er da mit klarem Kopf, frischen Muskeln, entspannt vor seinen Büchern saß. Er hatte eine graue Flanellhose, ein blaues Baumwollhemd und einen dunkelblauen Pullover an, keine Krawatte, der offene Hemdkragen lag über dem Pulloverbund. Er hatte zwei Jahre Khâgne2 absolviert, so fiel ihm die Übersetzung nicht allzu schwer, er arbeitete mit dem angenehmen Gefühl, zügig und gut voranzukommen. Die schwierigen Sätze ergaben sich einer um den anderen nach durchaus berechtigtem Widerstand. Nur das ständige Verlangen aufzustehen bereitete ihm einige Qual. Ménestrel schrieb auf den Rand seines Manuskripts: meine Unruhe bekämpfen. Dran denken, daß ich seit einem Monat zwanzig bin, er dachte nach; zwanzig Jahre, das ist immerhin was. Es klickte irgendwo in seinem Kopf, er begann, ein nacktes Mädchen auf den Rand des Blattes zu zeichnen. Den Kopf deutete er nur an, der war nicht wichtig, dafür malte er den Körper um so genauer, zwei runde Brüste, ziemlich voll, breite Hüften, die Schenkel ein wenig schwer. Er ließ die Schenkel sich kreuzen, und mit einem leichten Strich setzte er den Schamteil hin. Hübsch, dieses kleine Dreieck, es sah sehr geschlossen, sehr vollendet aus.
Der Tacitus-Text blickte ihn an. Scheiße, sagte Ménestrel und gab ihm seinen Blick zurück. Er hielt es nicht mehr aus, er stand auf, ging zum Waschbecken, wusch seine Hände, die er vorhin nach dem Frühstück erst gewaschen hatte. Ein junger General Napoleons schaute sich von der Seite an, wie er seine Hände seifte, die Hände eines Mannes der Tat. Er nahm den Kamm und kämmte sich ohne jeden Grund. Tacitus, gut und schön, sollen sie seinen elliptischen Stil in den Himmel heben, aber der Inhalt? Reißt sein »Dialogus de oratoribus« einen, der im Februar 1968 zwanzig geworden ist, vielleicht vom Stuhl? Zwischen dem Tatbestand, in Latein sattelfest zu sein, weil man’s neun Jahre lang gepaukt hat (gezwungenermaßen wohlverstanden), und der Liebe zum Latein, dem Glauben an seine magischen Tugenden (die die Lehrer mit religiösem Eifer preisen), besteht doch noch ein Unterschied. Ménestrel setzte sich, von ketzerischen Gedanken überquellend, wieder an seinen Tisch. Überall kommen sie einem mit ihrem Latein, selbst im Examen für moderne Literatur und Sprache. Und dabei könnte ich, wenn ich statt der neun Jahre Latein Russisch gelernt hätte, Tolstoi jetzt im Original lesen. Das wäre ja wohl was anderes, als Tacitus zu stottern.
Blick auf die Uhr. Es war Zeit, sich an den Rousseau zu machen. Levasseur empfahl seinen Studenten regelmäßig, den zu erläuternden Text vor dem Seminar noch einmal gründlich durchzugehen. Ménestrel suchte die Belegstelle, sechstes Buch des ersten Teils, Seite 180. Am Rand stand: Danièle Toronto. Armes Mädchen, sie war mit der Erläuterung dran. Und so scheu, so verkrampft. Er suchte die Seite. »Wie dem auch sei, Maman sah, daß es Zeit war, mich als Mann zu behandeln, und das tat sie denn auch, aber auf die absonderlichste Weise, auf die je eine Frau bei solcher Gelegenheit verfiel. Ich bemerkte, wie ihre Miene mit einem Male ernster, ihre Rede moralischer war als sonst.« Moralisch ist gut. Moralisch ist sogar hübsch. Aber Maman? Meiner Ansicht nach hätte Jean-Jacques darauf verzichten können, Madame de Warens in dem Augenblick Maman zu nennen. »Ihr Anfang, diese ganze vorbereitende Art hatten mich unruhig gemacht: während sie redete, war ich verträumt und unaufmerksam wider Willen und weniger mit dem beschäftigt, was sie sagte, als damit, herauszufinden, worauf sie eigentlich hinauswollte, und sobald ich das begriffen hatte, was mir nicht eben leichtfiel, nahm mich die Neuheit dieses Gedankens, der mir, seit ich bei ihr lebte, auch nicht ein einziges Mal in den Sinn gekommen war, so ganz und gar in Besitz, daß ich nicht mehr imstande war, das aufzunehmen, was sie mir sagte. Ich dachte nur noch an sie und hörte nicht mehr zu.« Eine Bohrmaschine setzte sich draußen mit so betäubendem Lärm in Betrieb, daß die Scheiben zitterten. Ménestrel hob den Kopf und sah abwesend zum Fenster hinaus. Eine lange, wohlausgewogene Periode, und dann ein kleiner kurzer Satz, päng, aus. Stilistisch ist das einwandfrei. Sogar so einwandfrei, daß er dich mit seiner hübschen Musik alles glauben macht, was er will, vor allem, daß ihm nie eingefallen wäre, mit Madame de Warens zu schlafen. Moment, Monsieur. Fünf Jahre früher, wenn ich nicht irre, als Sie sie zum erstenmal sahen – Ménestrel feuchtete den Zeigefinger an und blätterte fiebrig in dem Buch, um die Stelle zu finden, da war sie schon, Seite 42, er hatte sie sich bei der ersten Lektüre mit Bleistift angestrichen: »ich hatte mir eine griesgrämige alte Betschwester vorgestellt … Ich sehe ein liebreizendes Antlitz vor mir, schöne blaue Augen voller Süße, einen blendenden Teint, die Umrisse eines berückenden Busens«, notieren wir den Busen, und weiter: »sie hatte eine zärtliche, liebreiche Miene, einen sehr sanften Blick, ein engelgleiches Lächeln, einen Mund wie für den meinen geschaffen …«, notieren wir auch den Mund, den er sich schon im voraus so genau angesehen hat, oh, und er möchte nicht mit ihr schlafen, o nein, keineswegs, in fünf Jahren kommt ihm dieser Gedanke, wie er sagt, kein einziges Mal »in den Sinn«, aber nein! Und trotzdem hat er gleich beim ersten Mal, als er sie sieht, Lust, sie zu küssen, und Augen für ihre Stoßstange.
Ménestrels Blick fiel auf die Uhr, er sprang hoch, raffte seine Sachen zusammen und warf sein Tweedjackett über, er hatte noch Zeit, aber wenn er sich bewegte, dann mit Vorliebe rasch. Er pfiff vor sich hin, während er die Tür abschloß, machte zwei tänzelnde Schritte durch den Flur und donnerte an Bouchutes Tür, zwei linke Gerade auf kurze Distanz, wumm, wumm. Ja-a, antwortete eine grunzende, verschlafene Stimme. Das Stinktier liegt noch in der Falle. Ich geh schon los, sagte Ménestrel laut, komm nach.
4
Acht Uhr dreißig
David Schultz, einundzwanzig Jahre alt, einszweiundachtzig groß, Augen braun, schwarzes lockiges Haar, ovales Gesicht, matter Teint, regelmäßige Züge, Vater Chirurg, Mutter ohne Beruf, Soziologiestudent des zweiten Studienjahres in Nanterre, zwinkerte im Halbdunkel lange mit den Augen. Nach einer Weile blieb sein Blick an einem anthrazitgrauen Vorhang und dem Lichtstreifen, der unter ihm einfiel, haften. Im selben Moment wurde er sich bewußt, daß sein linker Arm steif war, sein Kopf fuhr langsam herum, er sah Brigittes Kopf auf seiner Schulter und unter dem dichten blonden Haargewuschel perspektivisch verkürzt eine runde Nase, einen halboffenen Mund. Sie hatte das linke Bein über seinem liegen, kaum zu glauben, wie schwer so ein Frauenbein auf die Dauer wird. Aber anders als übereinander kann man hier ja nicht schlafen. Zu schmal die Betten im Heim, die Zimmer eng. Man hatte sich für die Studenten ein Universum der Zellen und der Keuschheit ausgedacht, die Mädchen auf einer Seite, die Jungen auf der anderen, wie im Gefängnis. Und jeder bekam ein Minimum an Lebensraum, eine rationierte Kubikmenge Luft, achtzig Zentimeter zum Schlafen und die sexuelle Frustration zur Gesellschaft. Denn die besteht weiter, keine Frage, auch jetzt, wo wir die Heimordnung durchbrochen haben und bei den Mädchen aus und ein gehen. Wieviel Jungs mögen pro Tag durchschnittlich in den Mädchengebäuden sein? Nicht mehr als zwanzig, nehme ich an, das ist wenig, sehr wenig. Wir haben die Geschlechtertrennung abgeschafft, aber die Tabus bleiben, unsichtbar, eingefleischt, allmächtig. Und nicht mal die Mädchen, die mit Jungs schlafen, sind wirklich befreit. David seufzte, Studentinnen, dachte er deprimiert, gibt es letzten Endes zwei Sorten: die einen zu verklemmt, um mit einem Jungen zu schlafen, die anderen, die’s tun, zu verklemmt, um Spaß dran zu finden. Beispiel: Brigitte.
Er beugte und streckte seinen linken Arm, schloß und öffnete rasch und ruckweise die Hand. Das Prickeln wurde nur schlimmer, fast schmerzhaft. Tausende winzig kleiner Stiche bei jeder Bewegung. Komisch, wie lange es dauert, bis der Kreislauf wieder, funktioniert. Statt aufzuhören, nahm das Kribbeln zu. Man müßte mal die Zeit stoppen, die ein eingeschlafener Arm zur Normalisierung braucht. In Soziologie beschäftigt man sich eigentlich nur mit dem Menschen, idiotisch, die ganze animalische Seite wird unterschätzt. Bevor man mit der menschlichen Gesellschaft anfängt, müßte man sich mindestens ein Jahr lang mit der Gesellschaft der Tiere befassen. Mit so unerhört interessanten Sachen wie Verteidigung des Reviers, Hordenhierarchie, Leittiere, Paarungsrituale.
Brigitte wachte auf.
»Du schläfst nicht?« fragte sie mit gedrückter, unglücklicher Stimme.
Er konnte diesen Ton nicht leiden und sagte knapp:
»Mein Arm ist eingeschlafen.«
Sie wendete den Kopf und küßte ihn auf den Hals. Ihre Geste rührte ihn, aber er verdrängte die kaum entstandene Regung. Er hielt nichts davon, sich zu binden. Trieb, ja, gesunde Sexualität, freie animalische Erotik. Was das (in Anführung) Gefühl anbelangt, dieser Falle spießigen Besitzdenkens bin ich längst auf die Spur gekommen: mein Taschentuch, mein Schlips, meine Frau. Lächerlich. Heuchelei. Schwachsinn im höchsten Grad. Ideal wäre tatsächlich eine Kommune von Mädchen und Jungen, wo jeder jedem gehört. Laut und aggressiv sagte er:
»Blödsinnig, dieses Kribbeln.«
»Pst«, sagte Brigitte, »sprich nicht so laut.«
»Wieso?« fragte er, ohne leiser zu werden. »Hast du Angst, was deine Nachbarinnen denken?«
Er preßte die Lippen aufeinander und hüllte sich in Schweigen. Sie stützte sich auf den Ellbogen, so daß ihre Augen in seiner Höhe waren, und während er mißbilligend zur Decke sah, bewunderte sie ihn. Das lockige braune Haar, das, nie gekämmt, voll und wirr seine Stirn umgab, die glänzenden schwarzen Augen, sein mageres Gesicht, der schön geschwungene, ein wenig feminine Mund und die Miene vor allem, diese auf tausend Meilen distanzierende Miene, was für ein schöner Christuskopf. Nach dem Äußeren, denn sein Vokabular … Am meisten bewunderte sie die Höhlung der Wangen mit dem Schimmer des Bartes und den Schnitt der Jochbögen, sie unterdrückte noch rechtzeitig das Verlangen, ihre Lippen darauf zu legen, Zärtlichkeit war das sicherste Mittel, ihn zu verlieren. Plötzlich zitterten ihre Hände, und sie dachte erschrocken: ich verliere ihn trotzdem, bestimmt verliere ich ihn wie alle anderen. Sie schlief mit ihnen, um sie zu halten, aber es nützte nichts, nach ein paar Wochen hatten sie sie wegen ihrer Frigidität satt. Ein Gefühl von Ungerechtigkeit wallte in ihr auf, ich bin doch kein Objekt, ich bin doch keine Maschine zum Genießen, dachte sie empört. Ich bin ein Mensch. Mein Gott, wenn doch einer, ein einziger, mich nur ein kleines bißchen lieben könnte.
Mit einer gewissen Rauheit fragte sie:
»Ich verstehe übrigens nicht, weshalb du die Nacht unbedingt in meinem Zimmer schlafen wolltest. Ging es in deinem nicht genauso?«
David zuckte die Achseln.
»Daß du das nicht begreifst. Daß die Mädchen zu den Jungs rüberkamen, wurde geduldet, aber es war Heuchelei, weil das Umgekehrte verboten war. Wir haben ein Recht erobert. Kein Zugeständnis, sondern ein Recht. Dafür haben wir ein Jahr lang gegen den Dekan und seine Polente gekämpft. So. Und von diesem Recht will ich Gebrauch machen, soviel ich lustig bin. Auch wenn das deinen Nachbarinnen nicht paßt«, setzte er, lauter werdend, hinzu.
»Ach, David, so sind sie ja gar nicht«, sagte Brigitte verzweifelt.
Er hob die Hand.
»Jedenfalls haben sie was gegen mich«, sagte er scharf.
»Deswegen brauchst du sie aber nicht aufzuwecken.«
Er sah auf seine Armbanduhr.
»Es ist genau halb neun. Da wäre es ja wohl an der Zeit, daß sie ihre dicken Hintern bewegen. Aber die Damen«, fuhr er sarkastisch fort, »sind wieder mal spät ins Bett gekommen. Sie laden sich gegenseitig zu Fettgebackenem ein. Tratschen bei Appetithäppchen. Besuchen sich (das wußte er von Brigitte) in langen Kleidern.«
Entrüstet setzte er hinzu:
»Stell dir das vor! Lange Kleider! In Nanterre! Meine Damen«, schrie er und klopfte gegen die Wand, »ihr braucht keine langen Kleider, ihr braucht …«
Brigitte hielt ihm die Hand vor den Mund.
»Sei still, David, ich bitte dich«, sagte sie flehend, »du hast ja keine Ahnung. Ich muß mit ihnen auskommen, nicht du.«
David schob Brigittes Hand brüsk beiseite, streckte seine langen Beine aus, kreuzte die Arme unterm Kopf und starrte zur Decke. Brigitte beugte sich, auf einen Ellbogen gestützt, ängstlich über ihn.
»Ich frage mich«, sagte David, mit einem Schlage wieder vollkommen ruhig, »warum die Frauen so oft ihr eigener Feind sind. Warum gibt es immer noch Mädchen, und gebildete Mädchen (er setzte gebildet in Gänsefüßchen), die sich als verpackte Ware betrachten, deren Siegel nur der Käufer erbrechen darf? Was für eine widerlich merkantile Auffassung von der Frau. Wenn du nicht das Recht hast, über deinen Körper nach Belieben zu verfügen, bist du kein Mensch mehr, sondern wirst zum Konsumobjekt.«
Brigitte sah ihn schweigend an. Im Grunde gab sie ihm recht. Ihre Vorbehalte bezogen sich nicht auf das Grundsätzliche. Wenn Peyrefitte unter Berufung auf eine nicht ernst zu nehmende Umfrage erklärte, daß »die Studentinnen keinerlei Wert darauf legten, den Jungen Zutritt in ihr weibliches Reich zu gewähren«, wußte sie nur zu gut, wie es um das von dem Minister so geschätzte »weibliche Reich« bestellt war. Frustrierte Mädchen voller Hemmungen, in eine entsetzliche Isolation versponnen, oder noch schlimmer: ihr Zusammenglucken in einer seichten Atmosphäre von Kemenate, Klatsch und Intimfreundschaften. Glauben Sie mir, Herr Minister, wenn Sie eine Tochter hätten, wäre es besser, sie ließe wie ich einen Jungen in ihr Zimmer, selbst einen Anarchisten wie David.
»Meinst du nicht?« fragte David, ohne sie anzusehen.
»Sicher«, sagte Brigitte und erlaubte sich ihrerseits ein leichtes Achselzucken.
Sicher, das meinte sie auch. Nur hatte die Sache zwei Seiten. Im Grundsätzlichen, in seiner gesellschaftlichen Haltung zur Frau war David großzügig. Gar keine Frage. Aber im konkreten Fall? Im Verhältnis zu mir? In den menschlichen Beziehungen zu dem Mädchen mit Namen Brigitte?
»Aber deshalb brauchst du meine Nachbarinnen nicht zu beschimpfen«, sagte sie. »Was sollen diese dauernden Provokationen?«
David lachte auf.
»Du redest wie der ›France-Soir‹. Merk dir eins, Schätzchen: die Provokation, wie wir sie verstehen, hat ihre Berechtigung. Provokation ist eine äußerst nützliche Waffe im politischen Kampf. Sie zwingt den Gegner, die Maske fallenzulassen und seine wahre Natur zu zeigen.«
Sie sagte mit scharfer Stimme:
»Habt ihr deswegen im Januar den Dekan angerempelt und ihn Flic und Nazi geschimpft?«
Sie setzte hinzu:
»Nazi stimmt sowieso nicht. Er war in der Résistance.«
David zuckte die Achseln.
»Zunächst mal: Es war keine Absicht, wenn wir den Dekan ein bißchen gerempelt haben. Ich sage: ein bißchen. Zuerst wollten wir lediglich gegen das Ausweisungsverfahren protestieren, das gegen Dany3 in der Schwebe war. Aber du weißt, wie das bei solchen Aktionen ist. Der Dekan kam dazu, und da hat das Ganze eine andere Richtung gekriegt, wir haben ihm seine Kumpanei mit der Polizei vorgeworfen. Und er hat unsere Vorwürfe ja umgehend gerechtfertigt, er hat seine liebe Polente sofort wieder gerufen. Wie 67.«
»67?«
»Da warst du noch nicht hier.«
»Und warum habt ihr ihn Nazi genannt?«
»Kannst du einem auf den Wecker gehen! Ich habe schon mal gesagt, daß das ein Irrtum war.«
»Das hast du nicht gesagt.«
»Na schön, dann sage ich es jetzt. Denkst du vielleicht, du müßtest den Dekan verteidigen, weil du Germanistin bist? Was soll dieser Fachrichtungschauvinismus?«
»Das ist kein Chauvinismus, das ist Gerechtigkeitssinn.«
»Herrgott noch mal, wie sollen wir wissen, was der Dekan 1940 gemacht hat? Wir sind 46 geboren! Jedenfalls, wenn einer 1940 gut war, ist er noch lange nicht berechtigt, 68 oder 67mies zu sein.«
»Wieso 67?«
David warf die Decke beiseite und reckte seine langen mageren Beine in die Höhe.
»Ich stehe auf. Ich muß mich bewegen. Gibt es nichts zu essen bei dir?«
»Brot ist im Schrank. Die Butter ist draußen.«
»Moment, ich gehe erst pinkeln.«
Er verschwand hinter der Wand aus imitiertem Mahagoni, und sie hörte ihn fluchen, während er das Wasser laufen ließ. Idiotisch so was, ins Waschbecken pinkeln zu müssen, bloß um die Dämchen nicht zu schocken, wenn man im WC draußen erscheint. Unfaßbar, was ist Heiliges an ihrem Urin? Brigitte lachte, aber er gab kein Echo, er seifte sich die Hände, und kaum daß sein Blick in den Spiegel fiel, quoll er über vor Bitterkeit. Schön fanden sie ihn! Armer Vater, selig sind die Anspruchslosen. Für mich ist der Fall klar, ich hänge mir zum Halse raus. Man braucht mich bloß anzusehen und weiß sofort, daß ich mein Leben lang mit Feinkost von Fauchon gepäppelt worden bin. Es kommt mir hoch, wenn ich meine bourgeoise Fresse im Spiegel sehe, stülpt mir eine Bombe auf den Kopf und Stiefel an die Füße, und ich habe alles von dem kleinen Bubi, der auf der Ecole Saint-Louis de Gonzague reiten und gute Manieren gelernt hat. Der Kopf juckte ihn, er streckte die Hand nach Brigittes Haarbürste aus, nahm seine Bewegung aber stoisch zurück. David hielt Hygiene für ein bürgerliches Vorurteil. Unglücklicherweise hatte er eine zu feine Nase, sobald sein Körpergeruch ihn störte, duschte er sich (zwei- oder, dreimal in der Woche), außerdem war seine Epidermis sehr empfindlich, und wenn die Bartstoppeln ihn zu sehr kratzten, rasierte er sich. Kurz, mehr als der streng eingehaltene Vorsatz, seine Haare nicht zu kämmen, blieb nicht übrig, aber da er Locken hatte, merkte man davon nicht viel. Mit zwei Schritten seiner langen Beine war er wieder am Tisch.
»Draußen?« fragte er. »Die Butter ist draußen, hast du gesagt? Wo draußen?«
»Am Fenster. Paß auf, daß sie nicht runterfällt, wenn du aufmachst.«
»Urig, diese Mädchen«, sagte David. »Auf was für Ideen ihr kommt. Keinem Mec würde einfallen, seine Butter in einem Plastebeutel zum Fenster rauszuhängen, damit sie über Nacht frisch bleibt.«
»Anders gesagt, wir kommen auf solche kleinen Ideen, während ihr die großen denkt.«
»Das nimmst du zurück«, sagte David, während er das Knüppelbrot durchbrach, »ich bin kein Weiberfeind. Keine Spur. Mädchen oder Mec sind für mich dasselbe. Außer daß ich mit Mecs nicht schlafe«, fügte er mit einem kleinen Lachen hinzu. »Hast du auch Hunger?« fragte er.
»Ja«
»Pech. Aber die Hälfte von deinem Brot laß ich dir.«
Sie lachte dankbar. Sie mochte diesen leichten Ton. Er gab ihr Sicherheit. Dergleichen war bei den Jungs jetzt ziemlich selten. Die Politik nahm alles in Beschlag, selbst harmloses Geblödel war fast unmöglich.
»Ich koche dir Kaffee«, sagte sie und stand auf. Sie war ebenfalls nackt, und um David Freude zu machen, verzichtete sie darauf, ihren Morgenmantel überzuziehen. Sie füllte den Kessel, hockte sich hin, um ihn anzuschließen, und fühlte sich erniedrigt. Nackt zu hocken war entwürdigend, damit sank man auf die Stufe einer indianischen Häuptlingssquaw. Außerdem war ihr nicht gerade warm. »Mädchen oder Mec sind für mich dasselbe«, sicher, dachte sie voller Bitterkeit, aber woher kommt es, daß immer nur das Mädchen dem Mec gehorcht? Übrigens verabscheute sie das Wort »Mec«. Aber David und seine Clique gebrauchten es mit Begeisterung.
»Ich halt’s nicht aus, bis der Kaffee soweit ist«, sagte David, »ich schlinge jetzt.«
Er saß, den Rücken zum Fenster, mit nackten Schenkeln auf den über den Tisch verteilten Seiten von Brigittes handgeschriebener »Dissert«4 in deutscher Sprache. Er fühlte sich wohl so, er hatte den Mund voll und sah befriedigt einem molligen weiblichen Tierchen mit langer blonder Mähne und grünen Augen zu. Tatsächlich, nicht der Zar mit seinen Vorstellungen von »Zivilisation«, sondern die Duchoborzen hatten recht, indem sie nackt lebten. Was sie suchten, war ein Zustand der Unschuld, ein Leben vor dem Sündenfall, eine unmittelbare Verbindung zu Gott. Gott war natürlich das altertümliche Vokabular jener Zeit. Was sie Gott nannten, war der Instinkt.
»Du hast auf meine Frage nicht geantwortet«, sagte Brigitte, die im Waschbecken die Gläser spülte. »Was war 67 los?«
»März 67, Schätzchen!« rief David aus und schwang sein Brot feierlich in die Lüfte, aber Brigitte befand sich hinter der imitierten Mahagoniwand, und so entging ihr die sehenswerte Geste. »Damals hat alles angefangen! Die Bewegung von Nanterre ist aus dem März 67 hervorgebrochen wie das Küken aus dem Ei!«
Brigitte erschien mit den Gläsern und der Zuckerdose. Sie kam zum Tisch und stieß einen Schrei aus.
»So was von Frechheit! Nimm sofort deinen Hintern von meiner Dissert!«
»Mehr als meinen Hintern ist sie wahrscheinlich nicht wert«, sagte David, während er aufstand. »Außerdem ist eine Dissert an sich idiotisch. Idiotisch und repressiv.«
»Mir sind deine Ansichten darüber bekannt«, sagte Brigitte, die ihre Seiten ordnete, wütend. »Du hast sie mir oft genug erläutert. Außerdem«, setzte sie ohne erkennbare Logik hinzu, »ist mir kalt, ich will mich beim Frühstück wohl fühlen können.«