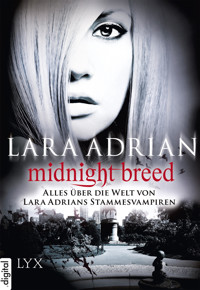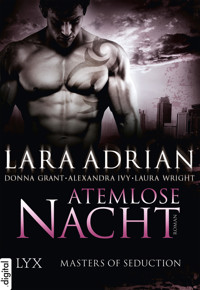8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Midnight Breed
- Sprache: Deutsch
Das leidenschaftliche Finale der SPIEGEL-Bestseller-Reihe!
Die Stammesvampire wappnen sich zur entscheidenden Schlacht gegen ihren Erzfeind. Doch der Sieg kann ihnen nur gemeinsam mit den Atlantiden gelingen. Und so liegt das Schicksal der Welt in der Hand eines Stammesvampirs, der sich aufmacht, das Herz einer unsterblichen Königin zu erobern.
Band 18 der MIDNIGHT-BREED-Reihe
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 402
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Inhalt
Titel
Zu diesem Buch
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Epilog
Ein paar Worte von der Autorin
Die Autorin
Die Romane von Lara Adrian bei LYX
Impressum
LARA ADRIAN
Hüterin der Ewigkeit
Roman
Ins Deutsche übertragen von Katja Liebig
Zu diesem Buch
Die Geheimgesellschaft Opus Nostrum hat eine mörderische Droge freigesetzt, die jeden Vampir zum Rogue machen kann. Der Ordenskrieger Darion Thorne sieht nur eine Chance, um dem blutigen Ansturm zu begegnen: Er muss ein Artefakt der Atlantiden beschaffen, das im Besitz von Königin Selene ist, die alle Vampire aus tiefster Seele hasst. Doch als Darion der Frau gegenübersteht, die er für eine seiner größten Feind:innen hielt, wird seine Welt auf den Kopf gestellt. Die Verbindung zwischen ihnen ist mächtiger als alles, was er je verspürt hat, und er begreift, wie einsam die scheinbar so eiskalte Unsterbliche ist. Schon bald wird klar, dass das Schicksal aller Völker davon abhängt, den Hass zwischen ihnen zu beenden. Denn ein neuer Feind hat sich erhoben, eine Bedrohung aus den Tiefen der Vergangenheit, die alles in den Schatten stellt, was die Welt je gesehen hat – und nur wenn Menschen, Vampire und Atlantiden sich vereint gegen ihn stellen, können sie verhindern, dass die Dunkelheit den Sieg davonträgt.
1
Rogues.
Sie waren überall.
Wie tollwütige Hunde, die man auf eine panische Menschenmenge losgelassen hatte, jagten ganze Horden blutgieriger Vampire durch den beißenden Rauch, der die zerstörten Straßen von Georgetown in Washington, D. C., unter sich erstickte. Ihr animalisches Gebrüll übertönte alle anderen verstörenden Geräusche, die die Nacht erfüllten. Das Heulen von Martinshörnern. Explosionen. Die markerschütternden Schreie der armen Teufel, die sich nicht an die kürzlich erlassene Ausgangssperre nach Sonnenuntergang gehalten hatten und nun den Preis dafür zahlten.
Die Rogues, von ihrer Blutgier getrieben, kannten nichts als ihren Durst und das unkontrollierbare Verlangen, ihn zu stillen. Sie streiften umher, wurden zu Jägern, zu wilden Tieren – zu Schlächtern. Niemand, weder Mensch noch Vampir, war vor ihnen sicher. Sie hinterließen nichts als Verwüstung und Ströme von Blut.
Darion Thornes Stadt war nicht die einzige, die sich diesem jüngsten Ausbruch von Gewalt und Verderben ausgesetzt sah. Wie ein Virus, das der Wind verteilte, überrollten die Rogues alle größeren menschlichen Siedlungen auf der ganzen Welt, ohne dabei auch nur im Geringsten an Geschwindigkeit zu verlieren.
Nein, es wurde nur immer noch schlimmer.
Mit jeder Dämmerung schien sich die Anzahl der Rogues zu vervielfachen.
Ihre Angriffe waren mittlerweile zum drängendsten Problem des Ordens geworden – nicht, dass dessen Krieger sonst keine Probleme gehabt hätten. Ihre Feinde drängten von allen Seiten auf sie ein, wobei jeder einzelne von ihnen nicht nur eine existenzielle Bedrohung für den Orden selbst, sondern für jedes Lebewesen auf diesem Planeten darstellte.
Diese Explosion von Rogue-Angriffen war ein lästiges Ärgernis, das sie gerade verdammt schlecht brauchen konnten.
Darion bleckte fluchend seine Fänge und stieß eine seiner langen Titanklingen in die Brust des Vampirs, den er gerade eine Gasse hinuntergejagt hatte.
Der Rogue lag auf dem Rücken. Er trug einen Anzug, der möglicherweise einmal sehr teuer gewesen war, ihm jetzt jedoch nur noch in Fetzen vom Körper hing. Sein ehemals weißes Hemd war verschmiert und stank von den Überresten seiner letzten Opfer.
Darion hielt ihn fest und nagelte ihn mit dem Fuß und dem kalten, rasiermesserscharfen Metall, das nun aus der Brust seines Gegners ragte, auf den rissigen Asphalt. Der Vampir schlug um sich und knurrte, mittlerweile vollkommen wahnsinnig vor Blutgier. Seine Augen loderten wild und bernsteinfarben wie heiße Kohlen zu Darion empor.
Doch die Mordlust in diesen transformierten Augen verwandelte sich bald in Entsetzen, als das Titan der Klinge seinen kranken Blutstrom traf und den Rogue von innen heraus zerfraß. Er würde schnell, jedoch nicht ohne Schmerzen sterben. Der entsetzliche Laut, der seinem schäumenden Rachen entfuhr, zeugte von nichts als reinster Qual.
Darion verspürte keinerlei Genugtuung bei diesem tödlichen Akt – oder bei all den anderen, die er in dieser Nacht bereits ausgeführt hatte. Bis zum Morgengrauen waren es noch viele Stunden. Noch vor Ende ihrer Patrouille wären er und sein Team blutgetränkt.
Und morgen Nacht fing alles wieder von vorne an.
Schlimm genug, dass D. C. und viele andere große Städte von Rogues verseucht waren, doch die Mitglieder der Terrorgruppe Opus Nostrum, die das ganze Problem erst verursacht hatten, lachten sich vermutlich die feigen Ärsche ab über das ganze Chaos und die Verwüstungen, die sie gerade anrichteten.
Monatelang hatte Opus mit Red Dragon, einer Droge, die selbst den friedlichsten Vampir in ein blutgieriges Monster verwandeln konnte, nur gespielt. Sich ein wenig damit amüsiert. Dessen Fähigkeiten als potenzielle Waffe getestet. Es offensichtlich noch wirkungsvoller gemacht.
Und schließlich auf die Vampire losgelassen.
Darion zog seine Klinge aus dem sterbenden Rogue und trat zurück. Es gab keinen Grund, noch länger zu bleiben. Titan bedeutete ein schnelles, sicheres Ende für einen Rogue. Schon ein winziger Schnitt mit einer Titanklinge führte fast augenblicklich zum Tod.
Er betrachtete es als einen Akt der Gnade, den Mann zu töten. Besser als für immer dazu verdammt zu sein, unter diesem unstillbaren, unheilbaren Durst und dem Wahn der Blutgier zu leiden.
Mit großen Schritten marschierte er die enge Gasse wieder hinauf, als eine tiefe, ruhige Stimme über Funk in seinem Ohr sagte: »Hab einen Einsatz drüben auf der M Street. Irgendjemand in der Nähe?«
Darions Teamleiter Nathan sprach über die Martinshörner hinweg, die irgendwo bei ihm im Hintergrund heulten. »Fünf menschliche Zivilisten sitzen in einem Juweliergeschäft fest. Um sie herum sind überall Rogues. Einer der fünf blutet offenbar aus einem Schnitt von einer Fensterscheibe, die er eingeschlagen hat.«
Einer von Darions Teamkollegen antwortete mit einem leisen Schnauben. Darion kannte diesen höhnischen Laut. Er kam von Rafe, seinem alten Freund und Kameraden auf ihren Patrouillen durch die Stadt. »So viel zum Thema nächtliche Ausgangssperre.«
»Scheiß Einbrecher«, knurrte Jax, der Vierte in ihrem Team. »Überlassen wir sie den Rogues.«
»Sie sind noch Kinder«, erklärte Nathan grimmig. »Teenager oder sogar noch jünger, jedenfalls dem hysterischen Mädchen nach zu urteilen, das vor einer Minute angerufen hat. Nicht, dass es eine Rolle spielt.«
Jax grunzte nur. Mit seinem kalten Verstand und seiner Vorliebe für Wurfsterne war er nie ein besonders warmherziger Typ gewesen, doch seit sein bester Freund Elijah, ebenfalls ein Krieger, vor ein paar Nächten in einem von Opus inszenierten Hinterhalt getötet worden war, wirkte Jax beinahe eisig.
Elis Tod war ein herber Verlust für Nathans Team gewesen, und Darion hatte bereitwillig seinen Platz eingenommen, auch wenn er den Grund für diese Gelegenheit, die sich ihm so geboten hatte, abgrundtief verabscheute. Er würde weder seine Teamkollegen noch seinen Vater Lucas Thorne, den Gründer und Anführer des Ordens, enttäuschen.
Seit er ein kleiner Junge gewesen war, hatte Darion auf seine Chance gewartet, dem Orden als Krieger zu dienen. Er hatte trainiert und sich gewissenhaft auf diese Aufgabe vorbereitet, auch wenn es anfangs so ausgesehen hatte, als würde er niemals die Gelegenheit dazu bekommen.
»Ich bin ganz in der Nähe«, sagte er, die lange Klinge in der Hand, und wandte sich bereits in die angegebene Richtung. »Schon unterwegs.«
Er wartete nicht auf Rückbestätigung. Mit der geballten Kraft und Geschwindigkeit, die ihm als Stammesvampir zur Verfügung standen, überbrückte er die Strecke innerhalb von Sekunden.
Die Situation vor dem Juweliergeschäft war genauso prekär, wie Nathan sie beschrieben hatte. Das große Schaufenster zur Straße war eingeschlagen worden. Spitze Scherben säumten eine Öffnung, die kaum groß genug schien, um eins der fünf Kinder, die jetzt schreiend dahinter kauerten, hindurchzulassen, geschweige denn die drei riesigen Rogues, die nach einer Möglichkeit suchten, zu ihnen hineinzugelangen.
Die fünf Menschenkinder waren immerhin geistesgegenwärtig genug gewesen, eine Barrikade zwischen sich und dem Fenster zu errichten. Der umgestürzte Schaukasten, den sie offenbar in Flammen gesetzt und vor die Öffnung geschoben hatten, hielt die drei Rogues draußen, wenn auch sicherlich nicht mehr lange.
Tatsächlich nicht mal mehr eine Sekunde.
Einer der Vampire senkte die Schulter und rammte sie gegen die provisorische Barrikade. Das Möbelstück zerbarst unter der Wucht seines Stoßes, und Holzsplitter und verbogene Metallteile flogen durch das winzige Ladengeschäft.
Der Rogue begann sich durch die Öffnung in der Scheibe zu zwängen, während seine beiden Kumpane hinter ihm drängelten.
»Fuck.« Darion sprintete über die dunkle Straße, die lange Klinge kampfbereit in der einen Hand, während seine andere zum Pistolenholster am Waffengürtel schoss.
Er vergeudete keine Zeit.
Während die Kinder schreiend und übereinander stolpernd versuchten, dem Griff des vordersten Rogue zu entkommen, rammte Darion einem der beiden anderen, die den Zugang zum Laden blockierten, die Klinge zwischen die Schulterblätter. Laut aufheulend ging der Vampir in die Knie. Den anderen stoppte Darion mit einer Titankugel, die er ihm in den Schädel jagte.
Beide gingen zu Boden und krümmten sich auf dem Asphalt, als das Titan zu wirken begann.
Darion zwängte sich hinter dem ersten Rogue durch das Loch im Schaufenster des Juweliergeschäfts. Die fünf Kids hasteten hysterisch in alle Richtungen, während der Rogue sie zu packen versuchte. Er bekam die weite Jacke eines schlaksigen Jungen zu fassen, dessen zerrissener Ärmel von seinem Blut bereits dunkel verklebt war. Das musste der Junge sein, der sich am Glas verletzt hatte.
Der metallene Geruch frischen menschlichen Blutes ließ Darions Augen bernsteinfarben glühen. Seine Fänge schossen aus seinem Gaumen – eine instinktive Reaktion, die er mit einem leisen Knurren abschüttelte.
Als der Junge ihn hinter dem angreifenden Rogue erspähte, das Gesicht von Kampfeswut verzerrt und mit der glänzenden blutigen Klinge in der Faust, wurden seine Schreie noch schriller.
Der Rogue hielt inne und drehte seinen riesigen Kopf, um zu sehen, wer ihm sein Opfer streitig machen wollte.
Darion stieß zu und schob seinem Gegner die Klinge unter den Kiefer. Die Faust, mit der der Rogue den schreienden Jungen gepackt hielt, wurde schlaff. Der Junge stand da und starrte mit offenem Mund auf seinen Angreifer, der in einem Haufen aus schmelzendem Fleisch und Knochen zu Boden ging.
Darion ließ seinen finsteren Blick über die Gruppe der vor Schreck starren Menschenkinder gleiten. »Raus hier, los.«
Doch es war bereits zu spät.
Der ganze Tumult und vor allem der durchdringende Geruch der blutenden Wunde des schlaksigen Jungen hatten weitere Rogues herangelockt.
Darion wirbelte herum und stellte sich schützend vor die Kinder. Draußen vor der zerstörten Ladenfront näherte sich leises animalisches Grunzen und Knurren. Mehrere Paare glühender Augen durchstachen die Dunkelheit, als eine neue Horde Rogues auftauchte.
Es waren fünf, die Fänge gebleckt, die Blicke wild und irr vor Blutgier.
Darion hielt seine lange Klinge in der einen, die halb automatische Waffe mit den Titangeschossen in der anderen Hand. Doch er drückte nicht ab. Eine Salve von Schüssen würde nur noch mehr Rogues auf den Plan rufen. Schon der einzelne Schuss, den er gerade eben abgefeuert hatte, musste dazu beigetragen haben, diese fünf hier zu ihnen zu locken.
Also verstaute er die Pistole an seinem Rücken und rammte dem ersten Angreifer die Klinge in den Körper. Der riesige Rogue erstarrte, doch seine vier Begleiter stürzten sich nun gemeinsam auf Darion.
Darions Klinge war so schnell, dass man ihr mit den Augen kaum folgen konnte. Schwingend und stechend erledigte er zwei weitere Angreifer, doch der dritte krallte die dicken, splitterigen Nägel in seine Schulter. Riesige Fangzähne schnappten direkt vor seinen Augen zu, während Blut und stinkender Geifer vom Kinn des Rogue tropften.
Darion wich dem Biss aus, stieß zu und kickte den toten Körper zu Boden, während schon der nächste Rogue versuchte, an ihm vorbei an die hilflose Beute hinter seinem Rücken zu gelangen.
Er hatte gerade die Klinge erhoben, um erneut zuzustoßen, als der Rogue vor ihm mitten in der Bewegung erstarrte. Der riesige Körper kippte nach vorn, Blut strömte wie ätzende Säure aus seiner Nase und seinem offenen Mund.
Der sterbende Rogue fiel zu Boden, und Darion sah Rafe, der grinsend seinen Krummdolch abwischte und in den Waffengürtel zurückschob. Das schöne Gesicht, das den Frauen jedes Mal die Köpfe verdrehte, wenn der Krieger irgendwo auftauchte, war mit Ruß, Asche und Blut verschmiert.
»Ich war zufällig in der Nähe und dachte, ich schau mal vorbei.«
Darion grinste seinen Freund und Kameraden an. »Ich hatte hier alles unter Kontrolle.«
»Sehe ich. Hätte mir wohl gar keine Gedanken machen müssen, ob du Hilfe brauchst.« Rafe schaute von Darion zu den sieben Hügeln zischender Rogue-Überreste, die Darion geschaffen hatte, und wieder zurück. »Angeber.«
Darion reagierte nicht auf die brüderliche Stichelei. Er war noch immer im Kampfmodus und sich nur allzu bewusst, dass ihnen vermutlich nur wenige Augenblicke blieben, bis die nächsten Rogues auftauchten. »Wir müssen die Kids hier an einen sicheren Ort schaffen. Und der Blutende muss ins Krankenhaus – wenn die Rogues ihn nicht vorher noch kriegen.«
Die fünf Menschenkinder waren ganz still geworden und drängten sich bleich und mit weit aufgerissenen Augen im hinteren Teil des zerstörten Juweliergeschäfts zusammen.
Rafe nickte. »Ich habe bereits ein Evakuierungsteam angefordert.«
Noch während er das sagte, hörten sie einen Motor aufheulen, und ein schwarzer SUV kam draußen auf der Straße mit quietschenden Reifen zum Stehen. Das Fahrerfenster wurde hinuntergelassen, und Rafes wunderschöne Gefährtin Devony kam zum Vorschein.
Das lange dunkle Haar der Stammesvampirin war zu einem glatten Pferdeschwanz zurückgebunden. Wie Rafe und Darion trug auch sie die schwarze Kampfmontur des Ordens, und ihr Gesicht zeigte Spuren des Gefechts, in das sie als aktives Mitglied des Teams in dieser Nacht ebenfalls eingebunden gewesen war. Als gefährliche Kriegerin und eine der wenigen Tagwandlerinnen war Devony schnell zu einem wertvollen Mitglied des Ordens geworden.
Und zu alledem war Rafe ihr wie ein Schoßhündchen verfallen, was Darion noch immer über alle Maßen amüsierte.
»Wollt ihr beiden die ganze Nacht da rumstehen?«, rief Devony. »Bringt die Zivilisten raus, und dann lasst uns hier verschwinden.«
Rafe grinste. »Verdammt, ich liebe es, wenn sie diesen Kommandoton draufhat. Macht mich jedes Mal echt scharf.«
Darion schnaubte und schüttelte den Kopf. »Auf diese Information hätte ich gut verzichten können.«
»Sagt der Mann, der auf niemand Geringeren als eine unsterbliche Königin steht«, gab Rafe lachend zurück. »Und erzähl mir jetzt nicht, du hättest noch gar nicht bemerkt, was für eine atemberaubende Schönheit Selene ist – wenn man mal großzügig über ihre eisige Persönlichkeit und ihre mörderischen Neigungen hinwegsieht. Und die grob geschätzt zehntausend Jahre Altersunterschied natürlich.«
Darion spürte, wie seine Miene sich verfinsterte. »Die Königin der Atlantiden ist unsere Feindin. Das hat sie mehr als einmal deutlich gemacht.« Tatsächlich konnte Darion gar nicht mehr sagen, ob nun von Selene, Opus Nostrum oder der neuen Bedrohung, die vor wenigen Nächten in den Deadlands explodiert war, die größte Gefahr für den gesamten Planeten und seine Bewohner ausging. Und natürlich für ihn selbst und die anderen Mitglieder des Ordens. »Es spielt keine Rolle, wie schön Selene ist. Wenn überhaupt, dann wird sie dadurch nur noch gefährlicher.«
»Also hast du es bemerkt.«
So gern Darion es auch geleugnet hätte – ja, ihm war sehr wohl bewusst, wie attraktiv Selene war. Atemberaubend schön, und mehr als das. Dabei hatte er sie nur ein einziges Mal gesehen, und das nicht mal in natura. Seit sie sich in die Kommandozentrale des Ordens gehackt hatte, um ihnen mal eben – ganz nebenbei – mit der Vernichtung zu drohen, hatte er kaum mehr an etwas anderes denken können.
Und dabei weit mehr Zeit als angebracht gewesen wäre damit verbracht hatte, sich zu fragen, ob die eisige platinblonde Unsterbliche wohl jemals einem Mann begegnet war, den sie mit ihrem eiskalten Temperament nicht in die Flucht schlagen konnte.
Darion starrte seinen Freund finster an. »Solltest du mir nicht helfen, die Kids hier rauszubringen? Oder wartest du lieber, bis Devony dir den laschen Arsch versohlt?«
»Sieht aus, als hätte ich einen Nerv getroffen.« Rafe klopfte ihm zwinkernd auf die Schulter. »Na komm, sehen wir zu, dass wir diese Dummköpfe hier rauskriegen, bevor die Rogues den Laden übernehmen.«
Eilig brachten sie die Jugendlichen nach draußen und setzten sie in den SUV. Rafe stand schon an der geöffneten Beifahrertür, um zu Devony ins Auto zu springen.
»Kommst du, Dare?«
Darion schüttelte den Kopf. Die Erwähnung der Atlantiden und ihrer wunderschönen, unberechenbaren Königin, kombiniert mit der Erinnerung an all das Chaos und die Gewalt, die sie Opus Nostrum seit ein paar Jahren verdankten, hatte ein Feuer in seinen ohnehin schon brodelnden Adern entzündet. Er wollte, dass dieser Wahnsinn endlich aufhörte – egal was es kostete.
Es gab nichts, was er nicht getan hätte, nichts, was er nicht geopfert hätte, um dieses Ziel zu erreichen.
Um ihn herum erfüllten fernes Geheul, Schreie und Martinshörner die Nacht.
»Ich bin hier noch nicht fertig«, sagte er. »Wir sehen uns später in der Zentrale.«
Rafe sah ihn einen Moment lang an, dann nickte er und stieg ein. Er hatte kaum die Tür geschlossen, als Devony auch schon aufs Gas trat und der schwarze Wagen dröhnend davonraste.
Darion legte den Kopf schief und lauschte auf den Terror, der die Stadt noch immer fest in seinem Griff hielt. Er drehte sich auf den Absätzen seiner Stiefel um die eigene Achse und zog die Titanklinge aus der Scheide.
Und dann verschwand er in die Nacht, um weiterzutöten.
2
Ein menschlicher Schrei drang aus einem entlegenen Zimmer des riesigen Anwesens in D. C., in dem die Zentrale des Ordens untergebracht war. Der Schrei war jämmerlich, voller Angst und Verzweiflung, und ihn zu hören bescherte Lucan Thorne ein ungesundes Gefühl der Befriedigung.
»Klingt, als hätte Hunter sich unserem Gast vorgestellt«, bemerkte Gideon und blickte von seiner kleinen Armada an Monitoren und Tastaturen in der Schaltzentrale auf.
Lucan runzelte die Stirn. »Ich hätte Hunter sofort herbeordern sollen, um sich der Sache anzunehmen. Wir haben keine Zeit, Stunden oder sogar Tage auf ein Verhör zu verschwenden.«
Der »Gast« des Ordens war ein einfacher Fußsoldat von Opus Nostrum, einer von vielen. Dieser hier hatte das Pech gehabt, dem Orden nach einem brutalen Angriff auf ein Theater voller Stammesvampire und Menschen vor ein paar Nächten in die Hände zu fallen.
Nachdem Opus die Anwesenden mithilfe halb automatischer Gewehre und ihrer neuesten Lieblingswaffe – vampirtötender ultravioletter Munition – im Gebäude eingesperrt hatte, war Lucan aufgefordert worden, sich ihnen zu ergeben, im Gegenzug würde man die Geiseln freilassen. Lucan jedoch hatte keinerlei Interesse daran gehabt, mit Opus zu verhandeln oder sich gar zu ergeben, und war gemeinsam mit seinen Kriegern zum Theater gefahren, um sich dem Kampf zu stellen – was Opus vorhergesehen, vermutlich sogar geplant hatte.
Denn ihr Plan hatte einen zweiten Akt beinhaltet.
In dieser Nacht hatten der Mann, der in diesem Moment in der Zelle des Ordens um Gnade winselte, und dessen Kameraden eine noch weit schrecklichere Waffe auf die unschuldigen Geiseln losgelassen: Red Dragon.
Diese Droge konnte innerhalb von Sekunden selbst den gesetzestreuesten Stammesvampir in einen tödlichen, blutgierigen Rogue verwandeln. Und das hatte sie auch getan. Dutzende von ihnen.
Das gesamte Theater war im Chaos versunken, und das unbändige Gemetzel hatte die Krieger des Ordens dazu gezwungen, die neu geschaffenen Rogues zu töten, um weiteres Blutvergießen zu verhindern.
Und um die ganze Katastrophe noch schlimmer zu machen, war jedes abscheuliche Detail dieser Nacht von den Medien, die Opus gezielt an den Ort des Geschehens gerufen hatte, live in die ganze Welt übertragen worden.
Die Tatsache, dass der Angriff auf all diese Zivilisten zudem direkt auf einen Angriff von Opus gefolgt war, der den Orden einen seiner Männer, Elijah, gekostet hatte, ließ Lucans Blut vor Wut kochen.
Und jetzt waren alle Kampfteams des Ordens damit beschäftigt, eine schier endlose Flut an Rogues abzuwehren, die ständig neu erschaffen und auf die Städte der Welt losgelassen wurden.
Lucan knurrte, als er nur daran dachte. »Wenn Hunter dieses Stück Scheiße beim Blutlesen nicht umbringt, tu ich’s vielleicht.«
Mit ungeduldigen Schritten verließ er die Schaltzentrale. Gideon wirbelte seinen Stuhl von den Computern weg und folgte ihm, wobei er sich beeilen musste, um mit Lucan Schritt zu halten, als dieser zu dem Raum marschierte, in dem der Opus-Mann noch immer schrie und um sein Leben bettelte.
Der Gefängnisraum wie auch der restliche Teil des unterirdischen Labyrinths waren bereits Teil des historischen Anwesens gewesen, als der Orden es vor über zwanzig Jahren erworben hatte, um dort sein Hauptquartier für D. C. einzurichten. Seitdem hatte man unter Gideons Leitung die Sicherheitsvorkehrungen sowie den technischen Standard des Gebäudes massiv verbessert. Besonders stolz war der Technikfreak auf die hochmodernen multifunktionalen Gitterstangen, die den Käfig in diesem Zimmer umgaben. Sie waren so gefertigt, dass sie jedem Gefangenen widerstehen konnten, vom gemeinen Rogue bis zum feindlichen Atlantiden oder gar etwas noch Gefährlicherem als beide zusammen.
Doch Gideons eindrucksvolle Planung und Technik waren vollkommen wirkungslos gegen den knochigen Typen, der seit seiner Gefangennahme in der knapp zweieinhalb Quadratmeter großen Zelle hockte.
Sein Name war Elmer Gopnik, was den Spitznamen »Scarface«, den der Orden ihm gegeben hatte, beinahe wie ein Upgrade klingen ließ.
Im Augenblick waren Gopniks hohle, pockennarbige Wangen schweiß- und tränenverschmiert; seine ungewaschenen Haare klebten fettig auf seinem Kopf. Der dürre, schlaff herunterhängende Arm wies zwei winzige Bissspuren auf, aus denen ein dünner Strom Blut rann.
»Irgendwas Wissenswertes?«, fragte Lucan Hunter.
Der ehemalige Auftragskiller wischte sich mit dem Handrücken über den Mund. Seine goldenen Augen waren unergründlich. »Er weiß nichts. Alles, was der Kerl dir bisher erzählt hat, war gelogen.«
»Dachte ich mir«, knurrte Lucan. Auch wenn ihn diese Information kaum überraschte, durchfuhr ihn der Zorn, und seine Fänge traten augenblicklich hervor. »Allein dafür sollte ich ihn umbringen.«
Hunter nickte emotionslos. »Für uns hat er keinen Wert.«
Unter den Blicken der drei Stammesvampire, die ihn ansahen wie ein ekliges Insekt, rang Gopnik panisch nach Luft und zerrte verzweifelt an seinen Fesseln. »Lasst mich gehen … bitte! Oh Scheiße, Mann, bitte tötet mich nicht! Ich flehe euch an!«
Lucan trat näher an die dicken Titanstangen heran. »Du flehst mich an? So wie der Botschafter der Stammesvampire von Irland dich in diesem Theater angefleht hat, kurz bevor ihr ihn vor seiner verdammten Familie mit UV-Licht vollgepumpt habt?«
Gopnik erblasste. »Ich habe nur meine Befehle befolgt. Ich hatte keine Wahl!«
»Keine Wahl?« Lucan spie diese Worte förmlich aus. »Willst du, dass wir dir das Video vorspielen? Sag ja, denn wenn ich dieses verdammte Massaker noch ein einziges Mal mitansehen muss, werde ich dich für jede Sekunde, die diese unschuldigen Zivilisten leiden mussten, ein Jahr leiden lassen.«
Gopnik schüttelte so wild den Kopf, dass es aussah, als hätte er einen Krampf. Schaudernd sank er in sich zusammen, und die ätzende Pfütze aus Urin unter dem Stuhl, auf den man ihn gefesselt hatte, wurde noch größer, als er sich stammelnd zusammenkauerte.
Lucan starrte ihn an. Er spürte nichts, nicht einmal Mitleid. Gopnik hatte seine Befehle in diesem Theater mit krankhafter Freude und voller Enthusiasmus ausgeführt. Es wäre ein passendes Ende für ihn, wenn Lucan ihm nun mit bloßen Händen den Kopf abriss und diesen draußen vor der Zentrale auf einem Pfahl aufspießte. Oder noch besser, ihn mit dem Versprechen an Opus Nostrum zurücksandte, dass deren Anführer als Nächstes dran waren.
Dafür allerdings musste der Orden erst einmal herausfinden, wo genau diese sich aufhielten.
Gideon arbeitete bereits an einer Möglichkeit, dieses Problem zu lösen, doch die beiden Leerstellen in seinem Plan lauteten: Information und Gelegenheit. Für Ersteres hatte sich Elmer Gopnik als absoluter Reinfall erwiesen, und was das Zweite anging: Egal wie viel Genugtuung es Lucan auch verschafft hätte, seine Wut an einem von Opus’ Fußsoldaten auszulassen, so konnte der Mann ihnen vielleicht noch von Nutzen sein.
Die Vorstellung, ihm den Kopf abzureißen, war jedoch nach wie vor ziemlich verlockend, und wenn er Gopnik noch einen Moment länger unter den Augen – oder seinen grässlichen Gestank unter der Nase – hatte, bestand ernsthaft die Gefahr, dass Lucan seinen Mordgelüsten doch noch nachgab.
Außerdem musste er weiter.
»Ich kümmere mich später um diesen Abschaum hier«, erklärte er. »Oder ich lasse ihn einfach hier unten verrotten.«
Lucan gab Gideon und Hunter ein Zeichen, ihm zu folgen, und entfernte sich von Gopniks Zelle.
»Wartet!«, rief Gopnik ihnen nach. »Es tut mir leid! Ich werde euch jetzt die Wahrheit sagen.«
Lucan beantwortete diese plötzliche Reuebekundung mit einem Schnauben. »Red ruhig weiter. Damit machst du mich nur noch wütender.«
»Bitte!« Gopniks Stimme stieg um eine weitere Oktave nach oben. »Ihr könnt mich doch nicht einfach in diesem Drecksloch allein lassen!«
Gideon blieb neben Lucan stehen. »Augenblick. Hat das Arschloch gerade meine Arbeit beleidigt?« Mit gebleckten Fängen wirbelte er herum und marschierte zurück zu den glänzenden Stangen, die Gopniks Zelle bildeten. »Das ist kein Drecksloch, du ignoranter Wichser. Diese Zelle hier ist ein technisches Kunstwerk.«
Lucan räusperte sich, amüsierter, als es in Anbetracht der Situation vielleicht angebracht war.
»Fühlst du dich jetzt besser?«, fragte er, als Gideon sich wieder zu ihm und Hunter gesellte, die bereits an der Tür standen.
Gideon fuhr sich mit der Hand über die spitzen Stoppeln seiner kurzen blonden Haare. Seine Augen hinter den hellblauen Brillengläsern glühten noch immer bernsteinfarben vor Wut. »Zu schade, dass das Arschloch bloß ein Mensch ist. Hätte ihm nur zu gern gezeigt, was die Zelle so alles draufhat.«
Lucan grinste. »So sehr ich dir zustimme, wir müssen uns die Schock-Methode für ein anderes Mal aufheben. Es gibt noch viel zu tun. Erst recht, nachdem sich das Ganze hier als Sackgasse entpuppt hat.«
Die drei Krieger traten hinaus auf den Korridor, und Gideon tippte den Code ein, der das Sicherheitssystem des Gefängnisses aktivierte. Kaum war die Tür hinter ihnen verriegelt, stieß Lucan einen wütenden Fluch aus.
»Verdammt. Opus hat uns an den Eiern, und das wissen sie genau. Und solange es ihnen gelingt, sich zu verstecken und die ganze Welt in Angst und Schrecken zu versetzen, wird sich daran auch nichts ändern. Red Dragon. UV-Waffen. Sie treffen uns aus allen Richtungen, und solange wir ihr Kommandozentrum nicht hochnehmen, können wir nichts anderes tun, als die Feuer zu löschen, die sie legen.«
»Lass mich das übernehmen«, sagte Hunter. »Geheimoperationen sind genau das, wozu ich geboren wurde.«
Das meinte er wörtlich. In der Kunst des Mordens gab es niemand Kompetenteren als den riesigen Gen-Eins-Vampir, der in den Laboren eines Wahnsinnigen, des einstigen Erzfeinds des Ordens, durch Züchtung, Erziehung und Ausbildung zu einer gefühllosen perfekten Tötungsmaschine geformt worden war.
Doch egal wie diabolisch Dragos auch gewesen sein mochte, Opus Nostrum war schlimmer.
»Ich zweifle nicht an deinen Fähigkeiten, Hunter, aber Opus ist wie eine Hydra. Wenn du einen Kopf abschlägst, taucht sofort der nächste auf. Die Erfahrung haben wir schon mehrmals gemacht. Jedes Mal, wenn wir dachten, wir hätten gewonnen, übernimmt jemand Neues die Führung. Gesichtslos. Namenlos. Wir wissen nicht, wie viele bei Opus da oben an der Spitze der Kommandokette sitzen, ganz davon zu schweigen, wer diese Mistkerle überhaupt sind.«
»Wir haben ihnen ein paar empfindliche Verletzungen beigebracht«, erinnerte Hunter ihn. »Reginald Crowe und seine verräterische Tochter Iona Lynch, Fineas Riordan … und noch einige andere, Vampire und Menschen, die Opus noch immer dienen würden, wenn der Orden sie nicht erledigt hätte.«
»Stimmt. Aber das reicht nicht«, sagte Lucan. »Wir haben höchstens ein paar Dellen in die ganze Organisation geschlagen. Wir müssen sie von oben nach unten erledigen. Aber die gesamte Führung wird von einer Armada aus Sicherheitsvorkehrungen und -technik geschützt, durch die wir einfach nicht durchkommen.«
»Noch nicht«, warf Gideon ein. »Der Computerwurm, den ich programmiert habe, wird sich durch alle Sicherheitsschranken arbeiten. Ich muss nur noch wissen, wohin ich ihn schicken soll. Wir hatten gehofft, dass Scarface dadrin uns Informationen dazu liefern würde, aber das können wir wohl vergessen.«
Lucan ärgerte sich maßlos über diesen Rückschlag, den sie sich gerade wirklich nicht leisten konnten. »Dann werden wir eben so lange Fußsoldaten von Opus einkassieren, bis wir die Informationen haben, die wir brauchen.«
Hunter nickte grimmig. »Wird erledigt. Sobald wir hier fertig sind, kümmere ich mich darum. Und was machen wir mit dem, den wir schon haben?«
»Ich sag dir, was ich am liebsten mit ihm machen würde: dieses wertlose Stück Scheiße heute Abend mit zu meinem Treffen des Rates der Vereinten Nationen nehmen und in aller Öffentlichkeit ein Exempel an ihm statuieren. Ich könnte ihm die Kehle rausreißen, sozusagen als Highlight dieser albernen Rede, die ich dort halten muss, während ich eigentlich mit den anderen draußen auf der Straße Rogues abschlachten sollte.«
Gideons Augenbrauen schossen nach oben. »Du meinst die Rede, die in alle Winkel des Planeten übertragen werden soll? Korrigier mich, wenn ich mich irre, aber ist es nicht der Sinn dieser ganzen Rede heute Abend, der Welt zu versichern, dass der Orden alles tut, um den Frieden zu wahren beziehungsweise wiederherzustellen?«
Lucan spürte, wie sein Gesichtsausdruck immer finsterer wurde. »Und?«
»Nun, ich könnte mir vorstellen, dass die Message ein bisschen besser rüberkäme, wenn du sie nicht mit blutigen Fängen und einer menschlichen Leiche vor dir auf dem Boden halten würdest. Ist nur so ein Gedanke.«
Lucan schnaubte. »Sagt der, der Gopnik noch vor einer Minute Feuer unterm Arsch machen wollte.«
Gideon zuckte mit den Schultern und grinste. »Wie gesagt: Alles, was wir brauchen, ist ein Hinweis, der mich grob in die Nähe von Opus’ Netzwerk bringt, damit ich meinen Wurm losschicken kann. Und schon kann der Spaß losgehen. Wir demaskieren heimlich die Führungsebene, schalten einen nach dem anderen aus, und die ganze Organisation fällt in sich zusammen.«
Lucan war froh über Gideons Zuversicht. Und er teilte sie. Doch die neunhundert Jahre, die er mittlerweile lebte, hatten ihn gelehrt, dass die Dinge nur selten so liefen, wie man sie geplant hatte.
Zudem blieb immer noch die ständige Bedrohung durch das tödliche Waffenarsenal, das Opus Nostrum zur Verfügung stand. Nicht mal ein Gen-Eins-Vampir wie Hunter, mit all seiner Kraft und seinen Fertigkeiten, hatte eine Chance gegen die sofort tödlichen UV-Geschosse oder das hirnzerfressende Gift von Red Dragon.
Die Risiken, die die Jagd auf die Führung von Opus Nostrum mit sich brachte, waren enorm und gehörten zu den größten, mit denen sich der Orden je konfrontiert gesehen hatte.
Und das neben all den anderen Gefechten, die nur auf sie warteten: zum einen gegen die böse Königin der Unsterblichen in Atlantis, zum anderen – eine Gefahr, die alle anderen überschattete – gegen eine außerirdische Bedrohung, die vor wenigen Tagen gemeinsam mit zwei atlantidischen Kristallen, die in der Lage waren, den gesamten Planeten in Schutt und Asche zu legen, einen gottverlassenen Flecken Erde in der sibirischen Steppe verlassen hatte.
Und heute Abend, während ein Großteil von D. C. und zahllosen anderen Städten in Flammen stand und von Rogues überrannt wurde, erwartete man von Lucan das Versprechen, sie alle von ebendiesem Schrecken zu erlösen.
Die ganze Welt blickte auf ihn und wartete darauf, dass er ihnen versicherte, all dieses Chaos und der Terror würden schon bald enden und Frieden zurückkehren – und zwar endgültig.
Diese hoffnungsvollen Worte, die er gemeinsam mit seiner Gefährtin Gabrielle vor wenigen Stunden geschrieben und geprobt hatte, würden auf seiner Zunge wie Lügen schmecken, wenn er sie am Abend verkündete.
Seine Menschen- und Vampirkollegen im Rat rechneten fest damit, dass es ihm gelingen würde, den angsterfüllten Planeten zu beruhigen, doch Lucan konnte sich des Gefühls nicht erwehren, dass alles nur noch schlimmer werden würde.
3
Es ist viel zu still, dachte Jenna, die allein im Archiv des Ordens saß und arbeitete.
Sie wusste, dass überall draußen in der Stadt ein brutaler Kampf tobte, doch die Stille in den abgesicherten Mauern des Anwesens, in dem die Zentrale des Ordens untergebracht war, und in der riesigen Bibliothek des Hauses, die ihr als Arbeitszimmer diente, war ohrenbetäubend.
Und die schon so lange währende Stille in ihrem Kopf machte ihr ebenfalls Sorgen.
Es kam nicht oft vor, dass ihr Gefährte Brock und so ziemlich jedes Mitglied der Kampfteams zur selben Zeit auf Patrouille geschickt wurden. Sogar die Frauen, die für den Kampf ausgebildet waren, befanden sich an diesem Abend an der Seite ihrer Gefährten und Kameraden draußen auf der Straße.
Als ehemalige Polizistin wünschte Jenna, auch sie könnte mit Brock und den anderen dort draußen sein. Es war nie ihre Art gewesen, während einer Krise danebenzusitzen und zuzuschauen, doch selbst sie musste zugeben, dass sich ihre Zeit als Bundespolizistin in Alaska mittlerweile so fern anfühlte wie der Umstand, dass sie einmal ein echter Mensch gewesen war.
Über zwanzig Jahre war es nun her, doch an manchen Tagen schien es ihr, als wäre es gestern gewesen. An anderen wiederum konnte sie sich kaum daran erinnern, wie sie einmal ausgesehen hatte – vor alledem.
Gedankenverloren hob sie die Hand und strich mit den Fingerspitzen über die Dermaglyphen an ihrem Nacken. Was einmal als winziger Punkt begonnen hatte, war im Laufe der Zeit immer größer geworden. Mittlerweile war ihr gesamter Körper von diesen außerirdischen Hautmustern überzogen und erinnerte sie beständig an das Martyrium, das ihr Leben so sehr verändert hatte.
Dieses Martyrium allerdings hatte auch Brock in ihr Leben geführt, und das allein machte alles andere ein wenig erträglicher.
Jennas Gedanken wanderten zurück zu einem kleinen Grab in Alaska. Das Qualvollste, das sie je hatte erleben müssen, war der Tod ihrer kleinen Tochter Libby gewesen. Nichts konnte Libby jemals wieder zurückbringen, doch es gab Jenna immerhin einen winzigen Funken Trost, zu wissen, dass ihr Kind niemals die Angst und den Terror würde erleben müssen, die die Welt aktuell in ihrem Griff hielten.
»Klopf, klopf«, erklang eine tröstliche weibliche Stimme zögernd von der Schwelle der offenen Tür.
Jenna blickte auf und sah Gabrielle dort stehen und darauf warten, hereingebeten zu werden. Lucans Gefährtin, eine Stammesvampirin, trug weite Leggings und ein ebenso weites Oberteil. Ihr langes kastanienbraunes Haar war zu einem lockeren Knoten hochgesteckt, und in den Händen hielt sie ein Tablett mit herrlich duftenden Köstlichkeiten.
Neben ihr, mit einer offenen Flasche Rotwein und drei Weingläsern in den Händen, stand Gideons wunderschöne Gefährtin Savannah. Sie war ähnlich gekleidet wie Gabrielle, und aus dem etwas verrutschten Halsausschnitt ihres hellgrauen Sweatshirts lugte eine glatte mokkabraune Schulter hervor.
»Wir bringen ein wenig Proviant«, sagte sie und lächelte Jenna mit sanftem Verständnis in den dunkelbraunen Augen an. »Ich gehe nicht davon aus, dass du heute schon etwas gegessen hast, oder?«
Jenna schloss das Traumtagebuch, in dem sie geschrieben hatte, und schüttelte den Kopf. Sie war keine Vampirin wie ihre Freundinnen, und vom Blut ihres Gefährten zu trinken, reichte ihr nicht aus, um zu überleben. Brock erfüllte all ihre anderen Bedürfnisse – und mehr –, doch sie musste zugeben, dass der köstliche Duft des geräucherten Fleisches, des cremigen Käses und all der anderen Kleinigkeiten auf dem Tablett eine willkommene Unterbrechung ihrer Arbeit bildete. Und zu einem Glas Wein würde sie auch nicht Nein sagen.
Gabrielle stellte das Tablett auf den Tisch, an dem Jenna gearbeitet hatte, und Savannah füllte ihre Gläser. Jenna biss in ein Stückchen Käse und trank einen Schluck von ihrem Wein. Sie seufzte wohlig, als der Geschmack von beidem sich auf ihrer Zunge verband.
»Danke«, murmelte sie und lehnte sich in ihrem Stuhl zurück, während die anderen beiden Frauen sich zu ihr setzten. »Ehrlich gesagt habe ich seit Wochen nicht viel Appetit.«
Savannah nickte mitfühlend. »Du hast einiges durchgemacht.«
»Wir alle«, erwiderte Jenna und betrachtete die Schatten, die unter den Augen ihrer Freundinnen lagen. »Ist Lucan zur Krisensitzung des Rates der Vereinten Nationen gefahren?«
»Ja«, antwortete Gabrielle. »Seine Rede beim GNC soll in der nächsten Stunde übertragen werden. Ich brauche wohl nicht zu sagen, dass er nicht sonderlich erpicht darauf ist. Er wäre lieber auf Patrouille gegangen, so wie alle anderen auch. Ich konnte ihn gerade noch davon abhalten, nicht in Kampfmontur dort aufzutauchen.«
Jenna lächelte. »Kann ich mir vorstellen.«
Gabrielles Mundwinkel bogen sich ein wenig nach oben, doch die Schwermut in ihrem Blick blieb. Sie trug sie bereits seit langer Zeit, zweifellos eine Folge ihres Blutbandes mit Lucan. Wie alle durch ihr Blut miteinander verbundenen Paare spürten auch Lucan und Gabrielle jeweils die intensivsten Emotionen des anderen – die guten wie die schlechten –, als wären es ihre eigenen.
Freude, Zuneigung, Sorge.
Angst, Trauer, Schmerz.
Sie alle übertrugen sich mittels der Blutsverbindung, die diese Paare besaßen.
Und somit war Gabrielles offensichtlich tiefe und langewährende Sorge auch Lucans.
Nicht, dass sie keinen Grund dafür gehabt hätten, sich zu sorgen.
Allen erging es so, vor allem jedoch den Kriegern des Ordens. Sie standen bei jeder Gefahr an vorderster Front, bildeten den letzten Wall zwischen den Bewohnern dieses so fragilen Planeten und der Finsternis, die aktuell drohte, ihn von allen Seiten zu verschlingen.
Jenna konnte sich nur an eine Situation erinnern, in der das allgemeine Gefühl von Bedrohung in der Zentrale und auch draußen in der Welt ähnlich akut gewesen war. Diese andere höllische Nacht vor zwanzig Jahren war die dunkelste gewesen, die sie und die anderen Mitglieder des Ordens jemals erlebt hatten.
Damals allerdings hatten sie nur gegen einen Wahnsinnigen und dessen teuflische Pläne gekämpft. Nun jedoch sah sich der Orden gleich drei mächtigen Feinden gegenüber, von denen einer gefährlicher war als der andere.
Selene.
Opus Nostrum.
Und der Älteste, der vor zwei Wochen in den Deadlands beinahe Jenna, Brock und einige andere Mitglieder des Ordens und seiner Verbündeten vernichtet hätte.
Gabrielle betrachtete Jenna einen Moment lang. Der Blick ihrer sanften Augen folgte den Dermaglyphen, die sich von Jennas nackten Armen bis hinauf zu ihrem Kopf zogen. »Immer noch keine Ahnung, wo der Älteste sich aufhalten könnte?«
»Nein. Nichts als Schweigen auf der medialen Alien-Hotline.« Jenna lachte grimmig. »Ich hätte nie gedacht, dass ich mir tatsächlich einmal wünschen würde, eine mentale Verbindung zu einer dieser Kreaturen aufzubauen. Und jetzt, wo es uns tatsächlich helfen könnte, empfange ich gar nichts.«
»Denkst du, die Explosion, die er verursacht hat, könnte die Verbindung auf irgendeine Weise zerstört haben?«, fragte Savannah. »Die beiden atlantidischen Kristalle explodieren zu lassen, hätte womöglich halb Sibirien in Schutt und Asche gelegt, wenn Phaedra euch nicht geschützt hätte. Vielleicht hat die Wucht dieser Detonation irgendeinen Kurzschluss in dem kleinen außerirdischen Chip in dir verursacht.«
»Ich habe keine Ahnung«, gestand Jenna. »Möglich wäre es. Obwohl ich jetzt seit zwanzig Jahren mit diesem Chip in meinem Hinterkopf lebe, weiß ich noch immer nicht genau, wie er funktioniert.«
»Oder vielleicht ist die Verbindung tot, weil der Älteste selbst es in dieser Nacht gar nicht aus den Deadlands herausgeschafft hat«, mutmaßte Gabrielle.
Dafür bestand immerhin eine winzige Hoffnung. Eine Hoffnung, von der Jenna wünschte, sie möge sich als wahr erweisen, während Tage und Wochen ohne einen Hinweis darauf vergingen, dass ihr Unterbewusstsein noch immer mit dem Monster verbunden war, dem sie in den Überresten des zerstörten Raumschiffs persönlich gegenübergestanden hatte.
Sogar ihre Träume hatten seit ihrer Rückkehr nach D. C. ihr allein gehört.
Und dennoch, diese Stille zerrte an ihren Nerven.
Sie wagte es nicht, ihr zu trauen, so gerne sie es auch wollte.
Savannah kaute auf einer Olive und sah Jenna an. »Blöd, dass es keine Gebrauchsanweisung für außerirdische Biotechnologie gibt, was?«
Jenna musste lachen, auch wenn die ganze Situation kein bisschen komisch war. »Eine für atlantidische Kristalle wär auch nicht schlecht.«
»Auf diesem Gebiet haben wir wenigstens ein wenig Hilfe«, sagte Gabrielle. »Ich weiß nicht, was wir ohne Zael, Phaedra und Jordana machen würden.«
»Darauf trinke ich.« Mit ernstem Gesicht erhob Jenna ihr Glas auf die drei Unsterblichen aus Atlantis, die mittlerweile zu den Verbündeten des Ordens gehörten. Zael und seine Gefährtin Brynne, eine Gen-Eins-Vampirin, waren gerade draußen in der Stadt auf Patrouille, gemeinsam mit Micah, Tegans und Elises Sohn, und dessen Gefährtin Phaedra, der letzten Atlantidin, die sie in ihrem Kreis willkommen geheißen hatten.
Auch die ätherische, platinblonde Jordana war eine vollblütige Atlantidin, obwohl sie in den ersten fünfundzwanzig Jahren ihres Lebens keine Ahnung davon gehabt hatte. Sie hatte von ihrer wahren Herkunft erst ungefähr zu der Zeit erfahren, als sie sich mit Nathan, einem der besten Krieger des Ordens, verbunden hatte.
»Nun, alles, was wir tun müssen, ist, die atlantidische Kolonie davon zu überzeugen, sich mit uns gegen Selene zu verbünden«, sagte Savannah.
»Leichter gesagt als getan.« Jenna stellte ihr Weinglas ab und griff nach einem Stückchen Brot. »Die Atlantiden auf ihrer kleinen verborgenen Insel brauchen den Kristall zu ihrem eigenen Schutz. Ich kann verstehen, dass sie zögern, dessen Kraft mit uns zu teilen. Er ist das Einzige, das sie vor der Außenwelt schützt, seit sie vor vielen Jahrhunderten vor Selene aus Atlantis geflohen sind.«
»Dann muss ich mir eben etwas einfallen lassen, um sie zu überzeugen.«
Diese Worte ließen alle drei Frauen aufblicken. Jordana trat in die Bibliothek. Sie schritt hinüber zu den anderen, wobei es ihr mit ihrem entspannten, eleganten Stil irgendwie gelang, weite Jeans und ein schlichtes Top ebenso königlich wirken zu lassen wie ein Ballkleid. Was nicht überraschte, wenn man bedachte, dass ihre Großmutter keine Geringere war als Selene persönlich.
Die Königin der Atlantiden hasste alle Stammesvampire und deren Ahnen, die Ältesten, ohnehin schon, auch ohne die zusätzliche Schmach, dass ihre einzige Erbin ihre Abstammung mit Füßen getreten und sich mit einem Krieger des Ordens verbunden hatte.
Jordana trat an den Tisch. »Es ist so schrecklich still im Haus heute Abend. Ist es in Ordnung, wenn ich mich zu euch geselle?«
»Bitte«, sagte Jenna und wies auf einen der leeren Stühle, die um den langen Tisch herumstanden. »Was meinst du damit, du müsstest einen Weg finden, die Kolonie davon zu überzeugen, sich uns anzuschließen? Ich dachte, Zael und Brynne versuchten bereits, mit ihnen zu verhandeln.«
»Sie werden in ein paar Tagen in die Kolonie zurückkehren, um erneut an den Rat zu appellieren. Ich habe angeboten, sie zu begleiten.«
Jenna blickte zu Gabrielle und Savannah hinüber. Die beiden schienen genauso überrascht zu sein wie sie selbst. »Bist du sicher, dass das eine gute Idee ist?«
Jordana nickte entschlossen. »Ich glaube, so haben wir die größte Chance. Jetzt, wo wir wissen, dass sich zwei der ursprünglich fünf Kristalle in den Händen des Ältesten befinden – wo auch immer er sein mag –, können wir es uns nicht leisten, noch länger zu warten oder bloß darauf zu hoffen, dass die Kolonie uns helfen wird, wenn wir ihre Hilfe benötigen. Womöglich bin ich die Einzige, auf die sie hören werden. Phaedra und Zael sehen es genauso. Und Brynne auch.«
Gabrielles Blick wurde weich vor Sorge. »Was sagt Nathan dazu?«
Jordana senkte den Blick; tiefe Falten erschienen auf ihrer Stirn. »Er wird es akzeptieren. Er versteht, dass ich es tun muss, nicht nur für meine Familie hier im Orden, sondern auch für die Bewohner der Kolonie. Auch sie sind meine Familie, selbst wenn ich ihnen nie begegnet bin.«
Savannah nahm ihre Hand und drückte sie. »Dein Mann ist absolut unverwüstlich, aber nicht, wenn es um dich geht. Er weiß, dass Selene alles darum geben würde, dich nach Atlantis zurückzuholen.«
»Zur Not mit Gewalt«, ergänzte Jenna.
»Ich weiß«, murmelte Jordana. »Meine Großmutter hat schon einmal versucht, mich zu entführen. Aber das war, bevor ich meine atlantidischen Kräfte kannte und wusste, wie ich sie einsetze. Und meine Blutsverbindung mit Nathan hat mich nur noch stärker gemacht. Ich habe keine Angst. Ich weiß, wie ich mit mir selbst und anderen umgehen muss.«
»Das mag so sein, aber keiner von uns hat sich jemals persönlich Selene oder ihren Kriegern entgegengestellt«, erinnerte Jenna sie.
Savannah nickte. »Es gibt nur eins, das Selene mehr will als die Kristalle oder Rache dafür, dass man sie ihr gestohlen hat. Und das bist du, Jordana.«
»Das stimmt«, bekräftigte Jenna. »Wir wissen nicht, wozu sie fähig ist und was sie tun würde, um dich wieder zurückzubekommen.«
Gabrielle hatte bisher geschwiegen und den anderen nachdenklich zugehört. Als sie nun sprach, war ihre Stimme leise, und in ihren braunen Augen stand eine unausgesprochene Angst. »Hoffen wir, dass keiner von uns jemals in den direkten Genuss von Selenes Zorn kommt.«
4
Blut und Feuer. Rauch und Schreie. Eine Welt in den Fängen der Finsternis, erstickt von Zerstörung und Gewalt.
Nie zuvor hatte Selene solches Chaos, einen solchen scharfen, albtraumhaften Terror gesehen.
Wobei – doch, das hatte sie. Vor so langer Zeit, dass es schon fast zum Mythos verklungen war … doch nicht für sie.
Niemals für sie.
Sie konnte noch immer die Bitterkeit dieses anderen, damaligen Angriffs hinten in ihrer Kehle schmecken, und selbst jetzt musste sie sich auf die Zunge beißen, um ihre alte Wut daran zu hindern, durch ihre fest zusammengebissenen Zähne zu entweichen.
Diesmal allerdings stand die Welt der Sterblichen in Flammen. Es waren Menschen und Vampire, die in den Straßen ihr Leben ließen. Diesmal war es nicht ihr Reich. Nicht ihr Volk.
Warum also zog sich beim Anblick all dieses Gemetzels, dieses Leids ihr Magen zusammen? Ihr Herz fühlte sich an, als hätte jemand es in einen Schraubstock gespannt und hielte es in einem Würgegriff, der sie scharf nach Luft ringen ließ.
»Majestät?« Die Seherin, die gemeinsam mit Selene im Salon des königlichen Palastes stand, blickte besorgt von dem Becken auf, in dem sie Selene auf deren Befehl hin ein Fenster auf das mit Angst und Terror erfüllte Gebiet im Osten der Vereinigten Staaten eröffnet hatte. »Wenn Ihr wünscht, kann ich einen anderen Ort aufrufen.«
»Nein.« Selenes Ton war so knapp wie die Handbewegung, mit der sie den Vorschlag der Seherin abtat. »Ich habe genug gesehen. Ihr könnt gehen, Nuranthia.«
»Ja, Majestät.« Ängstlich wie eine Maus, die verzweifelt darauf bedacht war, den Klauen der Katze zu entwischen, eilte die zierliche Brünette hinaus.
Selene starrte auf die große, aus Gold gehämmerte Schale auf dem marmornen Sockel. Mit der Seherin war auch die Vision, die sie heraufbeschworen hatte, fort. Nichts als klares, reines Wasser glitzerte in dem flachen Becken.
Sie brauchte Nuranthias Visionen nicht, um zu wissen, dass die blutgetränkten Ränder der Außenwelt immer näher an die Grenzen ihres Reiches heransickerten. Seit Jahrhunderten wusste sie, dass es irgendwann dazu kommen würde. Es hatte an dem Tag begonnen, an dem das erste Mitglied ihres Volks sich mit einem Menschen verbunden und ein Mädchen gezeugt hatte, das sich wiederum mit den wilden, bluttrinkenden Nachkommen von Atlantis’ Erzfeinden hatte verbinden können.
Lange hatte es Selene genügt, die Vampire und Menschen sich gegenseitig abschlachten zu lassen, doch in letzter Zeit waren die Dinge so weit eskaliert, dass sie sie nicht länger ignorieren konnte.
Selenes transparente Röcke schwebten um sie herum, als sie an dem Becken vorbei durch den von einer Kuppeldecke überdachten Freiluftsalon schritt. Zwei von Säulen flankierte Bögen boten Zugang zu einem wunderschönen, von Mauern umschlossenen Garten. Nach dem Einblick in die finstere, von Chaos und Zerstörung geplagte Welt der Sterblichen sehnte sie sich nach frischer Luft und den reinigenden Strahlen der atlantidischen Sonne auf ihrem Gesicht.
Ihr Palast war eine steil aufragende Festung aus glattem, weißem Stein mit eleganten, spitzen Erkertürmen und stand auf einem Hügel in der Mitte einer fruchtbaren, friedlichen Insel. Selenes Privatgemächer lagen im obersten Geschoss des Hauptturms, hoch oben über dem Garten vor dem großen Thronsaal und dem Salon im Erdgeschoss, in dem sie jetzt stand. In den Etagen dazwischen befanden sich die Räume ihrer Diener, Berater und Leibwächter sowie der übrigen Bediensteten.
Innerhalb des Palastes gab es noch weitere Türme und Gebäude, und jenseits davon erstreckte sich in alle Richtungen die glänzende Zitadelle, in der die Bewohner ihres Reiches lebten. Diejenigen zumindest, die noch übrig waren. Die wenigen Tausend, die aktuell dort lebten, waren nur noch ein Bruchteil der Bewohner der ehemaligen Metropole. Dazu kam noch eine Handvoll Abtrünniger und Rebellen, die aus dem neu geschaffenen Reich geflohen waren und nun dort draußen ihrer eigenen Wege gingen.
Selene hatte ihnen diesen Verlust noch immer nicht vergeben.
Dieses zweite atlantidische Reich, von türkisblauem Wasser und einem klaren blauen Himmel umschlossen, war fast ebenso paradiesisch wie das, das man ihrem Volk einst gestohlen hatte.
Für Selene war es ihre Heimat. Sie würde ihr Reich bis zu ihrem letzten Atemzug, dem letzten Schlag ihres Herzens, verteidigen – und jeden töten, der auch nur mit dem Gedanken spielte, es zu zerstören.
Sie schob ihre düsteren Gedanken beiseite und ging tiefer in den Garten hinein. Helles Sonnenlicht lag wie ein Schirm über der gesamten Insel; darüber erstreckte sich ein tiefblauer Himmel. Sie sog all das ein, die Sonne und den Himmel, das türkisblaue Wasser, das die Insel umschloss, den Duft von Meer und Zitronen und unzähligen Blumen, die überall im Garten blühten.
Es hatte einmal eine Zeit gegeben, da hatte diese friedvolle Stille ihr genügt, doch das war vorbei. Schon seit langer, langer Zeit.
So lange, wie ein Teil von ihr – Selenes einzige Erbin – unter den brutalen Nachkommen derjenigen gefangen war, die Atlantis zerstört hatten.
Selene wollte gerne glauben, dass ihre Enkelin gegen ihren Willen dort festgehalten wurde, doch wie es schien, war es noch weit schlimmer: Jordana hatte sich offenbar entschieden, bei den Vampiren zu leben und sich mit einem von ihnen zu verbinden.
Und das, nachdem sie von ihrer wahren Herkunft erfahren hatte.