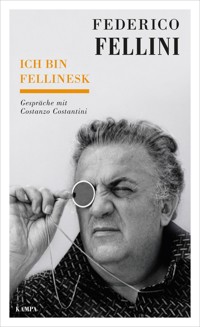
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kampa Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Kampa Salon
- Sprache: Deutsch
Erzählen, sagt Federico Fellini, sei für ihn das einzige Spiel, das sich zu spielen lohne. Und so »erzählt« Fellini, der geborene raconteur, in diesen Gesprächen sein Leben - leidenschaftlich, tiefgründig, amüsant, filmreif, eben »fellinesk«: von seiner Kindheit in Rimini, von den Inspirationen zu seinen Filmen, von seiner Zusammenarbeit mit Filmgrößen wie Anita Ekberg, Marcello Mastroianni oder Pier Paolo Pasolini bis zu seiner Dankesrede für den Ehrenoscar, als er seine Frau Giulietta Masina bat, mit dem Weinen aufzuhören, obwohl er ihre Tränen von der Bühne aus nicht sehen konnte. Fellini spricht über Neorealismus und Katholizismus, Psychoanalyse und Fieber am Set - und über Filmangebote aus dem arabischen Raum: »Vielleicht wollten die, dass ich einen Film mache über die religiösen und mystischen Gefühle, die Erdöl hervorruft.« Dass der Journalist Costanzo Costantini, der Fellini über dreißig Jahre immer wieder interviewt hat, längst ein Freund geworden war, merkt man dem entspannten Charakter der Gespräche an, die das intime Porträt eines der großen Filmemacher des 20. Jahrhunderts zeichnen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 260
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Federico Fellini
Ich bin Fellinesk
Gespräche mit Costanzo Costantini
Aus dem Italienischen, Französischen und Englischen übersetzt und herausgegeben von Thomas Bodmer
Kampa
»Ich habe, seit ich groß bin, immer davon geträumt, es zu einem Adjektiv zu bringen. ›Fellinesk‹ nennen mich die Amerikaner also. Wie schmeichelhaft!«
Federico Fellini,
Corriere della Sera, 30. März 1993
Editorische Notiz
Von den in diesem Band enthaltenen Gesprächen gibt es verschiedene Fassungen. Die erste erschien 1995 auf Französisch unter dem Titel Conversations avec Federico Fellini bei Editions Denoël. Im selben Jahr erschien auf Englisch Fellini on Fellini bei Faber & Faber. 1996 folgte auf Italienisch Fellini: Raccontando di me bei Editori Riuniti.
Die vorliegende deutschsprachige Ausgabe ist eine Art Frankenstein-Version, die Elemente aller drei Ausgaben kombiniert und Passagen weglässt, die nur für italienische Leserinnen und Leser von Belang sind. Bei den Interviews wird unter dem Titel jeweils angegeben, wann sie entstanden sind. Für die übrigen Texte ist anzunehmen, dass sie aus der Zeit zwischen 1993 und 1995 stammen.
Die Anmerkungen betreffen Dinge, die man nicht mit Leichtigkeit im Internet finden kann.
T.B.
Vorwort
Federico Fellini begegnete ich zum ersten Mal in den Fünfzigerjahren. Ich interviewte ihn für die römische Tageszeitung Il Messaggero, deren Redaktion in der Via di Tritone lag. Ihr damaliger Chefredakteur war Vincenzo Spasiano, ein Neapolitaner, der als Magier des Journalismus galt. Er harrte bis in die frühen Morgenstunden im Büro aus und ging nur ab und zu auf einen Kaffee in die Nachtbar Settebello am Largo Tritone. In diesem Lokal, wo die Nacht alle möglichen Gestalten anspülte, lernte er den Regisseur aus Rimini kennen, und die beiden waren einander sofort sympathisch. Als ehemaliger Reporter mochte Fellini Zeitungen sehr und begleitete Spasiano deshalb gern in die Redaktion, wo er sich am liebsten in der Setzerei oder in den unterirdischen Räumen mit den Druckmaschinen aufhielt. So kannte man ihn bei der Zeitung, und auch wir beide verstanden uns von unserer ersten Begegnung an gut.
Ab Mitte der Fünfzigerjahre interviewte ich Federico jährlich zweimal oder öfter, meist wenn er einen Film anfing sowie nach Abschluss der Dreharbeiten. Wir trafen uns mal hier, mal dort: am Set in der Cinecittà, in seinen Büros in der Via della Croce, der Via Sistina und am Corso d’Italia; in Restaurants, in seinen Häusern in Rom oder seiner Villa in Fregene, dem nahe Rom gelegenen Badeort, wo er 1951 seinen ersten Film Lo sceicco bianco (dt. Die bittere Liebe oder Der weiße Scheich) gedreht hatte. Wir trafen uns aber auch sonst, unabhängig von der Arbeit.
Im April 1975, gleich nachdem bekannt geworden war, dass er den Oscar für Amarcord (dt. Amarcord, 1973) erhalten hatte, rief ich ihn an und bat ihn um ein Interview.
»Was soll ich dir schon sagen können? Ich habe nichts zu sagen, ich weiß nicht, was sagen, das musst du mir glauben, ehrlich.«
»Ich bitte dich, Federico.«
»Das ist der vierte Oscar, den ich unverdienterweise bekommen habe, ich kann doch nicht immer das Gleiche wiederholen.«
»Mir reichen zehn Minuten, auch fünf.«
»Dann komm halt morgen früh um neun in die Via Sistina. Aber ich sage dir noch einmal: Ich habe nichts zu sagen.«
Kurz vor neun war ich in seinem Büro.
»Tut mir leid, dass du umsonst gekommen bist«, sagte er, drückte meine Hand und umarmte mich.
Nach kurzem Schweigen fügte er hinzu:
»Ich weiß wirklich nicht, was ich dir sagen soll.«
Nach einem weiteren kurzen Schweigen fläzte er sich auf das Sofa und wies auf einen daneben stehenden Stuhl.
Dann redete er ohne Punkt und Komma bis um 13:30 Uhr.
Plötzlich fiel ihm ein, dass er zum Essen verabredet und bereits verspätet war. Er stand auf und sagte: »Entschuldige, aber ich muss weg. Es tut mir leid, dass ich jetzt gehen muss. Mit dir fühle ich mich so wohl. Du gehörst zu den wenigen Menschen, mit denen man ein echtes Gespräch haben, Ideen austauschen, kommunizieren kann.«
Ich hatte während der ganzen Zeit nur sechs Wörter gesagt: »Entschuldige, aber ich muss mal kurz.« Ohne sich vom Fleck zu rühren, hatte er auf den gewünschten Ort gezeigt, und nach meiner Rückkehr redete er weiter.
Es war faszinierend, ihm zuzuhören: Außer ihm konnte vielleicht nur Jorge Luis Borges beim Reden so ungewohnte, leuchtende und verführerische Horizonte eröffnen. Auch Roberto Rossellini, der einzige Cineast, dem Fellini den Titel »Maestro« zugestand, konnte außerordentlich gut reden. Aber der Schöpfer von Roma, città aperta (dt. Rom, offene Stadt, 1945) und von Paisà (1946), Filmen, an denen Fellini als Co-Drehbuchautor und Regieassistent mitgewirkt hatte, sprach außer über seine Abenteuer und Missgeschicke auch über andere Menschen, wohingegen sein Schüler nur von sich redete, von seinem Innenleben und von dem berückenden imaginären Kosmos, dessen absoluter Herrscher er war.
»Er lügt auch dann, wenn er die Wahrheit sagt«, hieß es über ihn. Und er selbst sagte: »Viele sagen, ich sei ein Lügner, aber die anderen lügen auch. Die größten Lügen über mich habe ich von anderen gehört. Ich könnte sie entlarven, aber da ich ein Lügner bin, würde mir niemand glauben.« Er kultivierte das Lügen im Sinne von Oscar Wilde, der es als Ausdruck von Phantasie, Erfindungsreichtum und künstlerischer Schaffenskraft betrachtete.
Die australische Essayistin Germaine Greer schrieb, Fellini sei der italienischste aller Cineasten, wenn nicht gar der italienischste aller Italiener. Er vereinte in sich alle unsere Widersprüche: offen und verschlossen, extravertiert und introvertiert, ausufernd und zurückgezogen; mehrdeutig, ausweichend, ungreifbar. Je öfter man ihn sah, desto weniger kannte man ihn. Je mehr man mit ihm zu tun hatte, desto weniger verstand man ihn. Je näher man ihm kam, desto weniger konnte man ihn festnageln. Der Eindruck, den er auf einen machte, veränderte sich ständig, wie bei den verschiedenen Flächen eines Prismas. Hatte man das Gefühl, einen festen Punkt erreicht zu haben, geriet alles wieder in Bewegung, wurde nebulös, und man musste von vorn anfangen. Eine Sisyphusarbeit.
Seine Stimme war sanft und schmeichlerisch; um die Aufdringlichen abzuwehren, konnte sie leicht und fein werden wie die einer abgeschieden lebenden Nonne, eines Beichtvaters oder Psychoanalytikers; sie konnte ebenso gut den Ton eines Therapeuten wie den eines Patienten annehmen, er umgarnte seine Gesprächspartner mit der Sprache eines Magiers, konnte so Frauen wie Männer, Freunde wie Feinde, Produzenten wie Financiers verführen und verwirren, und all dies mit dem Ziel, seine Spuren zu verwischen.
Er war immer derjenige, der ein Gespräch bestimmte, auch wenn er zerstreut und geistesabwesend zu sein schien, verzagt, lustlos, nervös, verstimmt oder in seinen Hirngespinsten verloren: Er führte dich, wohin er wollte, auf verschlungene Wege, in undenkbare Diskurse und verblüffende Abschweifungen. Doch immer nur an den Rand seines Ichs, nie ins Zentrum seines Universums, ins Innerste des Labyrinths.
Von 1990 an wurde meine Beziehung zu Federico Fellini viel enger als zuvor. Ich wurde sein ständiger Begleiter, offiziell und halboffiziell, sein »persönlicher Reporter«. Er war der einzige Mensch der internationalen Szene, dem gegenüber ich die kritische Haltung, die für das Metier des Journalisten unabdingbar ist, sozusagen aufgab.
Mitte Oktober 1990 begleitete ich ihn nach Tokio, wo er den Praemium Imperiale entgegennehmen sollte, das asiatische Gegenstück zum Nobelpreis. »Ich würde lieber zwanzig Millionen im Canova annehmen als hundertfünfzig in Tokio«, sagte er vor der Reise und bestätigte einmal mehr seinen Widerwillen dagegen, Rom zu verlassen. (Canova ist das berühmte römische Café an der Piazza del Popolo, wo er gern Freunde und Bekannte traf.) Dies sollte die zweitlängste Reise sein, die er je unternommen hatte. Ein paar Jahre zuvor war er nach Tulum in Mexiko gereist mit der Absicht, einen Film auf Basis der Berichte von Carlos Castaneda zu drehen. Aus dem Projekt wurde nichts. Doch auf die Reise nach Tokio ließ er sich ohne größere Umstände ein.
»Es war die reinste Odyssee«, sagte er nach der Ankunft, während Fotoreporter und Fernsehkameras ihn und Giulietta Masina ins Visier nahmen. Doch gleich darauf, nach einer kurzen Ruhepause, zeigte er sich in Hochform. »Es tut mir leid, dass ich während des Flugs keine kleine Rede vorbereiten konnte, aber die Reise war dafür schlicht zu kurz«, sagte er in einem der Salons des Okura, des luxuriösesten Hotels von Tokio, zur Eröffnung der Pressekonferenz vor der Preisverleihung. Dann unterhielt er die Anwesenden mit allerlei Geschichten sowie seiner Lieblingstheorie über die Entstehung von Kunst: »Der Praemium Imperiale«, sagte er, »führt die glorreiche Tradition der katholischen Kirche fort, die begriffen hatte, dass ein Künstler ein ewig Pubertierender ist, den man mit Schmeicheleien und Drohungen dazu bringen muss, unsterbliche Meisterwerke zu schaffen.« Auf Fragen von Journalisten gestand er, das zeitgenössische japanische Kino nicht zu kennen, dasjenige seines Freundes Akira Kurosawa hingegen sehr gut. Er zitierte eine Sequenz aus Rashomon (1950) als Beleg dafür, wie der große japanische Regisseur über die scheinbare Wirklichkeit hinausgehe, um zu tieferen und spirituelleren Wirklichkeiten vorzustoßen und dem Kino so sein zugleich abenteuerliches und sakrales, visionäres und geheimnisvolles Wesen zurückzugeben.
Am nächsten Tag plauderten Federico Fellini und Giulietta Masina mit dem Publikum, das zu einer Vorführung von La voce della luna (dt. Die Stimme des Mondes, 1990) gekommen war, und lieferten sich ein unterhaltsames ehelich-professionelles Scharmützel.
»Giulietta ist meine ideale Darstellerin, meine Inspiration, eine geradezu magische Präsenz in meinem Werk«, sagte der Regisseur.
»Er lügt: Ich habe mich immer davor gehütet, einen Fuß an den Set eines Films zu setzen, an dem ich nicht mitwirkte, denn meine Anwesenheit hätte ihm nicht behagt«, entgegnete die Schauspielerin.
»Giulietta ist meine Beatrice1«, sagte der Regisseur und lächelte seiner Gattin süß und heuchlerisch zu.
»In Tat und Wahrheit haben wir die Aufgaben aufgeteilt«, sagte die Schauspielerin, »am Set ist Federico der uneingeschränkte Herrscher, zu Hause herrsche ich. Doch für meine Herrschaft im Haushalt hat Federico mich einen hohen Preis zahlen lassen. Ich habe mir nie gefallen: Ich bin winzig klein, habe ein rundes Gesicht und widerspenstiges Haar. Als er La strada (dt. Das Lied der Straße, 1953) vorbereitete, träumte ich davon, dass er mich wie die Garbo oder Katherine Hepburn aussehen lassen würde. Stattdessen hat er mein Gesicht noch runder gemacht, mein Haar noch widerspenstiger, und er hat mich noch winziger gemacht. Er hat mich zu einem Punk avant la lettre gemacht.«
»Ich habe dich verführerischer als Jean Harlow und Marilyn Monroe gemacht«, widersprach der Regisseur.
Die Schauspielerin erwiderte: »Wie Sie wissen, mag Federico monumentale, üppige, kurvenreiche Frauen. Aber gerade weil ich so klein und dünn bin, ist es mir gelungen, mich unter diese lebenden Statuen zu schmuggeln, verkleidet als Gelsomina, Cabiria, Giulietta und Ginger, und mich so genüsslich an ihm zu rächen.«
Das Publikum brach in tosenden Applaus aus, Fellini wechselte das Thema und nutzte die Gelegenheit, um Kurosawa die Reverenz zu erweisen. Er erzählte, er habe am Vorabend im Sony-Haus noch einmal den Film Konna Yume Wo Mita (dt. Akira Kurosawas Träume, 1990) gesehen und sei erneut überwältigt gewesen von der Sequenz, in der Van Gogh, dargestellt von Martin Scorsese, in eines seiner Gemälde hineingehe. Er fügte hinzu: »Das ist eine unvergessliche Sequenz, und wer weiß, vielleicht werde auch ich eines Tages das High-Definition-Verfahren verwenden. Früher oder später werde ich nicht drum herumkommen, allein schon um den Präsidenten von Sony, Akio Morita, loszuwerden, der mir hier in Tokio Tag und Nacht auf den Fersen ist und mich, wenn ich in Rom bin, mit Briefen und Telegrammen bombardiert.«
Bevor sie nach Kyoto weiterreisten, wurden Federico Fellini und Giulietta Masina von Kurosawa ins Ten Masa eingeladen, das im Stadtteil Kanda gelegene Restaurant, wo Kaiser Hirohito mittags zu speisen pflegte. Fellini erzählte danach: »Hirohito, dieser Gott auf Erden, geheimnisvoll und undurchschaubar, aß heimlich im Ten Masa, weil er heißen, knusprigen Fisch mochte. Im Kaiserpalast aber lag die Küche so weit entfernt vom Speisesaal, dass der Fisch, wenn er auf den Teller kam, immer schon kalt war. So haben auch die Götter ihre Achillesfersen. Dante hätte Hirohito in den Höllenkreis der Gefräßigen geschickt.«
Im März 1993 begleitete ich Fellini und Masina nach Los Angeles. Vom Beschluss der Academy of Arts and Sciences, ihm den Oscar für sein Lebenswerk zuzuerkennen, hatte er genau an seinem 73. Geburtstag erfahren, also am 20. Januar, und dieses Zusammentreffen machte ihn sehr glücklich. »Es wäre eine nicht entschuldbare Unhöflichkeit, wenn ich auch diesmal nicht persönlich nach Hollywood reiste, um die sagenhafte Statuette in Empfang zu nehmen«, sagte er. Und obschon er an einer Spondylarthrose der Halswirbelsäule litt und deswegen immer wieder Schwindelanfälle hatte, machte er sich guten Mutes auch auf diese lange Reise.
Wir bestiegen das Flugzeug am 26. März um 14 Uhr. Begleitet wurde Fellini neben Giulietta Masina außerdem von Marcello Mastroianni, dem Maler Rinaldo Geleng und dessen Frau, seiner Sekretärin Fiammetta Profili und dem Leiter seiner Presseabteilung, Mario Longardi (im selben Flugzeug befand sich auch Gillo Pontecorvo, der als Leiter des Filmfestivals von Venedig ebenfalls zur Oscarverleihung eingeladen worden war). Ein kleiner Künstlerfamilien-Clan, der auf dem Flugplatz wie im Flugzeug mit großer Herzlichkeit begrüßt wurde. An Bord vermied es Fellini, aufzustehen, aus Angst vor seinen Schwindelanfällen; er schrieb, zeichnete, witzelte und schwelgte mit Masina und Mastroianni in Erinnerungen. »Mein lieber Federico, auch ich leide an Schwindeln: Morgens beim Aufstehen habe ich das Gefühl, auf Treibsand zu gehen oder einem Teppich aus Eiern«, sagte ihm der Schauspieler.
»In meinem Gesundheitszustand ist es eine echte Herausforderung gewesen, mich auf diese endlose Reise einzulassen: Mir dreht sich der Kopf, ich schwanke«, sagte der Regisseur mit leiser Stimme, nachdem er am 27. März um 17:30 Uhr Ortszeit seinen Fuß auf festen Boden gesetzt hatte, bevor Kameraleute und Reporter über ihn herfielen und die anwesenden Zuschauer ihn mit einem Riesenapplaus empfingen. »Ich komme wie Groucho Marx daher, aber noch ist der Zeitpunkt meines Ruhestands nicht gekommen.« Und dann fügte er hinzu: »Es hat auch mit Autosuggestion zu tun: Je mehr ich an die Spondylarthrose meiner Halswirbelsäule denke, desto schlechter fühle ich mich – so kommt es mir jedenfalls vor. Aber jetzt bin ich erst einmal glücklich, hier zu sein. Ich hätte es auf keinen Fall versäumen dürfen, diesen Preis der Preise persönlich abzuholen, eine so bedeutende Anerkennung meines Gesamtwerks, um nicht zu sagen meines ganzen Lebens.«
Während der drei Tage, die Fellini in Los Angeles verbrachte, wurde das Beverly Hilton Hotel, in dem er wohnte, zu einer wahren Pilgerstätte: Sämtliche Regisseure Hollywoods wollten ihn treffen, mit ihm reden, Komplimente austauschen, ihm ein langes Leben wünschen und eine baldige Rückkehr an einen Set. Doch viele sahen ihn nur am Nachmittag des 29. März im Dorothy Chandler Pavilion, wo die Oscar-Verleihung stattfand.
Die dortige Ankunft von Fellini, Masina und Mastroianni ist unvergesslich: Auf beiden Seiten einer Avenue, auf der ein roter Teppich ausgerollt war, und auf zwei riesigen Tribünen linkerhand drängten sich über zweitausend Fotografen und Kameraleute. »Federico!«, »Giulietta!«, »Marcello!«, riefen sie den Vorbeigehenden zu, um deren Blick in Richtung ihrer Objektive zu lenken, und hantierten mit ihren Kameras, als seien es Kriegsgeräte. Der Kopf schwirrte einem vor lauter Getümmel, es war ein schwindelerregendes Chaos, ein gigantisches Babylon mit Autos, Lastwagen, schwenkbaren Scheinwerfern, Blitzlichtern, einer Menge in psychomotorischem Aufruhr, Herren in Smokings, Damen in langen Kleidern, während am grau dräuenden Himmel Hubschrauber in geringer Höhe schwebten und Anhänger einer Sekte, von puritanischem Furor gepackt, verkündeten, das Kino sei ein Machwerk des Teufels und müsse zerstört werden. Die Szene zog sich zwanzig Minuten lang hin, bis die illustren Gäste den Saal des Dorothy Chandler Pavilion erreichten. Kein anderer Regisseur oder Autor, keine Schauspielerin oder Diva, kein Schauspieler oder Star hatte einen vergleichbar verrückten Tumult ausgelöst. Es war wie eine Art poetische Vergeltung für das, was der Regisseur Anita Ekberg in La dolce vita (dt. Das süße Leben, 1959) zugemutet hatte – aber ins Maßlose ausgeweitet und jegliche filmische Phantasie übertreffend.
Der schönste und berührendste Moment der ganzen Zeremonie kam, als Fellini von der Bühne des Dorothy Chandler Pavilion zu Masina, die in der siebten Reihe saß, sagte: »Hör auf zu weinen«, und die Scheinwerfer das tränenüberströmte Gesicht der Schauspielerin beleuchteten: das Gesicht von Gelsomina, der unvergesslichen Figur aus La strada, dem Film, für den der italienische Filmemacher im weit zurückliegenden Jahr 1957 seinen ersten Oscar erhalten hatte.
Costanzo Costantini
Rimini, Kindheit und Jugend
1990
Rimini, was löst dieses Wort bei dir aus?
Die Erinnerung an das Pfeifen eines Zugs, des Zugs, der abends gegen sieben meinen Vater heimbrachte. Ich bereue es etwas, dass ich eingewilligt habe, über meine Heimat zu sprechen. Ich habe das Gefühl, nichts zu sagen zu haben. Wie macht man das, von Dingen berichten, die es wirklich gibt? Mir ist wohler, wenn ich erfinde. Das reale Rimini, wo ich meine Kindheit und Jugend verbracht habe, vermischt sich mit dem erfundenen, neu geschaffenen, das ich für meine Filme in der Cinecittà rekonstruiert habe oder aber im alten Viterbo oder in Ostia. Die beiden Erinnerungen überlagern sich, und ich kann sie nicht mehr unterscheiden.
»Wie macht man das, von Dingen berichten, die es wirklich gibt? Mir ist wohler, wenn ich erfinde.«
Hast du an Rimini keine realen, objektiven Erinnerungen?
Im Sommer in der blendend hellen Sonne halbnackte Körper, die Richtung Meer laufen, in einem tönenden Gewirr von Stimmen, Musik und dem metallischen Schnarren eines Lautsprechers, der den Namen eines Mädchens wiederholt, das seinen Eltern abhanden gekommen ist. Im Winter der Nebel, der alles verschwinden lässt. Was für ein aufregendes Erlebnis: Du wirst zum Unsichtbaren, man sieht dich nicht, und somit bist du gar nicht da.
Bis in welches Alter kannst du dich zurückerinnern?
Bis drei oder vier. Ich erinnere mich an die Nonnen von San Vincenzo, bei denen ich in den Kindergarten ging. Wie könnte ich sie vergessen, mit ihren gigantischen Hauben? Ich erinnere mich auch an Giovannini, den Grundschullehrer. Bei dem mussten wir die Faschistenhymne Giovinezza, giovinezza, primavera di bellezza singen.
Kannst du dich erinnern, wo du ins Gymnasium gegangen bist?
Nicht an die Straßennamen, aber an das Monument für die Gefallenen neben dem Gymnasium: Eine muskulöse Männerfigur aus Bronze reckte einen Dolch gen Himmel, auf ihrer einen Schulter lag etwas unbequem eine nackte Frau: der Ruhm. Wenn es regnete, lugten wir unter unseren Regenschirmen hervor und betrachteten diesen schönen großen Hintern, der dank des Wassers glänzte, zu pulsieren, lebendig zu sein schien. Und dann die Treppen des dunklen Gebäudes, einer Art heruntergekommenen Wolkenkratzers, die wir emporrannten und dabei laut schrien, als seien wir malaysische Tiger2, bis wir in den Hintern getreten wurden vom Rektor, einem Zwei-Meter-Mann, knochig, gebeugt, mit einem großen roten Bart: eine Mischung aus Mangiafuoco3 und Zeus, der uns am liebsten wie Mistkäfer auf den Treppenstufen zertreten hätte.
Welche Fächer mochtest du am liebsten?
Schon in der Grundschule hatte ich zu kritzeln begonnen, angeregt von den Comics in der Kinderzeitschrift Corriere dei Piccoli und später den Romanen von Salgari. Zeichnen und Kunstgeschichte mochte ich sehr. Ich machte Skizzen, Karikaturen, Witzzeichnungen. 1936, also mit 16, zeichnete ich Karikaturen von Balilla4-Jungen in ihrem Ferienlager. Die wurden ein Jahr später in einer Balilla-Zeitschrift veröffentlicht. Das sind meine Anfänge als Zeichner und Karikaturist. Im selben Jahr eröffnete ich zusammen mit dem Maler Demos Bonini beim Dom eine Künstlerwerkstatt, in der wir Karikaturen auf Bestellung anfertigten. Ich machte die Zeichnungen und signierte mit »Fe«, Demos malte sie aus und signierte mit »Bo«. Wir ließen sogar einen Stempel mit dem Schriftzug »Febo« anfertigen. Manchmal signierte ich auch mit »Fellas«, wer weiß, warum.
Wer waren deine Vorbilder unter den Zeichnern und Karikaturisten?
Der größte Karikaturist war für mich Giuseppe Zanini, genannt Nino Za. Er lebte in Berlin und zeichnete dort für die Satirezeitschrift Lustige Blätter. Die bekam man auch in Rimini, und die haben wir uns immer am Bahnhofkiosk gekauft. Später zog er nach Rimini, wo er auf der Terrasse des Grandhotels Karikaturen zeichnete. Er war für mich eine legendäre Figur. Er trug weiße Hosen, Segeljacken und weiße Handschuhe. Er empfing nur nach Vereinbarung und zeigte nie, was er am Zeichnen war. Die Karikatur übergab er erst, wenn er einen entsprechenden Scheck in der Hand hatte. Er war eine Art internationaler Playboy der Karikaturszene. Leider habe ich ihn in Rimini nicht persönlich kennengelernt, sondern erst später in Rom, wo wir dicke Freunde wurden.
»Von klein auf haben mich Maler fasziniert, und in den erwähnten Jahren habe ich ernsthaft daran gedacht, Maler zu werden. Ich hatte nicht vor, Drehbuchautor oder Filmregisseur zu werden.«
Hast du in jenen Jahren mit dem Gedanken gespielt, Maler zu werden?
Von klein auf haben mich Maler fasziniert, und in den erwähnten Jahren habe ich ernsthaft daran gedacht, Maler zu werden. Ich hatte nicht vor, Drehbuchautor oder Filmregisseur zu werden. Es ist dann anders gekommen, aber ich habe nie aufgehört, zu zeichnen, Karikaturen, Witzzeichnungen, Skizzen aller Art zu machen. 1937 oder 1938 bestellte der Besitzer des Kinos Fulgor bei mir eine Reihe von Karikaturen damaliger Stars, vor allem amerikanischer, zu Werbezwecken.
In welchem Alter hast du die ersten Flirts gehabt?
Die erste erotische Erfahrung habe ich mit sieben oder acht Jahren gehabt. Wir hatten damals ein Dienstmädchen namens Marcella. Sie war ein stattliches Weibsstück und hatte etwas Animalisches an sich. Eines Tages ging die ganze Familie – Vater, Mutter, mein Bruder Riccardo, der ein Jahr jünger war als ich, und meine Schwester Maddalena, die 1929 geboren war – weg, nur ich blieb zu Hause, weil ich Fieber hatte. Meine Mutter befahl Marcella, bei mir von Zeit zu Zeit das Fieber zu messen. Ich war eingeschlafen, als Marcella mein Nachthemd hochhob, meinen Pimmel in die Hand nahm und ihn sich in den Mund steckte. Dann ging sie in die Küche, packte eine riesige Aubergine, steckte sie sich zwischen die Schenkel und rieb sie hin und her. Ich habe seither nie mehr Auberginen essen wollen.
Ich hatte eigentlich von Flirts geredet; in welchem Alter hast du den ersten Flirt gehabt?
Im Gymnasium, aber das war ein Flirt aus der Ferne, ein rein visueller Flirt. Ich hatte damals dieselben Schulkameraden, die ich schon in der Grundschule, ja zum Teil schon im Kindergarten gehabt hatte: Luigi Benzi (der »Titta« aus Amarcord), Luigi Dolci, Mario Montinari. Luigi Benzi ist heute ein angesehener Strafrechtler, doch als ich drei Jahre alt war und wir beide bei der Mole am Strand im Wasser saßen, versuchte er, mich mit einer kleinen Holzschaufel zu erschlagen. Aber zurück zum Gymnasium: Damals habe ich mich in die »Elf-Uhr-Frau« verliebt. Immer um diese Zeit gingen die Fensterläden des kleinen Balkons gegenüber der Schule auf, und eine wunderschöne Frau im Morgenmantel wurde sichtbar, die sich mit der Katze, den Kanarienvögeln im Käfig und den Blumen in der Vase unterhielt. Wenn sie sich bückte, um den Blumen frisches Wasser zu geben, öffnete sich der Morgenmantel etwas und man sah ihr ins Dekolleté. Von halb neun an lauerten wir auf diesen Augenblick. Der Mathematiklehrer, der, die Hände auf dem Rücken, ständig zwischen den Bänken auf und ab ging und so mehrere Kilometer pro Stunde zurücklegte, bemerkte manchmal unsere Blicke, ging zum Fenster und blickte hinaus, wobei er ständig auf den Zehenspitzen auf und ab wippte.
Aber welches war deine echte erste Liebe?
Bianchina.
Diese Bianchina ist zu einer mythischen Figur geworden wie die Silvia von Leopardi5.
Das war ein Mädchen aus Fleisch und Blut, ein schönes Mädchen. Sie hieß mit vollem Namen Bianchina Soriani. Meine Liebe für sie drückte ich in Zeichnungen aus. So stellte ich sie und mich dar, wie wir Arm in Arm durch Alleen gingen, wie die Liebespaare des Zeichners Peynet, oder wie wir von der Mole aus zum fernen Horizont Richtung Jugoslawien blickten. In den Siebzigerjahren hat Bianchina ihre Geschichte dann im Roman Una vita in più erzählt.
Hast du Bianchina auch Gedichte geschrieben?
Nein. Ich kann mich weder rühmen, noch muss ich mich schämen, je Liebesgedichte geschrieben zu haben. Sonst alles Mögliche: Lieder, kleine Gedichte, Abzählreime für Kinder, Parodien in Versen, Couplets für Soubretten in Varietés, aber nie hat mich die klassische Liebeslyrik, der dolce stil novo gereizt.
Kannst du dich an deinen ersten Kinobesuch erinnern?
Das war in Rimini im Kino Fulgor: Maciste all’inferno (1925). Ich war klein, mein Vater trug mich auf dem Arm. Der Saal war rammelvoll und voller Rauch. Ich war völlig überwältigt. Ins Kino zu gehen hatte damals etwas Rituelles, wie in die Kirche zu gehen, wobei die Kirche weder rammelvoll noch verraucht war. Auf der Kanzel stand der Pfarrer, schimpfte mit Donnerstimme über die Sünder, beschwor das Feuer der Hölle und kündigte Strafen an, welche noch am selben Tag die Sünder ereilen würden. Im Kino war Mae West, die auch dies und jenes ankündigte, was allerdings etwas weniger bedrohlich klang. Ich habe immer wieder versucht, Mae West in einem meiner Filme unterzubringen, aber das ist mir so wenig gelungen wie eine Neuauflage von Maciste all’inferno.
Seid ihr ins Theater gegangen?
Selten, wirklich äußerst selten. In Rimini ins Theater zu gehen bedeutete, etwas anzuschauen, das man nicht kapierte, weil man nicht gebildet war, weil man die Schule schwänzte, ein Lausejunge, ein unverbesserlicher Frechdachs war. Ich lernte für die Schule wenig bis nichts. Die wenigen Male, die ich doch ins Theater ging, wurde ich von der Lehrerin gepiesackt. Alle drei Minuten hieß es: »Wenn du nicht stillhältst, schmeiß ich dich raus!« Und so war es dann auch, allerdings zu meiner großen Freude, denn mich interessierte viel mehr, was draußen passierte. Was auf der Bühne stattfand, hat mich nie sonderlich bewegt. Fasziniert hat mich aber das ganze Drumherum, der magische Aspekt des Theaters: die Atmosphäre, die Gärten, ein Zug, der eine Frau enthauptet wie in einem Grand Guignol, der französische König Ludwig XV., der mit einem Bologneser Akzent sprach – aber was da verhandelt wurde, verstand ich nicht, das Geschehen auf der Bühne hat mich nicht gepackt. Mir hat nur der zirkushafte Aspekt des Ganzen gefallen. Obschon das, was ich mache, ja eine Art Theater ist und ich mich im Theater so fühle wie ein Junge, der Priester werden will, sich in der Kirche fühlt, bin ich kaum ins Theater gegangen und gehe auch heute nicht. Ich fühle mich wohl hinter den Kulissen und auf der Bühne, aber im Zuschauerraum langweile ich mich zu Tode. Da war und ist mir die Oper lieber.
»Ich fühle mich wohl hinter den Kulissen und auf der Bühne, aber im Zuschauerraum langweile ich mich zu Tode.«
Wann bist du zum ersten Mal in einer Oper gewesen?
Mit sieben oder acht Jahren. Aber beinahe wäre meine erste Begegnung mit der Oper in eine Tragödie ausgeartet. Mein Vater war befreundet mit einem Polizeikommissar namens Chianese, der dem Stummfilmkomiker Ben Turpin glich. Dieser Kommissar spielte gern den Harten, er hatte den Ruf, selbst den abgebrühtesten Verbrechern Angst einzujagen, doch tatsächlich war er eine Seele von Mensch, der die Musik über alles liebte, und ganz besonders die Oper. Er hatte im Stadttheater eine Loge und überließ sie manchmal meinem Vater. Dieser nahm mich einmal mit zu einer Aufführung von Zandonais I cavalieri di Ekebú (dt. Die Ritter von Ekebú). Die Loge des Kommissars befand sich direkt über dem Orchestergraben, und man konnte von ihr aus sehen, was hinter den Kulissen geschah: ein Getümmel von Leuten, die alles Mögliche taten, Riesenweiber, die mit riesigen Gläsern voller bunter Flüssigkeiten gurgelten, Sänger, die herumschrien. Das Stück begann in einer furchterregenden Nibelungenhöhle, wo irgendeine bedrohliche Gottheit wie Vulcanus oder Wotan hauste. Es gab eine Schmiede, eine Waffenwerkstatt mit einem riesenhaften Gong. Der Chor der dämonischen Schmiede sagte: »Cali il maglio / tuoni giù / cavaglieri di Ekebú« (»Lass sausen den Hammer / mit großem Getöse / Ritter von Ekebú«). Dann sauste ein Riesenzylinder hinab, die Dämonen stießen wilde Schreie aus, und der Gong dröhnte entsetzlich. Ich war ein bisschen wie Hamlet gekleidet, in schwarzen Samt mit einem weißen Spitzenkragen. Plötzlich bemerkte mein Vater, dass der Kragen blutig war. Vor lauter Getöse war eines meiner Trommelfelle geplatzt und Blut auf meinen Spitzenkragen geflossen. Ich wurde sogleich ins Krankenhaus gebracht, und es ist ein Wunder, dass ich auf dem Ohr nicht taub wurde.
Hast du vielleicht deswegen Musik nie sonderlich gemocht und dich immer geweigert, eine Oper zu inszenieren?
Das weiß ich nicht, glaube ich aber nicht. Die Oper hat für mich wie gesagt immer etwas Faszinierendes gehabt, vor allem Aida, zu der ich eine besonders enge Beziehung habe. 1938 oder 1939 wirkte ich nämlich als Statist in einer Aida-Aufführung in den Caracalla-Thermen mit. Mein Freund, der Maler Rinaldo Geleng, war mit von der Partie. Wir waren äthiopische Krieger aus dem Gefolge Amonasros, des Vaters von Aida. Pro Abend erhielten wir fünf Lire. Unser größtes Problem war, zu vermeiden, dass unsere Tennisschuhe beschmutzt wurden durch die riesigen, weichen, nach Spinat riechenden Dungkugeln, welche die Elefanten überall auf der Bühne fallen ließen. Aber während die Oper für mich eine gewisse Attraktivität hat, ist das beim Theater nicht der Fall. Es gelingt mir einfach nicht, aufmerksam zu bleiben.
Komisch bei einem doch so aufmerksamen Regisseur wie dir.
Beim Theater gefällt mir immer der erste Teil: das Foyer, die Platzanweiserinnen, die Begegnungen mit Freunden, die Logen, das Schrillen der Glocke, das Dämpfen der Lichter, dann die Dunkelheit, die Stille, das Räuspern und Husten, der Vorhang, der aufgeht. Doch sobald jemand auf die Bühne kommt, dort agiert und redet, überkommt mich das Bedürfnis zu flüchten. Dennoch gefällt mir, was im Zuschauerraum geschieht: dieses Gefühl einer gedrillten Mannschaft, einer Schulklasse, die gezwungen ist, stillzuhalten, jedes Niesen zu unterdrücken. Tatsächlich sind wir während der Schulzeit eingeschüchtert, terrorisiert worden. Die Lektüre von Aischylos, Sophokles und Euripides auf Griechisch hat unsere Seelen heillos geknechtet, niedergeknüppelt.
Hat es dich nie gereizt, Theater zu machen?
Doch, aber nicht als Regisseur, sondern eher als Animator eines Happenings, als Medium einer spiritistischen Sitzung, als Anführer eines Haufens von Komikern. Auch später, als ich mit fahrenden Truppen unterwegs war, haben mich nicht deren Auftritte interessiert, sondern die Eisenbahnfahrten, die Bahnhöfe, die Liebeleien mit Zimmermädchen, die Hotels.
1938 nach dem Abitur bist du nach Florenz gezogen, bevor du dich dann in Rom niedergelassen hast. Was für Bilder hast du aus Rimini mitgenommen, als du es verlassen hast?
Die üppigen Lippen der Frau des Bahnhofsvorstehers von Savignano, die mir den ersten Kuss meines Lebens gegeben hat.
Diese Lippen sind nicht wirklich ein Bild von Rimini.
Ich trug die Rocca Malatestiana mit mir, eine hässliche, gedrungene, bedrohlich wirkende Burg. Unter den Dächern, im Dunkel der Schießscharten, sah man oft Hände, die sich an den Gittern festklammerten, und hörte die Stimmen der Eingekerkerten heulen: »Hast du eine Zigarette für mich?« Die waren um die zwanzig Meter über uns, wir hätten vielleicht hochklettern können, aber wir hatten Angst, die würden uns packen und hineinzerren. Auf dem Platz unterhalb der Burg machten die Zirkusse Station, und wenn dann das Zelt aufgebaut wurde, verfolgten die Gefangenen das Schauspiel und riefen den Akrobaten und Reiterinnen alles Mögliche zu.
Geht I clowns (dt. Die Clowns, 1970) auf diese Erinnerungen zurück?
Ja, und eine solche Episode habe ich auch an den Anfang dieses kleinen Films gestellt. Aber von Rimini habe ich nicht nur in I vitelloni (dt. Die Müßiggänger, 1953), La strada, Amarcord und Roma (dt. Fellinis Roma, 1971) erzählt. Sondern auch in Filmen, die zu meiner Heimatstadt keinerlei Bezug haben, wie La dolce vita, Satyricon (dt. Fellinis Satyricon, 1969), Casanova (dt. Fellinis Casanova, 1976) und E la nave va (dt. Fellinis Schiff der Träume, 1983), nämlich insofern, als das Meer im Hintergrund da ist, als Urelement, als blauer Streifen, der den Himmel abschneidet und von wo Korsarenschiffe kommen können, die Türken, der Rex6, die amerikanischen Schlachtkreuzer, auf denen Ginger Rogers und Fred Astaire im Schatten der Kanonen tanzen.





























