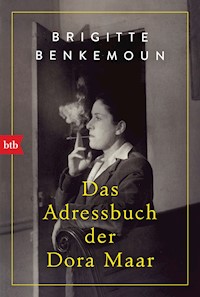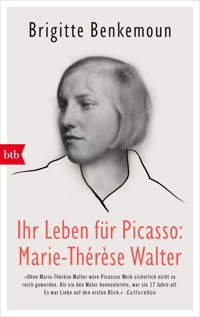
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Sie war die Lieblingsmuse Picassos – und doch bleibt ihr Leben bis heute ein Rätsel. Die bislang unbekannte Geschichte einer verzehrenden Leidenschaft, Verblendung und Verehrung.
Es ist ein Winterabend in Paris im Jahr 1926: Marie-Thérèse Walter ist 17 Jahre alt, als ihr Leben sich für immer ändert. Die junge blonde Frau mit dem klassischen Profil hat noch nie von diesem 45-jährigen Mann gehört, der ihr anbietet, für ihn Modell zu stehen. Dabei ist er bereits einer der berühmtesten Maler der Welt und verspricht ihr, dass sie »gemeinsam große Dinge erreichen« werden. In seinen Armen entdeckt sie die Amour fou. Zehn Jahre malt Picasso ihr Gesicht. Sie wird zum Inbegriff einer ganzen Schaffensperiode. Bilder, die zu den beeindruckendsten, zärtlichsten, fröhlichsten und erotischsten des Künstlers zählen. Trotzdem verbirgt Picasso die junge Geliebte vor der Welt. Erst nach der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter Maya kennen die engsten Freunde ihren Namen. Als Picasso die Fotografin Dora Maar trifft, wird er Marie-Thérèse bald überdrüssig. Doch sie kann sich dem Einfluss des Malers nie ganz entziehen, für den Rest seines Lebens schreibt sie ihm täglich Briefe. Vier Jahre nach dem Tod Picassos nimmt Marie-Thérèse Walter sich 1977 in Juan-les-Pins das Leben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 213
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Es ist ein Winterabend in Paris im Jahr 1926: Marie-Thérèse Walter ist 17 Jahre alt, als ihr Leben sich für immer ändert. Die junge blonde Frau mit dem klassischen Profil hat noch nie von diesem 45-jährigen Mann gehört, der sie bittet, für ihn Modell zu stehen. Dabei ist er bereits einer der berühmtesten Maler der Welt und verspricht ihr, dass sie »gemeinsam große Dinge erreichen« werden. In seinen Armen entdeckt sie die Amour fou. Zehn Jahre malt Picasso ihr Gesicht. Sie wird zum Inbegriff einer ganzen Schaffensperiode. Bilder, die zu den beeindruckendsten, zärtlichsten, fröhlichsten und erotischsten des Künstlers zählen. Trotzdem verbirgt Picasso die junge Geliebte vor der Welt. Erst nach der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter Maya kennen die engsten Freunde ihren Namen. Als Picasso die Fotografin Dora Maar trifft, wird er Marie-Thérèse bald überdrüssig.
Brigitte Benkemoun, geboren 1959 in Oran /Algerien, ist eine französische Schriftstellerin und Journalistin. Sie war lange Zeit Chefredakteurin eines großen französischen Radiosenders und arbeitet regelmäßig für das französische Fernsehen. Als Autorin beschäftigt sie sich mit dem Leben beeindruckender Frauen und Künstlerinnen. Bei btb ist von ihr bereits »Das Adressbuch der Dora Maar« erschienen. Brigitte Benkemoun lebt in Paris und in Arles.
Brigitte Benkemoun
Ihr Leben für Picasso:Marie-Thérèse Walter
Aus dem Französischenvon Alexandra Baisch
Die französische Originalausgabe erschien 2022 unter dem Titel»Sa vie pour Picasso: Marie-Thérèse Walter« bei Éditions Stock, Paris.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Erstveröffentlichung Dezember 2024
btb Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Copyright © der Originalausgabe 2022 Éditions Stock, Paris
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2024 btb Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH
Covergestaltung: semper smile, München
Covermotiv: Bridgeman Images / PVDE; © Shutterstock / abstract_art7
Satz und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-641-30194-1V001
www.btb-verlag.de
www.facebook.com/penguinbuecher
Für Dora Maar
»Aber nein, nicht unterworfen, ich war doch nett!«1
Marie-Thérèse Walter
Prolog
»Keine Frau verlässt einen Mann wie mich«2, hatte Picasso gesagt … Trifft dieses Diktum etwa auch auf mich zu?
Dabei hat meine Geschichte mit dem Maler so gar nichts von einer leidenschaftlichen Romanze. Ich komme mir eher vor wie ein angeheiratetes Familienmitglied, das sich im Kielwasser von Dora Maar widerrechtlich Zugang zu ihm verschafft hat. Nachdem ich monatelang mit dem Adressbuch seiner ehemaligen Gefährtin beschäftigt war3, wollte ich dieses Kapitel tatsächlich hinter mir lassen. Ich hatte schon angefangen, mich von ihm zu entfernen, und mich stattdessen wieder meinen alten Leidenschaften zugewandt, ganz so, wie man nach einer schönen Reise nach Hause zurückkehrt. Ich hatte sogar meinen Verleger davon überzeugt, ein weiteres, persönlicheres Buch herauszubringen.
Doch Picasso hat mich wieder eingeholt. Während einer Signierstunde in einer Pariser Buchhandlung legte mir eine Leserin nahe, mich mit einer anderen Gefährtin des Malers zu beschäftigen: Marie-Thérèse Walter. »Sie werden sehen«, sagte sie, »bei ihrer Geschichte gibt es Unstimmigkeiten.« Sie sah sich kurz um, wie um sich zu vergewissern, dass uns niemand zuhörte, dann begann sie flüsternd eine komplizierte Erzählung, in der es um widersprüchliche Daten und vergessene Schwestern ging. Ich lächelte, unterließ es jedoch, diese Unterhaltung zu sehr zu befeuern: Mittlerweile erkannte ich die etwas zu enthusiastischen Bewunderer im Picasso-Universum, die jeweils eine seiner Frauen verherrlichten und alle anderen als Usurpatorinnen erachteten. Zumindest musste man dieser Frau zugutehalten, sich für Marie-Thérèse entschieden zu haben, wozu nur die wenigsten neigten. »Sie können sich gern bei mir melden«, sagte sie und kritzelte mir ihre E-Mail-Adresse auf einen herumliegenden Prospekt. Aus Höflichkeit steckte ich ihn ein und dachte, ich würde das Ganze vergessen.
Doch gleich am nächsten Tag fing ich an, Nachforschungen darüber anzustellen, inwiefern es im Leben von Marie-Thérèse Unstimmigkeiten gegeben hatte. Die Aussicht auf ein Rätsel weckte unweigerlich meine Neugier, und zugleich verstärkte sie das eigenartige Gefühl, das mich überkommen hatte, als ich bei meinen Recherchen zu Dora Maar über sie gestolpert war.
Ich erinnerte mich, gelesen zu haben, dass die beiden sich buchstäblich vor den Augen von Picasso geprügelt hatten. Auch war mir in Erinnerung geblieben, dass Marie-Thérèse seine abgeschnittenen Haare und Fingernägel wie Reliquien aufbewahrt und ihm bis ans Ende ihres Lebens fast täglich geschrieben hatte – mehr als dreißig Jahre, nachdem sie »verstoßen« worden war. Ich wusste auch noch von ihrer Bewunderung, ihrer Naivität, ihrer Blindheit und ihrer Unterwürfigkeit. Mir waren dabei Begriffe wie »Hörigkeit« und »emotionale Abhängigkeit« in den Sinn gekommen, doch ich hatte nicht ernsthaft versucht, mehr darüber herauszufinden, wer diese Frau eigentlich war …
Der Kunsthistoriker, den ich an diesem Tag anrief, schien überrascht, dass ich mich für Marie-Thérèse interessierte. Weil ich jedoch wiederholt vorbrachte, wie unergründlich sie doch sei, erklärte er schließlich, halb paternalistisch, halb genervt: »Meine liebe Brigitte, ich glaube, dass es da nicht sehr viel zu ergründen gibt.« Dieser Satz bewirkte bei mir genau das Gegenteil dessen, was er hatte bewirken sollen.
Ich meinte sogar die leise Ahnung zu haben, dass ein Ergründen von Marie-Thérèse mir helfen würde, dem Rätsel Picasso auf die Spur zu kommen.
1 Eine Schaffensperiode
Für gewöhnlich ist es nicht sehr kompliziert herauszufinden, wo ein Leben beginnt und wo es aufhört.
Für ihre Angehörigen und das französische Personenstandsregister kam Marie-Thérèse Walter am 13. Juli 1909 in Perreux-sur-Marne, einem Vorort von Paris, zur Welt. Am 20. Oktober 1977 hat sie in Juan-les-Pins Selbstmord begangen, und begraben wurde sie in Antibes.
Marie-Thérèse hat jedoch auch noch ein anderes Leben. In der Kunstgeschichte erblickt sie in dem Moment das Licht der Welt, als sie Picasso kennenlernt, Ende der Zwanzigerjahre. Während des Krieges verschwindet sie nach und nach, doch inzwischen ruht sie in den größten Museen und privaten Sammlungen.
Die Gemälde, die sie zeigen, gehören zu den beeindruckendsten, zärtlichsten, fröhlichsten und erotischsten. Ganze Bataillone von Spezialisten haben Recherchen zu ihren sinnlichen Kurven sowie den Sinnen des frohlockenden Meisters, des brünstigen Minotaurus, des ekstatischen Mittagsdämons, des Künstlers am Höhepunkt seiner Inspiration angestellt.
John Richardson (ein Freund und der bedeutendste Biograf von Picasso): »Während der Marie-Thérèse-Jahre hat er die radikalste Revolution in der Kunst des Porträtierens seit der Renaissance herbeigeführt.«4
Pierre Cabanne: »Seine Kunst hat in der glücklichsten Fülle überhaupt Ausdruck gefunden.«5
Doch was weiß man tatsächlich von dem jungen Mädchen, das diese Inspiration und diese Revolution befeuerte?
Sie ist etwa siebzehn Jahre alt, als ihr Weg den des großen Pablo Picasso kreuzt. Blond mit hellem Teint und blauen Augen, sportlich, heiter, nicht sonderlich am Lernen interessiert, unwissend in Sachen Malerei wie auch in vielen anderen Dingen. Ihr ist die Welt, in der der Künstler sich bewegt, völlig fremd. Mit seinen 45 Jahren gilt Picasso bereits als einer der größten Künstler des Jahrhunderts. Seit etwa zehn Jahren ist er mit Olga Chochlowa verheiratet, einer ehemaligen Tänzerin der Ballets Russes, die er 1917 in Rom kennengelernt und ein Jahr später geehelicht hat. Der gemeinsame Sohn Paulo wird bald sechs Jahre alt. Picasso war unglaublich verliebt in diese raffinierte Frau, die Muse, die ihm eine prächtige Rückkehr in den Klassizismus seiner Malerei bescherte. Ihr ist es außerdem gelungen, diesen Bohemien in einen Dandy zu verwandeln, ihn in die besseren Kreise der Pariser Gesellschaft einzuführen und sich selbst das Kostüm der perfekten Ehefrau eines reichen und berühmten Künstlers überzustülpen. Doch wie immer wird Picasso des Ganzen irgendwann überdrüssig.
Marie-Thérèse erlaubt ihm also, dem Familienleben, das ihn erdrückt, seiner Frau, die neuerdings kränkelt, ständig klagt und eifersüchtig ist, sowie seinem Status als großer Maler, der ihm so häufig alles vergällt, zu entkommen. Um bei Olga keinen Verdacht zu wecken, stellt er die junge Geliebte allerdings keinem seiner Freunde vor. Und auch wenn manchen die Initialen in den kubistischen Gemälden gegen Ende der Zwanzigerjahre auffallen, weiß doch niemand, dass die Buchstaben M und T dem kryptischen Eingeständnis einer heimlichen Leidenschaft gleichkommen.
Als Marie-Thérèse dann volljährig ist, ähneln die Porträts der jungen Muse immer mehr und werden immer eindeutiger. Nach der Geburt ihrer beider Tochter Maya im Jahr 1953 kennen die engsten Freunde ihren Namen schließlich. Während der deutschen Besetzung treffen manche in Royan oder im Atelier des Künstlers in der Rue des Grands-Augustins auf die junge Frau. Nach der Trennung von Olga teilt sich Picasso zwischen Marie-Thérèse und seiner neuesten Eroberung auf, der Fotografin Dora Maar. Aber jede hat ihren Platz: auf der einen Seite Marie-Thérèse und ihre Tochter, mit denen er heimlich die Wochenenden verbringt, auf der anderen Seite Dora, die offizielle Geliebte und seine Gefährtin bei gesellschaftlichen Anlässen. Als er sich später, im Jahr 1943, in die junge Françoise Gilot verliebt, verschwindet Marie-Thérèse, wie auch Dora Maar, von der Bildfläche … genauso unauffällig, wie sie einst aufgetaucht ist.
Fast musste man bis zum Tod des Malers im Jahr 1973 warten, bis sie endlich in Erscheinung trat und die zehnjährige Schaffensphase beleuchtete, deren Muse sie war. Ihr Name, der in keinem der Gemäldetitel auftaucht, umreißt auf einmal eine ganze Schaffensperiode.
Doch während Dora Maar, Françoise Gilot oder Jacqueline Roque zu Dutzenden Werken und Dokumentarfilmen inspiriert haben, interessiert sich kaum jemand für Marie-Thérèse. Als ich mit diesen Nachforschungen anfing, musste ich mich mit sehr wenig begnügen: sehr schönen Ausstellungskatalogen6, der Tatsache, dass dem Gegenstand meines Interesses in den Biografien des Malers nur eine bescheidene Statistenrolle zukam, der Beschreibung eines netten Mädchens, von manchen auf wenigen Seiten und mit spitzer, in Geringschätzung getauchter Feder hingeworfen. Der Surrealist Lord Penrose beschreibt sie als »von einer robusten Vulgarität«7 und vertraut der Zeitschrift Life an, sie sei »die einzige wirklich nicht sonderlich intelligente Frau im Leben von Picasso« gewesen. Und wenn der britische Schriftsteller Patrick O’Brian sie als »eine vortreffliche, junge Frau«8 wahrnimmt, so räumt er doch ein, dass sie die einzige Muse ist, über die er kaum Berichte findet.
Am wertvollsten ist da noch die Aussage von Maya, der einzigen Tochter von Marie-Thérèse Walter und Pablo Picasso, die inzwischen über achtzig Jahre alt ist. Ich hatte sie vor Jahren anlässlich einer Ausstellung im Grand Palais interviewt und als heitere, lebhafte, schelmische und überaus sympathische Frau in Erinnerung behalten. Doch mein erster Brief an sie blieb unbeantwortet. Ihre Tochter teilte mir mit, sie stelle selbst gerade ein Buch über die Großmutter zusammen und könne mich nicht treffen. Ihre Brüder redeten sich mit derselben Entschuldigung heraus.
Ab und an beschleicht einen als Biografin das absurde Gefühl, dass manche Protagonisten einem die Türen weit öffnen, während andere sich entziehen oder sich gar verbarrikadieren. Marie-Thérèse, die so lange im Geheimen gelebt hat, gehört natürlich dem Clan der Widerspenstigen an.
2 Nicht anerkannt
Der Zugang zu den Archiven gelingt da schon einfacher. Beim Schreiben meiner vorherigen Bücher hatte ich gelernt, die auf kommunaler wie auch auf departementaler Ebene vorhandenen digitalisierten Dokumentenbestände, die Personenstandsbücher und die alten Volkszählungen, via Internet zu durchforsten. Solche Nachforschungen können sich zu einem süchtig machenden, spielerischen, fast schon verwerflichen Vergnügen auswachsen. Ich kann unglaublich viel Zeit damit zubringen, ein Detail zu überprüfen, ein Datum, eine Adresse, auch wenn selbiges vielleicht ohne jede Bedeutung ist. Diese Reisen, ohne zu reisen, gleichen für mich einem bezaubernden Aus-der-Zeit-Fallen, einem Abtauchen, und erfüllen mich mit dem berauschenden Gefühl, im Stil einer Analystin der Spionageabwehr Ermittlungen anzustellen. Allerdings sind meine Verdächtigen nur Geister.
Meine Nachforschungen über Marie-Thérèse Walter beginnen also auf Seite 29 des Geburtsregisters der Jahre 1909 – 1911 der Gemeinde Le Perreux-sur-Marne.
»Eintrag Nummer 120: Im Jahr neunzehnhundertneun, am 14. Juli um 9.30 Uhr vormittags, Geburtsurkunde von Marie Thérèse Léontine Deslierres, weiblichen Geschlechts, geboren gestern um 12 Uhr in Perreux, Rue de Trianon, 2 (Villa des Lierres, 6), Tochter von namentlich nicht angegebenen Eltern. Ausgestellt von uns, Albert Lecocq, Standesbeamter der Gemeinde […] auf Präsentation des Kindes durch Jeanne Marie Antoinette Berté, Hebamme mit Wohnsitz in Perreux […], die bei der Geburt assistiert hat.«
Erstes Dokument, erste Überraschung: Bei ihrer Geburt hat Marie-Thérèse offiziell weder einen Vater noch eine Mutter. Wie einem Findelkind verpasst man ihr den erstbesten Namen, der einem einfällt: Deslierres, nach der Villa des Lierres, in der sie geboren wurde. Dabei ist diese Adresse der Hauptwohnsitz ihrer Mutter, die sie eigenartigerweise achtzehn Monate später doch anerkennt: Da wird in der Geburtsurkunde der Name Deslierres durchgestrichen und durch Walter ersetzt. Denn die Mutter von Marie-Thérèse heißt Émilie-Marguerite Walter.
Auch ihr bin ich gefolgt, habe in den Archiven nach ihrer Spur gesucht. Sie kommt 1871 als Tochter eines deutsch-französischen Paares in Paris zur Welt. Die Ehefrau ist Pariserin, ohne Beruf und stirbt, als Émilie-Marguerite gerade einmal dreizehn Jahre alt ist. Der Vater stammt ursprünglich aus Heidelberg (weshalb Walter auch deutsch ausgesprochen wird), führt eine Klempnerfirma und heiratet wieder, kaum dass seine erste Frau beerdigt ist. Émilie-Marguerite wächst in Paris auf und wird dann zu Ordensschwestern nach Deutschland ins Internat geschickt. Sie heiratet mit 19, lässt sich aber recht schnell scheiden; danach findet man sie eine Weile im Quartier de la Chapelle in Paris. Mit 38 Jahren ist sie schließlich mit Marie-Thérèse schwanger und zieht mit drei weiteren, ebenfalls unehelichen Kleinkindern allein nach Perreux-sur-Marne: Maurice ist sechs, Geneviève fünf und Jeanne drei Jahre alt. Fassen wir zusammen: eine wenig konventionelle Frau, alleinerziehende Mutter, ohne Beruf, ohne genau bestimmte Einkünfte.
Den Ältesten, Maurice, hat sie gleich bei der Geburt in Paris anerkannt, er trug sofort den Namen Walter. Die beiden Mädchen, die danach kamen, sind genau wie Marie-Thérèse »ohne Angabe von Mutter und Vater« zur Welt gekommen. Nach ein paar Monaten hat Émilie-Marguerite sie jedoch, vielleicht geplagt von Gewissensbissen, ebenfalls anerkannt. Somit scheint ihr Vorgehen bei der Jüngsten typisch für sie zu sein.
Allerdings ändern die beiden älteren Schwestern von Marie-Thérèse im Alter von 18 und 17 Jahren ihren Namen. 1923 wird im Rathaus des XX. Arrondissements von Paris ein Mann vorstellig und will die beiden als seine Töchter anerkennen. Sein Name ist Eugène-Élie Valroff. Ab diesem Tag heißen sie also offiziell Geneviève und Jeanne Valroff. Marie-Thérèse und Maurice hingegen tragen weiterhin den Namen Walter.
Noch überraschender: Der Mann, der Geneviève und Jeanne so spät anerkennt, ist gar nicht ihr tatsächlicher Vater. Diana Widmaier Picasso, die Enkelin von Marie-Thérèse, hat den richtigen Namen des biologischen Vaters der vier Kinder in mehreren Texten genannt: Er heißt sehr wohl Valroff, doch sein Vorname lautet Léon. Ich habe ihn in den Archiven von Val d’Oise und auf Seiten zur Ahnenforschung wiedergefunden: Firmenchef, Oberschicht, schwedischer Herkunft, ansässig bei Saint-Leu-la-Forêt, verheiratet, vier Kinder.
1923 haben sich Léons Lebensumstände verändert: Er ist sechzig Jahre alt und hat gerade seine Frau verloren. Offenbar fühlt er sich freier, verspürt aber gleichzeitig den Drang, die Situation seiner unehelichen Kinder zu klären. Um zu verhindern, dass seine Familie und sein Ruf ruiniert werden, bittet er einen Cousin, Eugène-Élie Valroff, zwei Töchter von Émilie-Marguerite an seiner Stelle anzuerkennen. Zum Ausgleich wird diesem wahrscheinlich ein Dienst erwiesen, oder er erhält eine gewisse Summe Geld. Warum aber nur zwei? Man stelle sich die Enttäuschung und das Unverständnis von Marie-Thérèse und ihrem Bruder vor, schließlich kennen sie diesen Vater, der sie nicht anerkennt, ebenso gut wie ihre Schwestern.
Vielleicht hat er versprochen, dass auch sie noch an die Reihe kommen. Oder aber der Cousin hat sich geweigert, mehr als zwei Kinder zu akzeptieren. Léon hat jedenfalls die intelligentesten ausgewählt, jene, auf die er so stolz ist, Abiturientinnen und angehende Medizinstudentinnen, was in den Zwanzigerjahren eine außergewöhnliche Laufbahn war.
Dennoch vernachlässigt er Marie-Thérèse nicht. Seine Geschäfte führen ihn häufig in die Schweiz und nach Deutschland. Zudem hat er in Wiesbaden in Immobilien investiert, und als Marie-Thérèse 1922 im Alter von dreizehn Jahren dorthin aufs Internat geschickt wird, ist es Léon Valroff, der sie begleitet, ehe ihre Mutter, Émilie-Marguerite, sich ebenfalls dort niederlässt. In Wiesbaden, einer hübschen Thermalstadt am Ufer des Rheins, die auch »Nizza des Nordens« genannt wird, ganz in der Nähe von Heidelberg, der Heimat der Familie Walter.
Der einzige Hinweis auf diesen Aufenthalt in Deutschland ist ein Porträt von Marie-Thérèse vom 20. Oktober 1922. Sie posiert vor einer großen Fotoleinwand, auf die der Fotograf einen Tempel nach griechischem Vorbild aufgezogen hat: den Monopteros von Neroberg, errichtet auf den Höhen von Wiesbaden. Marie-Thérèse ist blond, hat helle Augen, trägt einen Pagenschnitt und einen Glockenhut mit breitem Rand, dazu eine eher brave Schülerinnentracht, eine Medaille um den Hals, eine ziemlich originelle achteckige Armbanduhr und hübsche gewachste Stiefel. Es ist das Porträt eines etwas schüchternen, aber fröhlichen, gut genährten und gut gekleideten Teenagers.
Wie lange sie in Deutschland gelebt hat, lässt sich schwer sagen, doch es ist anzunehmen, dass es drei Jahre waren. Als sie zurückkehrt, ist aus dem kleinen Mädchen eine junge Erwachsene geworden. Mit ihren sechzehn Jahren ist sie nicht so schlank wie ihre Schwestern, dafür aber athletischer, ihr Körper ist vom Sport geformt, dem sie in Deutschland mehr als zuvor in Frankreich nachgegangen ist. Anscheinend hat sie im Einer und im Schwimmen sogar Wettkämpfe gewonnen. Ihre schulischen Leistungen sind im Gegensatz dazu – und zu denen ihrer Schwestern – nicht brillant; Fortschritte hat sie nur in Deutsch gemacht. Da aber auch sie einen Beruf ergreifen muss, sieht ihre Mutter sie als Sekretärin und schreibt sie in einer entsprechenden Schule ein, damit sie Steno lernt.
Nach Marie-Thérèses Rückkehr aus Wiesbaden ziehen sie nach Maisons-Alfort, in ein kleines Haus, das Madame Walter von ihrem Vater geerbt hat. Auf den Fotos wirkt es einfach, aber adrett, es steht in einer blühenden Straße, die zur Marne führt. Und Paris ist nicht weit weg, man braucht nur in den Zug zu steigen.
Ich habe versucht, dieses Haus ausfindig zu machen. Leider ist die Straße in den Neunzigerjahren verschwunden, um einem Bürogebäude Platz zu machen. Die Zeitung L’Humanité hat damals von einer Mobilmachung der Anwohner berichtet, die das »Liebesnest von Marie-Thérèse und Picasso« retten wollten. Laut den damals veröffentlichten Artikeln soll der Maler in einem Taubenschlag im hinteren Teil des Gartens ein Atelier eingerichtet und dort insbesondere das berühmte Gemälde L’Atelier de la modiste (Das Atelier der Hutmacherin) geschaffen haben.
Dieses bedeutende Werk gehört heute zur Sammlung des Centre Pompidou. Nach offiziellen Angaben ist es aber nicht in Maisons-Alfort entstanden, sondern in der Rue La Boétie, und es datiert vom Januar 1926 … das wäre ein Jahr vor dem gemeinhin anerkannten Kennenlernen von Picasso und Marie-Thérèse.
Vielleicht handelt es sich um einen Irrtum der Zeitung, doch angesichts dieser Ungereimtheit musste ich an meine Leserin und ihre komplizierte Geschichte über »widersprüchliche Datumsangaben« denken, mit der sie versucht hatte, mich für Marie-Thérèse zu gewinnen.
3 Siebzehn Jahre später
Niemals hat Picasso die Umstände seines Zusammentreffens mit Marie-Thérèse öffentlich erwähnt, genauso wenig, wie er das bei seinen anderen Gefährtinnen getan hat. Schamhaft, was seine Privatsphäre betrifft, befand er, »das Werk, das man hervorbringt, ist ein Weg, um Tagebuch zu führen«9. Somit mussten sich seine ersten Biografen damit begnügen, seine Gemälde zu betrachten, um über den Daumen gepeilt zu schätzen, dass diese junge Blondine wohl gegen 1931 in sein Leben getreten war.
Weitere dreißig Jahre mussten vergehen, ehe ihr Name zum ersten Mal genannt wurde, das war 1957.10 Und dann noch einmal acht Jahre, bis Françoise Gilot (Picassos Gefährtin von 1943 – 1953, Mutter von Claude und Paloma Picasso) in einem Buch, das einen Skandal auslöste, enthüllte, dass Picasso Marie-Thérèse »auf der Straße in der Nähe der Galeries Lafayette getroffen [habe], als sie siebzehn Jahre alt war«11. Zu Beginn der Siebzigerjahre hat dann diejenige, um die sich hier alles dreht, ihre Version der Geschichte erzählt.
In nur drei Interviews: einem ersten, sehr kurzen in der Zeitschrift Life, einem zweiten mit Lydia Gasman, einer amerikanischen Akademikerin, die an einer Doktorarbeit über Picasso arbeitete, und in dem für France Culture aufgezeichneten Interview mit dem großen französischen Kunstkritiker Pierre Cabanne. Die Wortwahl ist weitestgehend immer dieselbe: Sie habe in den Galeries Lafayette einen Bubikragen kaufen wollen, als Picasso sie auf der Straße angesprochen und gesagt habe, er wolle ihr Porträt malen.
Nur das Datum variiert leicht: Gegenüber der Journalistin von Life12 spricht sie vom 8. Januar 1927, bei Lydia Gasman13 nennt sie den 11. Januar, bei France Culture gibt sie wieder den 8. Januar an: »Ich war etwas über siebzehn Jahre alt […] Es war besagter Samstag, der 8. …« Ihr Ton, die Selbstgewissheit, mit der sie das sagt, stellt es als solch unumstößliche Wahrheit dar, dass die Frage für die meisten Spezialisten seitdem geregelt ist.
Am 8. Januar 1927 schlendert Picasso also untätig vor den Galeries Lafayette herum, ganz im Stil seiner neuen Surrealistenfreunde, die das Finden der Amour fou dem Zufall überlassen, wie es etwa bei Breton und seiner Nadja der Fall war. Genau dort spricht übrigens auch Paul Éluard 1930 Nush an.
Marie-Thérèse unterstreicht, dass es »sechs Uhr abends« gewesen sei, als sie aus der Metro kam, und betont dabei jede einzelne Silbe …
»Das macht mich ganz wuschig«, hätte meine Mutter dazu gesagt. Am Samstag, den 8. Januar 1927, ist die Sonne in Paris um 16.07 Uhr untergegangen. Um »sechs Uhr abends« ist es also schon stockdunkel, und das große Kaufhaus schließt bald. Es scheint ziemlich eigenartig, dass ein junges Mädchen so spät allein auf dem Boulevard Haussmann unterwegs sein soll. Umso mehr, als sie danach zur Gare de Lyon muss, um in den Zug nach Maisons-Alfort zu steigen, wo sie dann wiederum gut zehn Minuten zu Fuß durch einen sehr dunklen Vorort gehen muss.
In einem Picasso gewidmeten Dokumentarfilm14 schildert ihre Tochter Maya einen etwas anderen Ablauf. Maya zufolge entdeckt ihr Vater ihre Mutter nicht am Ausgang der Metro, sondern hinter den Scheiben des Kaufhauses. Marie-Thérèse ist bereits im Inneren, damit beschäftigt, nach ihrem Bubikragen zu suchen. Überwältigt von dieser jungen Blondine mit dem perfekten griechischen Profil, folgt Picasso ihr mit Blicken und wartet am Ausgang auf sie. Es muss »sechs Uhr abends« sein, sie ist noch allein, in der Kälte und bei Nacht. Er hält sie am Arm fest. »Er hat mir ein schönes Lächeln geschenkt. Er hat mich angesehen, und dann hat er gesagt: ›Mademoiselle, Sie haben ein interessantes Gesicht, ich würde gern Ihr Porträt malen!‹«
Aus Höflichkeit oder um sie zu beruhigen, fügt er noch hinzu, dass er Picasso heiße. Leider kennt sich das Mädchen mit Malerei nicht aus, liest keine Zeitung und hat noch nie von ihm gehört. Das überrascht nicht sonderlich, Frankreich hat länger gebraucht als die Amerikaner oder die Russen, um Picasso anzuerkennen. Tatsächlich spaziert er mit einem großen, ihm gewidmeten Kunstband unter dem Arm herum, »auf Chinesisch oder Japanisch« … Marie-Thérèse erinnert sich nicht mehr genau.
An die Farbe seiner Krawatte kann sie sich hingegen besser erinnern, »aus roter und schwarzer Seide«, wie auch an die genaue Uhrzeit des Rendezvous, das er ihr vorschlägt: »Nächsten Montag um elf Uhr morgens an der Metro Saint-Lazare.«
Montag, 10. Januar 1927. Zur vereinbarten Stunde trifft sie ganz unschuldig ein. Es ist ein schöner Wintertag, mild und sonnig. Wieder lächelt Picasso, lädt sie erst auf einen Kaffee, dann zum Mittagessen ein. »Wir werden gemeinsam Großes machen«, verspricht er, und dann schleppt er sie mit in sein Atelier, das nur zehn Minuten Fußweg entfernt ist. Er ist so nett, dass sie sich nicht traut, Nein zu sagen. Und plötzlich ist sie mit diesem Unbekannten allein in einer großen Wohnung. Holztäfelungen, Kamine, Zierleisten; die Räume müssen prunkvoll gewesen sein, ehe dieses unbeschreibliche Durcheinander mit den ausgehängten Türen aus ihnen wurde. Eingeschüchtert und verunsichert, wie sie ist, wagt Marie-Thérèse es nicht, sich die an den Wänden hintereinander aufgereihten Gemälde anzusehen. Er wiederum betrachtet sie von allen Seiten. Er redet wenig, mit ruhiger Stimme, und vermeidet jede abrupte oder taktlose Geste. Er lässt sie sich um die eigene Achse drehen, studiert ihre Silhouette, ihr Gesicht, ihr Profil. Er macht ihr Komplimente zu ihrer perfekten griechischen Nase. Das passiert ihr tatsächlich zum ersten Mal … Sie lässt all das einfach geschehen, ohne zu wissen, dass sie bei einem der weltweit berühmtesten Maler gelandet ist. »Ach, mich hat einfach nur seine Krawatte interessiert«, antwortet sie Pierre Cabanne lachend …
Ihr 65. Geburtstag steht kurz bevor, als sie dem Kunsthistoriker dieses einmalige, bewegende und leicht irritierende Interview gewährt, von dem sich relativ einfach im Internet eine gekürzte Fassung finden lässt und das unlängst erneut auf France Culture ausgestrahlt wurde. Pierre Cabanne hat es außerdem in der mehrbändigen Picasso gewidmeten Biografie zusammengefasst15 und in einem Artikel des Kunstmagazins L’ŒIL16 veröffentlicht. Doch meine Freundin Hélène, eine ausgezeichnete Dokumentarin, hat das vollständige Interview der Sendung von 1974 in den Archiven der INA für mich ausgegraben: eine fünfzigminütige Originalversion, aus der keine unbeholfenen Stellen, kein Zögern und auch keine später von Marie-Thérèse als belanglos erachteten Aussagen herausgeschnitten sind.
Das erste Anhören war verblüffend … Die Worte sprudeln nur so aus ihr heraus, nicht immer passend oder im beabsichtigten Sinn. Sie überbetont ihre gute Laune, kokettiert, um möglichst entspannt zu erscheinen, spricht mit hoher Stimme, die sich ab und an grundlos noch weiter nach oben schraubt. Wenn man es sich allerdings recht überlegt, dann spricht sie eher wie ein Kind, als wäre sie nicht erwachsen geworden, sondern in dem Alter stecken geblieben, in dem sie war, als Picasso sie geliebt hat. Der Kunsthistoriker interviewt sie auch nicht wie eine Erwachsene: Er spricht sehr sanft, um ihr Vertrauen zu gewinnen, gebraucht keine allzu komplizierten Wörter. Ein paar wenige Fragen bringen sie durcheinander. Einmal hört man sie ein »Lassen Sie mich doch in Ruhe« flüstern, wie ein verängstigtes kleines Mädchen. Doch sehr schnell fasst sie sich wieder, verfällt erneut in ihren fröhlichen Ton und enthüllt innerhalb weniger als einer Stunde die unaufgeregte intime Seite eines Genies, das sich heimlich bei einem jungen, anspruchslosen Mädchen ausruht. Dieser Aufzeichnung, die ich mir beim kleinsten Zweifel über Monate hinweg immer wieder angehört habe, wohnt die Stärke und die Zerbrechlichkeit ihres Wesens inne. Aber eine andere gibt es nun einmal nicht!