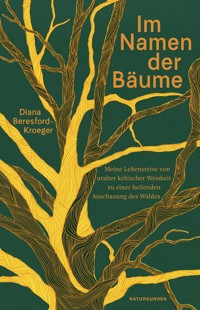
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Matthes & Seitz Berlin Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Nachdem ihre Eltern früh versterben, wird Diana Beresford-Kroeger von einer Familie aufgenommen, die seit Jahrhunderten alte keltische Traditionen pflegt. Im Laufe von drei Sommern wird Diana in der keltischen Triade von Geist, Körper und Seele unterrichtet, einer Philosophie, deren Weisheiten und Fähigkeiten Wälder als überlebenswichtig für das physische und spirituelle Überleben ansehen. Die Verwurzelung in dieser ganzheitlichen Naturauffassung lässt Diana zu einer führenden Wissenschaftlerin werden, die alte, geheime Lehren mit eigenen Beobachtungen verbindet: die Entdeckung der Mutterbäume im Herzen des Waldes oder jene, dass Bäume nicht nur mithilfe einer chemischen Sprache kommunizieren, sondern sogar über heilende natürliche Antibiotika verfügen. Dieses Buch schildert nicht nur den Werdegang einer eindrucksvollen Wissenschaftlerin, sondern bündelt auch ihr gesamtes Wissen über die komplexen Zusammenhänge zwischen dem globalen Wald und dem Wohlergehen aller Lebewesen. Nicht zuletzt bietet Im Namen der Bäume eine so fundierte wie ermutigende Handreichung dafür, dass das Pflanzen und das Verstehen von Bäumen eine praktikable Lösung darstellen, um die Folgen unseres selbstzerstörerischen Verhaltens – allen voran die des Klimawandels – in den Griff zu bekommen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 342
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Meinen Vorfahren im Castle of Ross, Killarney, die in Lackavane und dem Valley of Lisheens lebten. Von euch habe ich meine größte Gabe, meinen Verstand.
NATURKUNDEN N° 105
herausgegeben von Judith Schalansky bei Matthes & Seitz Berlin
Inhalt
Einleitung
TEIL EINS
Ein tröstlicher Stein
Der gelbe Farbkasten
Ins Tal
Bildung ist für eine Frau keine Bürde
Die Bedeutung meiner Mündelschaft
Das Feldexperiment
Wo sind die Bäume?
Fürsorgepflicht
Die Wissenschaft des alten Wissens
Die Sumachblüte
Arbeit nach meiner Fasson
Holz spalten
Der Mutterbaum
Philanthropie des Geistes
TEIL ZWEI
Das keltische Baumalphabet
Danksagungen
Leseliste
Register
Brehon
Mit Poesie ist die Landschaft von Éire
in den Schlaf gesungen worden, lang ist’s her.
Fadó.
Fadó.
Raunend liegt das Land.
Sanfte Traumfelder voller Hasen
und Hasenschwanzgras ziehen langsam vorbei
mit von Purpurheide beanspruchten Bergen
und Füchsen fiebernd im Schimmer gilbenden Ginsters.
Waldwörter
vom Regen zerzaust
zwischen dem Rallenhimmel
und dem Fischschwanzgeplätscher
die das Meer aufsaugen.
Das Mondjoch wird die Gesetze der Freiheit beschirmen
arís agus arís
und uns verweisen direkt
auf Brehon
Diana Beresford-Kroeger
Einleitung
Ich hatte immer Schwierigkeiten damit, über meine Lebensgeschichte nachzusinnen oder sie gar zu erzählen. Als Kind habe ich schwere Traumata erlitten. Um mich selbst zu schützen, habe ich meinen Schmerz gepackt und ihn in meinem Kopf in einem tiefen Brunnen versenkt. Ich habe ihn vor mir selbst versteckt, damit ich funktionierte, während meiner gesamten wissenschaftlichen Ausbildung und Jahrzehnten der Forschung die Augen immer nach vorne gerichtet und nach der nächsten Frage gesucht, der nächsten Antwort, der nächsten Einsicht oder dem nächsten Stückchen Weisheit.
Aber der Mensch, der ich heute bin, würde ohne dieses Trauma nicht leben können. Es führte mich als dreizehnjähriges Mädchen zu einer der letzten Bastionen der keltischen Kultur in Irland, an einen Ort namens Lisheen Valley im County Cork. Ich brauchte etwas, was mich zusammenhielt, und kam in Lisheens genau zu dem Moment an, als der Ort selbst auseinanderfiel. Das alte Wissen der Druiden und der Brehon Laws, der Richtergesetze, das über Jahrtausende von Generation zu Generation bewahrt, verfeinert und weitergegeben worden war, war im Begriff, verloren zu gehen. Doch es wurde an mich weitergegeben und mit ihm eine Einsicht in die heilenden Kräfte der Pflanzen und in das heilige Wesen der Natur, die das größte Geschenk darstellt, das mir je zuteilwurde.
Die einzige Gegenleistung, um die ich für dieses Geschenk gebeten wurde, war, es nicht für mich zu behalten. Und obwohl ich während meiner fünfzigjährigen Wissenschaftslaufbahn meine Ideen und Entdeckungen freigebig geteilt habe, habe ich immer Teile meiner Geschichte zurückgehalten und das vollständige Bild sogar vor mir selbst verborgen.
Heute jedoch befinden wir uns in einer besonderen Zeit. Einerseits stellt die Klimakrise die schlimmste Bedrohung für unseren Planeten dar, die die Menschheit je erlebt hat. Andererseits sind wir so gut gerüstet wie noch nie, uns dieser Herausforderung zu stellen. Aber dafür müssen wir die Natur so verstehen lernen, wie es die Menschen einst getan haben. Wir müssen alles, was uns die heilige Kathedrale des Waldes bietet, in den Blick nehmen und zu der Einsicht gelangen, dass es unter dem, was sie zu bieten hat, einen Weg gibt, unsere Welt zu retten.
Wir alle sind Menschen des Waldes. Wie die Bäume besitzen wir eine genetische Erinnerung an die Vergangenheit, denn die Bäume sind die Eltern eines tief in uns ruhenden Kindes. Wir spüren, wie diese gemeinsame Geschichte jedes Mal, wenn wir in den Wald gehen, zum Leben erwacht, wo uns die Erhabenheit der Natur in einer Weise anruft, die über unser Vorstellungsvermögen hinausgeht. Doch selbst bei denjenigen, die über Monate oder sogar Jahre keine Begegnung mit Bäumen hatten, ist die Verbindung zur Natur noch vorhanden und wartet darauf, erinnert zu werden.
Indem ich die Geschichte meines Lebens erzähle und von den Blättern, Wurzeln, Stämmen, Rinden und Stängeln berichte, mit denen es verwoben ist, hoffe ich, an diese Erinnerung zu rühren. Ich möchte Ihnen ins Gedächtnis rufen, dass der Wald weit mehr ist als nur das Holz, das wir aus ihm herausholen. Er ist unser Medizinschrank. Er ist unsere Lunge. Er ist das Regulierungssystem für unser Klima und unsere Ozeane. Er ist der Mantel unseres Planeten. Er ist die Gesundheit und das Wohlergehen unserer Kinder und Kindeskinder. Er ist unser heiliges Zuhause. Er ist unsere Rettung.
Bäume bieten uns eine Lösung für fast jedes Problem, das die Menschheit heute zu gewärtigen hat, sei es der Kampf gegen die Arzneimittelresistenz oder der Stopp der globalen Erwärmung, und sie sind begierig, uns ihre Antworten mitzuteilen. Sie tun es sogar, wenn wir sie nicht hören oder hören wollen. Einst wussten wir ihnen zuzuhören. An diese Fähigkeit müssen wir uns wieder erinnern.
Ein tröstlicher Stein
Mein Tränenstein stand an der höchsten Stelle der Talflanke und wies in das Blau darüber. Der Stein war deutlich größer als mein Kopf, ein großes Rechteck, wenn man von der Kurve an seinem Scheitelpunkt absah, wo er vor langer Zeit schon abgebrochen war. Seine Oberfläche war zu rauen Riefen verwittert, unterbrochen vom rundlichen Schorf der Flechten. Der Stein war gut doppelt so groß wie der schwere Kiefernholztisch in der Küche des Bauernhauses, groß genug, dass alles, was sich an ihm veränderte, in einer für mich unmerklichen Langsamkeit ablief und ihm eine willkommene Beständigkeit verlieh.
Ich nannte ihn meinen Tränenstein, weil ich, wenn ich mich besonders einsam fühlte, den Hügel hinaufstapfte, um in seiner Nähe zu sein. Ich habe nie wirklich geweint. Meine Tränen waren schon lange versiegt. Oder ich habe sie unterdrückt und es nie gemerkt, denn ich habe sie zur Gänze heruntergeschluckt. Ich saß gewöhnlich am Fuß des Steins und lehnte mich an seine massive Flanke, bereit, auf eine andere Seite zu schlüpfen und mich zu verstecken, wenn jemand von unten nach mir rief. Es handelte sich um eine reine Beruhigungsmaßnahme, obwohl mich nie jemand gerufen hat.
Wenn ich dort saß, drang mit dem langsamen Pochen der Erde Ruhe in meine Knochen. Unter mir lag das Bauernhaus mit seiner Rauchfahne, und dahinter erstreckten sich die zum Hof meiner Großtante gehörenden Felder. Wie in einem alten Lied trug ein jedes einen gälischen Namen. Die Felder unseres Nachbarhofs bedeckten die Talseiten mit einem Flickwerk, in dessen Grün es zu glühen schien. Ich sah den Meeresvögeln zu, wie sie über den Weiden den Schleier aus Timotheegras auszubreiten schienen, und mitunter sah ich tief unten im Tal den lachsreichen Owvane River, der sich nach Westen in die offenen Arme der Bantry Bay ergoss. Wenn ich mich nach Norden wandte, konnte ich die großartigen schlafenden Silhouetten der Caha-Berge bewundern, auf deren sperrigen Formen die Farben tanzten. Cnoc Buí, der gelbe Berg – von seinen gelben Blüten unter Strom gesetzt –, schien im Chrom des Stechginsters zu vibrieren. Manchmal, wenn ich das Aquamarin des Meeres beobachtete, wunderte ich mich über die bronzenen Blitze, die in einer stillen Farbensymphonie kamen und gingen. Von diesem Aussichtspunkt aus konnte ich tatsächlich die gesamte Landschaft überblicken, die die Familie meiner Mutter in den vergangenen dreitausend Jahren an Körper und Seele genährt hat. Das mit den Wolken spielende Licht, der salzige Wind und der Regen trösteten mich. Auch wenn ich an meinen Tränenstein gelehnt nie wirklich geweint habe, war ich doch ein Kind, das den Schmerz zur Genüge kannte.
An jenem besonderen Sommertag, an den ich mich erinnere, war ich in Gedanken an meinen Vater zu dem Stein hinaufgestiegen. Ich war eine Waise, hatte erst kürzlich beide Eltern verloren. Die meiste Zeit meines jungen Lebens war ich allein gewesen, durch Nationalität, Religion und Klasse, um nur diese zu nennen, von den Menschen in meiner Umgebung getrennt, und ich hatte gelernt, in dieser Isolation zu leben. Doch der Tod meiner Eltern versetzte mir einen Schlag, von dem ich nicht wusste, ob ich mich würde von ihm erholen können. Monat um Monat war vergangen, und ich fühlte mich immer noch wie betäubt. Die tägliche Unmittelbarkeit ihres Todes war verwirrend, so, als ob mir Erde und Himmel unter den Füßen weggezogen würden. Die Trauer um meinen Vater war anhaltend, der Verlust so stark, dass ich manchmal an der Gewalt, die sie über mich hatte, zu ersticken drohte. Ein lebenswichtiger Teil von mir fehlte und würde nie mehr zurückkommen, denn der Tod hatte eine Tür verschlossen. Ich wollte nur klein sein, nur ein winziger Punkt. Wenn ich den Atem anhielt, würde ich vielleicht ganz verschwinden.
Am Fuß des Steins kauerte ich mich in mich selbst, um zu überleben. Durch den Anblick des Tals unter mir fühlte ich mich sicher und zugleich wie ein winziger Fleck, so klein wie unten die langsam trottenden schwarzweißen Kühe mit ihren schwingenden rosa Eutern. Sie waren zufrieden. Ich musste es auch sein. Und da ich mich langsam beruhigte, konnte ich einen nüchternen Blick auf mein Leben werfen.
Väterlicherseits war ich ein Abkömmling der englischen Aristokratie, das brüchigste Blatt im Familienstammbaum der Beresford, der gespickt war mit Earls, Lords und Marquis. Mütterlicherseits war ich so irisch wie die Heide zu meinen Füßen, der letzte lebende Tropfen einer Blutlinie, die sich bis zu den Königen von Munster zurückführen ließ. Meine doppelte Stammlinie führte zu Ressentiments, an denen ich mein ganzes Leben zu tragen hatte. Als weibliches Kind der Beresfords sah ich mich mit den Einschränkungen des Erstgeburtsrechts konfrontiert. Aus dem Besitz meines Vaters würde ich bis auf meine Abstammung und meinen Namen nichts von Wert erben können. Ich war ein Mischling, zu irisch für die Engländer und zu englisch für die Iren. Meine einzige Gnade in den Augen der Iren war, dass ich ein Mädchen und deshalb wichtiger als ein männlicher Nachkomme war.
Der Gedanke daran, dass die Familie meines Vaters mich, wie seit dessen Tod geschehen, weiterhin ignorieren würde, versetzte mich in Panik. Aber auch das ging vorbei, während ich über die Weiden des Tals von Lisheen blickte, jene paar Quadratkilometer eines ländlichen Irlands, wo ich in den kommenden zehn Jahren meine Sommer verbringen würde. Ich hatte noch keine Ahnung von der Hoffnung, die direkt vor mir lag, oder von der Art und Weise, wie das Land und seine Menschen mich leiten und prägen würden. Ich wusste damals nicht, dass die ältere Generation meiner Familie mütterlicherseits sich bereits unten in Pearson's Bridge zusammengefunden hatte, um über mein Schicksal zu befinden. Ich wusste nicht, dass sie bereits beschlossen hatten, mir ihr altes Wissen, ihr offenes Geheimnis, zum Geschenk zu machen, und dass das mir das Leben retten würde. Oder dass sie die Absicht hatten, mich zu ihrem »Schicksalskind« zu machen. An den Tränenstein gelehnt, wusste ich nur, dass ich unsichtbar war, von zu viel Tod niedergeschmettert und furchtbar allein.
Meine Eltern Eileen O’Donoghue und John Lisle de la Poer Beresford lernten sich irgendwann im Zweiten Weltkrieg in England, sehr wahrscheinlich in London kennen und verliebten sich. Obwohl ich als Kind großes Vergnügen daran hatte, die romantische Vergangenheit der Menschen in meiner Umgebung auszuforschen, hatte ich nie die Gelegenheit, meine Eltern nach ihrer Liebesgeschichte zu fragen. Ein paar kleine Einzelheiten wusste ich trotzdem. Etwa, dass meiner Mutter, wenn sie im Abendkleid mit silbernen bis zu den Ellenbogen reichenden Handschuhen und geschmückt mit Zuchtperlen und Saphiren auftrat, kaum zu widerstehen war. Einmal, als ich klein war, wurde ich geholt, um sie bei einem privaten Ball über die Tanzfläche rauschen zu sehen. Alle Anwesenden überließen ihrer Eleganz und Schönheit das Feld. Dass ein Mann einer Frau wie meiner Mutter erliegt, ist pauschal betrachtet leicht zu verstehen.
Jack, mein Vater, kam in jeder Hinsicht aus bestem Hause. Er war ein Eton-Junge, der als Sohn von Lord William Beresford bei Hofe eingeführt wurde. Er war verwandt mit den Churchills und Spencers und der ganzen übrigen englischen High Society. Er pflegte den ambitionierten Lebensstil des frühen zwanzigsten Jahrhunderts in höchster Vollendung, und allein schon dies hätte genügt, das Interesse der Frauen auf sich zu ziehen, aber er war auch ein charmanter, kultivierter Mann. Selbst die Verwandtschaft meiner Mutter in Lisheens sprach von ihm, trotz seines Status in der protestantischen angloirischen Elite, wohl oder übel mit Bewunderung und Zuneigung. Er war Linguist, sprach dreizehn Sprachen, darunter drei arabische Dialekte, fließend und unterrichtete in Cambridge. Er war hochgewachsen und trug ein Monokel, was heute albern klingt, ihm aber meines Erachtens gut stand.
Auch wenn das Gesicht meiner Mutter durch die sehr helle Haut zart und feinfühlig wirkte, war sie doch mutig und abenteuerlustig, belesen und extrovertiert; wenn ihr danach war, beherrschte sie mit ihrer Präsenz einen ganzen Raum. Und sie war sportlich, eine versierte Reiterin, die in ihrer Kindheit jeden Tag zur Schule geritten war. Sie hatte etwas Wildes an sich und eine ungewöhnliche Ader für Tiere, vor allem für Pferde und ihre Verwandten. Diese beiden Eigenschaften finden sich in meiner Lieblingsgeschichte über sie zusammengefasst, worin es heißt, dass es ihr als Mädchen einmal gelungen war, einen Esel auf das Dach ihres Schulhauses zu manövrieren. Niemand konnte sich erklären, wie sie das bewerkstelligt hatte, und sie hat es angeblich auch nie erzählt.
Ihre Eltern lebten nicht mehr, als sie einen englischen Aristokraten heiratete, aber wie ihre noch lebenden Verwandten hätten sie darin einen entschiedenen Akt des Ungehorsams gesehen. Die Familie meines Vaters hingegen verurteilte lieber auf die stille Art.
Obwohl wir in den ersten Jahren meines Lebens in Bedford, England, lebten, bin ich 1944 in Islington, einem Stadtteil von London geboren worden. Meine erste Erinnerung ist, dass ich gestillt wurde. Ich erinnere mich, wie die Brustwarze meiner Mutter an meinen Gaumen stieß, ich sofort in eine Art Ekstase fiel und dann losließ und einschlief. Vielleicht habe ich mich an diesen Moment nur dieses einfachen Vergnügens und der spürbaren Zufriedenheit wegen so lange erinnert. Wahrscheinlicher ist aber, dass ich ihn in Erinnerung behalten habe, weil die Zeiten echter Nähe zu meiner Mutter so selten waren.
Als ich zwei oder drei war, begannen meine Eltern, regelmäßig nach Irland zu fahren, wobei sie mich wie Gepäck mit sich schleppten. Die Welt bereisen und den Sommer auf dem Land verbringen, war, was Menschen ihrer Klasse so zu tun pflegten. Ungeachtet des Tabus, dass sie eine Verbindung über kulturelle Grenzen hinweg eingegangen waren, und des rebellischen Zugs meiner Mutter taten meine Eltern im Großen und Ganzen das, was von ihnen erwartet wurde. Allerdings gab es einen Punkt, bei dem sich meine Mutter nicht fügen wollte: Sie bestand gegen den urenglischen Willen meines urenglischen Vaters darauf, mich Jahr für Jahr zu Besuch auf unseren Stammsitz in Irland mitzunehmen.
Wir fuhren zu zweit mit dem Auto an die Grenze zwischen den Countys Kerry und Cork, wo wir, bevor wir die enge Straße hinauf zum Pass von Keimaneigh nahmen, unsere Geschwindigkeit ehrerbietig drosselten. Auf der Passhöhe, wo die Straße endgültig durch den Fels schnitt, berührten sich über uns beinahe die Berge. Dort hielt meine Mutter an, und wir stiegen aus dem Auto, bewunderten voller Ehrfurcht die Felsen, die, wie es aussah, nur von einem Band aus Heide festgehalten wurden, einem Band, das vor lauter Anstrengung dunkelpurpur angelaufen schien. Über dem Geräusch der Zwillingsbäche, deren Wasser auf beiden Seiten des Passes über den schwarzen Fels schoss, erzählte mir meine Mutter die Legende des Priesters, der in der Zeit der Penal Laws den Pass für eine waghalsige Flucht nutzte. Unter diesen von den englischen Besatzern den Iren auferlegten Strafgesetzen, die fünfhundert Jahre lang, bis 1916, in Kraft blieben, war es unter anderem für jede »Person der papistischen Religion« illegal, eine Schule zu betreiben oder Kinder zu unterrichten. Der Priester hatte aber nicht nur die Kinder der Gegend unterwiesen, er hatte es zudem noch im Freien getan, in einer von den Einheimischen so genannten »Heckenschule«, mit Spähern, die vor möglichem Ärger warnen sollten. Mit Gefängnis oder Schlimmerem bedroht und von berittenen englischen Soldaten und ihren Hunden gejagt, war er oben am Pass über die Kluft gesprungen und erfolgreich entkommen.
Nach einem Halt in Gougane Barra, wo wir in den einst von Mönchen bewohnten Höhlen meditierten, betraten wir in aller Stille den anmutigen Kirchenraum von Finbarr’s Oratory, einer Kapelle, die auf ihrer eigenen heiligen Insel stand. Dann sausten wir in nordwestlicher Richtung nach Kerry und an den Familiensitz Castle of Ross am Ufer des Loch Léin, dem größten der drei Seen Killarneys. Sobald meine Mutter aus dem Auto ausgestiegen war, zündete sie sich eine Zigarette an, eine Woodbine, inhalierte und entließ eine Ringellocke aus Rauch, während sie sich vornüberbeugte, um den Rock ihres Pariser Kostüms glattzustreichen. Vorsichtig die Schlammpfützen umrundend, betrachtete sie das Gebäude mit einem taxierenden Blick, als ob sie es möglicherweise kaufen wollte. Sie musterte den oberen Teil des Schlosses, der nun den Elementen ausgesetzt war, denn das Dach war, um Steuern zu sparen, zur Zeit der Engländer entfernt worden, sie musterte auch die Sau, die mit ihrem Wurf quiekender rosa Ferkel an der Steinmauer lag. Ihre Zigarette ausdrückend und zurück zum Auto gehend, gab sie abschließend noch eine spitze Bemerkung von sich: »Das Dach hat auch noch niemand repariert.«
Diese Pilgerfahrten waren der sichtbare Beweis dafür, dass meine Mutter ihr irisches Erbe nicht ganz aufgeben konnte, dass sie noch immer die Anziehungskraft der alten Orte, aber auch eine Art Verantwortungsgefühl verspürte, mir den Kontakt zur Vergangenheit zu ermöglichen. Fast überall sonst aber lehnte sie die Kultur und die Überzeugungen ihrer Eltern als rückständig und abergläubisch ab. Sie erwartete von mir, zu einer Frau heranzuwachsen, die attraktiv und in den Kreisen meines Vaters akzeptabel war, um eine gute Heirat eingehen zu können. Darüber hinaus hielt sie mich an, den Mund zu halten und möglichst unauffällig zu bleiben. Was ich nach besten Kräften tat.
Als ich sieben war, zerstritten sich meine Eltern heftig und trennten sich. Mein Vater blieb in England, während meine Mutter und ich nach Irland, nach Cork, in ein großes georgianisches Haus am Belgrave Place 5 zogen. Eine Erklärung für die Veränderung oder für die plötzliche Abwesenheit meines Vaters erhielt ich nicht; wir waren einfach von ihm weggezogen. Diese ausbleibende Kommunikation war nicht nur auf meine Eltern beschränkt. Damals und vor allem in dieser Gesellschaftsschicht waren Kinder Anhängsel, denen keinerlei emotionale Anteilnahme entgegengebracht wurde. Dass mein Vaters so plötzlich aus meinem Leben verschwand, verwundete mich jedoch tief. Er war ein reservierter Mann und sagte mir nie direkt, dass er mich liebte, aber ich fühlte mich, auf seine ruhige Art, von ihm geliebt. Er zeichnete und malte mich. (Sein Ölporträt von mir hängt noch in meinem Wohnzimmer.) Ich habe Erinnerungen daran, wie er Klavier spielte, da war ich noch sehr klein, und er sein Spiel unterbrach, mich mit warmer Stimme zu sich an den Klavierschemel rief und mich auf seinen Schoß setzte. Er legte dann immer meine Hand auf die seine. Meine Hände waren zu klein, um den Bewegungen seiner Finger folgen zu können, aber er wollte mich, während er spielte, den Rhythmus der Musik spüren lassen. Ich erinnere mich auch daran, wie er mich auf seine Füße stellte und mit mir in unserem Haus in Bedford tanzte.
Am Belgrave Place lebten wir mit zwei Geschwistern meiner Mutter zusammen. Mein Onkel Patrick war einst ein berühmter Sportler gewesen, der in ganz Irland als der Langläufer und Speerwerfer Rocky Donoghue bekannt war. Er war Junggeselle geblieben und arbeitete als Chemiker bei den städtischen Gaswerken. Meine Tante Biddy hatte sich in ihrer frühen Kindheit den Rücken gebrochen, eine Verletzung, die sie zur Invalidin gemacht hatte. Sie war oft, vielleicht drei Mal jährlich, im Krankenhaus und tat sich schwer mit dem Gehen. Biddy war liebenswürdig zu mir. Sie fand immer warme Worte und interessierte sich für mich. Ich gewann sie mit der Zeit sehr lieb und umsorgte sie, so gut ich konnte. Ich erinnere mich, dass ich ihr wieder und wieder Jane Eyre in ganzer Länge vorgelesen habe. Onkel Pat wirkte eher gleichgültig – nicht grausam oder kalt, hin und wieder sogar für einen kleinen Schwatz bereit, aber immer mit seinen eigenen Sachen beschäftigt. Er interessierte sich nicht allzu sehr für die Gedanken oder Wünsche eines Kindes, im Grunde genommen auch nicht für die Anliegen aller anderen im Haus. Da meine Mutter nun meine einzige Bezugsperson war, ließ sie ihren Gefühlen freien Lauf: »Du bist ein einziges Ärgernis«, schalt sie mich, »und mein Leben wäre viel besser ohne dich.«
Lorbeer
Außerhalb des Hauses hatte ich nur wenig Freunde. Mein Nachname wies darauf hin, dass ich nicht nur anders, sondern auch potenziell gefährlich war. Die Beresfords gehörten zu den mächtigsten Familien in Irland. Wenn ein Kind in der Nachbarschaft oder auf dem Schulgelände mir wehtun, mich beleidigen oder aus Versehen mit mir aneinandergeraten würde, könnte ich den Vorfall einem Verwandten berichten, der womöglich die ganze Familie des Kindes in den Ruin treiben würde. Würden etwa Kinder die politischen Ansichten ihrer Eltern in meiner Hörweite ausplappern, so gäbe es keine Garantie dafür, dass dies nicht auch der Beresford-Familie zu Ohren käme. Meistens gingen mir die Leute in Cork einfach aus dem Weg.
Das Haus am Belgrave Place gehörte zu einem Ensemble aus zehn Gebäuden, die als Einheit an einem großen gemeinsam genutzten Vorplatz gebaut wurden. Es war wahrscheinlich Anfang des achtzehnten Jahrhunderts als Offiziersquartier gebaut worden. Lange bevor wir dort einzogen, hatte jemand ein kleines Arboretum auf den Vorplatz gepflanzt. Dies wurde mein Spielplatz, und wohl weil ich keine anderen Spielkameraden hatte, schienen die Bäume mich willkommen zu heißen. Sie wurden meine Freunde. Ich setzte meine kostbarste Puppe, die aus Amerika mit dem lockigen roten Haarschopf und dem Porzellangesicht mit den blinzelnden blauen Augen, in den Schutz des riesigen Lorbeerbaums. Das war der Baum, in dessen Stamm ich meine Puppenstube einrichtete, wo der Duft der Lorbeerblätter meinen Spielzeugherd und alle meine weniger wichtigen Puppen umwehte (in fester Rangordnung, die bei den schlaffen Stoffpuppen endete). Wie mein Tränenstein, den zu entdecken noch ausstand, trösteten mich die Bäume mit ihrer immensen Größe. Ihre Präsenz besaß eine Verlässlichkeit, die mir wohlwollend vorkam, und sie veränderten sich unablässig und auf eine Weise, die ich unbedingt verstehen wollte. Auch nachts gelangten die Bäume in meine Träume, wenn sich unter ihren langen Schattengirlanden die Landschaft meiner Schlafzimmerwand veränderte.
Zwei Türen weiter, in der Nr. 7 lebte ein Mann, von dem ich glaubte, er könne mir helfen, die Bäume kennenzulernen. Dr. Barrett war ein Naturheilkundler, der eine Drahtbrille trug und keine Kinder hatte. Er lebte mit Frau und Schwester, die beide auch Drahtbrillen trugen, eine Gemeinsamkeit, der mein junges Gemüt manche Bedeutung zumaß. An zahlreichen Tagen stellte ich mich hinter einen Lorbeerbusch gegenüber seiner Tür, der mich durch seinen Vorhang gesprenkelten Laubs vor Blicken schützte, und wartete darauf, dass Dr. Barrett nach Hause kam. Wenn es so weit war, passte ich ihn an seiner Eingangstür mit meiner ersten vorbereiteten Frage ab, und von da an ergab sich unsere Lehrstunde wie von selbst.
Im Herbst dieses ersten Jahres nach der Trennung meiner Eltern geschah etwas Seltsames. Ein überaus hoher und überaus dünner Baum, auf den ich ein Auge geworfen hatte, war plötzlich mit kleinen eiförmigen roten Früchten übersät, die ich in Ermangelung eines anderen Worts für Äpfel hielt. Ich hatte noch nie etwas gesehen wie diesen Baum, der über zehn Meter hoch war und vor farbenfrohem Überfluss strotzte, und ich war von der Überzeugung besessen, dass es sich um ein seltenes und besonderes Lebewesen handeln musste. Der Baum sprach zu mir, so ungewöhnlich, wie er war, und ich wollte unbedingt wissen, was er mir zu sagen hatte. Also nahm ich meine Stelle im Gebüsch ein, und als Dr. Barrett auf der Stufe vor seiner Haustür stand, um seine Welt zu betrachten, näherte ich mich ihm und hielt ihm einen der Äpfel vor seine drahtbebrillten Augen. »Kann man diese Äpfel essen?« Er sagte ja, ich könne sie essen, und erklärte, dass der Schatz, den ich in den Händen hielt, eigentlich eine Mehlbeere war, die Frucht einer Weißdornart, die er als amerikanischen Weißdorn, Crataegus douglasii kannte. Ich nahm einen Bissen, ein süßes und herbes Geschmackserlebnis, eine köstliche Entdeckung ganz für mich allein.
Von da an war das Arboretum nicht mehr nur ein Ort der Kameradschaft und des Spiels, sondern auch einer für Experimente und Offenbarungen. Ich erinnere mich daran, wie mir Dr. Barrett erzählte, dass die Blätter eines anderen Weißdorns – die geläufige Variante, die ich später bei ihrem lateinischen Namen als Crataegus monogyna kennenlernte – essbar und gut für unsere Gesundheit sind. Mit dieser Information ausgestattet, kletterte ich so weit ich konnte den betreffenden Baum hinauf, ertrug seine Dornen und probierte seine Blätter. Sie schmeckten wie Salat.
Als ich an einem anderen Tag um den Lorbeerstrauch herumging, trat ich auf einen seiner kleinen schwarzen Samen. Die äußere Samenhülle, die Testa, riss unter meinem Fuß leicht auf, und das Aroma, das entwich, war unglaublich. Ich hob den Samen auf und schälte mit dem Fingernagel die Testa ab, unter der etwas Weißes und Glänzendes zum Vorschein kam. Der Geruch intensivierte sich. Er entsprach exakt dem Duft des Baumes selbst, nur konzentrierter. Ich konnte kaum glauben, dass der Baumgeruch so stark in dem kleinen Samen enthalten war. Das Erstaunen darüber habe ich immer noch deutlich im Kopf – sowohl das Gefühl, die Verbindung zwischen dem Samen und seinem Baum entdeckt zu haben, als auch das Erstaunen über die Verbindung selbst.
Dr. Barrett brachte mir auch, da ich darauf bestand, die lateinischen Namen der Arten bei, auf die wir stießen. Diese Information war an sich bereits Belohnung genug, aber jedes Mal, wenn ich etwas Neues im Gedächtnis behalten hatte, zog Dr. Barrett eine braune Tüte mit Schokoladendatteln hervor und forderte mich auf, eine zu nehmen. Er war ein sehr netter Mann.
Später in diesem Herbst begann ich mit der Schule, wo ich von einer grobknochigen rotgesichtigen Frau namens Miss Barrett, der Schuldirektorin, unterrichtet wurde. Sie war nicht mit dem Naturheilkundler verwandt, aber durch die positive Assoziation, die ich mit dem Namen verband, erschien sie mir vertrauenswürdig und ungefährlich. Als mich Miss Barrett nach meinen Sommerferien ausfragte, zählte ich altklug triumphierend die lateinischen Namen aller Bäume auf, die vom Klassenzimmerfenster aus zu sehen waren. Ich erinnere mich nicht mehr an ihre unmittelbare Reaktion, weiß aber, dass sie meiner Mutter einen Brief schrieb.
Am Samstagnachmittag derselben Woche schleppte mich meine Mutter zu Miss Barretts Bungalow. Die Art, wie sie an die Eingangstür klopfte, verriet, wie verärgert sie über die ganze Sache war, was sie mir bereits unmissverständlich klargemacht hatte. Drinnen stand ein Teetisch, gedeckt für drei, mit Marietta-Keksen. Wir nahmen Platz, ich vor Angst erstarrt, meine Mutter steif und abweisend. Miss Barrett schenkte Tee ein und erzählte, obwohl sie es wahrscheinlich bereits in ihrem Brief berichtet hatte, den Vorfall mit den lateinischen Namen. Sie meinte gegenüber meiner Mutter, sie habe den Eindruck, ich sei hochintelligent, und meine Mutter wurde innerlich so starr, dass ich mir vorstellte, sie würde gleich zerbrechen. Die verbleibende Zeit nickte sie mal hier, mal da mit dem Kopf und ging dann mit mir in entsetzlicher Stille nachhause. Dort angekommen schalt sie mich, ich hätte nur Aufmerksamkeit auf mich ziehen wollen. Niemals, erklärte sie mir, würde eine kluge Frau die Chance erhalten, in eine vermögende Familie zu heiraten. Dabei hatte sie selbst eine gute Erziehung genossen. Männer wollten eine Schlossherrin, jemanden, der zuverlässig ihren Haushalt und ihre Bediensteten führt, und keine Frau, die sie mit Argumenten besiegt. Ich sollte in Zukunft meinen Mund halten und weitere Szenen vermeiden, für die sie sich schämen müsste. Während ihrer Tirade duckte ich mich halb hinter die Couch, wo ich mich sicher fühlte. Als sie fertig war, nickte ich einfach. Wir haben nie wieder darüber gesprochen.
Nach zwei Jahren der Trennung war es vor allem die Entscheidung meiner Mutter, für ein Jahr nach England zurückzukehren, wo wir in London mit meinem Vater zusammenlebten, gerade lange genug, damit ich am Brompton Oratory in Knightsbridge meine Firmung erhalten konnte. Dann, als ich beinahe zwölf war, kehrte meine Mutter mit mir im Schlepptau nach Irland zurück. Ich bemühte mich weiterhin sowohl in der Schule als auch zu Hause redlich, keine Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen, und fand einen Weg, so zu leben, dass ich damit zurechtkam und niemanden störte. Dieser Zustand in der Deckung wurde zu meinem Normalzustand.
Doch dann löste sich innerhalb eines Jahres das wenige, was mich bis dahin noch an die Erde gebunden hatte, noch weiter auf. Ich wurde zur Waise.
Der gelbe Farbkasten
Als ich acht Jahre alt war, schenkte mir meine Mutter einen Farbkasten. Es war das einzige Geschenk, das ich erinnere, von ihr bekommen zu haben. Sie hatte mich dabei entdeckt, wie ich mit farbigen Kreidestiften auf die Unterseite des Esszimmertischs malte. Ich malte immer auf Papierreste, die irgendwo herumlagen, selbst auf kleine Stücke Zeitungspapier. Verängstigt sah ich zu, wie sie die Kunst begutachtete und mich dann, ohne ein Wort zu sagen, anblickte. Anderntags ging sie in die Stadt und kaufte mir hübsche Wasserfarben von Winsor&Newton.
Ich liebte diesen Farbkasten, ließ dafür sogar meine Puppen links liegen. Er war lang und schmal mit einem gelben Deckel, der sich nach hinten aufklappen ließ und eine Fläche bildete, die man als Palette zum Mischen benutzen konnte. In dem Kasten lag nur ein Pinsel, aber meine Mutter hatte noch ein paar weitere dazugekauft. Ein etwas größeres Exemplar war aus Kamelhaar gefertigt. Das wurde mein Lieblingspinsel, denn die hellbraunen Haare fühlten sich unter meinen Fingern lebendig an.
Ich erinnere mich, dass ich einmal, ich war etwa zwölf, mit meinen Wasserfarben draußen war und Blumen malte. Ich brauchte frisches Wasser und lief mit dem Marmeladenglas voll schmutzigen Wassers und eingeweichten Pinseln ins Haus. Ich konzentrierte mich darauf, vorsichtig das Glas zu tragen, und bemerkte meine Mutter zunächst nicht.
Sie lehnte mit einem Arm am Kaminsims und hielt eine Zigarette in der herabhängenden Hand, deren Rauch in den Kamin zog. Sie las so etwas wie einen Brief, einen amtlichen wohl, wobei ihre Augen jeder Zeile folgten. Plötzlich rief sie, in ihrer Stimme lag beinahe etwas Triumphierendes, »Jack«. Ich hielt inne.
»Jack, der Bastard, ist tot«, brüllte sie und lachte, als hätte sie gerade ein Spiel gewonnen. Ich nahm, was sie gesagt hatte, beim Wort: Mein Vater ist tot. Ich drehte mich auf der Stelle um und ging in die Küche, wo ich meinen Kamelhaarpinsel, in dem spielerischen Glauben, die weichen Borsten seien meines Vaters Haare, mit der ganzen Zärtlichkeit auswusch, die mein junges Leben aufbringen konnte. Die Umstände seines Todes habe ich nie erfahren und ihn nie mehr wieder gesehen.
An dem Tag, an dem der Autounfall passierte, bei dem, nur einige Monate später, meine Mutter zu Tode kam, war ich mit dem Fahrrad gestürzt. Ich hatte mir den Kopf gestoßen und eine Gehirnerschütterung erlitten. Als mich ein Nachbar fand, wusste ich nicht, wo ich war, und er brachte mich nach Hause. Meine Mutter war für einen Besuch ausgegangen und jemand sagte, man würde sie anrufen, damit sie nach Hause käme. Sie würde schon bald bei mir sein. Ich wartete, aber sie kam nicht. Als es Abend wurde, lauschte ich nach dem Geräusch ihrer Absätze im Flur, bis ich schließlich einschlief.
Noch vor der Morgendämmerung wurde ich geweckt, ein blasses Licht drang durch die Vorhänge. Ein Fahrer namens Johnny Hayes war gekommen, um mich abzuholen. Ich kannte Johnny, der mich schon früher gefahren hatte, aber er wollte mir nicht erzählen, wohin ich so eilig gebracht wurde und warum. Die Straßen waren so gut wie leer und das Auto fuhr schneller, als ich es jemals erlebt hatte, sicherlich schneller als erlaubt. Die aufgehende Sonne tauchte die Wolken hinter den linken Fenstern in ein sanftes Rosa. Den Kopf auf eine Hand gestützt, starrte ich in den Himmel, der in ein tiefes Rot überging. Deine Mutter ist tot, schienen die Wolken wieder und wieder zu sagen.
Als das Auto am Mallow General Hospital vorfuhr, hatte Johnny nicht einmal Zeit, seine Handschuhe auszuziehen, bevor ich aus dem Wagen sprang. Ich lief an der Notaufnahme vorbei und, einem Bauchgefühl folgend in den linken Flügel, wo ich meine Mutter vermutete, rannte einen schmalen Korridor hinab, auf dessen linker Seite Krankenzimmer lagen, und kam in einem schwach beleuchteten Zimmer mit nur einem einzigen Bett an. Als ich auf das eiserne Bettgeländer zuging, sah ich meine Mutter. Ihre Glieder und sogar ihr Hals waren mit zerrissenen Leinenstreifen an den Bettrahmen gebunden. Ein sauberes weißes Leintuch bedeckte sie bis zum Kinn. Die Bänder waren fleckig, sahen aus wie gebraucht. Der Kontrast zwischen den schmutzigen Streifen und dem sauberen weißen Leintuch versetzte mich in Angst und Schrecken, ebenso ihre Haut, die die Farbe von Kalk angenommen hatte. Als ich sie so liegen sah, hatte ich keinen Zweifel, dass sie verblutet war.
Ich beugte mich herab, um sie auf ihre kalte Wange zu küssen, sie zu berühren, mich als Teil von ihr zu fühlen, um etwas festzuhalten, das für immer von mir gehen würde. Als ich meinen Kopf wieder hob, rauschte der Chefarzt in den Raum, gefolgt von der Oberschwester und mehreren Krankenschwestern, die sich alle gegenseitig, aber auch mich anblafften. »Wie kann man nur dieses Kind hier hineinführen und seine Mutter in diesem Zustand sehen lassen? Wie fürchterlich.«
Ich habe keine Erinnerung daran, weggeführt zu werden. Ich erinnere mich nicht, von Johnny Hayes nach Hause gefahren worden zu sein. Ich erinnere mich aber genau, dass ich verzweifelt meinen Vater herbeisehnte, der auch für immer von mir gegangen war.
Kurz nach dem Unfall wurde ich zum Mündel der irischen Justiz bestimmt und musste in Cork vor einem Richter erscheinen, dem die Aufgabe zukam, wie er selbst sagte, zu entscheiden, was mit mir geschehen sollte. Das Schicksal der erbärmlichen Klasse von Waisen, der ich nun angehörte, bestand, zumindest der katholischen Kirche zufolge, gewöhnlich darin, in eine Magdalenen-Wäscherei gesperrt zu werden, fürchterliche Gefängnisse, die ursprünglich für die »Beherbergung« von Prostituierten und unverheirateten Müttern errichtet worden waren und sich Jahrzehnte später als alptraumhafte Brutstätten von Missbrauch und Tod herausstellen sollten. Laut dem Richter hätte die Entscheidung, mich als Packerin in eine örtliche Wäscherei namens Sunday's Well zu stecken, auf der Hand gelegen. Mein Fall allerdings gestaltete sich nicht so einfach.
Mit meiner grünen und schiefergrauen Schuluniform wurde ich in das Richterzimmer geführt. Zunächst tat der hinter einem riesigen dunklen Holztisch sitzende Richter einige Minuten lang seine Bedenken kund, was wohl mit ihm geschehen würde, würde er eine Beresford in die Wäschereien schicken. Schließlich kam er um den Tisch herum und teilte mir mit, dass mein Onkel Pat angeboten habe, mich aufzunehmen und für mich zu sorgen, bis ich einundzwanzig bin. Ob ich denn willens sei, bei Patrick O’Donohue am Belgrave Place zu leben, fragte der Richter. Ich antwortete mit ja, was mir ein erleichtertes Lächeln von seiner Seite einbrachte.
Mit dieser Entscheidung war allerdings die Drohung, in einer Wäscherei zu landen, nicht ganz vom Tisch. Meine Freiheit hing davon ab, ob ich mich an eine Handvoll Bedingungen hielt, die der Richter bei diesem ersten Zusammentreffen gestellt hatte: Ich sollte alle drei Monate bei Gericht erscheinen, um sicherzustellen, dass ich nicht auf Abwege geriete. Meine materiellen Bedürfnisse – vor allem Geldmittel für Schule und Kleidung – würden, von den Justizbehörden verwaltet, aus meinem Erbe bestritten. Mir würde zudem ein Ausgangsverbot nach zehn Uhr auferlegt. Bei einer Verletzung dieser Bedingungen und auch, wie er annehme, wenn mein Onkel krank würde, würde ich in Sunday's Wells enden.
So erschreckend diese Aussicht war, ich hatte andere, unmittelbarere Sorgen. Dass ich nun eine Waise war, machte mich nicht unbedingt interessanter für Onkel Pat. Er hatte sich zwar vor Gericht für mich eingesetzt, und dafür war ich dankbar, aber das hieß nicht, dass er sich ähnlich verhalten würde, wenn es darum ging, sich tatsächlich um mich zu kümmern. Er hielt an den gleichen Routinen fest, die er auch, bevor er mein gesetzlicher Vormund wurde, gepflegt hatte, und verschwendete offenbar keinen Gedanken an mich. Vielleicht weil ich von meiner Mutter bereits darauf konditioniert war, nahezu unsichtbar zu sein, war es für Erwachsene offenbar einfach, so zu tun, als ob ich nicht existierte. Obwohl in der Zeit um die Beerdigung und an der Beerdigung selbst mehr Menschen im Haus ein- und ausgingen als in den Jahren zuvor, dachte niemand daran, mich zu fragen, ob es mir gut geht. Tante Biddy, auf deren Mitgefühl und Herzlichkeit ich immer rechnen konnte, war damals zur Behandlung eines Bauchspeicheldrüsenkrebses im Krankenhaus; sie ist ein paar Jahre später gestorben. Ich verdrückte mich letztlich in eine Ecke des Wohnzimmers und blieb dort. Niemand dachte daran, mir wenigstens etwas zu essen zu bringen.
Ich weiß nicht, wie lange ich ohne Essen blieb, erinnere mich aber, dass die Beerdigungsaktivitäten anfingen und wieder endeten; es konnten also Tage gewesen sein. Eine Freundin meiner Mutter, Bridie Hayes, kam ins Haus. Als sie in die Küche kam, fragte sie die dort versammelten Erwachsenen nach meinem Verbleib. Niemand antwortete, aber sie suchte mich, entdeckte mich in meine Ecke gekauert und kam geschwind zu mir. »Hat denn niemand an das Kind gedacht?«, fragte sie in die zur Seite blickende Runde schauend. »Hat ihr jemand zu essen gegeben?« Ihre Fragen stießen auf Schweigen; ich meinte sogar eine gewisse Verlegenheit wahrgenommen zu haben. Während die übrigen Erwachsenen wie erstarrt auf ihren Plätzen blieben, ging Bridie daran, mir Rühreier zu machen. Es war das erste Essen seit dem Tag des Unfalls, und diese Rühreier waren gewiss das Beste, das mir je in den Mund geraten ist, besser als jede Mahlzeit in den besten Restaurants, in denen ich seither gegessen habe. Ich hatte solchen Hunger und Durst, und während ich aß, machte Bridie mit bösen Blicken den anderen die Hölle heiß. Sie sagte, es wäre eine Schande, mich dermaßen vernachlässigt zu haben. Aber als ich zu Ende gegessen hatte, verließ sie das Haus, und keiner machte mehr Anstalten, sich um mich zu kümmern.
Einige Zeit später war ich allein in der Küche und hatte fürchterlichen Hunger. Ich erinnere mich, wie ich an den Brotschrank ging und einen Schädellaib aus Thompsons Bakery fand – ein rundes Krustenbrot mit einem eingeritzten X, mit dem ein Auseinanderbrechen beim Aufgehen verhindert werden sollte. Ich hatte solchen Hunger, und meine Hand war klein genug für ein Loch, das ich in die Seite gerissen hatte. Stück für Stück pulte ich das weiche weiße Innere heraus und aß es, bis der Laib bei intakter Kruste ausgehöhlt war. Obwohl Onkel Pat die leere Brothülse im Schrank gefunden haben musste, hat er mir gegenüber nie ein Wort darüber verloren.
Ich weiß nicht genau, wo und wann Onkel Pat aß, ob zu früh fürs Frühstück oder zu spät für die Hauptmahlzeit, aber in unseren ersten gemeinsamen Monaten erinnere ich mich an keine Mahlzeit, die wir zuhause zusammen zu uns genommen hätten. Der Mangel an Essen und meine Trauer forderten – selbstredend – körperlichen Tribut. Sonntags (es passierte anscheinend immer an Sonntagen) kippte ich oft vor Unterernährung um und wurde dann auf dem Boden liegend gefunden. Ich war so schwach, dass ich anscheinend alle paar Wochen eine Halsentzündung bekam. Obwohl ich, wenn es überhaupt jemanden scherte, vor aller Augen immer mehr zusammenfiel, kümmerte sich kein Mensch darum, etwas für mein Wohlergehen zu tun. Ich wurde dünn wie ein Hering.
Ich ging wie gewöhnlich zur Schule und traf regelmäßig meinen Rechtsanwalt, hatte mit Gerichtsdienern und anderen Amtsträgern zu tun. Offenkundig machte sich keiner von ihnen Gedanken über meinen Zustand. Allerdings bleibt mir die Vernachlässigung durch Onkel Pat bis heute am wenigsten erklärlich, vor allem angesichts einer ganz anderen Version von ihm, die ich in späteren Jahren kennen und lieben lernen sollte. Meine Mutter meinte immer, ihr Bruder stecke mit dem Kopf in den Wolken und hätte keinen blassen Schimmer, wie Familien funktionieren. Aber nicht einmal zu merken, dass ein Kind in seiner Obhut dringend essen muss? Das bleibt mir ein Rätsel.
Aus Verzweiflung ergriff ich schließlich selbst die Initiative und wurde erfinderisch. Nachdem ich im Haus ein in Leinen gebundenes französisches Kochbuch gefunden hatte, beschloss ich, für mich zu kochen. Ich fragte Onkel Pat, der immer bereit war, über Bücher zu sprechen, was es mit dem Band auf sich hatte, und er meinte, das Buch stamme von meinem Vater und verdanke sich wohl dem Umstand, dass dieser in Bordeaux einen Weinberg besessen habe. (Später wurde mir klar, dass er damit erklären wollte, wieso es auf Französisch geschrieben war.) Damals hatte ich bereits oft genug beim Kochen zugeschaut, um einen einfachen Plan zu fassen. Ich zog einen Topf hervor, holte vier Kartoffeln und wusch sie. Die Kartoffeln wanderten in den Topf, ich bedeckte sie mit Wasser und setzte das Ganze auf den Gasherd. Das Kochbuch, dachte ich, würde mir Auskunft über die entscheidende noch fehlende Information liefern: Wie lange dauert es, Kartoffeln zu kochen. Sollte ich mit Sekunden, Minuten oder Stunden rechnen? Ich blätterte durch die Seiten, um es herauszufinden.
Doch über gekochte Kartoffeln war keine brauchbare Information zu finden. Ich beschloss also, selbst die Kochzeit herauszufinden. Mit einer Gabel bewaffnet, brachte ich die Kartoffeln zum Kochen und pikste sie dann alle paar Minuten, um festzustellen, ob sie schon weich geworden waren. Anfangs waren sie noch steinhart und entwischten mir in dem sprudelnden Wasser. Ich versuchte sie immer wieder zu piksen, mit dem gleichen Ergebnis. So langsam kamen mir Zweifel – vielleicht hatte ich einen entscheidenden Schritt übersehen. Doch ich blieb dabei, schloss das Kochbuch und stellte es mit einer unbewussten Geste der Gewissheit an seinen Platz im Regal zurück. Minuten später gelang es mir, die Haut anzustechen, und nach ein paar weiteren Minuten ging die Gabel durch die Kartoffel durch. Ich hatte es geschafft.
Ich drehte das Gas ab, goss das Wasser ab, ohne mich groß zu verbrennen, und schüttete die heißen Kartoffeln auf einen kalten Teller. Ihre Haut





























