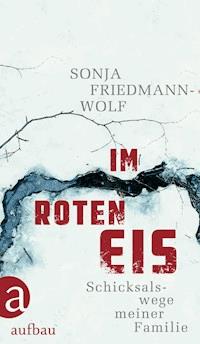
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Berlin – Moskau – Gulag – Vilnius – Tel Aviv. Sonja Friedmann-Wolf schildert die Gewalt des Terrors aus der Perspektive des Mädchens bzw. der traumatisierten Frau. Ihre Eltern, Ärzte, Juden und Kommunisten, mussten vor den Nazis fliehen. 1934 kamen sie mit den beiden Kindern nach Moskau, wo der Vater 1938 als angeblicher „trotzkistischer Gestapospion“ zum Tode verurteilt wurde. Die Mutter beging 1940 Selbstmord. Sonja war mit 17 Jahren alkoholabhängig und NKWD-Informantin. Als sie sich ihrer eigenen Verstrickung in das stalinistische System voll bewusst wurde, wollte sie sich umbringen, der Bruder rettete sie. Beide wurden 1941 nach Kasachstan deportiert. Die Ehe mit dem litauischen Zionisten Israel Friedmann erleichterte Sonjas zeitweise den Alltag in der Verbannung. Im Oktober 1944 brachte sie die Tochter Ester zur Welt. Ihr Dasein im Lager beschreibt Sonja ebenso rückhaltlos wie ihre Krisen im Jahrzehnt nach der Rückkehr in „normale Verhältnisse“. Trotz Krankheiten und neuer Nachstellungen des NKWD betrieb sie die Rehabilitierung ihres Vaters und die Ausreise (ab 1956). Lion Feuchtwanger, der sich beim sowjetischen Generalstaatsanwalt für ihren verhafteten Vater eingesetzt hatte, wurde für Sonja noch einmal zum „Rettungsanker“. In den Briefen, die sie an den Schriftsteller bis zu seinem Tod im Dezember 1958 richtete, skizziert sie den Auftakt ihrer Erinnerungen. Eine bewegende Familiengeschichte zwischen Berlin, Moskau und Tel Aviv, wie sie nur das 20. Jahrhundert prägen konnte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 643
Veröffentlichungsjahr: 2013
Sammlungen
Ähnliche
Sonja Friedmann-Wolf
IM ROTEN EIS
Schicksalswege meiner Familie
1933–1958
Herausgegeben von Reinhard Müller und Ingo Way
Impressum
Mit einem Nachwort von Ester Noter
Mit 39 Fotos und Faksimile
ISBN 978-3-8412-0647-3
Aufbau Digital,
veröffentlicht im Aufbau Verlag, Berlin, August 2013
© Aufbau Verlag GmbH & Co. KG, Berlin
Die Originalausgabe erschien 2013 bei Aufbau, einer Marke der Aufbau Verlag GmbH & Co. KG
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jegliche Vervielfältigung und Verwertung ist nur mit Zustimmung des Verlages zulässig. Das gilt insbesondere für Übersetzungen, die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen sowie für das öffentliche Zugänglichmachen z.B. über das Internet.
Umschlaggestaltung hißmann, heilmann, Hamburg
unter Verwendung eines Motivs von plainpicture/Etsa
E-Book Konvertierung: le-tex publishing services GmbH, www.le-tex.de
www.aufbau-verlag.de
Inhaltsübersicht
Cover
Impressum
I
Kapitel 1. Meine Eltern
Kapitel 2. »Juden raus!«
Kapitel 3. Schweizer Intermezzo. Begegnung mit Lion Feuchtwanger
Kapitel 4. Ankunft in Moskau. Das MOPR-Kinderheim
Kapitel 5. Immer noch in Iwanowo. Die Stassowa
Kapitel 6. Vater geht unter die Filmschauspieler. Die Tretjakowka. Wir ziehen in den »Weltoktober«
Kapitel 7. Ein Subbotnik in unserem Hof. Betty und Mathilde
Kapitel 8. Das Ehepaar Schmückle
Kapitel 9. Ein blinder alter Bolschewik. »Die Geschwister Oppermann«
Kapitel 10. Mein dreizehnter Geburtstag. Ernst Busch singt. Lion Feuchtwanger hält eine kleine Ansprache
Kapitel 11. Silvester 1936/37
Kapitel 12. Schädlinge sind plötzlich überall
Kapitel 13. Die Verhaftung des Genossen Schmückle
Kapitel 14. Auch blinde alte Bolschewiken können Volksverräter sein
Kapitel 15. Ich mache die Bekanntschaft eines Helden. Vater meldet sich als Zeuge
Kapitel 16. »Bürger Wolf, Sie sind verhaftet von den Organen des NKWD!«
Kapitel 17. Mutter sucht Hilfe bei Wilhelm Pieck und Walter Ulbricht
Kapitel 18. Ein Gefängnis von außen
Kapitel 19. Ich wohne einer Komsomolversammlung bei 126
Kapitel 20. Übergriffe. Doktor Petrow
Kapitel 21. Wie sag ich’s Mutter?
Kapitel 22. Unser Eigentum wird beschlagnahmt
Kapitel 23. Mathilde geht
Kapitel 24. Ich dringe bis zu Dimitroff vor. Unsere letzte Hoffnung – Lion Feuchtwanger
Kapitel 25. Bei Staatsanwalt Wyschinski. Auch Mutter geht 185
Kapitel 26. Von den Deutschen aus- und von den Russen eingebürgert
Kapitel 27. Georgi Romanowitsch
Kapitel 28. Besuch des alten Mannes
Kapitel 29. Sonja oder Anna? Anna
Kapitel 30. Ich kooperiere
Kapitel 31. »Aber wat denn fürn Kleener?«
Kapitel 32. Und nun muss gleichfalls gegangen werden
Kapitel 33. Ich blieb
II
Kapitel 1. Der Krieg. Betty meldet sich freiwillig
Kapitel 2. Der Krieg. Ich werde zwangsweise nach Nord-Kasachstan verschickt
Kapitel 3. Der Krieg. Im Kolchos. Die »Arbeitsarmee«
Kapitel 4. Der Krieg. Hunger tut weh
Kapitel 5. Der Krieg. Sonja oder Anna? Sonja
Kapitel 6. Der Krieg ist aus. Statt in die Freiheit, wandre ich ins Gefängnis
Kapitel 7. Im Karlag
Kapitel 8. Bei Mann und Kind in Sowjetlitauen
Kapitel 9. Sonja oder Anna? Wodka
Kapitel 10. Und wiederum heißt es: »Juden raus!«
Kapitel 11. Auch Götter sind sterblich. Die Epoche der späten Rehabilitierung. Der Eiserne Vorhang lüftet sich. Sonja oder Anna? Endgültig Sonja
Kapitel 12. »Willkommen in der Heimat, Genossin Wolf!« Neue Begegnungen mit alten Bekannten. Ohne Internationale durch das Brandenburger Tor
Anhang
Ester Noter: Das Leben meint es gut mit uns
Ingo Way: Sonja Wolf und ihre deutsch-jüdische Jahrhundertgeschichte
Reinhard Müller: »Menschenopfer unerhört«. Martha Ruben-Wolf und Lothar Wolf
Editorische Notiz
Abkürzungen
Anmerkungen
Bildnachweis
Dank
Kommentiertes Personenregister
Informationen zum Buch
Informationen zur Autorin/den Herausgebern
Wem dieses Buch gefallen hat, der liest auch gerne ...
I
Kapitel 1Meine Eltern
Als meine Mutter mich, ihr erstes Kind, erwartete, wünschte sie sich einen Sohn. Vater dagegen war mehr für ein Mädchen. Nach einem Spaziergang durch den Berliner Zoo, wo er sich scheinbar von dem ehelichen Glück einer Elefantenfamilie beeindruckt fühlte, kam Vater, der den Dingen gerne entschiedene handliche Bezeichnungen gab, auf den spaßigen Einfall, mich noch vor meinem Erscheinen einfach Jumbo zu nennen. Außerdem konnte so mit demselben Erfolg ein Knabe wie ein Mädchen heißen.
»Na, wie gehts denn Jumbelchen heute? Gut geschlafen?«, pflegte er sich gleich beim Aufstehen nach meinem Wohlbefinden zu erkundigen. Oder, den Erschrockenen spielend: »Was?! Jumbo hat schon wieder Hunger??«, sobald Mutter sich zu Tisch setzte.
Ich wurde auch ein richtiges Elefantenbaby: Ich wog volle neun Pfund und brachte einen außerordentlich gesunden Appetit mit in die Welt. Das geschah an einem mäßig kalten Wintertage, dem 3. Dezember 1923.
Aus Sympathie für Räterussland nannten mich meine Eltern Sonja. Vater indessen bediente sich des vollen Namens, aber nur dann, wenn er böse auf mich war, und das kam selten vor. Für ihn war und blieb ich Jumbo.
Fast zwei Jahre später, als wieder Familienzuwachs erwartet wurde, wünschten sich beide Eltern einmütig eine zweite Tochter. Doch schenkte ihnen diesmal das Schicksal einen Sohn, mein bildhübsches Brüderchen Walter.
Lothar Wolf und Martha Ruben-Wolf mit Walter und Sonja in Berlin, 1925
Meine Eltern, Dr. Martha Ruben-Wolf und Dr. Lothar Wolf, Mitglieder der Kommunistischen Partei Deutschlands seit 1921, waren ein der Berliner Öffentlichkeit seinerzeit nicht unbekanntes Ärztepaar. In Niederschöneweide führten sie zusammen eine sehr gut gehende, fast ausschließlich von Proletariern in Anspruch genommene Kassenpraxis.
Als meine Eltern in die Ehe traten, lag bereits eine langjährige berufliche Laufbahn hinter den beiden; sie standen auch beide bereits in relativ reifem Alter. Ich besaß demnach keine jungen Eltern. Und so leben sie auch in meiner Erinnerung als ein solides und gesundheitlich schon leicht angegriffenes Menschenpaar.
Mutters Aussehen war eigenartig. Wetteifernd mit ihren stets schneeweißen Ärztekitteln, wellte sich das so vorteilhaft von den starken, dunklen Brauen abstechende kurz geschnittene Silberhaar. Das hagere, strenge Gesicht, die mächtige Hakennase wirkten männlich, doch wurde dieser Eindruck durch einen zarten, wehen Zug um den Mund abgeschwächt.
Lothar Wolf, Passfoto, vor 1933
Stets hielt sich meine Mutter kerzengerade; sie ging weit ausschreitend und sprach meist im Befehlston. Wenn nörgelnde Patienten oder zeitraubende Besucher abzufertigen waren, verzog sich ihr Gesicht zu einer leidenden Grimasse, als ob sie Zahnschmerzen plagten. Ungeduldig rieb sie dann wohl die Handflächen aneinander, verkrampfte die Finger, knackte nervös mit den Knöcheln. Von Natur unbeherrscht, brauste Mutter leicht auf. Sie konnte auch grob werden, ließ sich jedoch mühelos von Vater beschwichtigen.
Der war die Ruhe und Gelassenheit in Person. Nie erhob Vater unnütz die Stimme; er fuchtelte auch nicht mit beiden Händen, wie Mutter und ich es gerne taten, beim Sprechen erregt in der Luft herum.
»Ungefähr so wird sich eine Unterhaltung unserer Vorfahren am Berge Sinai ausgenommen haben«, meinte er einmal nachdenklich, wodurch ein mehr lautes als böses Wortgeplänkel zwischen Mutter und mir jäh ins Stocken geriet.
Mein Vater, der Jude, ein Hüne von Gestalt, blond, blauäugig, mit großer Stirn, seiner stumpfen Nase und energischem Kinn, war, was das Äußere betraf, der ideale Typus eines reinrassigen Germanen. So könnte getrost, hätte ihn der Hagen nicht meuchlings ermordet, ein durch die Jahre behäbig und gemütlich gewordener Nibelungen-Siegfried aussehen.
Vater hätte sich nicht der Medizin verschreiben sollen. Er liebte seinen schönen Beruf leider auch gar nicht. Und er widmete sich ihm nur so wenig wie möglich. Und um gerecht zu bleiben, muss ich betonen, dass der große Erfolg der gemeinsam betriebenen ärztlichen Praxis meiner Eltern Mutters Energie und Tüchtigkeit zuzuschreiben war.
Brief von Lothar und Gertrud Wolf an Martha Seligsohn
Vater zeichnete leidenschaftlich gerne. Er träumte als Kind davon, Künstler zu werden. Dagegen sträubte sich aber Großmutter, die aus ihrem Einzigen unbedingt etwas »Seriöses« machen wollte.
Einige Aquarelle meines Vaters schmückten auch die Wände unserer Berliner Wohnung. Nur aus der Erinnerung heraus will es mir jetzt schwerfallen, zu beurteilen, ob diese Bilder, fast alles hell besonnte Landschaften, auch tatsächlich Kunstwerke waren. Indessen bin ich auch heute noch fest davon überzeugt, dass an meinem Vater ein zweiter Heinrich Zille verloren gegangen ist.
Mit einigen flüchtigen Bleistiftstrichen gelang es ihm, die witzigsten Karikaturen aufs Blatt zu werfen. Diese Zeichnungen, denen er selber recht wenig Wert beilegte, waren ungemein lebendig. Und sie sprühten nur so vor Humor. Sie entstanden zu Hause, in der Elektrischen, auf der Straße, in Versammlungen und in Cafés, kurz, überall dort, wo nach der Ansicht meines Vaters gerade »etwas los war«. Ob es nun ein torkelnder, mit beiden Armen liebevoll einen Laternenpfahl umklammernder Saufbold war oder eine im Konzert wie wahnsinnig tremolierende Sängerin, ein Röcke schwenkendes kesses Straßenmädchen oder redebrüllend der nach Luft japsende Hitler – sie alle lebten, von ihm gesehen, belacht oder bemitleidet, noch jahrelang in seinen voll gepfropften Alben fort.
Außer diesem Talent, mit dem er seiner Familie, unzähligen Freunden und Bekannten viel Spaß und Freude machte, war Vater noch sehr musikalisch, sehr belesen und außerordentlich sprachbegabt. Ganz frei beherrschte er die englische, französische und italienische Sprache; und er erlernte noch vor unserer Emigration das Russische.
Kommunisten wurden meine Eltern aus verschiedenen Gründen, doch brachten sie dazu dieselben Schlussfolgerungen.
Als Frau und als Ärztin empörte sich Mutter über das in Deutschland wirkende Abtreibungsverbot. Dieser zur Zeit seines Inkrafttretens nicht wenig Staub aufwirbelnde Paragraf 218 wurde für unzählige kinderreiche Arbeiterfrauen die Ursache eines frühzeitigen und qualvollen Todes. Denn er zwang sie zu häufig tragisch auslaufenden Selbsteingriffen.
Das kostenlose Verteilen an Patientinnen ihrer von der Zensur verbotenen Aufklärungsbroschüren (»Abort oder Verhütung?« und andere) sowie selbstloses Einschreiten in vielen Fällen konnte natürlich diesen armen Kreaturen keine genügend wirksame Hilfe sein. Mutter hatte erst darüber gelesen und späterhin sich selbst davon überzeugt, dass es in Sowjetrussland in jeder Stadt und in allen größeren Dörfern gut organisierte Beratungsstellen nebst staatlichen Abortarien für werktätige Frauen gab. Diese Feststellung führte sie in die Partei.
Sonja und Walter, Berlin, 1927/28
Vaters Abschlussexamen fiel in die ersten Tage des Weltkrieges. Er wurde sofort eingezogen und kam als Assistenzarzt in ein Hospital. Der erschütternde Anblick verstümmelter Leiber junger, lebenshungriger Soldaten und vieler Tausender von ihren Angehörigen in der Heimat beweinter Toter, dieser ganze durch Religionen und Regierungen gesegnete Massenmord versetzte seiner anfangs brav schwarz-weiß-roten Weltanschauung einen entscheidenden pazifistischen Stoß. Mit innerlichen Widersprüchen hadernd, nach vielem Lesen, Grübeln und Erkennen trat Vater bald nach Kriegsende in die Kommunistische Partei ein.
In den Berliner Jahren ihrer Ehe unternahmen meine Eltern eine ganze Reihe weiter Reisen. Ein Ergebnis dieser Fahrten wurden ihre in Deutschland herausgegebenen Russlandreportagen: »Kaukasus« (Skizzen zweier Ärzte), »Im freien Asien« und die unvollendet gebliebene »Rote Wolga«.
Durch jedes Kapitel dieser Bücher zogen sie als Leitmotiv die Hymne auf das neue Regime in Räterussland. Ihre letzte Reise galt dem Süden. Dort, im mussolinischen Italien, entstand auch das letzte Buch meiner Eltern: »Faschistenland«.
Zusammen mit den Werken anderer jüdischer, antifaschistischer und kommunistischer Verfasser wanderten die oben erwähnter Reportagen meiner Eltern im Frühling des Jahres 1933 auf den berüchtigten, von den Nazis Unter den Linden errichteten Bücherscheiterhaufen.
Kapitel 2»Juden raus!«
Der 1. April 1933, ein trüber, regnerischer Tag, mein letzter in der alten Heimat, fing morgens genauso an wie alle anderen.
Walter und ich tunkten beim Frühstück, trotz strengsten Verbots, die Hörnchen in den Kakao, wofür wir von Ella, unserem Kindermädchen, einem flachbrüstigen, rot bepickelten Geschöpf, wütend angeschnauzt wurden. Das eben noch blütenweiße Tischtuch sah aus, als hätte es die Masern bekommen.
Schon seit einigen Wochen waren unsere Eltern abwesend. Köchin Anna, die dürre Pickelella und wir beiden Geschwister fühlten uns von Tag zu Tag einsamer und verlassener in der großen und jetzt so leer anmutenden Fünfzimmerwohnung.
Rolf, Vaters Liebling, unserem rostbraunen Bernhardiner, schien die viel zu lang andauernde Abwesenheit seines Herrchens sehr auf die Nerven zu fallen. Unruhig schnupperte er an allen Wänden und Möbeln; ruhelos trottete er durch alle Räume. Gestoßen und ungeduldig angefahren, verkroch er sich, leise jaulend, in seine Korridornische; starrte von dort trübselig in die Luft, begann nach kurzer Rast seinen Dauerlauf von Neuem.
Hin und wieder schellte die Türglocke. Meist waren es Patienten, die sich über die unvorhergesehene Abwesenheit ihrer Ärzte wunderten, manchmal auch beschwerten. Und sehr oft läutete das Telefon. Das war dann gewöhnlich Großmutter, unsere Oma. Sie hatte eben erst eine böse Grippe überstanden und wagte sich noch nicht auf die Straße.
Bei alledem war es durchaus verständlich, dass der nie sehr stark gewesene Geduldsfaden unserer Bonne Anna nun noch häufiger riss als sonst. Walter und mir bereiteten die beschriebenen Umstände nicht das geringste Unbehagen. Unsere Eltern verschwanden nicht zum ersten Mal. »Untertauchen« nannten sie das. Wir waren es gewöhnt, dass sie nach jedem Untertauchen heil und gesund wieder auftauchten.
Die Uhr zeigte bereits ein Viertel nach acht. Es war demnach höchste Zeit für die Schule.
Ella steckte Walter und mir zwei umfangreiche Stullenpakete zu, und lustig mit den Ranzen klappernd, liefen wir die Treppe hinab. Unten zappelten und stöhnten wir, wie immer, ein bisschen beim Öffnen der schweren Haustür.
Ein schon die ganze Nacht andauernder gleichmäßiger Regen nieselte in schrägen Fäden aufs Pflaster, trommelte zart gegen weinende Fensterscheiben, wurde hie und da von den knospenden Ästen nass glänzender Kastanienbäume zerrissen; er setzte sich in winzigen Silberperlchen an unseren Wollcapes fest.
»Tach, kleene Wölfe! Na, jut jeschlafen?«, begrüßte uns auch heute ein dicker Schupo, der schon jahrelang vor unserem Haus, in dem sich eine Bank befand, seinen Dienst hatte.
»Guten Morgen, Herr Wachtmeister!«, wünschten wir im Duett zurück.
»Und wie geht es ihr denn heute?«, erkundigte ich mich, da es regnete. Mit »ihr« war eine französische Bleikugel gemeint, die dem Ärmsten seit anno 1916 in den Rippen saß und bei schlechter Witterung Schmerzen verursachte.
»Rumort, det Biest«, konstatierte der Gefragte. »Und wie!«
Diesen Schupo nannte Vater einen Sympathisierenden. Er unterhielt sich für sein Leben gerne mit beiden Eltern über Politik, besuchte auch, von Vater dazu aufgefordert, regelmäßig unsere Sprechstunden, wo er sich seine Rippen abtasten und wegen des rumorenden Kugelbiestes kostenlos beraten ließ.
Stets, wenn Vater am Schupo vorbeimusste, stellte sich ihm dieser mit gleichzeitig begierigem und unschuldigem Lächeln in den Weg.
»Tach, Herr Dokta. Jibts wat Neues?«
Was eigentlich heißen müsste:
»Quatschen wir doch ’n bisschen. Ick langweil mia so. Und Se sind son netta Kerl und een jebildeta Mensch.«
Vater verstand auch, wie seine Begrüßung zu deuten war, und ließ ihn nur selten unbefriedigten Gemütes stehen. Ebenso Mutter.
Ich habe es beobachtet, dass unser Schupo, ohne auch nur für eine Sekunde den Atem zu verlieren und immer feste berlinernd, mindestens eine halbe Stunde lang auf die Herren Kapitalisten, über den von ihnen angezettelten Krieg mit nachfolgender Inflationszeit schimpfen konnte, in der seine »saua vadientn Spargroschen hopp jejangen sinn«.
Der brave Mann war für Gleichberechtigung der Frau, er las Nietzsche und das »Kommunistische Manifest«, er hielt viel von einer planmäßigen Wirtschaftsführung, liebte Charlie Chaplin, wählte SPD, und er hatte eine unüberwindliche Abneigung gegen die Nazis, die er nie anders denn als »Mistviecher« titulierte.
Es sollte jedoch meinem Vater nicht gelingen, ihm eine fast gleich unüberwindliche Abneigung gegen die im »Kommunistischen Manifest« proklamierte Diktatur des Proletariats auszureden.
»Nee, Herr Dokta. Da könn Se sagen, wat Se wolln: det is mia zu krass«, meinte er kopfschüttelnd. »Ordnung muss sinn.« Diese Entgegnung wiederholte er in den verschiedensten Variationen. Blieb zäh.
Amüsiert ließ Vater von ihm ab. Meine Mutter, eine hartnäckigere Verfechterin der guten Sache, steckte sich noch längere Zeit das Ziel, aus diesem gutmütigen, in den Fragen der Politik mehr instinktmäßig herumtappenden Menschen einen konsequent denkenden Kommunisten zu formen. Bis er eines Tages, nach einer besonders hitzigen Auseinandersetzung mit ihr, gequält aufstöhnte:
»Aba piesacken Se mia doch nich so heftich, Frau Dokta. Ick kapier det eben nich. Und doof bleibt doof, da helfen och von Ihnen keene Pilln. Stimmts?«
Nun gab auch Mutter ihn auf. Doch politisierten alle drei auch weiterhin noch gerne miteinander. Nur durfte eben in diesen Diskussionen die nach der Meinung meiner Eltern unumgängliche Notwendigkeit einer Diktatur des Proletariats in Deutschland nicht besprochen werden.
Dass im Drama dieses schicksalsschweren Tages dem Herrn Wachtmeister eine ganz bedeutende Rolle zufallen sollte, ahnten weder er, der sich vorläufig gemütsvoll über »dat vaflixte Wetter« ärgerte, noch Walter und ich, die wir friedlich unseren Schulweg fortsetzten.
Doch nachdem wir das Gebäude unserer Schule betreten hatten, fing alles an, drunter und drüber zu gehen. Gleich in der Klasse, als ich mich auf meinen Platz begab, fielen mir zwei mit Riesenlettern auf die Tafel geschmierte Worte in die Augen.
JUDEN RAUS! stand da. Und dasselbe war mit Kreide auf meine Bank gekritzelt.
Erstaunt sah ich mich um. Meine Schulkameraden benahmen sich so eigentümlich. Einige grinsten, teils schadenfroh, teils unbeholfen. Die meisten taten, als ob sie mein Kommen nicht bemerkt hätten. Meine beste Freundin, ein liebes, schüchternes Irmchen, wich hilflos meinen Blicken aus. Betroffen wischte ich mit Löschpapier an der Bank herum.
Schon nach dem ersten Klingelzeichen erschien Herr Grune auf der Bildfläche. Das war unser selten lächelnder und noch seltener lachender, sehr strenger, aber sehr gerechter Klassenlehrer. Stirnrunzelnd und ohne hinzuschauen, befahl er, die Tafel abzuwischen. Gereizt klang dabei seine Stimme. Und mit hartem Knall flog das Klassenjournal aufs Pult.
Erschreckt zogen wir die Köpfe zwischen die Schultern. Das konnte ja heute gemütlich werden!
Zerstreut wanderten Herrn Grunes bebrillte Augen von einer Bank zur anderen. Sie konzentrierten sich. Sie blieben schließlich mit einem mir vollkommen unverständlichen Ausdruck an meinem Gesicht haften.
Oje! Jetzt fiel mir auch ein, dass gestern, zur Zeit der großen Pause im Hof herumtollend, ich unserem Schuldirektor gegen den Bauch gerannt war. Ganz blau ist der nach dem Anprall geworden. Und trotz meiner hervorgestammelten Bitte um Entschuldigung sah er schön wütend aus. Nicht anders, das Ekel hat sich beklagt.
Da kam Herr Grune auch schon auf mich zu. Beunruhigt schaute ich ihm entgegen. Doch lag jetzt nichts als Müdigkeit in seiner Stimme.
»Du brauchst heute dem Unterricht nicht beizuwohnen«, erklärte er mir, »geh nach Hause, mein Kind. Dein Bruder wartet auch schon im Korridor auf dich.«
Vor Verwunderung sperrte ich den Mund auf. Vor grenzenloser Verwunderung klapperte ich mit den Augendeckeln. Ich muss wohl komisch ausgesehen haben, denn Herr Grune lächelte auf mich herab sein eigentümlich karges Lächeln. Dann, schon beim Weitergehen, strich er mir mit einer flüchtigen Handbewegung über das Haar.
Eilig packte ich meine Bücher zusammen. So etwas ließ man sich doch nicht zweimal sagen! Den Zurückbleibenden wünschte ich ein leises »Auf Wiedersehen«, und beim Türaufmachen stieß ich auch tatsächlich mit meinem Bruder zusammen.
Außer uns beiden erhielten in der Garderobe auch noch andere Kinder aus anderen Klassen ihre Mäntel. Das Nach-Hause-gehen-Dürfen fand aber anscheinend in ihren Augen wenig Gefallen. Im Gegensatz zu uns unterhielten die sich nämlich im Flüsterton. Und im Gegensatz zu unserer ausgelassenen Fröhlichkeit konnte man denen keine Spur von Freude anmerken.
Als Walter und ich, vergnügt über den unerwartet freien Tag, durch den immer stärker strömenden Regen heimtrotteten und schon die gute Hälfte des Weges zurückgelegt hatten, bremste plötzlich mit hysterischem Quietschen dicht neben uns ein Autotaxi. Ein Strom schwarzen Rinnsteinwassers ergoss sich über meine Füße. Ruckartig wurde von innen die Wagentür geöffnet, … und mein »Donnerwetter!« blieb mir im Halse stecken.
»Jott sei Dank! Da wärn se«, frohlockte unser Herr Wachtmeister. Und, sich zu uns herausbeugend, wischte er mit dem Handrücken über die verregneten oder verschwitzten Stirn und Backen.
Wortlos starrten wir in das hochrote, pitschnasse Gesicht, wussten nicht, was wir von seinem plötzlichen Erscheinen halten sollten.
»Nu aba rinn in de jute Stube!«, befahl uns der Schupo in solch resolutem Tonfall, dass Walter widerspruchslos Folge leistete. Und: »Ham se vielleicht irgend ne anstänje Vawandte in Berlin?«, fragte er mich, als wir schon hinter ihm saßen.
»Gewiss, Herr Wachtmeister«, versicherte ich ihm. »Unsere Oma. Kurfürstenstraße 71 wohnt sie. Und die ist sehr anständig. Aber könnten Sie mir nicht …«
»Jar keen aba!«, wurde mir da kurz das Wort abgeschnitten.
»Hast de jehört, Fritze?«, wendete er sich an unseren Chauffeur. »Kurfürstenstraße 71. Nu quetsch man aba jefällichst ’n bissken mehr Tempo, Tempo aus die olle Motorkutsche.«
»Nur keene Bange«, knurrte der zurück. »Det Ding wird jedreht.« Und los ging es.
Ich gelangte auch fast sofort zu der festen Überzeugung, dass aus unserem Vehikel noch ein ganz ansehnliches Tempo herauszuquetschen war. Denn Walter und ich begannen wie zwei wild gewordene Tennisbälle auf unseren Sitzen auf und ab zu hopsen, und bei einer mit besonderem Elan genommenen Kurve stießen wir schmerzhaft mit den Köpfen aneinander. Verdattert und durchgerüttelt hielten wir uns schließlich an den am Wagenpolster angebrachten Riemen fest, betrachteten abwechselnd das feiste Streifchen Nacken unter dem schwarz lackierten Tschako und Fritzens ziemlich abgeschabten Lederrücken.
Als wir an unserem Haus in der Berliner Straße (jetzt Schnellerstraße) vorbeirasten, sah ich dort für den Bruchteil von Sekunden eine Möbelpyramide auf dem Pflaster liegen. Braun gekleidete und ebenso gestiefelte Männer umstanden den Haufen.
Neugierig presste ich die Nase gegen das Hinterfenster und konnte gerade noch sehen, wie sich von unserem Balkon ein wohlbekannter Ledersessel löste und runterstürzte.
Entgeistert fuhr ich herum. Walter schaute, nichts ahnend, auf die andere Seite; der Chauffeur, so wie es sich gehörte, durch das Vorderglas. Und unser Wachtmeister putzte sich schnaubend und trompetend die Nase. Er hatte scheinbar auch nichts bemerkt. Nur kam er gerade in diesem Moment mit der Frage heraus, ob ich denn nicht wisse, wo unsere Eltern denn eigentlich stecken.
Das wusste ich. Die waren getürmt. Sie befanden sich im Ausland, in der Schweiz. Doch unsicher geworden, zog ich es vor, zu lügen.
»Keine Ahnung, Herr Wachtmeister. Wirklich nicht.«
Mich ungläubig anlächelnd, sah Walter sich um. Er wollte schon den Mund aufmachen, da traf ihn meine tatkräftige Warnung gegen das Schienbein. Nun schwieg auch er.
Bums! Großmutters Buch fiel auf den Boden, als der Schupo mit uns beiden an der Hand bei ihr erschien.
»Um Gottes willen!«
Die kleine alte Frau sah zu Tode erschrocken aus.
»Aba wat denn, wat denn … Imma mit de Ruhe, Frau Wolf«, beschwichtigte sie der Hüter der Ordnung. Und: »Is ja alles in Butta«, war das Letzte, was ich von unserem Herrn Wachtmeister zu hören bekam. Denn Großmutter stieß Walter und mich in ihr Schlafzimmer und zog eiligst die Tür hinter sich zu.
Nein, diese Erwachsenen! Mit ihrer ewigen Heimlichtuerei! Verärgert warf ich das durchnässte Cape von mir, und angestrengt lauschend beugte ich mich über das Schlüsselloch.
»Pssst! Du Idiot!«
Das galt meinem Bruder, der sich mit Krach und freudigem Hallo hinter Großmutters Angorakatze hermachte. Walter und die Mieze scherten sich aber einen Deibel um mein Geschimpfe, und so konnte ich aus dem polternden Brummen und wispernden Flüstern, das kaum vernehmbar durch die schwere Eichentür zu mir drang, auch nicht klug werden. Dann hörte ich Schritte, die sich zu entfernen schienen, und gleich darauf, mir fast den Schädel einschlagend, kam Großmutter herein.
Der erste Schreck war anscheinend überwunden. Sie sah aus wie immer: klein, altmodisch, streng und damenhaft. Nur zitterte kaum merklich ihre leise, brüchige Stimme, als sie uns mitteilte, dass wir noch heute, nein, jetzt gleich zu den Eltern nach Lugano fahren müssten.
Sofort war alles vergessen. Begeistert klatschte ich in die Hände, strahlte. Walter johlte vor Freude auf, wie es der letzte der Mohikaner nicht besser vermocht hätte. Dazu umtanzte er mich in wilden Sprüngen.
Die entsetzt fauchende Katze floh erhobenen Schwanzes. Großmutter beugte sich besorgten Gesichts über die Tiefen eines Koffers. Und ich fing schon wieder an, mich zu ärgern. Zu blöd und albern sind doch manchmal kleine Brüder! Auch überfielen mich von Neuem quälende Zweifel.
Was sollte das hässliche, auf Bank und Tafel geschmierte JUDEN RAUS! bedeuten? Wer schmiss unsere Möbel auf die Straße und warum? Wie konnten Walter und ich mitten im Schuljahr wegfahren?
Mit all diesen Fragen bestürmte ich Großmutter. Erst bekam ich überhaupt keine Antwort, und zu guter Letzt wurde ich nur ungeduldig angefahren. Und auf einen Klaps wollte ich es lieber nicht ankommen lassen.
Ein unkindlicher Kummer nahm allmählich von mir Besitz. Erbost verweigerte ich Großmutter meine Hilfe beim Packen, setzte mich abseits, dachte angestrengt nach. Zu einem Resultat kam ich nicht.
Wenige Stunden später befanden wir uns in der Halle des Schlesischen Bahnhofs. Unser Zug stand schon abfahrbereit. Schnell stiegen wir ein.
In dem uns angewiesenen Schlafwagencoupé drückte ich mich, von der ungewohnt anstrengenden Grübelei ganz erschöpft, in eine Ecke. Unbeachtet weinte ich dort leise vor mich hin. Und eingeschlummert, merkte ich gar nicht, dass unser Zug die Grenzen meiner Heimatstadt bereits verlassen hatte.
Kapitel 3Schweizer Intermezzo. Begegnung mit Lion Feuchtwanger
Der Kurort Lugano wurde die erste und beste Etappe unseres gemeinsamen Exils. Einen ganzen Sommer hindurch wohnten wir dort im fashionablen Viertel der Stadt, im magnolienduftenden Paradiso.
Meine Befürchtungen betreffs der Unterbrechung des Schuljahrs hatten sich als unbegründet erwiesen. Walter und ich besuchten in Lugano eine deutsche Volksschule, in der ein schwarzlockiger Maestro Martinelli uns Italienisch beibrachte.
Unser Schulweg war ein weiter, doch gingen wir ihn gern. Er führte durch den herrlichen Stadtpark, an einem den sterbenden Sokrates darstellenden Marmordenkmal vorbei. Majestätisch schaukelten in der lauen Luft wedelnde Palmenfächer. Vom Hotel an gaben sie uns ein kerzengerades Geleit. Zwischen den behaarten Stämmen hindurch flimmerte in leuchtender Bläue der See. Kopfstehend spiegelten sich in seinen Fluten die schneebedeckten Kuppen der Monte-Rosa-Kette.
»Ohoo, Helvetia«, sangen Walter und ich, berauscht von der nie vorher gesehenen subtropischen Pracht und stolz auf unsere eben erst erworbenen italienischen Sprachkenntnisse: »bello Ticino/anche per noi/terra amata«.
Eines Sonntags, vom Strand heimkehrend, sah ich Vater mit einem neben ihm, dem Riesen, ganz besonders klein aussehenden Mann vor unserem Hotel auf und ab gehen. Beide waren in ein mir unendlich vorkommendes Gespräch vertieft, und ich hörte sie mehrmals belustigt auflachen. Der Fremde schien äußerst amüsiert. Er krähte hell, in den höchsten Tenortönen; Vater dröhnte tief, laut, salvenartig.
Dieses Duett klang so komisch, dass, ohne zu wissen, um was es sich handelte, ich gleichfalls loslachte. Hierbei bemerkten sie mich. Ich wurde herangerufen, musste die Hand reichen, machte einen Knicks. Ich schaute für einen Augenblick in hinter dicken Brillengläsern liegende, freundlich zusammengekniffene Augen, in ein mir unbekanntes, vom Lächeln zerfurchtes Gesicht.
Familie Ruben-Wolf vor der Reise nach Moskau
Der Gong rief zum Dinner, deshalb gingen wir auseinander.
Im Speisesaal sah ich den Unbekannten wieder. Er saß an einem der guten Fensterplätze. Er widmete sich fast ausschließlich dem Inhalt seiner Teller, schenkte der lieblich vor ihm ausgebreiteten Natur sowie den vielen Menschen um ihn herum, die schwatzend, lachend und flirtend mit ihren Bestecken klapperten, nur mäßige Beachtung. Er kaute, schluckte, arbeitete konzentriert und emsig mit Gabel und Messer. Mir schien, dass er sich beeilte.
»Wer ist denn das?«, erkundigte ich mich nach ihm.
Meinem Blick folgend, nahm Vaters Gesicht einen innig achtungsvollen Ausdruck an.
»Das ist Lion Feuchtwanger, Jumbelchen. Ein ganz großer und sehr berühmter Schriftsteller. Und er ist genauso wie wir vor den Nazis geflohen.«
»So.« Nach dieser Auskunft fühlte auch ich eine gewisse Hochachtung zu dem Schnellesser in mir aufsteigen. Außerdem, ich saß zum ersten Male in meinem Leben in unmittelbarer Nähe einer Berühmtheit. Das wollte etwas bedeuten, und dementsprechend senkte sich auch meine Stimme bis zum Flüsterton.
»Was schreibt er denn?«, zischte ich gedämpft.
»Historische Romane.«
Damit wusste ich, bei Gott, wenig anzufangen.
»Und Märchen?«
»Nein, Märchen schreibt er nicht.«
»Auch sonst nichts für Kinder?«
»Soviel ich weiß, nein.«
»Och …«
Vater verstand meine Enttäuschung und versuchte mich zu trösten.
»In drei oder in vier Jahren wirst du schon Feuchtwangers Bücherlesen können. Sie werden dir bestimmt gefallen. Denn er ist wirklich, glaube mir, ein ganz großer, ein ganz bedeutender Künstler!«
»Möglich …«
Das Flüstern hielt ich in diesem Fall aber schon für überflüssig.
»Weißt du, Papa, er könnte sich ruhig etwas für uns Kinder ausdenken, dein Großer«, beharrte ich eigensinnig, den tief über seinen Teller gebeugten kleinen Mann mit missbilligenden Blicken streifend. »Ist Erich Kästner etwa von Pappe? Und Mark Twain, der ist ein Klassiker und der hat den ›Tom Sawyer‹ verfasst und sogar seinen Söhnen gewidmet. Also.« Gereizt fuchtelte ich schon mit Messer und Gabel in der Luft herum.
»Feuchtwanger ist aber kinderlos«, nahm Vater mir da den Wind aus den Segeln.
Ich flaute auch sofort ab. »Ach so … Na, vielleicht deswegen.« Schon etwas versöhnlicher gestimmt, schielte ich abermals zu dem Fensterplatz hinüber. Doch der war schon leer.
Da ich an besagtem Sonntagvormittag länger, als bekömmlich war, in den kalten Wassern des Luganersees geplätschert hatte, musste ich für kurze Zeit einer Erkältung wegen das Zimmer hüten. Als ich wieder das Mittagessen in der Speisehalle einnehmen durfte, sah ich Lion Feuchtwanger nicht mehr. Er befand sich bereits in Frankreich.
Bald nach ihm nahmen auch wir Abschied von dem uns lieb gewordenen Tessin. Meine Eltern begaben sich nach Paris, wo sie sich um die Einreiseerlaubnis nach Russland bemühten. Walter und mir war dadurch noch ein weiteres Dreivierteljahr in der sonnigen Schweiz beschieden, das wir in einer Kinderpension im Städtchen Montana des Kantons Wallis verbrachten.
Die Inhaber dieses »Mon Loisir«, ein sentimentales, sehr religiöses Ehepaar, gaben sich die erdenklichste Mühe, um uns unselige Judenkinder dem Christentum zuzuführen. Bei Walter war in dieser Hinsicht Hopfen und Malz verloren. Bei mir jedoch sollten Herr und Frau Kleinert mehr Erfolg haben. Und solange ich mich unter ihrer Obhut befand, blieb ich auch eine gläubige Protestantin.
Ich las, ohne dazu mit Strenge angehalten zu werden, leidenschaftlich gerne in der Bibel, wobei ich dem Alten wie dem Neuen Testament ein gleiches Interesse entgegenbrachte. Ich leierte genauso andächtig wie alle anderen Heimzöglinge vor dem Schlafengehen mein »Vater unser« herunter; ich zog mit Vorliebe an Sonntagen zusammen mit Jürgen, ihrem Sohn, in der Kirche am Glockenstrang. Und zu den Klängen unseres verstimmten Hausharmoniums sang ich im Chor und solo: »Wer beten kann, ist selig dran« – bar jeder Vorstellung, wie selig, im Vergleich zu späteren Zeiten, hier, in Montana, ich noch dran war.
Was an meinem damaligen frömmelnden Getue echt und was an ihm nur Schauspielerei war, fällt mir auch heute noch schwer auseinanderzuhalten.
Im Januar 1934 erhielten meine Eltern durch die deutsche Sektion der Komintern die Einreiseerlaubnis nach Russland. Und schon im Februar desselben Jahres trafen wir als Politemigranten in Moskau ein.
Kapitel 4Ankunft in Moskau. Das MOPR-Kinderheim
Uns empfing Winterkälte, – 30 Grad, die durch atemraubend eisige Windstöße verstärkt wurde. Nach Berlin, Lugano, Paris machte die Hauptstadt Räterusslands einen unsäglich armseligen, ungepflegten Eindruck. Vom Belorussischen Bahnhof bis nach Ochotnyj rjad zog sich eng und schlecht bepflastert die Twerskaja. Jetzt trägt sie den Namen Maxim Gorkis und ist eine der schönsten Straßen Moskaus.
Bimmelnde Elektrische, an denen zappelnde Menschentrauben hingen, erfüllten die Stadt mit ohrenbetäubendem Getöse. Vor den Lebensmittelgeschäften drängten sich von früh bis spät riesige Schlangen schlecht gekleideter und schlecht aussehender Frauen.
Obdachlose Kinder, vom Hunger aus der Ukraine und aus Wolgadeutschland vertrieben und von ihm, dem Würger, zu Waisengemacht, hielten Moskau in Horden belagert. Überall stieß man auf diese Besprisorniki. Hungrig, halb nackt, blau gefroren, trieben sie sich, eine Plage der Einwohner, in den Straßen herum.
Die Obdachlosen schliefen in den ewig überfüllten Wartesälen der Bahnhöfe, in Güterzügen, in Kellergewölben; sie verkrochen sich nachts wie lebensmüde Tiere in dunkle Treppenaufgänge. Tagsüber bettelten und stahlen sie. Malerisch in ihre Lumpen gehüllt, konnte man sie direkt auf den schnee- und eisverkrusteten Pflastersteinen sitzen sehen: Sie spielten Karten und rauchten dazu stinkende Machorka; sie fluchten und sangen zwischendurch herrliche Lieder. Gezwungen, auf Raub auszugehen, stießen sie hin und wieder einem zufälligen Opfer, im Streit auch manchmal einem von ihnen das in der russischen Verbrecherwelt berüchtigte doppelkantige Messer, Finka genannt, in die Seite.
Vater hatte für alles ungewohnt Düstere und Hässliche, das uns in der neuen Heimat umgab, tiefstes Verständnis. Er wurde nicht ungeduldig und wenn auch zum hundertsten Mal einer der in Russland von Ausländern so oft verlangten Anträge (sajawlenije) umgeschrieben werden musste oder wenn ihm schon wieder ein neuer ellenlanger Fragebogen vorgelegt wurde. Er konnte stundenlang, ohne zu murren, in der MOPR auf Empfang warten. Er amüsierte sich nur darüber, dass es ihm nicht gelingen wollte, in die stets überfüllten Elektrischen hineinzukommen. Ging eben zu Fuß.
Mitleidig, nicht ohne künstlerisches Interesse beobachtete Vater das Treiben der Obdachlosen. Er schenkte ihnen Valuta, zeichnete sie. Er geriet nicht außer sich, als nach angeregtem Geplauder mit einem von ihnen, dessen wolgadeutsches Kauderwelsch und einnehmende Art es ihm angetan hatten, er zu Hause das Verschwinden seiner goldenen Taschenuhr feststellte.
Vater betrachtete Land, Menschen und Ereignisse mit den überzeugten Augen eines Gläubigen. Begeistert und hoffnungsfroh klärte er uns über den großen Plan der Rekonstruierung Moskaus auf. Dort, wo vorläufig noch unansehnliche Häusermassen klebten, wo knietief Schmutz und Geröll herumlagen, sah er schon helle Neubauten, grüne Parkanlagen und marmorgleißende Untergrundbahnstationen entstehen.
Vater, der immer Geduldige und Tolerante, konnte Zweifler hart anfahren. Er ärgerte sich, wenn wir angeekelt einen besonders aufdringlichen Obdachlosen abwimmelten.
»Schämt euch!«, brummte er dann wohl. »Der arme Kerl wird es bald besser haben. Er wird schon in nächster Zukunft in der Lage sein, tüchtig beim Aufbau mitzuhelfen.«
Mutters schweigender Skeptizismus tat ihm weh.
»Staunen wirst du noch, Marthel, staunen!«, unterbrach er des Öfteren seine ihm bereits zur Gewohnheit gewordenen Lobtiraden, bekümmert und irritiert durch ihr stereotypes Achselzucken.
Gleich nach unserer Ankunft erhielten wir durch die MOPR ein kleines Zimmer in dem im Zentrum Moskaus gelegenen Hotel »Passage« angewiesen. Beide Eltern erhielten auch sofort Arbeit. Da Walter und ich nicht den ganzen Tag uns selbst überlassen werden konnten, brachten sie uns in einem MOPR-Kinderheim unter, das sich in der Textilstadt Iwanowo befand.
Auch heute noch überfällt mich ein Frösteln bei der Erinnerung daran, wie kalt trotz der im Hof hoch aufgestapelten Holzvorräte wir es dort im Winter hatten. Den spärlichen Heizkörpern entströmte eine milde, lauwarme Temperatur, die nicht imstande war, das zweistöckige Gebäude richtig durchzuheizen.
Herrgott, wie jämmerlich froren wir in unseren dünnen Flanellkleidchen und fadenscheinigen Baumwolljacken! Die Mehrzahl der Kinder lief auch ewig mit nassen Nasen herum und schnäuzte sich aus Mangel an Taschentüchern einfach in die Hand, die dann hübsch säuberlich an den Kleidern abgewischt wurde. Auch war das Essen zum Verzweifeln eintönig und vitaminarm und die Portionen, die uns zugeteilt wurden, zum Verzweifeln klein.
Dessen ungeachtet gefiel mir das Leben in Iwanowo. Herrlich fand ich zum Beispiel die allsonnabendlichen Filmvorführungen. Ich verstand damals schon genug Russisch, um voll Enthusiasmus die Kämpfe, Siege und Niederlagen der Tschapajew-Reiter oder der meuternden Matrosen des Panzerkreuzers »Potemkin« zu verfolgen.
Und ganz besonders imponierte mir, dass man in unserem Heim zur Zeit des Schulunterrichts tun und lassen konnte, was einem gerade beliebte. Das Wort Disziplin schien hier unbekannt zu sein. Von Hausarbeiten war überhaupt keine Rede.
Unsere Jungens liefen darum auch gewöhnlich in den Stunden mit »Hurra!« und »Hände hoch!« in der Klasse zwischen den Bänken herum. Dagegen benahmen sich die Mädels schon viel solider. Die saßen gruppenweise über Handarbeiten gebeugt, wobei nur halblaut geschwatzt und gelacht wurde.
Ich persönlich verhielt mich individualistisch, stopfte mir die Finger in die Ohren und begeisterte mich an den Abenteuern des Jules Verne oder Mayne Reid. Manchmal aber, des Lesens müde, stand ich auf, ging vollkommen unbekümmert am Lehrer oder an der Lehrerin vorbei zur Tafel (dort war mehr Platz) und trieb Gymnastik. Meine exakten Brücken und Spagate zwangen auch nicht nur den Mädels, nein, auch unseren Jungens neidvolle Anerkennung ab. Besonderen Beifall erntete ich jedoch an dem Tage, als ich vorsorglich in Trainingshosen zum Unterricht erschien und meinen schon in der Berliner Schule berühmt gewesenen Handstand demonstrierte.
Hier, in Iwanowo, sollte es geschehen, dass ich meinen ersten harten Kampf gegen bange Unentschlossenheit, gegen den eigenen Kleinmut zu bestehen hatte. Das geschah folgendermaßen.
In der Klasse mit meinem Bruder lernte ein schon zwei Jahre hintereinander sitzen gebliebener Junge namens Franz L. Seinen Vater hatten die Nazis in Deutschland hingerichtet, von einer Mutter war nichts zu hören. Franz erhielt nie Besuch und, wie ich glaube, auch keine Briefe. Höchstwahrscheinlich lag darin der Grund, warum seine runden, wasserblauen Augen so wild und so trotzig dreinschauten.
Größer und älter als seine Mitschüler, spielte Franz den Diktator. Er terrorisierte die ganze Klasse, er brachte Lehrer und Heimerzieher buchstäblich zur Verzweiflung. Eine seiner Lieblingsbeschäftigungen bestand darin, Katzen einzufangen, die fürchterlich Miauenden erst mit Petroleum zu begießen, dann anzustecken und als lebendige Fackeln laufen zu lassen.
Ich hatte eine Höllenangst vor dem Bengel und ging ihm, so gut ich konnte, aus dem Wege. Doch wollte es der Zufall, dass Franz und Walter Banknachbarn waren.
Einmal wie gewöhnlich wild um sich schlagend, traf Franz meinen Bruder mit dem Ellenbogen ins Gesicht. Der bekam sofort Nasenbluten. Betäubt, erschreckt kam Walter zu mir gelaufen. Es war gar nicht einfach, ihn zu beruhigen. Auch brauchte es Mühe und Geduld, bis ich mit kaltem Wasser seine Sachen gereinigt hatte. Und dann musste er sich noch mindestens zwei, drei Stunden lang an einen der lauwarmen Heizkörper anlehnen, um sie zu trocknen.
Dem Franz gefiel es aber anscheinend, dass ein einziger kurzer Schlag von ihm uns beiden so viel Plage und Scherereien machte. So gönnte er sich diesen Spaß nun regelrecht.
Walters Baumwolljäckchen war überhaupt nicht mehr trocken zu kriegen. Feucht und übel riechend, klebte es an seinem Körper. Das Herz zog sich mir im Leibe zusammen, als ich ihn so von Tag zu Tag blasser und bedrückter umherschleichen sah. Es wollte mir aber durchaus nicht imponieren, dass mein kleiner hübscher Bruder es gar nicht versuchte, sich zu wehren.
»Hau dem Kerl doch eins in die Magengrube«, riet ich ihm eines Tages, als ich ihm beim Wieder-trocken-Werden Gesellschaft leistete. Und vor Erregung boxte ich Löcher in die Luft.
Walters schöne, wie mit dichtem Trauerflor bewimperten Augen sahen meiner Pantomime traurig zu. Er schüttelte nur den Kopf.
»Ich kann das nicht.«
»Ach was! Einfach feige bist du. Du Waschlappen!«, platzte mir da die Geduld.
Die Beleidigung ließ ihn zusammenzucken. Er wollte etwas erwidern, schwieg aber. Große, klare Tropfen sammelten sich an den Spitzen des Trauerflors. Verflucht! Das konnte ich nicht sehen. Mit einem Gefühl, als sei ich selbst in den Magen geboxt worden, wendete ich mich ab.
Dabei war mein Bruder durchaus kein Feigling. Das erkannte ich aber erst einige Jahre später. Er bewies dies, indem er sich zwischen mich und einen tollwütigen Schäferhund warf, der ihm ganz entsetzlich das Gesicht zerbiss. Seine fast abgerissene Unterlippe musste genäht werden, und er bekam im Laufe eines ganzen Monats dreißig schmerzhafte Injektionen gespritzt. Niemand sollte damals auch nur ein einziges Wort der Klage hören.
»Gott sei Dank, dass er dir nichts getan hat«, war alles, was er zu diesem Fiasko äußerte. Auch im Herbst 1941, als Moskau stark unter den faschistischen Bombenangriffen litt, benahm er sich außerordentlich kaltblütig.
In Iwanowo konnte ich das alles aber noch nicht wissen. Und die scheinbare Hasenherzigkeit meines jüngeren, innig geliebten Brüderchens, eine Eigenschaft, die mir an anderen besonders verhasst war, machte mich ungerecht und streitbar.
Ich ging zum Direktor des Kinderheims, von dem ich mir Schutz erhoffte. Der musterte mich mehr erstaunt als verärgert. Feixte:
»Zum Teufel! Was soll ich denn da machen? Der Franz ist alleine, und ihr seid zu zweit. So etwas Unselbstständiges!«
Ehrlich gesagt, ich fand, der Genosse Lapschin habe gar nicht so unrecht. Dass Walter für eine Rauferei leider nicht zu gebrauchen war, konnte er ja nicht wissen.
Ich schrieb unseren Eltern, bekam keine Antwort. Ich schrieb noch einmal. Umsonst. Ich war ratlos.
Bis Walter sich nach einem der systematisch hervorgerufenen Nasenbluten erbrach. Schneeweiß und halb ohnmächtig lehnte er an meiner Schulter.
Behutsam führte ich ihn in mein Zimmer, legte den von heftigem Schüttelfrost Befallenen aufs Bett, deckte ihn warm zu. Vor Wut knirschte ich mit den Zähnen. Vor Wut sah ich schwarz. Das musste man dem Schwein austreiben! So meinen kleinen Bruder zu malträtieren. Wie weggeblasen war plötzlich all meine Angst, all meine Bange vor dem Franz. Ein einziger Wunsch, ein einziger Gedanke hielt mich gefangen: »Dem muss ich es heimzahlen.« Noch einen Blick auf Walters verweintes, blutverschmiertes Gesichtchen werfend, rannte ich los.
Vor meiner Klassentür angekommen, stockte ich. Mir war eine glänzende Idee gekommen. Ich ging hinein, holte aus meinem Ranzen einen hölzernen Federkasten, Großmutters Geschenk zum ersten Schultag, den ich seiner massiven Schwere wegen nicht leiden mochte. Abschätzend wog ich ihn in der Hand. Der war gerade richtig.
Hingelümmelt auf Walters Platz fand ich unseren Peiniger. Er war gerade damit beschäftigt, mit einem Rasiermesserchen den Lack von der gemeinsamen Bank herunterzukratzen. Er schien derart eingenommen, dass mein Kommen unbemerkt blieb. Ich trat ganz nahe an ihn heran.
»Franz!«
Irgendetwas in meiner Stimme musste ihn beunruhigt haben. Er sah hoch und starrte mich erschrocken an. Da sauste auch schon mit voller Wucht die Kante meines Federkastens auf seinen Nasenrücken. Mehr zur eigenen Abwehr hob ich den Arm noch einmal, aber ich ließ ihn gleich wieder sinken. Der Franz hatte genug. Mit jäh zurückgeworfenem Kopf und schlaff hängenden Armen saß er da und schaukelte sich vor Schmerz. Der wie zum Schrei geöffnete Mund schnappte karpfenartig nach Luft, doch kam kein Laut über seine Lippen.
Meine Erregung erreichte indessen den Höhepunkt.
»Wenn du dir noch ein einziges Mal erlaubst, meinen Bruder anzurühren, schlage ich dich tot!«, brüllte ich. »Ich nehme einfach ein Holzscheit im Hof und zertrümmere dir damit deinen dämlichen Schädel. Merke dir das!«
Die vor Zorn überkippende Stimme versagte mir den Dienst. Ich verschluckte mich und musste husten. Einige Schüler, die sich bis dahin schweigend als neutrale Beobachter betätigt hatten, fingen an zu kichern. Man gönnte es uns von Herzen: dem Franz seinen Schreck und mir den Ärger. Mein Widersacher reagierte plötzlich mit hündischem Gewinsel, setzte aus, winselte von Neuem. Jetzt lachte bereits, inklusive des Lehrers, die ganze Klasse. Man tobte, man grölte vor Gelächter. Nur uns beiden, dem Franz und mir, war elend zumute.
Walters weit aufgerissene Augen schauten mir erwartungsvoll entgegen. Das Blut unter seiner Nase und in den Mundwinkeln war geronnen und ganz braun geworden. Es sah aus, als habe er Schokolade gegessen und sich beschmiert.
»Du hast ihn, hast ihn …?« Und hingerissen deutete er auf meinen Federkasten.
Jetzt erst fiel mir auf, dass der einen tüchtigen Sprung abbekommen hatte. Angeekelt warf ich ihn von mir, setzte mich zu Walter aufs Bett, verfiel ins Grübeln. Was um alles in der Welt sollte nun werden? Sowie der Franz sich nur erholt, nimmt der gleich Rache an mir. Und bevor ich ihm den Schädel einschlage, haut der uns beide windelweich. Ich sah mich schon gefesselt und mit Petroleum begossen; ich sah mich lichterloh brennen und kläglich verenden. Das alte üble Angstgefühl vor dem Jungen kroch wieder spinnenartig in mir hoch. Ich schluckte, ich zog energisch mit der Nase. Es half alles nichts. Mir kamen die Tränen. Walter, zu einem Tränenerguss immer bereit, weinte bitterlich mit.
Die gemeinsame Heulerei hatte sich indessen als verfrüht erwiesen. Nichts dergleichen geschah. Unser Feind lief nur längere Zeit kleinlaut mit einer fürchterlich angeschwollenen und sich in allen Farben des Regenbogens verfärbenden Nase herum. Zur allgemeinen Verwunderung ging ihr Besitzer so gleichmütig an mir vorbei, als hätte ich mich niemals an ihm vergriffen. Und ohne speziell dazu aufgefordert zu sein, setzte er sich bald nach dem beschriebenen Ereignis neben einen anderen Schüler. Er ließ uns ein für alle Male in Ruhe.
Ganz allmählich erfüllte mich ein eigentümlich süßes Gefühl, wenn ich mich des Tobsuchtsanfalles erinnerte, der mir im Heim den Spitznamen »Tschuma« (Besessene) eintrug. Ich fühlte mich auch absolut nicht beleidigt, wenn man mich so nannte. Und die Erkenntnis, dass die schlimmsten Menschenschinder in der Regel auch die ärgsten Feiglinge sind, setzte sich von da an in mir fest.
Kapitel 5Immer noch in Iwanowo. Die Stassowa
Ungefähr um dieselbe Zeitspanne und gleichfalls hier in Iwanowo sollten meine Eltern ihren ersten ernsten Zusammenstoß mit der sowjetischen Wirklichkeit erleben.
Da sie bei ihren allmonatlichen Besuchen Walter und mich von Mal zu Mal abgemagerter vorfanden und sich auch selbst davon überzeugten, dass unsere Verpflegung im Heim zu wünschen übrig ließ, sprachen sie darüber bei der damaligen Vorsitzenden der MOPR in der UdSSR, bei Jelena Dmitrijewna Stassowa.
Letztere, eine alte Bolschewikin und frühere Sekretärin Lenins, war sprachlos.
»Wo doch der Staat für unsere Zöglinge solch enorme Summen zur Verfügung stellt!«, empörte sie sich.
Und die Genossin Stassowa brachte, zur größten Zufriedenheit meiner Eltern, eine sofortige Untersuchung in Gang. Dazu wurde eine spezielle Untersuchungskommission von mehreren MOPR-Angestellten erwählt. Kurz entschlossen stellte sie sich und meine Mutter an deren Spitze, zornsprühend verließ sie ihr gediegen eingerichtetes Riesenkabinett mit dem von blumenspendenden Pionieren umjubelten Stalin in Lebensgröße an der Wand und begab sich zur Revision nach Iwanowo.
Nur konnten meine Eltern natürlich nicht ahnen, dass Genossin Stassowa die genaue Ankunftszeit und den Zweck ihres Besuches vorher der Heimleitung hatte telefonisch mitteilen lassen. Auch konnten sie keinesfalls ahnen, dass die durch ihre Eröffnung hervorgerufene Empörung der alten angesehenen Parteigenossin durchaus nicht den Zuständen unseres Heims galt, das ihren Namen trug und das in der Sowjetunion als eine Musteranstalt galt, worin man sich auch nicht irrte. Die Lebensbedingungen in den gewöhnlichen russischen Kinderheimen waren mit den unseren überhaupt nicht zu vergleichen.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!





























