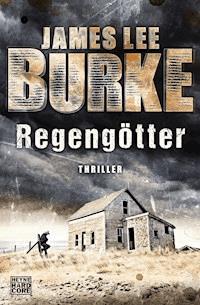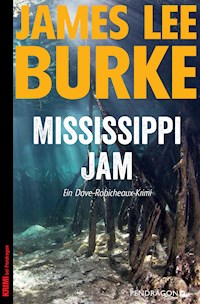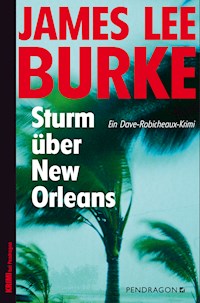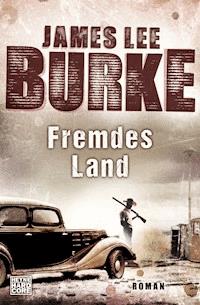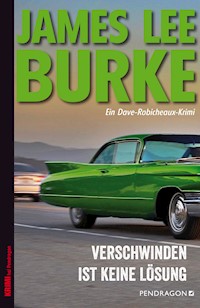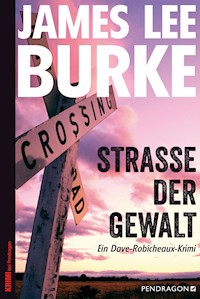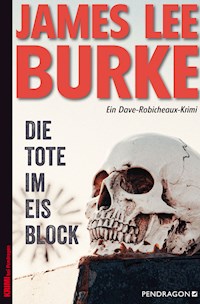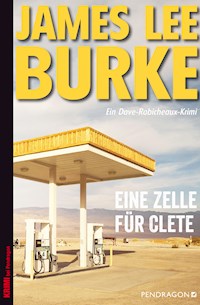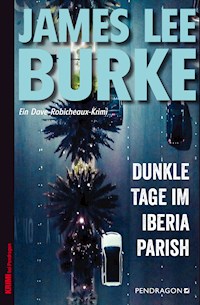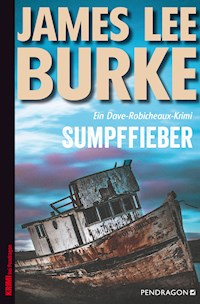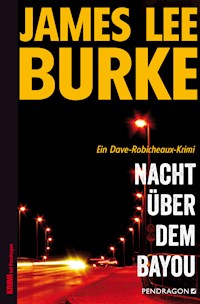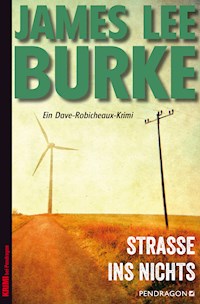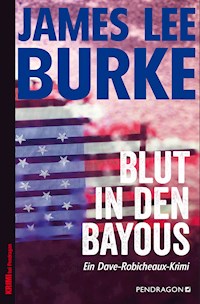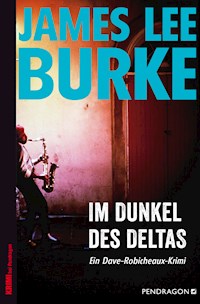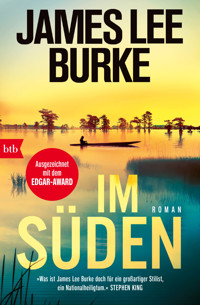
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ausgezeichnet mit dem Edgar-Award - Krimibestenliste Oktober 2025
»Im Süden« ist ein fesselndes, actiongeladenes Historiendrama vor dem Hintergrund des amerikanischen Bürgerkriegs und der Zeit der Sklaverei, in dem Gut und Böse um die Vorherrschaft kämpfen.
Als Hannah Laveau, eine der versklavten Frauen, die auf einer Plantage arbeitet, des Mordes beschuldigt wird, begibt sie sich zusammen mit einer abolitionistischen Lehrerin auf die Flucht vor dem örtlichen Constable und den Sklavenfängern, die in den Bayous ihr Unwesen treiben.
Der Roman behandelt einen Teil der historischen Vergangenheit Amerikas, der unsere Gegenwart in einem scharfen Licht erscheinen lässt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Im Herbst 1863 hat die Unionsarmee die Kontrolle über den Mississippi gewonnen. Ein Großteil von Louisiana, darunter New Orleans und Baton Rouge, ist besetzt. Die Armee der Konföderierten zieht sich in Richtung Texas zurück und wird durch die Red Legs ersetzt, eine Guerillaeinheit, die von einem Wahnsinnigen befehligt wird, derweil sich versklavte Männer und Frauen in Freiheit wähnen.
Als Hannah Laveau, eine der versklavten Frauen, die auf der Plantage von Wade Lufkin arbeitet, des Mordes beschuldigt wird, begibt sie sich zusammen mit Florence Milton, einer abolitionistischen Lehrerin, auf die Flucht vor dem örtlichen Constable und den Sklavenfängern, die in den Bayous ihr Unwesen treiben.
Im Süden ist ein fesselndes, actiongeladenes Historiendrama vor dem Hintergrund des amerikanischen Bürgerkriegs und der Zeit der Sklaverei, in dem Gut und Böse um die Vorherrschaft kämpfen.
James Lee Burke, 1936 in Houston, Texas, geboren, wurde bereits Ende der Sechzigerjahre von der Literaturkritik als neue Stimme aus dem Süden gefeiert. Nach drei erfolgreichen Romanen wandte er sich Mitte der Achtzigerjahre dem Kriminalroman zu, in dem er die unvergleichliche Atmosphäre von New Orleans mit packenden Storys verband. Burke wurde als einer von wenigen Autoren dreimal mit dem Edgar-Allan-Poe-Preis für den besten Kriminalroman des Jahres ausgezeichnet, zuletzt 2024 für Im Süden. 2015 erhielt er für Regengötter den Deutschen Krimipreis. Er lebt in Missoula, Montana.
JAMES LEE BURKE
IM SÜDEN
Roman
Aus dem Amerikanischenvon Alexander Wagner
Die amerikanische Originalausgabe FLAGS ON THE BAYOU erschien 2023 bei Atlantic Monthly Press, an imprint of Grove Atlantic, New York.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Dies ist eine Fiktion. Alle Verweise auf reale Begebenheiten,Institutionen, Orte oder Personen dienen lediglich dazu,ein fiktives Universum zu erschaffen.
Taschenbuchausgabe Oktober 2025
btb Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Copyright © der Originalausgabe 2023 James Lee Burke
Covergestaltung: semper smile, München, nach einem Entwurf von Tomás Almeida / Orion Books unter Verwendung von Motiven von © Getty / Shutterstock
(Vorstehende Angaben sind zugleich Pflichtinformationen nach GPSR.)
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
MK · Herstellung: BB
ISBN 978-3-641-32491-9V001
www.btb-verlag.de
www.facebook.com/penguinbuecher
Für Toby Thompson,
ein Musiker, Sänger, Poet und aufrechter Journalist der alten Schule, der in seiner Arbeit nicht nur das Herz des Neuen Westens, sondern das von ganz Amerika eingefangen hat.
Bleib dem alten Rock’n’Roll treu, Partner.
1WADE LUFKIN
Ein Morgen auf der Plantage Lady of the Lake kann ein wunderbares Erlebnis sein. Besonders im Spätherbst, wenn der Himmel strahlend blau ist, eine leichte Brise durch die Sümpfe streicht, sich das Spanische Moos in den Bäumen sacht bewegt und Tausende von Enten quaken, am Ende einer langen Reise in den Süden. Aber in dieser Zeit der Kämpfe und des Schmerzes ist es schwer, solche ergreifenden Momente zu genießen. So etwa gestern Abend, als unsere Invasoren aus dem Norden den Himmel mit Leuchtgranaten erhellten, die in gelblichen Rauchwolken detonierten und in spinnenbeinähnlichen Gebilden auf das Gras und den Sumpf niedergingen.
Ein Stück glühenden Metalls landete keine zehn Meter von meinem Stuhl und der Staffelei entfernt, an der ich malte. Ich würde gerne sagen, dass ich tapfer bin und mich an die furchtbaren Verheerungen gewöhnt habe, die Kanonenfeuer bei Menschen und Tieren bewirken kann. Aber das wäre gelogen. In meinem linken Bein steckt immer noch ein Minié-Geschoss, daher weiß ich sehr genau, welchen Schaden Billy Yank anrichtet, wenn er aus vollen Rohren feuert. Die Wahrheit ist, dass ich den Zorn unserer Feinde genauso fürchte wie den Zorn Gottes. Gleichzeitig wünsche ich mir, durch Seine heilige Flamme von einer Schuld gereinigt zu werden, von der ich nie geglaubt hätte, dass ich sie auf mich laden könnte.
1862 war ich mit der 8th Louisiana Infantry nach Virginia gezogen, weil unsere Offiziere mir versprochen hatten, ich würde als Assistent eines Chirurgen dienen und niemals das Blut meiner Mitmenschen vergießen müssen.
Ja, in meiner Naivität war ich überzeugt, dass ich niemals das Kainsmal tragen würde. Selbst dann nicht, wenn meine Vorgesetzten ihr Versprechen brechen und mir befehlen sollten, zur Waffe zu greifen und auf die Reihen der Jungs zu feuern, gegen die ich keine Abneigung hegte. Ich sägte also Gliedmaßen ab und stapelte sie zu Haufen, bei der ersten und zweiten Schlacht von Manassas, und vor allem bei Sharpsburg, wo die 8th Louisiana in einem Maisfeld in der Nähe von Dunker Church niedergemäht wurde. Durch ein Fenster sah ich, wie diese armen Kerle fielen, und ich rannte in das Getümmel und schleppte sie hinein, die Nordstaatler ebenso wie die Südstaatler, die Lebenden ebenso wie die Toten, und ich betete für uns alle.
Sharpsburg hat uns gelehrt, dass man nicht sterben muss, um in die Hölle zu kommen.
Dann kam der Winter, und wir waren müde von all dem Schlamm, der Kälte, den kurzen grauen Tagen und der Tatsache, dass die Yankees nicht aufgaben und sich nach Hause verzogen, so wie unsere Anführer es prophezeit hatten. Unglücklicherweise wird eine Armee, die nicht marschiert und nicht kämpft, unruhig und übellaunig. Als ich einen Spaziergang in einem verschneiten Wald entlang eines Bachs machte, sah ich einen Burschen in meinem Alter auf einem Felsen sitzen. Er las ein Buch, trug einen schwarzen Filzhut auf dem Kopf und hatte eine graue Decke um die Schultern geschlungen, die vor Kälte ganz steif war. Ein paar Meter weiter lehnte ein Gewehr mit aufgepflanztem Bajonett an einem Baum.
Der Soldat auf dem Felsen war in sein Buch vertieft, einen Gedichtband von Robert Browning. In meiner Hemdtasche hatte ich in einem Tabakbeutel Kaffeebohnen, und in meinem Tornister trug ich zwei Zinnbecher sowie einen halben Laib Brot und ein Stück Schinken bei mir. Ich hatte auch meine Bibel dabei. Es war eine Woche vor Weihnachten. In der Tristesse dieses Tages dachte ich daran, wie schön es wäre, mein Essen und meine Bibel mit einem Kameraden zu teilen, der die gleichen Gedichte liebte wie ich und der sich wahrscheinlich ebenso wie ich danach sehnte, seine Familie wiederzusehen.
»Wenn Sie ein paar Äste sammeln und ein Feuer machen, habe ich die Zutaten für ein Festmahl«, sagte ich.
Er antwortete nicht. Er hielt das aufgeschlagene Buch vor sein Gesicht und verbarg es wie hinter einer Maske.
»Ich hoffe, ich habe Sie nicht gestört«, sagte ich.
Langsam ließ er das Buch sinken. Da fiel mein Blick auf sein Gewehr. Es war ein Springfield. Im Jahr 1862 sah man nur selten Springfields bei den Grauröcken unserer Armee.
»Ich bin unbewaffnet, Sir«, sagte ich.
Er schlug sein Buch zu, ohne die Stelle zu markieren, und legte es neben sich auf den Felsen. Sein Gesicht war im Schatten der Hutkrempe verborgen. Er ließ die Decke von den Schultern gleiten und griff in seinen Mantel. Er war marineblau und hatte goldene Epauletten. Aus dem Hosenbund zog er einen kleinen Revolver und richtete ihn auf mich.
»Ich wollte nichts Böses«, sagte ich.
Er spannte den Hahn mit dem Daumen.
»Bitte, Sir«, stammelte ich.
In seinen Augen war kein Zorn. Aber auch keine Gnade.
Und auch sonst nichts, um genau zu sein.
»Sir, ich bin gleich weg. Ich bin der Assistent des Chirurgen. Ich bin kein Soldat.«
Ich weiß nicht, ob seine Hand zitterte oder ob er den Revolver nicht richtig zu fassen bekam, aber er schoss trotzdem, und die Kugel durchschlug meinen Mantel. Der Yankee-Offizier schien genauso erschrocken zu sein wie ich, aber das hielt ihn nicht davon ab, bei seiner versehentlichen oder vorsätzlichen Entscheidung zu bleiben, die unser beider Leben für immer verändern sollte. Er zielte jetzt mit beiden Händen und drückte ab. Der Hahn schnappte hart auf eine Patrone, die nicht zündete.
Er wirkte verblüfft oder erschrocken, und ich fragte mich, ob er wirklich im Zorn geschossen hatte. Aber für solche Überlegungen blieb mir keine Zeit. Mein Herz klopfte so laut, dass ich glaubte, mein Kopf würde explodieren.
Dann übernahm ein unbekanntes Wesen in mir die Kontrolle über meinen Körper und meinen Geist. »Du verdammter Bastard«, rief ich und rannte zu dem Gewehr. »Das wirst du mir büßen.«
Er versuchte erneut, den Revolver mit beiden Daumen zu spannen. Aber ich hatte jetzt sein Springfield und rammte ihm das Bajonett in die Brust. Es bohrte sich durch Knochen und Muskeln bis in einen Lungenflügel. Ich spürte, wie sein Gewicht über die Klinge sank, während er sich mit bloßen Händen von ihr wegzudrücken versuchte. Er ging auf die Knie, und seine Augen quollen hervor, groß und braun wie polierte Kastanien, während seine Hände nach dem Lauf des Gewehrs griffen.
Aber ich war noch nicht fertig. Ich riss das Bajonett aus der Wunde, zielte auf sein Herz und stieß ein zweites Mal zu, wobei ich mich mit aller Kraft gegen den Gewehrschaft stemmte, bis die Spitze des Bajonetts aus seinem Rücken trat und ihn im Schnee festnagelte. Langsam öffneten sich seine Lippen und stülpten sich vor, dann fielen seine Arme ausgestreckt zur Seite, wie bei einem gekreuzigten Christus. Im Sterben sprach er kein Wort.
Ich möchte meine Kriegserlebnisse nicht wieder aufleben lassen, daher hoffe ich, die Kämpfe bleiben im Osten oder hören ganz auf. Aber das ist reines Wunschdenken. Und die Schwarzen aus Afrika wissen das auch. In allen Gemeinden wurde ihnen verboten, auf den Feldern zu singen, denn Singen ist die Telegrafie der Afrikaner, und oft sind ihre Lieder nicht das, was sie zu sein scheinen. Welch eine Ironie. Wir behaupten, die überlegene Rasse zu sein, haben aber Angst vor Menschen, die nie gelernt haben, zu schreiben und zu rechnen.
Im Juni 1861 erhängten die Bürger von St. Martin sechs Sklaven und einen Weißen, die einen Aufstand geplant hatten. Andere wurden »disziplinarischen Maßnahmen unterworfen«. So lautete die in der Lokalzeitung verwendete Umschreibung. Auch das Wort »Sklave« tauchte in dem Artikel nicht auf. Wir haben uns ein Wörterbuch der Heuchelei geschaffen, das es uns erlaubt, Sklaven »Bedienstete« zu nennen. Ich schäme mich, Männern die Hand zu geben, von denen ich weiß, dass sie an den Hinrichtungen beteiligt waren, und ich meide sie, wenn ich ihnen in meiner Kirchengemeinde begegne.
Trotzdem finde ich keine Ruhe. Ich habe für Mr. Lincoln gestimmt, aber ich bin mit seiner Politik nicht einverstanden. Nach der Besetzung von New Orleans wurde an der Münzanstalt die amerikanische Flagge gehisst und sofort von einem Mob wieder heruntergerissen. Ein berufsmäßiger Spieler wurde dabei erwischt, wie er ein winziges Stück der Flagge im Knopfloch trug, und General Butler, dieser heimtückische Haufen Walsperma, war sich nicht zu schade, den armen Kerl am Fahnenmast der Münzanstalt aufzuhängen.
Aber ich fürchte, ein Ortswechsel wird mein Problem nicht lösen. Ich glaube, der wahre Feind ist der Affe, der noch in uns allen lebt. Voltaires Empfehlung an die Menschheit war es, unsere eigenen Gärten zu pflegen und die Verrückten ihrer Wege ziehen zu lassen. Dasselbe gilt für Charles Dickens. Erinnern Sie sich an Mr. Dick? Er sagt zu David Copperfield: »Es ist eine verrückte Welt. Sie gleicht einem Irrenhaus, Junge!« Mr. Dick war in der Irrenanstalt von Bedlam gewesen und trug Schreibfedern im Haar, falls er einen Gedanken notieren wollte. Lesen Sie unbedingt, was er über den Pöbel bei öffentlichen Hinrichtungen zu sagen hat. Vermutlich war Mr. Dickens ein einsamer Mensch.
Genug davon. Ich bin ein Mann ohne Heimat, ohne Ziel, ein Gast auf der Plantage meines Onkels, und ich male Vögel. Aber eine junge Kreolin namens Hannah Laveau hat es mir angetan. Mein Onkel hatte sie vor einem Jahr auf dem Sklavenmarkt in New Orleans gekauft, kurz bevor die Stadt kapitulierte, und sie dann als sogenannte Lohnsklavin an einen Bekannten am Spanish Lake vermietet.
Das Mietverhältnis dauerte keinen Monat. Mein Onkel fuhr eigens mit seiner Kutsche zum Spanish Lake und holte sie in sein Haus nach St. Martin, ohne ein weiteres Wort über die Angelegenheit zu verlieren. Es gab viele Gerüchte über seinen Freund, und alle waren übel. Aber mein Onkel wollte nicht darüber reden und gab der jungen Frau eine Hütte am Rande des Sumpfes, ganz für sich allein. Mein Onkel ist ein düsterer, einsilbiger Mann, dem ich nie wirklich nahegekommen bin, obwohl er sehr großzügig zu mir war.
Bis gestern Abend hatte ich nur wenige Begegnungen mit der jungen Sklavin, alle eher flüchtig. Offenbar spricht sie Spanisch und Französisch und war Sklavin auf den Westindischen Inseln, wo die dorthin verschleppten Afrikaner offenbar alle Arten von Grausamkeit und Härte erdulden mussten. Einige der Afrikaner meines Onkels behaupten, sie besäße magische Kräfte. Allerdings behaupten sie häufiger, Zeugen magischer Ereignisse zu werden, wahrscheinlich um die Verschleppung in den Süden zu ertragen. Gestern Abend, als die Yankees anfingen, über unseren Köpfen Granaten detonieren zu lassen, wurde mir klar, dass es sich bei der jungen Frau um eine seltsame Charaktermischung handelt, die von einer autoritären Gesellschaft nicht lange geduldet wird.
Als die erste Granate explodierte, zogen sich mein Onkel und seine Familie in den Keller zurück, während sich die Afrikaner in ihren Hütten am Rande des Sumpfes zusammenkauerten. Die Sonne brannte rot, und die Schatten der Pinien waren scharf wie Rasierklingen. Dann jedoch fiel ein Schatten auf mich und meine Staffelei, der garantiert nicht von einem Baum stammte.
»Hat der Master keine Angst vor Kanonen?«, fragte eine Stimme mit französischem Akzent.
Ich wandte mich um und sah zu ihr auf. Sie hatte ein Tuch um den Kopf geschlungen wie eine Art Kapuze. Trotzdem konnte ich ihre Züge erkennen. Ihre Hautfarbe war golden, und ihre Augen leuchteten grün-blau, eine Farbe, wie man sie in den Korallenriffen der Karibik findet.
»Ich bin kein Master«, sagte ich.
»Was sind Sie dann?«
In unserer Kultur spricht ein Sklave oder »Diener« einen Weißen niemals in der zweiten Person an. Eine Granate explodierte über dem Sumpf, und eine Sekunde später schlug ein Granatsplitter im Wasser ein, als hätte ein Kind einen Kieselstein geworfen. »Ich bin ein arbeitsloser Soldat«, sagte ich. »Können Sie lesen?«
»Ja, Sir.«
»Ich habe meine Brille verlegt, und mein Bein tut weh. Können Sie mir Mr. Audubons Buch Birds of America vom Tisch hinter der Eingangstür holen? Und bringen Sie bitte auch einen Stuhl für sich selbst mit.«
»Ich muss das Feuer in den Kaminen anmachen, Sir. Das gehört zu meinen Aufgaben.«
»Wir müssen den Yankees nicht verraten, dass wir hier sind, Miss Hannah.«
»Sie sollten mich nicht ›Miss‹ nennen, Sir.«
»Ich kann Menschen nennen, wie ich will.«
Es dämmerte, aber ich sah immer noch ihre Augen unter ihrem Schal. Sie blickten mich unverwandt an.
»Ihr Onkel kann manchmal sehr streng sein«, sagte sie.
»Muss ich laut werden, Miss Hannah?«, antwortete ich. Aber ich lächelte dabei. »Bringen Sie außer dem Buch und dem Stuhl auch eine Lampe mit. Gehen Sie zweimal, wenn es sein muss.«
»Nein, Sir, das werde ich nicht.«
Sie entfernte sich. Ihr Kleid reichte ihr bis zu den Knöcheln, ihr dunkler Mantel war eng um die Taille geschlungen, ihre Lederschuhe waren alt und wahrscheinlich hart wie Eisen. Die Sonne hatte den westlichen Himmel in Flammen aufgehen lassen. Ich glaubte, das Krachen von Handfeuerwaffen zu hören. Es klang wie chinesische Feuerwerkskörper. Sie hielt inne und drehte sich um, als hätte sie endlich begriffen, dass die Waffen der Befreier auch Unschuldige töteten, nicht nur die Diener des Fürsten der Finsternis. Aber ich hatte mich getäuscht.
»Ihr Onkel hat mich vor dem bösen Mann am Spanish Lake gerettet«, sagte sie. »Ich war Köchin bei den Südstaatensoldaten in Shiloh Church. Mein kleiner Junge war bei mir.« Ihre Stimme versagte.
»Pardon?«
»Ich habe ihn inmitten des Rauchs, der Schüsse und der brennenden Zelte verloren.« Ihre Augen wurden feucht. Der Kanonendonner und die Granateneinschläge hatten zugenommen. In einer der Hütten stöhnte jemand. »Ich weiß nicht, wo mein kleiner Samuel ist, Sir.«
»Das tut mir leid, Hannah.«
Sie kam auf mich zu, als wäre ich die Quelle ihres Unglücks, und der glühende Himmel spiegelte sich in ihren Augen. »Ich hole ihn zurück. Mein Leben zählt nicht. Ich habe keine Angst vor den Yankees und auch nicht vor den Rebellen. Ich gebe mein Leben für meinen kleinen Samuel.«
»Sagen Sie so etwas niemals vor anderen. Haben Sie mich verstanden?«
»Ich hole Ihr Buch, Sir.«
»Bitte antworten Sie mir, Hannah. Ich bin Ihr Freund.«
Sie entfernte sich. Die Kanonen waren verstummt, und die Stockenten quakten wieder im Schutz des Sumpfes. Die Sonne brannte am Horizont, die Luft war feucht und dunkel wie ein Bluterguss. Ich blinzelte und rieb mir die Augen. Hannah schien sich in der Finsternis aufgelöst zu haben.
2 PIERRE CAUCHON
Kein Zuckerschlecken ist das, in drei Gemeinden für Ruhe und Ordnung zu sorgen, und das sowohl bei den Sklavenpatrouillen wie auch bei den Schwarzen selbst. Erstere übertreiben es öfter mal, und Letztere scheinen es einfach nie zu kapieren, es sei denn …
Sie fragen sich vielleicht, was »es sei denn« bedeutet? Glauben Sie mir, besser, Sie wissen es nicht.
Die Sonne ist noch nicht ganz aufgegangen, der Nebel wälzt sich aus dem Sumpf und glitzert wie ein Regenbogen, aber da vorne höre ich schon die Schwarzen von der Plantage Lady of the Lake Zuckerrohr hacken und stapeln, und zwar ohne Gesang. Also wissen die Schwarzen von Mr. Lufkin Bescheid und legen offenbar keinen Wert darauf, dass man ihnen das Fell über die Ohren zieht, so wie schon einigen anderen zwischen hier und dem Atchafalaya Basin.
Letzte Woche haben drei von ihnen in New Iberia einen Krug Sirup, einen Sack Mais und ein Zuckerrohrmesser geklaut und sind damit abgehauen. Aber die Hunde und die Sklavenpatrouille haben sie von einem Baum tief im Sumpf heruntergeholt, und man hat ihnen eine disziplinarische Lektion erteilt. Ich finde nicht leicht die richtigen Worte dafür. Solche, die angemessen sind. Sagen wir es so: Die disziplinarische Lektion hat die Sichtweise der Ausreißer deutlich verändert.
Ich bin wegen einer Schwarzen hier. Hannah Laveau ist ihr Name. Ich hatte zwei- oder dreimal Schwierigkeiten mit ihr, als sie an einen gewissen Minos Suarez am Spanish Lake außerhalb von New Iberia vermietet war. Er erklärte mir, sie sei verrückt und würde die anderen Schwarzen aufhetzen. Ich solle doch mal ein Wörtchen mit ihr reden. Um der Wahrheit die Ehre zu geben: Der alte Suarez kann seinen Schwanz nicht im Zaum halten, und das ist allgemein bekannt. Ich wollte ihn gerade darauf ansprechen, womit ich mich wahrscheinlich heftig in die Nesseln gesetzt hätte, als er mir versicherte, dass sie eine Aufrührerin sei. Und wenn Sie hier einen Flächenbrand entfachen wollen, dann reicht dieses Wort. Fragen Sie mal die, die vor zwei Jahren in St. Martinville am Strick baumelten.
Nicht schön, so zwischen zwei Stühlen zu sitzen. Um ehrlich zu sein, ich mag sie. Sie hat unsere Jungs in Shiloh bekocht. Ja, das hat sie. Die Louisiana-Einheiten hatten schwarze Diener dabei, als sie in Owl Creek heftig eins auf die Mütze bekamen. Verdammt hübsch ist sie außerdem. Keine Frage.
Ich steige vom Pferd und führe es ins Zuckerrohrfeld. Kein einziger Schwarzer blickt von seiner Arbeit auf. Der Aufseher, den sie Biscuits-and-Gravy Comeaux nennen, ist ein Mann, der noch nie eine Mahlzeit verpasst hat. Er hat immer Tabak im Mund und spuckt alle sechzig Sekunden einen Strahl aus. Ich hab’s selber mit der Uhr überprüft. Auf dem Boden zwischen den Zuckerrohrblättern liegen halbmondförmige Eisensplitter, die aussehen wie Hufeisen. Aber es sind Splitter explodierter Granaten.
»Morgen, Biscuits«, sage ich.
»Ihnen auch einen guten Morgen, Sir«, antwortet er.
Ich betrachte die Metallsplitter auf dem Boden. »Sieht ganz so aus, als hätten die Blauröcke euch letzte Nacht auf Trab gehalten.«
Biscuits strahlt. »Bin mir nicht sicher, ob die von den Blauröcken sind. Hab gehört, die Jayhawkers oder Red Legs oder wie auch immer sich diese Freischärler nennen, hätten ein oder zwei Kanonen erbeutet. Was führt Sie hierher?«
»Ist Mr. Lufkin schon auf?«
»Die bessere Frage ist, ob er überhaupt schon im Bett war«, sagt er und lacht über seinen eigenen Witz.
Mr. Lufkin ist für seine langen Arbeitstage bekannt. Das gilt nicht nur für ihn, sondern auch für alle anderen auf seiner Plantage. Angeblich kam er mit neunzehn Jahren von Pennsylvania nach Louisiana und kämpfte an der Seite von Andrew Jackson in der Schlacht von New Orleans. Außerdem kaufte er alles, was er in die Finger kriegen konnte, vor allem Sklaven, egal welchen Geschlechts und Alters, solange sie fortpflanzungsfähig waren. Eine sichere Kapitalanlage, es sei denn, die Schwarzen machten Ärger oder begingen Selbstmord. Ein erwachsener Sklave wird für achthundert bis zwölfhundert Dollar gehandelt. Und das in Gold.
»Kennen Sie eine dunkelhäutige Frau namens Hannah Laveau?«
»Klar doch«, erwidert Biscuits.
»Hat Sie Ihnen je Ärger gemacht?«
»Nein, mir nicht«, antwortet er und lässt dann seinen Blick schweifen. In seinem Nacken stapeln sich Speckwülste, seine Haut ist rosig, und die Bartstoppeln unter seinem Kinn sind weiß.
»Aber damit ist die Geschichte noch nicht zu Ende?«, frage ich.
Er spuckt Tabaksaft auf den Boden. »Sie ist eine Voodoo-Frau.«
»Und?«
»Die anderen Nigger hören auf sie.«
Aus dem Sumpf fegt eine Windböe heran, und das Moos flattert auf den Hunderten von Tupelobäumen bis runter zum Golf und zum südlichen Horizont.
»Sieht ganz so aus, als braut sich ein Sturm zusammen«, sagt Biscuits.
»Könnte sein«, antworte ich.
Wieder spuckt er und trifft diesmal den Knöchel einer vollbusigen Schwarzen, die ein Bündel Zuckerrohr auf den Wagen hievt. Ihre Miene versteinert, ihre Augen sind schon tot. Ich möchte nicht wissen, was in ihrem Kopf vorgeht.
Ich schwinge mich auf meine Stute und reite die Straße hinauf zum Haupthaus der Plantage Lady of the Lake. Mein Pferdchen ist ein Missouri-Foxtrotter, extra gezüchtet für Pflanzer, die lange Tage im Sattel verbringen müssen und ein Tier brauchen, das über unwegsame Felder reiten kann, ohne dass einem der Hintern abfällt. Meine ist ein Fuchs, hat ein Stockmaß von fünfzehn Handspannen und ist ein mächtig schönes Pferd, das ich zugegebenermaßen sehr liebe. Ich habe sie Varina genannt. Nach der Frau von Jefferson Davis.
Das Haupthaus steht auf einem Hügel, von dem aus man einen herrlichen Blick auf die Sümpfe und die Gewitterstürme über dem Golf hat. Das Haus ist auch in anderer Hinsicht ungewöhnlich. Es ähnelt Villen auf den Westindischen Inseln, hat eine umlaufende Veranda, deckenhohe Fenster, Fensterläden mit Lamellen im zweiten Stock und Schornsteine auf beiden Seiten, aus denen Rauch quillt. Ein Haus, das gebaut wurde, damit Luft hindurchwehen kann.
Ich steige ab, binde mein Pferd an einen Eisenpfosten, gehe zur Haustür und klopfe. Der Vorbau und die Säulen der Veranda sind aus Ziegeln, nicht aus Zement, und sie liegen noch tief im Schatten, obwohl die Sonne schon über den Bäumen steht. Niemand macht mir auf. Ich zücke meine Uhr und warte eine Minute, dann klopfe ich erneut.
Mr. Lufkin öffnet langsam die Tür, als wäre es eine lästige Pflicht. Er trägt einen schwarzen Anzug und eine graue Weste, Pantoffeln ohne Socken und eine goldene Uhr um den Hals. Sein Gesicht könnte aus Balsaholz geschnitzt sein, sein Haar ist schmutzig blond, von der Farbe eines Seils, und hängt ihm wirr ins Gesicht. Sein gereizter Blick ist nicht sehr einladend. »Was wollen Sie?«, fragt er.
Ich ziehe meinen Hut. »Ich bin Constable Pierre Cauchon, Mr. Lufkin. Ich komme im Auftrag von Mr. Suarez von New Iberia. Er besitzt eine Plantage am Spanish Lake.«
»Ich weiß, wer Mr. Suarez ist und wo er wohnt. Was wollen Sie?«
»Ich möchte gerne mit Ihnen darüber sprechen, was Sie über eine Dienerin namens Hannah Laveau wissen. Es geht um das Thema Aufruhr.«
»Ich verstehe. Gehen Sie ums Haus herum.«
»Sir?«
»Sind Sie taub?«
Er knallt mir die Tür vor der Nase zu. Ich setze meinen Hut auf und gehe um das Haus herum. Zwei schwarze Frauen waschen Wäsche in einer Bütte. Sie kichern. Ich werfe ihnen einen Blick zu, und sofort werden ihre Gesichter ausdruckslos. Mr. Lufkin öffnet die Hintertür. Er soll mir bitte erklären, was da gerade vorgefallen ist, etwas in der Art wie: Entschuldigen Sie bitte, Mr. Cauchon, aber wir unterziehen unser Haus gerade einer Generalreinigung, oder wir reparieren einen Schaden, den die Yankee-Kanonen angerichtet haben, oder Mrs. Lufkin ist krank und noch nicht angekleidet, irgendetwas, das sein beleidigendes Verhalten von eben erklärt.
»Kommen Sie nun rein oder nicht?«, fragt er durch die offene Tür.
»Danke«, sage ich, nehme meinen Hut wieder ab und betrete die Küche. Ich schließe die Tür hinter mir.
»Was ist mit diesem Aufruhr?«, fragt er.
»Das ist lediglich ein Vorwurf, der erhoben wurde, Mr. Lufkin. Vielleicht ist er unberechtigt. Ich kenne die betreffende Angestellte. Sie scheint eine gute …«
Ich schaffe es nicht, den Satz zu beenden. »Komm rein, Hannah«, ruft er und fixiert mich dabei.
Hannah erscheint in der Tür, einen Besen in der Hand und ein gelbes Tuch mit roten Punkten um den Kopf geschlungen.
»Hast du über Rebellion und so was gesprochen?«, fragt Mr. Lufkin.
»Nein, Sir, habe ich nicht.«
»Da haben Sie Ihre Antwort«, sagt Mr. Lufkin. »Und jetzt sehen Sie zu, dass Sie weiterkommen.«
Mein Gesicht ist heiß, mein Mund trocken. Als Kind bin ich in einer Hütte mit Lehmboden neben einer Terpentinmühle aufgewachsen. Bohnen und gebratenen Speck gab es nur selten. Mein Vater starb am Gelbfieber, meine Mutter war blind, aber bei Gott, sie hat mir das Lesen beigebracht. Und ich weiß, wenn ich diesen Raum verlasse, ohne dass dieser alte Mann seine verächtlichen Äußerungen zurücknimmt, werde ich nie mehr derselbe sein, so als hätte man mir einen Arm oder ein Bein abgesägt und mich am Straßenrand zum Betteln ausgesetzt.
Dann mal los, sage ich mir. »Mr. Suarez hat mir gewisse Informationen übermittelt, die ich Ihnen hier zitiere. Ich möchte nur ungern zu ihm zurückkehren und ihn einen Lügner nennen müssen.«
»Das habe ich auch nicht verlangt.«
»Und sagt er nun die Wahrheit oder nicht?«
»Hören Sie. Mr. Suarez ist ein Geschäftspartner, kein Freund. Aber mit Fremden rede ich weder über Freunde noch über Geschäftspartner. Damit ist dieses Gespräch beendet.«
»Ich gebe Ihnen mein Wort, Sir«, sage ich. »Es behagt mir nicht, dass diese Angelegenheit so beiläufig behandelt wird.«
»Sir, Ihr Wort hat für mich keine Bedeutung. Sie sind weißer Abschaum. Verlassen Sie auf der Stelle mein Haus.«
Hannah Laveaus Augen sind gesenkt, ihre Schultern gebeugt, ihre Hände um den Besenstiel geschlossen. Dann schaut sie mich einige Sekunden lang an. Ich weiß nicht, was sie denkt. Will sie, dass ich aufbegehre, frech werde? Oder genießt sie meine Demütigung? Warum umklammern ihre Hände so fest den Besenstil? Warum löst das Funkeln ihrer grünblauen Augen und der schimmernde Ansatz ihrer Brüste in mir eine solche Scham und ein solches Verlangen aus, wie ich sie noch nie empfunden habe? Warum kümmert mich diese Schwarze überhaupt?
Ich starre Mr. Lufkin an. Es ist offensichtlich, dass er sich vor mir ekelt. Ohne Grund. Nur weil ich der bin, der ich bin.
»Ich wollte Sie nicht beleidigen, Mr. Lufkin«, sage ich.
Er öffnet mir die Tür, dabei atmet er durch den Mund und zieht ein Taschentuch hervor, um nicht den Türgriff berühren zu müssen, den ich vorher angelangt habe.
Mir ist schwindelig, als wäre ich auf Deck eines schwankenden Schiffes, während ich die hintere Treppe hinuntersteige. Ich fühle mich winzig. Und das, obwohl ich einen Meter achtzig groß bin. Lieber ließe ich mich ausweiden und meine Eingeweide verbrennen, so wie man es früher mit Schwerverbrechern gemacht hat, als die letzten zehn Minuten meines Lebens noch einmal erleben zu müssen. In meiner Dummheit hoffe ich noch, der alte Lufkin würde mir nachrufen, sich entschuldigen, dass er schlechte Laune hatte, lächeln und dann zum Abschied winken. Aber als ich mich umdrehe, starrt er mich an, seine Augen sind hart wie Murmeln, und dann zieht er abrupt den Vorhang vor das Fenster, wie ein Henker, der für diesen Tag mit der Arbeit fertig ist.
Ich steige auf Varina, reiße grob an der Trense in ihrem Maul und schlage sinnlos mit der Peitsche auf sie ein, schändlich und grausam, wie ich bin.
3 HANNAH LAVEAU
Master Lufkin war nicht fair zu Mr. Cauchon, nein, aber das liegt nur daran, dass er sich nicht verzeihen kann, mich an Master Suarez vermietet zu haben. In der zweiten Nacht auf seiner Plantage gab Master Suarez mir die beste Hütte und sagte, ich könne alles haben, was ich wolle. Er käme mich in ein paar Tagen besuchen, wenn die Feldarbeiter fertig seien, die Sonne über dem See untergegangen sei, der Wind die Moskitos weggeblasen habe, die Arbeiter sich gewaschen und zu Abend gegessen hätten und wie üblich zu Bett gegangen seien, und dann würden er und ich über die Antillen reden. Dann würde ich vielleicht einwilligen, mich zu ihm zu legen, und danach würde er mir jede Arbeit geben, die ich wolle, und er würde mir schöne Dinge kaufen, und wenn ich Angst hätte, ein Kind zu bekommen, solle ich daran denken, dass es von ihm gezeugt sei und immer gut versorgt würde.
Ich erklärte ihm, dass ich schon einen Mann habe. Sein Name ist Elkanah. Wir sind unsere Bindung vor einem Prediger eingegangen, aber Elkanah ging auch Bindungen mit anderen Sklavinnen ein und wurde dann verkauft, und ich blieb unfruchtbar und allein zurück, und dann habe ich gebetet und gebetet, und der Herr hat mir den kleinen Samuel geschenkt. Ich habe ihn mehr geliebt, als sich irgendjemand das vorstellen kann. Dann verlor ich ihn bei Shiloh Church, als die Yankees mit ihren Kanonen den Hügel hinunter in die Zelte feuerten.
Master Suarez wurde wütend, ging zurück in sein Haus und schickte mich für drei Tage ins Zuckerrohrfeld. Dann kam er nachts mit einem Krug Whiskey in meine Hütte und wollte, dass ich mittrinke. Ich sagte ihm, dass ich keinen Alkohol trinke und auch keinen Tabak kaue, und er gab mir stattdessen einen Kuchen und sagte, er sei ein einsamer Mann, seine Frau sei dement, und es sei nicht die Bestimmung eines Mannes, allein zu bleiben. Er sagte, all das stehe in der Bibel, und Eva sei dazu bestimmt, den Mann zu trösten und ihm beizuwohnen, also würden wir nichts Falsches tun, wenn er bei mir liege. Und ich sagte Nein und wieder Nein, aber er zog mir die Unterwäsche aus und tat mir sehr weh und hörte nicht auf, mir wehzutun, und als ich ihm sagte, wie sehr er mir wehtat, wurde er noch brutaler, presste seinen Mund fest auf meinen, sodass ich keine Luft mehr bekam, bis ich ganz schwach wurde und weinte und wusste, dass ich sterben würde.
Dann tat ich etwas, was ich noch nie getan hatte. Ich malte mir in meinem Kopf aus, was Master Suarez alles zustoßen würde. Dinge, die dafür sorgen würden, dass er nie wieder eine schwarze Frau angreift. Unmittelbar nachdem ich diese Bilder hinter meinen Augen gesehen hatte, fühlte ich nichts mehr, mein Inneres war völlig leer, nur ein Hohlraum voller Licht. In meinen Gedanken sah ich meinen kleinen Samuel, und ich wusste, dass er mich eines Tages finden würde, und dann würden wir dorthin gehen, wo Kokospalmen und Ananas wachsen, wo bei Sonnenschein Regen fällt und wo die Fische über den Wellen fliegen, an einen Ort, wo die bösen Menschen uns niemals finden.
In meiner Hütte habe ich eine Lampe. Ich besitze auch einen Schreibgriffel und Papier, was Sklaven normalerweise verboten ist. An einem Sonntagmorgen, zwei Wochen nachdem Mr. Cauchon auf der Lady of the Lake war und von Master Lufkin gedemütigt wurde, sehe ich Mr. Wade den Hang hinunter zu den Unterkünften kommen. Ich glaube, er ist ein guter weißer Mann, aber er macht mir Angst. Er wird von Geistern heimgesucht. Man sieht es in seinen Augen. Er hat etwas getan, das er nicht abschütteln kann, das ihn verfolgt, wohin er auch geht. Also hat er sich selbst zum Retter anderer Menschen erkoren. Mr. Wade ist jemand, der anderen nicht wirklich zuhört und das ganze Haus niederbrennt, nur weil im Dach ein Loch ist.
Er trägt seine Sonntagskleidung und nimmt den Hut ab, als ich die Tür öffne. »Wie geht es Ihnen heute Morgen, Miss Hannah?«
»Sehr gut«, antworte ich. »Brauchen Sie mich?«
»Ich arbeite an einem neuen Bildband. Und an einem Tagebuch. Ich habe gehört, Sie schreiben auch eines.«
Ich starre an ihm vorbei auf eine Stelle mitten im Sumpf. Er hat einen Schnitt am Kinn vom Rasieren. Er erinnert mich an einen Jungen, der nicht weiß, wie er zum Mann werden soll. Er folgt meinem Blick in den Sumpf. »Gibt es dort draußen etwas zu sehen?«, fragt er.
»Sir, ich weiß nicht.«
»Ich werde nicht verraten, dass Sie lesen und schreiben können. Mein Onkel wird das sicher auch nicht tun. Darf ich eintreten?«
»Ja, Sir.«
Der Boden meiner Hütte ist aus gestampftem Lehm, ich habe einen Tisch, zwei Stühle und ein Bett an der Wand, getrocknete Vorräte auf einem Regal und einen Holzeimer mit Regenwasser, das ich aus der Zisterne für die Unterkünfte hole. Mein Tagebuch und mein Schreibgriffel liegen auf einem Tisch, mein kleines Tintengläschen steht daneben. Sklaven, die gegen die Regeln der Plantage verstoßen, werden auf verschiedene Weise bestraft, meistens mit der Peitsche. Ich weiß von einer grausamen weißen Frau in New Iberia, die ein Sklavenmädchen grundlos gebrandmarkt und geblendet hat, nur weil ihr gerade danach war.
»Wollen Sie sich setzen, Sir?«
»Danke«, sagt er. »Hätten Sie was dagegen, wenn ich Sie zeichne? Ich möchte mich aber nicht aufdrängen.«
»Das macht sicher keinen guten Eindruck, Mr. Wade.«
»Ich verstehe«, sagt er. Er schaut auf meinen Tisch. »Sie benutzen einen Knochen als Schreibgriffel?«
»Ja, Sir.«
»Ich schenke Ihnen einen besseren.«
»Danke, aber ich benutze die Knochen von Tieren, um sie wieder zum Leben zu erwecken. So steht es im Alten Testament. Wir sollten Tieren nichts zuleide tun.«
Er lächelt mich an. »Sie sind eine ungewöhnliche Lady, Miss Hannah.«
»Sir, Sie dürfen mich nicht ›Lady‹ nennen.«
»Das weiß ich, und ich weiß auch, in welchen Schwierigkeiten Sie stecken. Ich trage ein Minié-Geschoss in mir, das ich mir im Dienst einer verhassten Sache zugezogen habe. Würde es Ihnen etwas ausmachen, ein wenig Rücksicht auf mich zu nehmen?«
Ich senke den Blick und erwidere nichts.
»Möchten Sie sich nicht setzen?«, fragt er.
»Ja, Sir.«
»Ich bin aus einem anderen Grund hier. Es geht um Mr. Suarez. Ein paar Constables wollen Sie befragen.«
Ich habe das Gefühl, als würde eine kalte Hand in meine Brust greifen und mein Herz zusammenpressen. Ich muss schwer atmen, um Luft in meine Lungen zu saugen. »Ist Master Suarez etwas zugestoßen, Mr. Wade?«
»Vor zwei Nächten hat ihm jemand die Kehle durchgeschnitten, ihm seine Augen ausgestochen und ihm an mehreren Stellen ein X in seinen Körper geritzt. Das ist ein Symbol der Verhexung, nicht wahr?«
»Ja, Sir. Das ist Voodoo. Mit Voodoo habe ich nichts zu tun.«
»Ich habe den Constables schon erklärt, dass Sie vor zwei Nächten hier waren und nicht in der Nähe vom Spanish Lake.«
Ich sehe ihm direkt ins Gesicht. »Warum glaubt man, dass ich es war?«
»Weil diese Leute wissen, wie Mr. Suarez mit seinen Sklaven umgesprungen ist.«
»Ist einer der Constables Pierre Cauchon, Mr. Wade?«
Er holt tief Luft. »Ja«, sagt er.
»Und er kommt hierher zurück? Obwohl Master Lufkin ihn rausgeworfen hat?«
»Miss Hannah, entfernen Sie alle roten Tücher, den ganzen Kram vom Friedhof und alle Knochenstücke aus Ihrer Hütte. Das gilt auch für Ihren Schreibgriffel.«
»Ich verhexe niemanden, Mr. Wade.«
»Ich weiß«, sagt er. Wieder holt er tief Luft. Aber er ist weiß, also weiß er gar nichts. Überhaupt nichts. Nicht mal das Geringste. Er verschränkt erst die Arme, dann legt er die Hände in den Schoß, schließlich stützt er die Fäuste auf die Knie.
»Was hat man noch mit Master Suarez gemacht?«, frage ich.
»Er wurde an einem weiteren Körperteil verstümmelt. Wahrscheinlich während er noch lebte.«
»Da bin ich aber froh.«
»So etwas dürfen Sie nicht sagen, Hannah.«
»Ich hoffe, es hat ihm wehgetan. So wie er mir wehgetan hat.«
Er steht auf, den Hut in der Hand, den Rücken gerade durchgedrückt. Er sieht gut aus in dem sanften Licht, das durch das Fenster fällt. »Sprechen Sie nur mit den Constables, wenn ich dabei bin.«
»Was wird mit mir geschehen, Mr. Wade?«
»Ich weiß es nicht, Hannah. Ich weiß es wirklich nicht.«
Dann geht er und setzt seinen Hut erst draußen wieder auf. Ich möchte den kleinen Samuel in meine Arme schließen. Ich will ihn an meine Brust drücken, mein Gesicht in seinem Kindergeruch vergraben und seine Arme um meinen Hals spüren. Und ich will, dass wir beide nach draußen gehen, im Sonnenschein und im Wind tanzen und erleben, wie sich Gottes Herrlichkeit über die ganze Welt ausbreitet. Aber in meiner Welt wird das nicht geschehen. Die bösen Menschen werden mich kriegen. Aus irgendeinem Grund scheinen die guten Menschen keine Chance zu haben. Und ich verstehe nicht, warum.
4 PIERRE CAUCHON
Sie fragen sich vielleicht, warum ich keine Uniform trage. Nun, ich habe mal eine getragen. Damals, 1862, in Shiloh und später in Corinth, wo ich beschuldigt wurde, mir die Zehen abgeschossen zu haben. Nichts davon ist wahr. Ich schlief in meinem Zelt, und dieser Idiot aus Mississippi spaltete daneben Holz und konnte nicht zwischen meinem nackten Fuß und einem Stück Kiefernholz unterscheiden.
Das ist wahrscheinlich der Grund, warum wir den Krieg verlieren. Was ich damit sagen will? Unsere Armee besteht zu drei Vierteln aus Soldaten, die keine Sklaven besitzen und trotzdem so dumm sind wie ich, sich als Kanonenfutter herzugeben. Und das nur, um Männer zu bereichern, die ohnehin schon steinreich sind. Warum sie so dämlich sind, fragen Sie sich? Die Antwort ist einfach. Die meisten sind Analphabeten. Wo sie leben, gibt es weder Zeitungen noch Telegrafenämter, manche wissen nicht einmal, dass Krieg herrscht. Dann erwachen sie eines Morgens, schauen aus dem Fenster und sehen, wie ein Regiment von Blauröcken ihre Scheune anzündet, ihr Vieh erschießt und in ihren Garten scheißt. Solche Erlebnisse machen die Menschen oft nachtragend.
Schauen Sie, die Plantagengesellschaft funktioniert folgendermaßen: Man legt sich eine adlige Herkunft zu, spielt sich auf, vögelt nach unten und heiratet nach oben. Währenddessen machen die kleinen Leute die Arbeit, egal ob sie weiß oder schwarz sind. Wir alle pflücken die Baumwolle des weißen Mannes. Vielleicht ist das im Norden anders. Ich war noch nie dort, aber ich habe gelesen, dass die Iren in New York die Wasserleitungen gekappt und dreihundert Schwarze in ihren Kellern ersäuft haben. Angeblich hat Herman Melville darüber geschrieben.
Es ist Sonntag, ich bin zwischen New Iberia und St. Martinville unterwegs und auf dem Weg zur Lady of the Lake. Die Landstraße ist kurvenreich, denn sie folgt dem Bayou Teche. Teche ist das indianische Wort für Schlange. Auf beiden Seiten der Straße stehen Stieleichen, und ihr von Sonnenstrahlen durchdrungenes Laubdach erinnert mich an ein Kirchenschiff. Die Felder werden hier nicht bestellt, das Gras steht zwei Meter hoch, und in der Ferne sind die Wälder dicht und verbergen oft einen Feind, der gefährlicher ist als die Blauröcke.
Gerade als ich darüber nachdenke, blähen sich die Nüstern meiner Stute, und ihr Fell zuckt, als hätten sich Stechfliegen auf ihrem Hinterteil niedergelassen. Am Rande einer Lichtung blitzt Metall im Sonnenlicht. Es bewegt sich hinter dem Laub der Bäume, und dann enthüllt der Wind eine Schar bärtiger Reiter. Offenbar sind sie auf der Suche nach einer Aufgabe, einer Bestimmung oder einem willkommenen Opfer für ihre wie auch immer gearteten mörderischen Launen.
Oh, Herr, warst du es, der solche Männer hervorgebracht hat? Diese Frage zu beantworten, ist mir nie gelungen.
Sie sind zu neunt, hängen schlaff in ihren Sätteln, ihre Köpfe baumeln – vermutlich haben sie die ganze Samstagnacht durchgefeiert oder eine Siedlung niedergebrannt. Sie tragen eine Mischung aus verblichenen Nordstaaten- und Rebellenuniformen, rot-weiß karierte Hemden und graue Hosen mit einem roten Streifen am Bein, im typischen Stil der Freischärler und irregulären Truppen, die durch Kansas und Missouri ziehen.
Der Anführer der Schar ist ein Mann, von dem ich schon viel gehört, den ich aber noch nie aus der Nähe gesehen habe. Er hat einen roten Bart, dick wie ein Kissen und mit Tabaksaft verschmiert, und er trägt ein beständiges Grinsen zur Schau, das eher einer schrecklichen Fratze ähnelt; außerdem schielt er. Da es im Umkreis von fünfhundert Meilen sicher keinen Zweiten dieser Art gibt, nehme ich an, dass es sich um Colonel Carleton Hayes handelt. Ein Mann, der alle Abolitionisten, die ihm in die Quere kommen, aufhängen lässt und ihren Familien verbietet, sie abzuschneiden, damit das Wetter und die Vögel nicht von Gottes Plan abgehalten werden. So zumindest wurden seine Worte in der Zeitung wiedergegeben.
Mit einem Ruck an den Zügeln lenkt er seine Schar so, dass sie meinen Weg kreuzen. Es sei denn, ich versuche, den Kugeln eines Spencer-Repetierers zu entkommen, den sie mit Sicherheit einem toten Blaurock abgenommen haben. Sie sind jetzt etwa vierzig Meter entfernt, und eine Salve würde Varina und mich wahrscheinlich ins Gras plumpsen lassen.
Im Moment zerrt sie mit angelegten Ohren an den Zügeln, wahrscheinlich ist sie sauer auf mich, weil ich uns erneut in ein Schlamassel gebracht habe.
»Wie ist das werte Befinden, Pilger?«, fragt der Colonel und tippt an seinen Hut. Er trägt Stulpenstiefel wie ein Pirat. Sein Gesicht ist von Pocken entstellt oder möglicherweise auch von einer bösartigen Geschlechtskrankheit. Seine Augen leuchten wie Laternen, obwohl er schielt. »Wer möchtet Ihr wohl sein«, fragt er und verzieht den Mund zu einem abstoßenden Grinsen.
»Ich bin Reverend Pierre Cauchon und auf dem Weg zur Plantage Lady of the Lake«, antworte ich und hoffe, dass mich der Schöpfer nicht mit einem Blitz aus dem Sattel schleudert.
»Da folgt Ihr in der Tat einer ehrenhaften Berufung, Sir«, sagt er. »Wie ich sehe, habt Ihr zwei Navy-Revolver am Sattelknauf hängen, aber ich entdecke keinerlei Anzeichen für eine Bibel oder Satteltaschen, in denen sich eine befinden könnte.«
»Ich trage die Bibel in meinem Herzen, Sir.«
»Ganz vortrefflich. Damit besitzt Ihr ohne Zweifel eine göttliche Gabe. Aber verratet mir, warum habt Ihr mich nicht nach meinem Namen gefragt?«
»Ihr Ruf eilt Ihnen voraus, Colonel Hayes. Sie sind bekannt als Freund der arbeitenden Männer und Frauen, die ein christliches Leben führen.«
»Danke für Eure lobenden Worte, Reverend. Wir wollten gerade etwas essen. Ich würde mich freuen, wenn Ihr uns dabei Gesellschaft leisten würdet.«
»Ich fühle mich geehrt, Sir, aber Mr. Lufkin erwartet mich. Mrs. Lufkin ist krank und kann leider nicht in die Stadt kommen, also werde ich die Messe in ihrem Haus zelebrieren.«
Die Sonne steht heiß und blendend über uns, Insekten steigen aus dem Gras und lassen sich auf Varinas Beinen und ihrem Bauch nieder. Der Colonel beugt sich zur Seite und spuckt Tabaksaft aus. »Bevor Ihr weiter Eurer Wege zieht, möchte ich Euch um einen Gefallen bitten. Für mein Pferd, um genau zu sein. Ich möchte, dass Ihr absteigt, seinen Schweif anhebt und seinen After küsst.«
In der Ferne müht sich ein Maultiergespann, eine Kanone auf Rädern aus dem Wald zu ziehen. Vermutlich ein Sechspfünder. Ein Rad scheint sich in der Nabe festgefressen zu haben. Zwei bis zur Hüfte entblößte Schwarze ziehen an den Maultieren.
»Ich habe Euch nicht verstanden«, sagt der Colonel.
»Weil ich nichts gesagt habe.«
Seine Männer grinsen. Er wischt sich mit einem Taschentuch über die Wange. Auf der geröteten, entzündeten Haut bleibt ein weißer, trockener Fleck zurück. »Ich möchte Euch noch etwas fragen«, sagt er. »Wart Ihr schon immer ein erbärmlicher Feigling und ein Lügner, oder habt Ihr erst jetzt in diesen kriegerischen Zeiten so richtig Gefallen daran gefunden?«
Ich höre, wie jemand aus seiner Truppe den Hahn einer Waffe spannt. Woraufhin ich meine Absätze in Varinas Flanken ramme und lospresche, tief in den Sattel geduckt und Varina im gestreckten Galopp, verdutzte Wachteln aus dem dichten Gras aufschreckend.
Der Colonel und seine Männer wollen uns alle auf einmal hinterher, wobei sich ihre Pferde in die Quere kommen, was wahrscheinlich das Einzige ist, was mir und Varina das Leben rettet. Die Kugeln von Minié und Spencer zischen und schwirren an unseren Ohren vorbei. Aber ich habe keine Angst mehr. Stattdessen fühle ich mich wie damals an der Front bei Corinth, als ich wie berauscht mit dem flatternden Andreaskreuz in der Hand auf die Yankee-Linie zustürmte und dabei »Woo! Woo! Woo!« ausstieß, den unverwechselbaren Schlachtruf der Rebellen, den gefürchteten Rebel Yell.
Ich ziehe einen meiner Colts aus dem Halfter, spanne ihn, richte ihn ohne zu zielen nach hinten und feuere zwei, vielleicht drei Schüsse auf die Freischärler ab. Dann galoppiere ich auf einer schmalen Holzbrücke über den Teche, erreiche den Schatten der Bäume am anderen Ufer, schwinge mich vom Pferd, packe jetzt meine beiden Colts und leere sie in Richtung Colonel Hayes und seiner Jungs, die an der Brücke in einen Engpass geraten sind und nicht darauf erpicht zu sein scheinen, ein Stück Blei als Katerfrühstück zu sich zu nehmen.
Ich steige wieder auf Varina, verlasse im Trab die Baumgruppe und fühle mich gleich viel besser. Ich denke sogar mit einem gewissen Stolz daran, dass ich ein gewöhnlicher Mann bin, der aber mit seinen Waffen umzugehen weiß, der seinem Gewissen und seiner Vorstellung vom Schöpfer treu ist, und kein Kriecher, der für die Plantagenbesitzer und andere Reiche schuftet, die sich nicht einmal Zeit nehmen würden, auf mich zu pissen, selbst wenn ich in Flammen stünde....Ende der Leseprobe