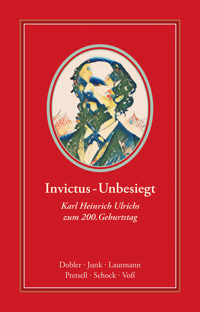
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Männerschwarm Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Karl Heinrich Ulrichs, Jurist, Sexualforscher, Dichter und Züchter von Seidenraupen, war ein Ausnahmemensch des 19. Jahrhunderts. In einer Zeit, als "Sodomie" der Kirche als Sünde und "widernatürliche Unzucht" dem Staat als Verbrechen galten, gelang es ihm, sich von all diesen Vorurteilen freizumachen und die seelische und körperliche Liebe zwischen Menschen des gleichen Geschlechts als einen ganz natürlichen Vorgang aufzufassen. Erst in historischer Perspektive wird Ulrichs wahre Größe sichtbar – gerade auch im Vergleich zum bekannteren Arzt Magnus Hirschfeld, der nach Ulrichs Tod einen großen Schritt zurückging, indem er um Verständnis für Homosexualität als "Fehler der Natur" warb. Die Würdigung von Leben und Werk Karl Heinrich Ulrichs' war das zentrale Anliegen von Wolfram Setz, dem 2023 verstorbenen Herausgeber der Bibliothek rosa Winkel. Folglich erscheint auch der Ulrichs-Gedenkband "Invictus – Unbesiegt" in der historischen Buchreihe. Der Soziologe und Rechtswissenschaftler Rüdiger Lautmann würdigt in seinem Artikel Ulrichs oft übersehene Leistungen als Sexualforscher, Axel Schock berichtet über die Widerstände, Straßen und Plätze in Deutschland nach Ulrichs zu benennen, und der Berliner Autor Kevin Junk beschreibt, wie er als schwuler Mittdreißiger von heute den Vorgänger im Kampf um homosexuelle Emanzipation wahrnimmt. Weitere Beiträge beleuchten Ulrichs aus Sicht der Queer Theory und rekonstruieren die Persönlichkeitsmuster homosexueller Männer in der Mitte des 19. Jahrhunderts.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Über dieses Buch
Karl Heinrich Ulrichs, Jurist, Sexualforscher, Dichter und Züchter von Seidenraupen, war ein Ausnahmemensch des 19. Jahrhunderts. In einer Zeit, als »Sodomie« der Kirche als Sünde und »widernatürliche Unzucht« dem Staat als Verbrechen galten, gelang es ihm, sich von all diesen Vorurteilen freizumachen und die seelische und körperliche Liebe zwischen Menschen des gleichen Geschlechts als einen ganz natürlichen Vorgang aufzufassen. Erst in historischer Perspektive wird Ulrichs wahre Größe sichtbar – gerade auch im Vergleich zum bekannteren Arzt Magnus Hirschfeld, der nach Ulrichs Tod einen großen Schritt zurückging, indem er um Verständnis für Homosexualität als »Fehler der Natur« warb.
Die Würdigung von Leben und Werk Karl Heinrich Ulrichs’ war das zentrale Anliegen von Wolfram Setz, dem 2023 verstorbenen Herausgeber der Bibliothek rosa Winkel. Folglich erscheint auch der Ulrichs-Gedenkband »Invictus – Unbesiegt« in der historischen Buchreihe. Der Soziologe und Rechtswissenschaftler Rüdiger Lautmann würdigt in seinem Artikel Ulrichs oft übersehene Leistungen als Sexualforscher, Axel Schock berichtet über die Widerstände, Straßen und Plätze in Deutschland nach Ulrichs zu benennen, und der Berliner Autor Kevin Junk beschreibt, wie er als schwuler Mittdreißiger von heute den Vorgänger im Kampf um homosexuelle Emanzipation wahrnimmt. Weitere Beiträge beleuchten Ulrichs aus Sicht der Queer Theory und rekonstruieren die Persönlichkeitsmuster homosexueller Männer in der Mitte des 19. Jahrhunderts.
Invictus – Unbesiegt
Karl Heinrich Ulrichs zum 200. Geburtstag
Mit Beiträgen von
Jens Dobler
Kevin Junk
Rüdiger Lautmann
Douglas Pretsell
Axel Schock
Heinz Voß
Im Anhang:
Magnus Hirschfeld: Sappho und Sokrates
Männerschwarm Verlag
It matters not how strait the gate,
How charged with punishments the scroll,
I am the master of my fate:
I am the captain of my soul.
W. E. Henley (1849–1903), Invictus
Bibliothek rosa Winkel
Begründet von Wolfram Setz (†)
Band 84
Covergestaltung:
Carsten Kudlik (Bremen)
© 2025 Männerschwarm Verlag
Salzgeber Buchverlage GmbH
Wilhelmine-Gemberg-Weg 6 – Haus K, 10179 Berlin, Germany
Herstellung: CPI Clausen und Bosse, Leck
Printed in Germany
ISSN 0940-6247
ISBN 978-3-86300-092-9
www.salzgeber-buchverlage.de
Inhalt
Vorwort
RÜDIGER LAUTMANN
Karl Heinrich Ulrichs als Forscher im Diskurs seiner Zeit und in der Nachwirkung
DOUGLAS PRETSELL
Eine Urning-Charaktertypologie
JENS DOBLER
Auf seidenen Flügeln
HEINZ VOSS
Karl Heinrich Ulrichs – Anschlusspunkte für queere Theoriebildung
KEVIN JUNK
Ich möchte ein Urning sein. Kevin Junk (*1989) liest Karl Heinrich Ulrichs (*1825)
AXEL SCHOCK
Postanschrift: Karl-Heinrich-Ulrichs-Platz
Anhang
TH. RAMIEN (D.I. MAGNUS HIRSCHFELD)
Sappho und Sokrates oder Wie erklärt sich die Liebe der Männer und Frauen zu Personen des eigenen Geschlechts?
DINO HEICKER
Th. Ramien (d.i. Magnus Hirschfeld):Sappho und Sokrates. Editorische Notiz
Biografische Angaben zu den Autoren dieses Bandes
Vorwort
Karl Heinrich Ulrichs, 1825 bei Aurich geboren, 1895 in Aquila gestorben, fand als einer der ersten Menschen den Mut, die Liebe zum eigenen Geschlecht als natürliches Phänomen zu betrachten – nicht als Sünde, nicht als Verbrechen und nicht als Krankheit. Die Bibliothek rosa Winkel und ihr Herausgeber Wolfram Setz haben mit zahlreichen Veröffentlichungen alles getan, um die Erinnerung an diesen Ausnahmemenschen wach zu halten, dessen Werk sich auch heute noch zu lesen lohnt. Insofern war es selbstverständlich, den 200. Geburtstag Ulrichs’ zum Anlass für einen erneuten Blick auf Leben und Werk zu nehmen. Herausgeber Wolfram Setz ist vor Fertigstellung des Bandes 2023 im Alter von 84 Jahren verstorben. Die Planung dieses Sammelbands zählt zu seinen letzten Buchprojekten. Wir danken den Autoren der hier versammelten Beiträge, dass der Band trotzdem erscheinen konnte.
Was ist 130 Jahre nach Ulrichs’ Tod Neues über ihn zu sagen? Die Frage drängt sich auf, aber die Antwort lautet überraschender Weise: ein Menge! Ulrichs’ Verehrung als Ahn der homosexuellen Emanzipationsbewegung und wohl auch seine eigenwillige Terminologie hatten bisher den Blick auf seine wissenschaftlichen Leistungen verstellt, mit denen sich nun zwei Beiträge dieses Bands befassen. Erstmals sucht ein Vertreter der Queer Theory nach Anschlüssen zu Ulrichs’, findet sie jedoch eher in seinem politischen Engagement als seinem Theoriegebäude. Ein Artikel zu Ulrichs’ Seidenraupenzucht zeigt eine bisher unbekannte Facette seiner Persönlichkeit, und zwei Beiträge zur Nachwirkung im Alltag runden den Band ab.
Ein Jahr nach Ulrichs’ Tod veröffentlichte ein gewisser »Th. Ramien, Arzt in Berlin« ein Heft mit dem Titel »Sappho und Sokrates«. Unter diesem Pseudonym schrieb Magnus Hirschfeld seine erste Stellungnahme zur gleichgeschlechtlichen Liebe der Männer und Frauen. Wir fügen diesen heute in keiner Verlagsausgabe erhältlichen Text im Anhang bei – man könnte sagen: als »Cliffhänger«, der in die Zukunft der Sexualforschung weist, aber auch als recht ernüchterndes Dokument dafür, wie weit Ulrichs seiner Zeit voraus gewesen war. Der Stolz des Unbesiegten ging verloren und wurde erst in der Schwulenbewegung der 1970er Jahre neu belebt.
J.B.
Zur Zitierweise: Die 12 Broschüren der »Forschungen« werden in diesem Band einheitlich nach römischer Ordnungszahl, Titel und Seitenzahl zitiert.
RÜDIGER LAUTMANN
Karl Heinrich Ulrichs als Forscher im Diskurs seiner Zeit und in der Nachwirkung
Bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts konnte das gleichgeschlechtliche Begehren noch kein Gegenstand seriöser Forschung sein, weil es allein als ›Sünde‹ und ›gegen die Natur‹ gesehen wurde. Eine Revision dieses Ausschlusses war keine Sache von ›gutem Willen‹ oder ›Humanität‹ – beide gab es ja durchaus, damals wie heute. Vielmehr waren es die Denkverhältnisse, die jene Forschungsfrage nicht zuließen, erschien diese doch, im damaligen Verstande, als völlig sinnlos. Noch die fortschrittlichsten Köpfe waren voll damit beschäftigt, die Naturordnung zu erfassen: Charles Darwin hatte alle Lebewesen als Produkt einer Entwicklung begriffen, vorangetrieben von den zahllosen Akten der Fortpflanzung. In den 1840er Jahren entwarf er seine Theorie der natürlichen Selektion, 1871 kam seine These zur sexuellen Selektion hinzu. Im Deutungsrahmen der Evolution fand eine ›unfruchtbare‹ Sexualität keinen angemessenen Platz. (Erst hundert Jahre später wurden wackelige Hilfshypothesen aufgestellt, um die Gleichgeschlechtlichkeit in der Evolutionstheorie unterzubringen.) Die Auseinandersetzungen zwischen religiösen und wissenschaftlichen Denkstilen dauern bis heute an.
Karl Heinrich Ulrichs überwand diese Barrieren und brach aus dem Denkgefängnis aus. Seine Studien sind als Forschung zu charakterisieren, weil sie ein Thema haben, welches in einem theoretischen Rahmen und mit nachvollziehbaren Methoden behandelt wird. Thematisch untersucht Ulrichs die erotische Anziehung zwischen Menschen desselben Geschlechts, theoretisch bezieht er sich auf die Differenzierung der Geschlechtscharaktere, und methodisch arbeitet er dabei mit empirischem Material aus Lebensläufen und aus der Naturgeschichte. Mit einer solchen Fokussierung fallen seine Forschungstexte auch nach heutigen Standards in den Bereich der Sexualwissenschaft, wobei noch die ganz anders geartete Wissenschaftspraxis der 1860er Jahre zu berücksichtigen ist – eine Epoche, in der es noch keine empirische Psychologie und Sozialforschung gab.
Forschen bedeutet, Wissen zu generieren. Der Begriff ist weiter als Wissenschaft, der auf Ulrichs’ Erkenntnisanliegen nicht so gut passt. Er war von der Ausbildung her Jurist, hat auch so gearbeitet, bevor ein faktisches Berufsverbot ihn aus dieser Laufbahn warf. Danach wurde er Publizist und ist dies bis zu seinem Lebensende auch geblieben (zuletzt mit seiner Zeitschrift über die lateinische Sprache). Die Buchreihe, der er heute seinen Ruhm verdankt, nannte er im Untertitel ›Forschungen über das Räthsel der mannmännlichen Liebe‹ – und das mit vollem Recht.
Der Autor der Studien verfügte über keinen Doktortitel und keine akademische Anbindung. Das schließt nicht aus, ihn im Bereich einer der Einzelwissenschaften zu verorten. Auch heute werden viele Bücher, die wesentliche Erkenntnisfortschritte enthalten, als Qualifikationsarbeiten geschrieben – bevor ein Doktorat oder eine Hochschulposition erlangt worden ist. Wenn Ulrichs’ Publikationen als bloßes ›Betroffenenmaterial‹ entwertet worden sind,1 dann hat das nicht mit deren vermeintlicher Unwissenschaftlichkeit zu tun, sondern mit dem religiösen, moralischen und strafrechtlichen Verbotensein des Forschungsthemas. Die gleichgeschlechtliche Körperintimität war seit etwa dem vierten Jahrhundert n. Chr. in Europa schwerst stigmatisiert. Über sie konnte nicht gesprochen werden, wie es noch im preußischen Allgemeinen Landrecht von 1794 hieß. Ulrichs stieß mit seiner Themensetzung eine Türe zu neuem Wissen auf, was allein schon als Erkenntnisleistung eigener Art gewürdigt werden muss.
War Ulrichs als Jurist denn überhaupt qualifiziert, über sexuelle Phänomene zu forschen? Etwas überraschend ist das klar zu bejahen – für die damalige Zeit. Und zwar nicht nur, weil er sich auch in Theologie, Philosophie und Naturwissenschaften ausgebildet hatte, was damals an der Universität noch möglich war. Ulrichs las und zitierte die medizinische und philosophische Literatur zu seinen Themen. Immer wieder bezog er sich – affirmativ, ablehnend oder modifizierend – auf diese Quellen.2 Das Sexuelle war erst um 1800 vor das Visier der Wissenschaft gekommen. Bis dahin hatten sich vor allem die Moraltheologie und das Strafrecht damit befasst, mit der einzigen Erkenntnis eines normativen Verdammtseins. Was gegen die ›Natur‹ oder die ›Schöpfungsordnung‹ verstieß, war eine Sünde oder ein Verbrechen bzw. beides. Vor der Masturbation warnte die Pädagogik. Für die Erforschung der näheren Umstände der Mann-mit-Mann-Intimität blieb im frühen 19. Jahrhundert der Strafbetrieb der wichtigste Auftraggeber. Gerichtsgutachter mussten für eine zunehmende Zahl von Strafprozessen Belege für den tatsächlichen Vollzug der unzüchtigen Handlung beibringen, obwohl meist weder ein Geständnis noch eine Zeugenaussage vorlag. Die Medizin, in den Prozessen zur Begutachtung hinzugezogen, war erst dabei, hier ein neues Feld für Diagnose und Therapie zu entdecken. In den 1860er Jahren konnte Ulrichs also darüber schreiben, ohne dass man ihn als formal unzuständig hätte ausschließen dürfen.
Lange Zeit ist versucht worden, Ulrichs’ Überlegungen den Status einer ›wissenschaftlichen Theorie‹ zu verweigern und sie zu einem lediglich ›strategischen Wissen‹ herabzustufen. Das könnte berechtigt sein, wenn die Thesen allein zu einem politischen Zweck aufgestellt worden wären. Beeinflusst von Vorausurteilen und in einer oberflächlich-kursorischen Betrachtung der Ulrichs-Schriften mochte ein solcher Eindruck sogar aufkommen. Jede Lektüre der Originaltexte zerstreut ihn aber sofort; die intensive Suche nach geeigneten Begrifflichkeiten und plausiblen Kausalitäten, die stetige Fortentwicklung der Konzepte und Annahmen zeigt, dass der Autor auf Wahrheitssuche war und sich nirgends auf werbende Sprüche beschränkte.
Karl Heinrich Ulrichs als Forscher
Ulrichs untersuchte Wesen, Genese und Erscheinungsformen der – in der Sprache des 20. Jahrhunderts – Homosexualität. Seine Thesen hierzu stifteten einen wissenschaftlichen Diskurs, innerhalb dessen sie bis heute relevant geblieben sind. In diesem Aufsatz hier werden die Aussagen von Ulrichs nicht erneut wiedergegeben; denn das ist schon oft geschehen. Ich möchte nur einige Kostproben präsentieren, um die Vorgehensweise und Leistung des Forschers zu charakterisieren.
Er widmete sich dem, wie er es nannte, »Uranismus«, d.h. der »mannmännlichen Liebe«. Da mit der Benennung eines Themas auch über die Richtung der Erkenntnissuche vorentschieden wird, war es bereits eine Leistung, wie Ulrichs das von ihm studierte Phänomen bezeichnete. Er schuf wertneutrale Konzepte, vielleicht sogar »einen positiv besetzten Begriff, keine Negativbeschreibung mit strafrechtlichem oder beleidigendem Charakter wie Sodomit, Päderast usw.«, um sein Thema in der Naturforschung zu platzieren (Domeier 2015:291).
Anfänglich war Ulrichs noch von einem »passiven animalischen Magnetismus« als Mechanismus der gleichgeschlechtlichen Anziehung ausgegangen und erörterte das in seinen Schriften (Kennedy 1994:13; Kennedy 2001:81 f.). Bald revidierte er den mechanistischen Denkansatz und suchte nach einem komplexen Modell aus organischer Anlage und Persönlichkeitsstruktur. Gleichgeschlechtliche Akte konnten zwar bei jedem Menschen vorkommen (›Sodomie‹ im alten Sinne), aber bei einigen markierten sie einen bestimmten Menschentypus (›Urning‹). Mit dieser Idee kam die Sexualwissenschaft in Gang.
Eine weitere Absage an den kruden Biologismus lieferte Ulrichs, als er die Richtung des Geschlechtstriebs von der äußeren Gestalt der Organe, d.h. der ›primären Geschlechtsmerkmale‹, löste. Bis heute meint ja der Volksglaube, allein schon die Beschaffenheit von Penis und Vagina beweise, dass sie füreinander bestimmt seien. Zur Widerlegung genügte bereits die Differenz zwischen Körper und Seele. Am Genital zeigt sich bloß die sexuelle Erregung, generiert wird sie aber mental. Doch wie kam die gleichgeschlechtliche Begehrensrichtung zustande? Hier stehen alle Behauptungen zum Angeborensein vor einem bis heute ungelösten Problem. Ulrichs bot Antworten an und entwarf auf dem damaligen Forschungsstand eine Theorie der embryonalen Entwicklung. Letztlich sah er sich dazu genötigt, das Axiom der Binarität aufzugeben. Die gleichgeschlechtlichen Körpermänner bilden ein »drittes Geschlecht« (Ulrichs I: Vindex S.5), und lesbische Frauen würden ein »viertes« bilden. Vieles davon beruht auf einem elaborierten Begriffsgerüst und auf Annahmen über die kausalen Abläufe. Das Nominale und Spekulative führte zu einem problematischen Erkenntniswert, den Ulrichs mit allen professionellen Wissenschaftlern bis weit in das 20. Jahrhundert hinein teilte.
Der Grundeinfall zur Gleichgeschlechtlichkeit postulierte, wie weidlich bekannt, eine weibliche Seele im männlichen Körper bzw. umgekehrt eine männliche Seele im weiblichen Körper. Hinzukamen Axiome wie dasjenige zur Liebe (die prinzipiell weiblich sei). Immer ist es ›die Natur‹, die alles bestimmt. Eine Leseprobe:
Das von der primären Natur ihr überkommene Zwittergeschöpf trägt nun aber in sich auch eines geistigen Lebens schlummernde Keime, namentlich: a. eines Verstandes, b. eines Gemütslebens (eines Charakters) und auch c. einer Geschlechtsliebe, eines Liebestriebes. […] Hieraus scheint mir aber mein Satz zu folgen: in jedem primären Embryo schlummere der Zwitterkeim eines geistigen Geschlechtsorganismus, d. i. ein solcher Keim des geistigen Geschlechtsorganismus, welcher zugleich männlicher und weiblicher Entwickelung fähig ist. Insonderheit scheint mir daraus noch zu folgen: der Keim des Liebestriebes sei ein Zwitterkeim, d. i. zugleich männlicher und weiblicher Entwickelung fähig. […] Oder auch, auf dem umgekehrt gleichen Wege, ein männlich liebendes Weib (eine Urningin, Uranierin, Urnin)? (Ulrichs IV: Formatrix, S. 42, 43, 45, H.i.O.)3
Auf dem damaligen Stande der Biologie suchte Ulrichs die embryonale Entwicklung zu erklären – im Auge immer ›die Natur‹ als Dirigentin.
Missrät ihr nur die Übereinstimmung zwischen Unterdrückung einerseits und Entwickelung der unentschiedenen Theile (Zwitterteile) zu entschiedenen Teilen anderseits, so entsteht Urning oder Urningin. Dies Gebilde hat allerdings in den am Urbild gezeichneten Einzelheiten durchaus keine Ähnlichkeit mit ihm: wohl aber im Allgemeinen, da beide, Urbild wie U, entwickelte Männlichkeiten und entwickelte Weiblichkeiten in sich vereinen. […]. Was im Keim vorhanden ist, das kann sich auch entwickeln. Jeder primäre Embryo aber trägt an sich männlicher Entwickelung fähige Testikel, ein Membrum, eine Körperhöhle, welche fähig ist, zu Raphe und Scrotum zuzuwachsen, und daneben geistig den weiblicher Entwickelung fähigen Liebeskeim. Der schaffenden Natur ferner gelingt es nicht, alle ihre Geschöpfe regelrecht zu bilden. Das ist der Schlüssel zu dem Rätsel urnischer Liebe. (Ulrichs IV: Formatrix, S. 52 f., H.i.O.)
Fraglos ist dies alles, zumal in der fragmentarischen Wiedergabe, schwer nachzuvollziehen. Dies gilt freilich ebenso für heutige Texte der Entwicklungsgenetik – wir befinden uns im fremden Gebiet einer Wissenschaftssprache. Ulrichs beherrschte und gebrauchte sie. Er entwarf ein Modell der genetischen Entwicklung, das mangels jeglicher Empirie zunächst spekulativ sein musste und erst sehr viel später durch Beobachtungen überprüft werden konnte. Zugleich trennte er die Phänomene der Homo- und Intersexualität (Hermaphroditismus), ebenfalls eine bedeutende theoretische Innovation. Der Autor tastete sich hier über viele Seiten langsam vor, seine Formulierungen waren kompliziert. Eine Probe davon:
Bei Heranbildung des Embryo durch die natura formatrix dürfen wir, wie mir scheint, gewissermaßen unterscheiden zwei der Zeit nach aufeinander folgende Naturen, zwei Bildnerinnen: eine primäre und eine sekundäre. Bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, welcher etwa in die zwölfte oder dreizehnte Woche des embryonischen Daseins fällt, waltet über dem Embryo körperlich wie geistig die primäre Natur. Alle Embryonen bildet sie heran nach ein und derselben Schablone. (Ulrichs IV: Formatrix, S. 40 f., H.i.O.)
Als Magnus Hirschfeld 1898 die Schriften neu herausgab, attestierte er die Vollständigkeit, mit der Ulrichs »nicht allein vom juristischen, sondern auch vom naturwissenschaftlichmedizinischen, theologischen und philosophischen Standpunkt seinen Gegenstand erfasste«. Soviel auch seitdem dazu geschrieben und geforscht worden sei, »allein neue Gesichtspunkte sind kaum hinzugefügt worden [.] Das gilt namentlich auch von der biologisch-embryologischen Erklärung der konträren Sexualempfindung.« (Hirschfeld 1898:8)
Der Umfang und die hohe Differenziertheit der Schriften zeigen, dass Ulrichs in diesem Zusammenhang nicht strategisch, sondern wissenschaftlich, nämlich theorieentwickelnd, dachte. Zugleich demonstrierte er seine Wende von einem rein biologischen zu einem naturalistisch-psychologischen Erklärungsrahmen. Der Sitz des Begehrens war für Ulrichs die Seele, zweiwertig als männlich oder weiblich konnotiert. Eine auf Männer gerichtete Anziehung musste für ihn weiblicher Art sein. Aus diesem Gerüst von Unterscheidungen zwischen Körper und Seele sowie zwischen zwei Geschlechtern ergab sich die besondere Art der homosexuellen Männer und Frauen. Die Struktur war also nicht eine aus der Luft gegriffene, willkürliche Setzung, sondern die Herleitung aus einem anthropologisch komplexen Bild zur Natur des Menschen. Da die meisten Grundannahmen dieser Theorie bis heute in der Diskussion verblieben sind, müsste das Befremden weichen, das sich bei der verkürzten Darstellung der Ulrichs-These (›weibliche Seele in männlichem Körper‹) so leicht einstellt.
Ulrichs rechnete mit 20 Tausend erwachsenen Urningen im Land, nach einer anderen »Berechnung« bis zu 35 Tausend. Die Zahl sei »in fortwährendem Wachsen begriffen« (Ulrichs I: Vindex, S. 2 f.). In späteren Schriften gab er höhere Zahlen an. Aus der Summe so veranlagter Individuen wurde bei ihm eine Kategorie, als er 1880 postulierte, es gebe eine »Klasse von Menschen, welche nichts dafürkönnen, dass sie von dem Finger der unerforschlichen Natur so zwitterhaft erschaffen worden sind, welche sich den Einwirkungen des Naturtriebes ebenso wenig entziehen können als die echten Männer und welchen es unmöglich ist, sich in echte Männer umzuwandeln« (Ulrichs XII: Critische Pfeile, S. 11).
Kritische Einschätzung
Worin nun bestand überhaupt Ulrichs’ Erkenntnisleistung? Was heute oft nur noch skurril anmutet, war damals die rationale Antwort auf ein Rätsel. Das gleichgeschlechtliche Begehren war den Zeitgenossen unbegreiflich erschienen; man glaubte an eine Geistesverwirrung. Die Ulrichs-These aber fügte das Unerklärliche in die Ordnung der Natur ein. Mit dieser ›Erklärung‹ wurde es diskursfähig und ist dies, einschließlich der Ulrichs-Interpretation, bis heute geblieben.





























