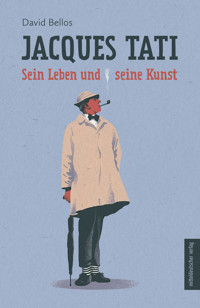
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Mitteldeutscher Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Jacques Tatis Monsieur Hulot, unverkennbar mit seiner Pfeife, seinem Regenschirm und seinen gestreiften Socken, war eine geniale Slapstick-Kreation, die das Publikum auf der ganzen Welt über die Absurdität des Lebens lachen ließ. David Bello’s Biografie zeichnet Tatis Aufstieg und Fall nach, von seinen Anfängen als Varieté-Mime während der Depression über den Erfolg von „Jour de Fête“ und „Mon Oncle“ bis hin zu „Playtime“, dem grandiosen Meisterwerk, das den gefeierten Regisseur und Oscar-Preisträger in den Bankrott trieb und ihn um finanzielle Unterstützung für die Fertigstellung seiner letzten Filme betteln ließ. Bei der Analyse von Tatis einzigartiger Vision, eines Clowns, dessen filmische Innovation darin bestand, das alltägliche Leben in eine Kunstform zu verwandeln, enthüllt Bellos die komplizierte Inszenierung seiner berühmtesten Gags und stützt sich auf bisher unzugängliche Archive, darunter Filmmaterial, Videos, aufgezeichnete Interviews und frühe Entwürfe von Drehbüchern, sowie die Mithilfe von Tatis Tochter. Herausgekommen ist das Bild eines Mannes, der gleichzeitig engagiert, leidenschaftlich und schüchtern war, mehr Künstler als Geschäftsmann. In der genau recherchierten Darstellung wird Tati sehr lebendig und bleibt, wie auf der Leinwand, seltsam liebenswert.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 684
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Originalausgabe erschien 1999 unter dem Titel »Jacques Tati.
His Life and Art« im Verlag Harvill Press, einem Imprint von Vintage.
Vintage ist Teil der Unternehmensgruppe Penguin Random House.
First published as »Jacques Tati. His Life and Art« in 1999
by Harvill Press, an imprint of Vintage.
Vintage is part of the Penguin Random House group of companies.
Copyright © David Bellos, 1999
Für die deutsche Ausgabe hat der Autor das Kapitel 12, »Tatis Krieg«, überarbeitet sowie ein ergänzendes zweites Nachwort, »Helgas Story«, verfasst.
David Bellos beansprucht das moralische Recht, als Autor dieses Werkes identifiziert zu werden.
Deutsche Erstausgabe
1. Auflage
Copyright © 2024 der deutschen Ausgabe
by mdv Mitteldeutscher Verlag GmbH, Halle (Saale)
www.mitteldeutscherverlag.de
Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werks insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen auch für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor.
Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen und strafbar.
Gesamtherstellung: Mitteldeutscher Verlag, Halle (Saale)
Umschlagabbildung: © Nelson Gonçalves
ISBN 978-3-96311-926-2
Inhalt
Danksagung
Vorwort
Zeichen an der Wand
Erster Teil – Jahre der Mühen, 1907–1946
Eins Die französische Familie Tatischeff
Zwei Das Bilderrahmengeschäft
Drei Der Kavallerist
Vier Tatis Universität
FünfLes Copains
Sechs Mittellos und auf der Straße
Sieben Oscar, Roger und Rhum
Acht Sport-Imitationen
Neun Ein Tag auf dem Land
Zehn Der Zentaur
Elf Spiel der Phantasie
Zwölf Tatis Krieg
Dreizehn Der Weg zurück
Vierzehn Mr Byrnes und M. Blum
Zweiter Teil – Jahre des Erfolgs, 1946–1960
Fünfzehn Lokale Farbe
Sechzehn Ton und Wort
Siebzehn Back-Up
AchtzehnUS Go Home!
Neunzehn Im tiefsten Frankreich
Zwanzig Fenster und Rahmen
Einundzwanzig Eine schleppende Freigabe
Zweiundzwanzig Unabhängigkeitserklärungen
Dreiundzwanzig Warten auf Hulot
Vierundzwanzig Gags, Witze und Kameratricks
Fünfundzwanzig Am Strand
Sechsundzwanzig Ferienstimmung
Siebenundzwanzig Unfall
Achtundzwanzig Mein Onkel
Neunundzwanzig Die Alte und die Neue Welt
Dreißig Tati-Total
Dritter Teil – Playtime, 1960–1970
Einunddreißig Edifice Complex
ZweiunddreißigLe Gadget
Dreiunddreißig Die breite Leinwand
Vierunddreißig Economic Airlines
Fünfunddreißig Situationen
Sechsunddreißig Fisch im Wasser
Siebenunddreißig Babylonische Türme
Achtunddreißig Das Ende des Wegs
Vierter Teil – Confusion, 1970–1982
Neununddreißig Tati-TV
Vierzig Rettung aus dem Norden
Einundvierzig Spiegel der Mobilität
Zweiundvierzig Auf Tour, im Fernsehen, auf der Bühne
Dreiundvierzig Zwei französische Wochen
Vierundvierzig Zirkus-Zeit
FünfundvierzigConfusion
Nachwort I
Nachwort II: Helgas Story
Abkürzungen
Anmerkungen
Quellennachweis
Abbildungsliste
Bildnachweis
Danksagung
Dieses Buch hätte ohne die großzügige Genehmigung und Kooperation von Tatis Tochter nicht geschrieben werden können: Sophie Tatischeff gewährte mir Einblick in die Pressebücher, Fotoalben und Geschäftskorrespondenzen ihres Vaters, wie auch in ihre eigene kostbare Sammlung von Videobändern. Ich hoffe, dass dieses Buch – für das ich allein die Verantwortung trage – meine Dankesschuld für ihr ungewöhnlich freundliches Entgegenkommen zu begleichen vermag.
Vielen Menschen bin ich zu Dank verpflichtet, die in Paris, Stockholm und andernorts sich die Zeit nahmen, ihre Erinnerungen an Jacques Tati mit mir zu teilen und in einigen Fällen mir kostbare Dokumente auszuleihen. Von den vielen seien nur diese genannt: Sylvette Baudrot, Michèle Brabo, Barbara Denneke-Ramponi, Gustaf Douglas, François Ede, Pierre Etaix, Karl Haskel, Maurice Laumain, Gilles L’Hôte, Germaine Meunier, Hyacinthe Moreau-Lalande, Fred Orain, Nicolas Ribowski, Anne Sauvy-Wilkinson, Marie-France Siegler, Lucile Terouanne, Norbert Terry und Elisabeth Wennberg.
Die Qualität der Illustrationen in diesem Buch ist weitgehend den technischen Fähigkeiten von Jérôme Javelle zu verdanken. Patrizia Molteni – eine verlässlich sorgfältige Assistentin – war bei den Bibliotheksarbeiten und Faktenchecks in Paris behilflich.
Steve Parker, Andrew Hussey, P. Adams Sitney, Gaetana Marrone-Puglia und viele andere Kollegen beantworteten Anfragen, machten Vorschläge und halfen mir, Fehler zu vermeiden. Pascale Voilley hat diesem Buch (und seinem Autor) mehr gegeben, als ich sagen kann.
Vorwort
Jacques Tati – besser bekannt unter dem Namen seiner filmischen Persona M. Hulot – war ein genialer Mime und Autor von vier oder fünf der unterhaltsamsten, wenngleich enigmatischen Filme, die je gemacht worden sind: Jour de fête, Les Vacances de M. Hulot, Mon Oncle, Playtime, wie auch, in den Augen vieler, Trafic und Parade. Alle diese Filme sind in Frankreich, Großbritannien, den USA und in vielen anderen Ländern im Handel auf DVD erhältlich; auch Zelluloid-Versionen werden noch gezeigt: gelegentlich in kommerziellen Kinos, und immer wieder in Film-Clubs weltweit. Jacques Tatis Filmwerk ist wohlbekannt. Dieses Buch verfolgt das Ziel, die Genese seines Werks näher zu beleuchten und damit zu dessen besserem Verständnis beizutragen.
Ich bin weder ein Filmkritiker noch ein Filmexperte und halte mich schon gar nicht für einen Filmemacher (was, wie ich befürchte, auf viele Filmkritiker zutrifft). Wichtiger aber ist, dass in den vergangenen vierzig Jahren mindestens ein Dutzend Bücher über Tati geschrieben worden sind. Die Bandbreite reicht von Marc Dondeys attraktivem Foto-Album bis hin zu einem sehr persönlichen Essay des hervorragenden Musikkritikers Michel Chion. Unter den zahlreichen Tati-Büchern finden sich ferner eine gut verständliche, wenngleich nicht ganz perfekte Biografie auf Englisch von James Harding sowie sorgfältig verfasste Thesen von Brent Maddock, Lucy Fischer und anderen amerikanischen Filmwissenschaftlern. (Detaillierte Angaben zu diesen und anderen Werken finden sich weiter hinten in der Bibliografie ab S. 529.) Alle sind überaus lesenswert – mein Buch verdankt vielen von ihnen wertvolle Informationen –, aber sie konnten mir nicht alles sagen, was ich wissen wollte.
»Das Auflösen eines Rätsels ist die reinste und fundamentalste Tätigkeit des menschlichen Geistes«, schrieb Vladimir Nabokov in einer ironischen Rezension seiner eigenen Autobiografie. Das Leben und Werk des Jacques Tati – und darüber hinaus das Verhältnis zwischen Leben und Werk – geben uns ein faszinierendes Rätsel auf: Wie konnte dieser Mann solche Filme machen? Auf welche Weise und aus welchem Grund nehmen Filme dieser Art Einfluss darauf, wie wir das Kino einschätzen und auch die reale Welt wahrnehmen? Was genau bedeutet uns M. Hulot? Das sind Rätsel, die jede Art von Kunst uns aufgibt. Ich kann nicht behaupten, das Tati’sche Rätsel ein und für alle Mal gelöst zu haben; aber dieses Buch versammelt eine weit größere Anzahl von Lösungshilfen, als bisher verfügbar waren.
Die Entscheidung, das Buch zu schreiben, basiert auf der anfänglich intuitiven, jetzt zur Überzeugung gewordenen Einsicht, dass Tati, anders als manch achtbarer professioneller Filmemacher, nicht einfach eine Reihe von Filmen produziert hat. Er schuf ein Set von Filmen, das zusammen genommen mehr darstellt als die Summe seiner Teile. Tati ist der Autor eines Oeuvres, das unsere Aufmerksamkeit verdient und unsere respektvolle Bemühung um sein faires Verständnis mittels sachgerechter Methoden, wie wir sie an das Werk jedes Künstlers herantragen, sei er Maler, Dichter oder Filmproduzent.
Tatis Filme geben uns ein komplexes Bild einer in sich geschlossenen, imaginären und leicht poetisierten Welt, und gleichzeitig einen aufschlussreichen Kommentar zur historischen Realität. Entstanden in einer Zeitspanne, die fast deckungsgleich ist mit den trente glorieuses von 1945 bis 1975 – den dreißig »glorreichen« Jahren des wachsenden Reichtums in Frankreich –, gibt Tatis Werk uns einen objektiv scharf gezeichneten Ausschnitt der Geschichte Frankreichs, wie auch dessen künstlerische Gestaltung durch eine hochgradig individuelle Sensibilität. Wie schon in meiner Studie zu Georges Perec geht es mir auch in diesem Buch darum zu zeigen, wie das Zusammenwirken von Kunstfertigkeit, Beobachtung, Feingefühl und Intelligenz (im Falle Tatis allerdings von ganz eigener Art) zur Quelle bedeutsamer Kunst wird.
Jacques Tati war ein Mensch und Künstler, der sich von Georges Perec so grundlegend unterschied, wie man sich nur denken kann. Während ich mit Perec vermutlich ein gutes Gespräch geführt hätte, muss ich bezweifeln, dass ich vis-à-vis Tati auch nur fünf Minuten hätte bestehen können. Dennoch sehe ich keinen Widerspruch darin, den Mann und das Werk im Rahmen desselben übergreifenden Narrativs zu präsentieren, auch wenn das Verhältnis zwischen beiden – und zwischen dem Biografen und jedem Einzelnen von ihnen – kein enges oder gar erforderliches ist.
Ein Leben ist länger und reicher, als eine Biografie sein kann. Ich habe mich bemüht, alles einzubeziehen, was ich von Tati als Mensch und von seinem Werk weiß, bin mir aber im Klaren darüber, dass noch viele Lücken verbleiben. Es wird wohl tausend nicht erzählte Anekdoten und Hunderte von nicht erfassten Fakten aus Tatis Leben geben. Konnte er kochen? Was aß er am liebsten? Ich habe es nicht herausfinden können – aus dem einfachen Grund, dass fast alle seiner Zeitgenossen schon vor einiger Zeit aus dem Leben geschieden waren. Aber einige der in diesem Buch fehlenden Kapitel werden eines Tages vielleicht doch noch geschrieben werden – wie zum Beispiel die lückenlose Geschäftsgeschichte von Cady-Films, Specta-Films und CEPEC; oder ein nicht allzu spekulativer Bericht darüber, wie Tati durch die Jahre 1939 bis 1944 gekommen ist – falls die relevanten Dokumente, die existiert haben müssen, irgendwann ans Tageslicht gelangen. Künftige Biografen werden vielleicht auch in der Lage sein, mehr über Tatis Verhältnis zu den Künstlern, Malern, Musikern und Entertainern seiner Zeit zu berichten. Die hier vorgelegte Biografie kann also nicht als das letzte Wort zu Tati betrachtet werden. Ich möchte sie verstanden wissen als Beitrag zu einem weltweit anhaltenden Gespräch über einen der herausragenden kreativen Köpfe des 20. Jahrhunderts – mit Sicherheit den letzten seiner Art.
D. B.
Princeton, N. J.
24. April 1999
Zeichen an der Wand
Wie selbst gelegentliche Besucher begreifen, verzieren die Straßennamen in Paris das Stadtbild mit einem reichen Muster nationaler Geschichte und Kultur. Von der Rue Clovis bis zur Rue Charlemagne, vom Quai Henri-IV zum Pont Louis-Philippe, alle französischen Könige haben ihren Ort, so auch zahlreiche Minister, Generäle, Ärzte, Biologen, Kriegshelden und Philosophen. Auch Künstler und Erfinder werden in jedem quartier geehrt, und seit einigen Jahren hat das nationale Kulturerbe weit mehr neue Orts- und Straßennamen hervorgebracht als das Militär oder die Politik. Pablo Picasso, Raymond Queneau und Louis Aragon haben heute ihre je eigene Metro-Station, und Straßen wurden benannt (oder umbenannt) nach Marcel Proust, Georges Perec und François Truffaut. Und noch etwas hat sich in der Praxis der Namensgebung verändert. Seit die alten blau-grauen Schieferplatten durch Metall und jetzt auch synthetische Stoffe ersetzt werden, stehen die Antworten auf die unvermeidlichen Fragen – »Papa, wer war Pierre Brosolette?« – in kleiner Schrift gleich unter dem Namen: »Französischer Journalist und Held des Widerstands, 1903–1944«. Diese Beschriftungen sind allerdings nur winzige Schutzwälle gegen den Ansturm von Zeit und Vergessen. Tolbiac, Arago, Trousseau, Isabey – verdienstvolle und herausragende Männer in ihrem jeweiligen Schaffensbereich – leben in den Köpfen der Menschen nur noch in Verbindung mit den Straßen und Plätzen, die ihren Namen tragen.
Die Rue André Gide (»Französischer Schriftsteller, 1869– 1951«) bildet die äußere Grenze einer Musterwohnsiedlung im Zentrum von Paris und verläuft bis zu den Bahnschienen, die zum Gare Montparnasse führen. Eine Plattenwand – beige und ockerfarben angestrichen – verdeckt die schmuddeligen Schuppen am hinteren Ende des Bahnhofs. Auf drei dieser Gipsplatten sind lebensgroße Flachreliefs eines hochgewachsenen, hageren, Pfeife paffenden Gentlemans mit weichem Hut zu sehen, der einmal ein Schmetterlingsnetz, einmal einen Tennisschläger und einmal einen Regenschirm in Händen hält. Hier findet man keine Gedenktafel, keinen Namen, keinen erläuternden Text. Man weiß ja – so die Erwartung –, dass der Schnellzug, der hinter dieser Wand dahingleitet, einen in Windeseile gen Westen nach Nantes und Saint-Nazaire trägt, von wo ein klapperiger Bus, ein Fahrrad oder ein alter Amilcar einen zum Hôtel de la Plage in Saint-Marc-sur-mer transportiert, dem realen, weitgehend unveränderten Ort von M. Hulots unvergesslichem Ferienaufenthalt.
Fast fünfzig Jahre nach seiner Erschaffung durch Jacques Tati ist und bleibt M. Hulot eine auf Anhieb erkannte Gestalt, sowohl in Frankreich als auch in vielen anderen Teilen der Welt. Keine Straße in Paris trägt Hulots Namen, oder den seines Schöpfers, und doch haben nur wenige andere Film-Ikonen ihren Platz in der Erinnerung und Imagination der Menschen so lange gehalten. Es bietet sich der Vergleich mit dem kleineren, aber ebenfalls lebensgroßen Bild eines Tramps an, der mit Bowler-Hut an der Südwestecke des Leicester Square in London steht. Die Parallele zu diesem »clever wee fellow«, dem cleveren kleinen Kumpel, ist zwingend, denn die amerikanische Burleske war der ausschlaggebende Kontext für Jacques Tatis Arbeit als Filmemacher in der Komik-Branche. Doch obwohl »Hulot« sich auf Chaplins französischen Spitznamen »Charlot« reimt, vollzieht sich das, was Tatis gemächliche und verträumte Filme zu sagen haben, auf einer völlig anderen Ebene.
Tatis sechs Spielfilme behandeln ausdrücklich eine Vielzahl der einschneidenden Veränderungen, die die Jahre 1945 bis 1975 mit sich brachten, wie zum Beispiel die städtische Erneuerung, das Wachstum der Wohlstandsgesellschaft, die Entwicklung und Verbreitung des Automobils. Diese Filme führen uns die Geschichte des modernen Frankreichs vor Augen – eine Materialgeschichte, dargeboten in leicht verträglicher, komischer Form, und frei von jedem intellektuellen Anspruch der »Nouvelle Vague«, die ja derselben Zeit angehört. Eine Geschichte also, die uns in der Rückschau umso aktueller erscheint.
Die Produktion dieser sechs Filme ging langsam voran, denn Tatis Arbeitsweise war auf eigene Art sorgfältig und akkurat, um nicht zu sagen, extrem pedantisch, doch in mancher Hinsicht unprofessionell und schleppend. Tati forderte und behielt fast komplette Kontrolle über alle Aspekte seiner Arbeit, so dass seine Filme in wesentlich geringerem Maß den Zwängen kommerzieller Erwägungen unterlagen als der Großteil aller Filmkunst. Daher ist es durchaus geboten, diese Filme nicht nur als charmante, historisch getränkte Komödien zu betrachten, sondern auch als den sorgfältig geformten Ausdruck einer singulären kreativen Persönlichkeit. Es gibt keinen Grund, Tatis Filme nicht mit derselben Ernsthaftigkeit und demselben Respekt anzugehen, wie wir sie – zum Beispiel – Molières Komödien entgegenbringen.
Ganz offensichtlich liegen die Quellen der Weltsicht Tatis viel weiter zurück als im Jahr 1945. Unser Ansatzpunkt – der auch die früheste uns vorliegende Information dessen ist, was Tati von seiner Herkunft preiszugeben gestattete oder nach eigenem Wissen überhaupt mitteilen konnte – geht zurück auf die Zeit, als Louis und Auguste Lumière den cinématographe noch nicht erfunden hatten.
Erster Teil
Jahre der Mühen
1907–1946
EINS
Die französische Familie Tatischeff
Il n’est trésor que de vivre à son aise
FRANÇOIS VILLON
Jacques Tati wurde 1907 geboren1 – neun Jahre nach dem Erscheinen der weltweit ersten Kurzkomödie (L’Arroseur arrosé, 1898), vier Jahre nach der Geburt von Raymond Queneau, zwei Jahre nach Sartre. So gehörte er zu der Generation derer, die den Ersten Weltkrieg 1914–18 nicht persönlich erlebt haben, sondern nur als mitgehörtes Gesprächsthema der Erwachsenen. Aber das Leben aller französischen Männer und Frauen in Tatis Alter zerfiel durch den Zweiten Weltkrieg und die deutsche Besetzung Frankreichs (1940–44) in zwei sehr unterschiedliche Teile.
Der Familienname war (und bleibt) Tatischeff, ein aristokratischer russischer Name ältester Herkunft. Tatis Großvater väterlicherseits, ein erblicher Graf und nomineller Oberbefehlshaber der Alexandrinischen Husaren, wurde in den 1870er Jahren als Militärattaché in die Kaiserliche Russische Botschaft nach Paris versetzt. Dort verliebte er sich in eine junge Französin, Rose-Anathalie Alinquant, die ihm 1875 einen Sohn gebar, dem er den Namen Georges-Emmanuel gab. Nicht lange danach kehrte Graf Dmitris Pferd ohne seinen Reiter aus Bois de Boulogne zurück: Die Leiche wurde später am Straßenrand aufgefunden. Offiziell galt der Tod des Militärattachés als ein bedauerlicher Reitunfall. Aber nach den Angaben eines verlorengegangenen Schriftstücks soll jemand die Steigbügelriemen des Pferdes manipuliert haben.2 In der Familie kursierte die Erklärung, dass Dmitris Tod kein Unfall war, sondern Mord, und dass, wenn nicht die Täter, dann doch der Auftraggeber in Moskau zu finden sei.
Der Verdacht eines Komplotts gewinnt durch die unmittelbar folgenden Ereignisse an Plausibilität. Gleich am nächsten Tag wurde Dmitris neugeborener Sohn entführt, und bald stellte sich heraus, dass er nach Moskau gebracht worden war, wo er als einziger männlicher Abkömmling des großen Hauses Tatischeff standesgemäß erzogen werden sollte. Die Mutter dieses Jungen – Jacques Tatis Großmutter – hatte ihren Liebhaber und auch ihr Kind verloren. Sie reagierte mit bemerkenswerter Willensstärke und Entschlossenheit. Sie brachte sich Russisch bei, nahm in Moskau einen Job als Kindermädchen an und machte ausfindig, wohin Georges-Emmanuel verschleppt worden war. Nach Jahren des Wartens und Planens organisierte sie die Entführung ihres Kindes und brachte den achtjährigen Jungen zurück nach Frankreich. Da sie in ständiger Angst vor Repressalien einer mächtigen russischen Familie lebte (Russland und Frankreich waren zu der Zeit enge Verbündete), zog sie sich in gute Entfernung von Paris in ein Dorf namens Le Pecq zurück, das in einer der großen Schleifen der Seine lag.
Abb. 1:Graf Dmitri Tatischeff in der Uniform der Alexandrinischen Husaren
Ob wahr oder erfunden, ist dieser Herkunftsmythos von einer wilden und gewalttätigen Energie geprägt, die in scharfem Kontrast zur Welt der Filme von Jacques Tati steht. Auch wenn der mutmaßliche Komplott im Rahmen der in Russland für die Vererbung aristokratischer Titel und Besitztümer geltenden Regeln durchaus denkbar ist – Balzac hatte dreißig Jahre vorher zu seinem Ärger erfahren müssen, dass es unter den zaristischen Gesetzen nicht möglich war, als Ausländer durch Eheschließung oder Erbschaft zu Titel und Reichtum zu gelangen –, erscheint er dennoch als nicht konsequent durchdacht, da es zum Zeitpunkt der Ermordung des Erbschaftsanwärters durchaus nicht sicher war, ob dessen illegitimes Kind überleben würde. Aber der Tod des Grafen Dmitri und Georges-Emmanuels frühe Jahre in Moskau – Geschichten, die Jacques Tati nachweislich immer und immer wieder erzählt bekam und sie auch seinen eigenen zwei Kindern weitererzählte – haben tiefe Narben hinterlassen. Nach den Aussagen seiner Großenkelin hat Georges-Emmanuel die brutalen Brüche seiner Kindheit nie richtig verwunden. Als Waise aufgewachsen, wurde er zum Gegenstand eines verwirrenden internationalen Tauziehens der Liebe und war seit seinem achtzehnten Lebensjahr der einzige Trost seiner Mutter. War er Russe? War er Franzose? Sehr früh in seinem Leben beschloss er, sich von Moskau zu lösen. Seinen Status als außerehelich Geborener empfand er als Stigma, das verborgen oder überspielt werden musste. Das tat er nicht durch die Annahme eines anderen Namens, auch nicht des Namens seiner Mutter, sondern dadurch, dass er sich mit Nachdruck als achtbaren Bürger der Dritten Französischen Republik definierte. Assimilation wurde in dieser optimistischen und selbstsicheren Gesellschaft ohnehin erwartet, und Nationalität war ein Begriff, mit dem man viel lockerer umging, als wir es heute tun. Von viel größerer Bedeutung war die Gesellschaftsklasse, der man zugehörte.
Abb. 2:Georges-Emmanuel Tatischeff in französischer Militäruniform, ca. 1915
Georges-Emmanuel wuchs in Le Pecq auf und wurde Geschäftsmann. In den späteren 1890er Jahren ging er in den Kohlenhandel, gründete in Port Marly sein eigenes Unternehmen (vielleicht hatte er es auch übernommen), das er nur allzu gern wieder aufgab, als er 1903 die Tochter eines viel erfolgreicheren Bilderrahmenhändlers heiratete.3 Claire Van Hoof war ebenfalls gemischter Herkunft: holländisch seitens des Vaters, italienisch seitens der Mutter. Von Claire lernte Jacques ein paar Brocken Holländisch, die ihm später zustattenkamen, als er an seinem letzten großen Spielfilm Trafic mit einer vorwiegend holländischen Crew an einem Drehort in den Niederlanden arbeitete. Es kann also kaum behauptet werden, Tati sei ein französischer Filmemacher »russischer Herkunft«, wie es häufig in der einschlägigen Literatur nachzulesen ist. Der Herkunft nach, wenn das heutzutage überhaupt noch viel bedeutet, war er ein europäischer Cocktail, teils italienisch, teils holländisch, teils russisch und teils französisch – und in dieser Hinsicht nicht untypisch für die französische Bevölkerung im zwanzigsten Jahrhundert. Abgesehen von dem Namen Tatischeff und einer schwerblütigen Verträumtheit, die oft als »typisch slawisch« beschrieben wird – er selber wollte seine Anfälle von Niedergeschlagenheit und Depression säuberlich von seiner »russischen Seite« getrennt wissen – hatte Tati von seinem russischen Großvater nichts geerbt.4 Weder Jacques noch seine ältere Schwester Odette (die 1905 geboren wurde und den Rufnamen Nathalie bekam) haben je ein Wort Russisch gesprochen und hatten auch keinerlei Kontakt zu diesem Land (abgesehen von Jaques’ Teilnahme an zwei Filmfestivals, als er schon ein weltweit bekannter Filmregisseur war). Zeit seines Lebens war Jacques Tati für die Welt, wie auch für sich selber, so französisch wie Knoblauchwurst; die ihm oft gestellte Frage, was seine russische Herkunft ihm bedeute, beantwortete er mit einem Achselzucken und ging zur nächsten Frage über.5
Abb. 3:Jacques Tatischeff am Tag seiner Erstkommunion
Georges-Emmanuel, der als einziges Kind einer alleinerziehenden Mutter in dem Dorf Le Pecq aufwuchs, hat sich nie von seinen französischen Wurzeln entfernt. Und dort wuchs auch sein Sohn Jaques auf. Le Pecq war eigentlich der untere Teil der altehrwürdigen Stadt Saint-Germain-en-Laye. Mit ihrem riesigen Schloss (in dem sich heute das Musée d’Archéologie Nationale befindet), mit ihrer Kavalleriegarnison und ihrem ausgedehnten Waldgelände ist die Stadt Saint-Germain mehr als nur ein Vorort von Paris. Sie mag heute die Endstation der Express-Metro-Linie sein, bleibt aber dennoch eine Stadt von großbürgerlichem, geradezu aristokratischem Gepräge. Saint-Germain war und ist bis heute ein prestigeträchtiges teures Pflaster.
Tatis Mutter war die Tochter eines angesehenen Besitzers einer Bilderrahmen-Galerie, Cadres Van Hoof, die er im Zentrum von Paris in der Nähe des Place Vendôme betrieb. Georges-Emmanuel hatte in Kürze sowohl die handwerklichen als auch die verwaltungstechnischen Fähigkeiten erlernt, die ihn zum natürlichen Nachfolger seines Schwiegervaters machten. Die seit der Jahrhundertwende florierende Firma Cadres Van Hoof produzierte antike und moderne Bilderrahmen für Museen und private Sammler wie auch für Künstler, die nicht immer das nötige Bargeld hatten. Doch der alte M. Van Hoof nahm keine Zahlung in Form irgendwelcher Sachleistungen entgegen; in der Familie wurde erzählt, dass er drei Van Goghs abgelehnt hatte, die sie alle zu Millionären gemacht hätten.6
Nach ihrer Eheschließung bezogen Tatis Eltern ein vornehmes, nagelneues Haus an der Rue de L’Ermitage in Le Pecq. Ihr Dienstpersonal hielt den großen Garten in Ordnung, betrieb die Stallungen und fuhr das Automobil, das die Tatischeffs sich 1903 zugelegt hatten; und im Bilderrahmengeschäft waren bis zu fünfundzwanzig Hilfskräfte eingestellt.7 Georges-Emmanuel war ein angesehener Mann und wurde durch clevere Manöver an der Pariser Börse immer reicher. Nach der Russischen Revolution muss Georges-Emmanuel seinen Sternen dafür gedankt haben, dass er französischer Bürger geworden war und nicht, wie es vielen anderen russischen Aristokraten in Paris, Berlin oder New York erging, mit einem nutzlosen Nansenpass in der Tasche sein Leben als Taxifahrer fristen musste.
Als Kinder einer wohlhabenden Familie der oberen Mittelschicht wurden Jacques und seine Schwester streng und nach Maßgabe standesgemäß geltender Konvention erzogen. Madame Van Hoof, geb. Teresa-Maria Rizzi, Tatis italienische Großmutter mütterlicherseits, lebte im Haus der Familie und bestand auf der strikten Einhaltung aller Formen religiöser und gesellschaftlicher Schicklichkeit. (Da die Tatischeffs jegliche Verbindung mit Russland abgebrochen hatten, war der katholische Glaube zur Familienreligion erhoben worden.) Fisch am Freitag, ohne Ausnahme; der Kirchgang am Sonntag war absolute Pflicht, und Jacques sang als Chorknabe im Gottesdienst. Erst im fortgeschrittenen Teenageralter durften die Kinder ihre Mahlzeiten gemeinsam mit den Eltern einnehmen.8
Abb. 4:Das Familiengeschäft, Rue de Caumartin, 1929
Da Jacques’ Eltern beide Einzelkinder waren, hatte der Junge keine Cousins und keine Kusinen ersten Grades, weder Tanten noch Onkel: Mon Oncle, Tatis Oscar-prämierter Film von 1958, kann daher nur von dem Onkel handeln, den er nie hatte. Mit entfernteren Verwandten auf der russischen Seite des Vaters hatte man keinerlei Verbindung, und die meisten Verwandten der Mutter lebten in Holland, Italien oder anderswo. Jacques wuchs als einziges männliches Kind seiner Generation auf, umgeben von zwei Großmüttern, dem schnurrbärtigen Opa Van Hoof, seiner Mutter und seiner älteren Schwester; er hatte eine englische Nanny, Miss Brammeld, und bekam Klavierunterricht von Mademoiselle Saulx.9 Und wie stand es mit dem einzigen männlichen Erwachsenen in der Generation seiner Eltern, Georges-Emmanuel? »Mein Vater war ein Mann von starkem Charakter«, sagte Tati zu Penelope Gilliatt in den 1970er Jahren, »ich wünschte, er hätte etwas mehr von dem Onkel in Mon Oncle gehabt …«10 Einem schwedischen Interviewer gegenüber äußerte er sich etwas deutlicher zu den Frustrationen seiner Kindheit und zu der auch in der Rückschau noch anhaltenden Enttäuschung: »[Mein Vater] war der Besitzer der Familie. Ich glaube, das war nicht so ganz richtig.«11
Abb. 5:Georges-Emmanuel Tatischeff zu Pferd, ca. 1925
Der Krieg brach aus, als Jacques noch keine sieben Jahre alt war. Das französische Cinéma, das damals mit den beiden Giganten Pathé Frères und Gaumont die Filmindustrie weltweit beherrschte, erlitt einen empfindlichen Niedergang. Wenn Jacques und Nathalie während ihrer Kindheit überhaupt ins Kino gekommen sind, dann haben sie ab 1915 sicher mehr amerikanische als französische Filme gesehen. Aber alles, was wir mit Gewissheit über Jacques’ frühe Erfahrung der Unterhaltungskultur sagen können, ist, dass er um die Zeit des Kriegsausbruchs den komisch überschwänglichen Zwerg-Entertainer namens Little Tich zu sehen bekam. Dieser englische Music-Hall-Künstler trug Schuhe, die doppelt so lang waren wie seine kurzen Beine, und er begeisterte seine Zuschauer in Paris und London mit akrobatischen Albernheiten ohnegleichen. Tati hat dieses Erlebnis nie vergessen, und in späteren Jahren berief er sich oft auf seine Erinnerungen an Little Tich, der, wie er sagte, die ganze Kunst der Film-Burlesque erfunden hat. Als Tati 1969 zu einem Vortrag im National Film Theatre nach London kam, bestand er darauf, den einzigen noch vorhandenen Filmclip von Little Tich vorzuführen.12
1914 ging Georges-Emmanuel, wie alle Männer im wehrfähigen Alter, zur Armee und diente bis zum Kriegsende. Anders als sehr viele seiner Zeitgenossen entging er der brutalen Vernichtung in den Schützengräben. Während dieser vier Kriegsjahre wurde die persönliche Umgebung seiner Kinder noch weiblicher geprägt, als sie ohnehin schon war. Der junge Jacques sah immer nur Frauen, außer in der Schule, oder wenn der Vater, was selten genug geschah, überraschend auf Heimaturlaub zu Hause auftauchte. Einen solchen Besuch gab es im Sommer 1916 während eines Ferienaufenthalts der Frauen und Kinder in Mers-les-bains an der Küste des Ärmelkanals. Diese Begebenheit ist unauslöschlich in Tatis Gedächtnis hängengeblieben:
Mein Vater war auf Urlaub. Er besuchte uns in voller Uniform. Er durfte sie, außer zum Schwimmen, nicht ablegen. Dort stand er, am Strand, in Militärblau. Wie ein Wildhüter, der uns bewachte. Diese Szene geht mir oft durch den Kopf.13
Fünfunddreißig Jahre später hielt Tati gemeinsam mit seinem Maler-Freund Jacques Lagrange Ausschau nach einem Drehort für Les Vacances de M. Hulot. Der schließlich ausgewählte Ort, Saint-Marc-sur-mer in der Nähe von Saint-Nazaire, ähnelt Mersles-bain nur insofern, als er eine kleine Ferienstadt am Meer mit einem Strandhotel ist. Aber das war gerade richtig, denn der Film sollte »Ferientage am Meer« abbilden und gefühlsmäßig aufleben lassen, um eine Erfahrung zu vermitteln, die für Tati, wenn nicht für die meisten von uns, unlöslich mit der Kindheitserinnerung verbunden ist. In allen seinen vielfach aufgezeichneten Erinnerungen – den zahlreichen weltweit veröffentlichten Interviews,14 den auf Tonband gesprochenen Memoiren – begegnet uns als früheste und oft zitierte Erinnerung das Bild des Vaters, der dem Kind als ein völlig fremder Mensch erschien.
Abb. 6:Jacques und Nathalie Tatischeff, Mers-les-bains, ca. 1916
Jacques war ein stiller Junge, ein geborener Nichtstuer – im Gegensatz zu seiner Schwester, die es immer eilig hatte. Er konnte sich stundenlang, ohne viel zu tun, in seinem Zimmer aufhalten. Gelegentlich geschah es, dass seine Schwester ihn bei Phantasiespielen vor dem Spiegel überraschte, wo er für sich ganz allein verschiedene Hüte ausprobierte; eine Zeitlang gab er einen Großteil seines Taschengelds für allerlei kuriose Kopfbedeckungen aus.15 Das war eine Form von Jux und Possenspiel, die er Jahrzehnte später wiederbelebte. Die Bergerons, eine befreundete Familie, hielten in der Garderobe ihrer Wohnung im sechzehnten Arrondissement Hüte für den normalen Gebrauch wie auch zu Partyzwecken bereit. So weit der Abend auch fortgeschritten war, Tati verließ kein einziges Mal eine Soirée bei den Bergerons, ehe er nicht ein oder zwei Hüte aufgesetzt und einen entsprechenden Charakter gemimt hatte. Das wurde zu seinem persönlichen Abschiedsritual.16
Der junge Tatischeff wuchs sehr schnell und schien nicht damit aufhören zu wollen. Als er gerade sechzehn war, glich er mit seinen 1,92 m17 eher einem Laternenpfahl als einem heranwachsenden Burschen. Die Durchschnittsgrößen damals waren geringer als heute, und wir müssen uns den jungen Jacques nicht nur als einen hochgewachsenen Jugendlichen vorstellen, sondern als eine Bohnenstange – eine Peinlichkeit für ihn selbst, wie wohl auch für andere. Aufgrund seiner frühzeitigen Größe musste er, wann immer es eine Beerdigung gab, das Kreuz tragen und die Prozession der Chorknaben von der Kirche bis zur Grabstelle anführen. So kam er regelmäßig am frisch ausgehobenen Grab in unmittelbarer Nähe der weinenden Trauergesellschaft zu stehen. Wenn er sah, wie der Sarg langsam in die Erde sank, wenn er hörte, wie die Menschen um ihn herum lamentierten und schnüffelten, wollte er mitweinen. Aber er durfte es nicht. Er hatte sich wie der große Junge zu verhalten, der er nun einmal war.18
Diese beiden Erinnerungsbilder – der Vater am Meer und die unterdrückten Tränen am Grab – sind natürlich keine wirklichkeitsgetreuen Bilder aus Jacques’ Kindheit. Es sind die Spuren, die der Prominente Jaques Tati hinterlassen oder festlegen wollte, sei es in Interviews mit der Presse oder in Anekdoten, die er seinen jüngeren Mitarbeitern bei Mahlzeiten in der Kantine erzählte. Beide Erinnerungsbilder lassen eine gewisse emotionale Unsicherheit erahnen. Es sind Erinnerungen weder an eine glückliche Kindheit noch an erlebtes Kindheitsglück. Sie sind wohl am besten zu deuten als Anzeichen dafür, dass der erwachsene Tati sich einiger emotionaler Komplikationen in seinen frühen Jahren durchaus bewusst war.
Tati hat sich nie direkt gegen die Werte und den Stil seines steifen, wohlanständigen und wahrscheinlich recht kalten Elternhauses aufgelehnt. M. Hulots Manieren, so unpassend er sie auch bewerkstelligen mag, entsprechen genau dem, was Tati in der Kinderstube und zu Tisch in Le Pecq gelernt haben muss. Noch auffallender ist das fast völlige Fehlen jeglichen Ausdrucks starker Gefühle in Tatis Filmen, was auf ähnliche Weise die art de vivre der standesbewussten Bourgeoisie widerspiegelt. Zumindest an der Oberfläche blieb der Filmemacher Tati den Prinzipien und dem Stil seiner im Elternhaus verlebten Kindheit treu; die Sittenkomödie seiner Fasson ist noch keine Satire, und Abrechnung oder gar Rache ist nicht ihr Ziel.
Der Teenager Tati überragte seine Klassenkameraden buchstäblich um einen ganzen Kopf, doch geistig reichte er nicht an sie heran. Er besuchte eine gute Schule und bekam zu Hause alle Unterstützung, die der moderate Reichtum der Eltern ihm bieten konnte, einschließlich zusätzlichem Hausunterricht. Doch nur wenig von dem, was man ihn lehrte, blieb lange in seinem Kopf haften. Sein Vater hätte ihn gern in einem guten Beruf gesehen – als Ingenieur zum Beispiel –, aber das war und blieb eine aussichtslose Hoffnung. »Das moderne Leben ist für die Klassenbesten«, antwortete Tati wiederholt auf die Frage, wie er die augenscheinlich anti-moderne Tendenz einiger seiner späteren Werke rechtfertige, »und ich möchte für all die anderen eine Lanze brechen.« Tatsächlich war Tatischeff in der höheren Schule weit von der Klassenspitze entfernt, so dass er nicht einmal die Prüfung für das Bakkalaureat schrieb. Im Alter von ungefähr sechzehn Jahren ging er von der Schule ab und arbeitete im Geschäft seines Vaters.
Tati ist nur einer von den vielen cleveren und kreativen Köpfen, die in der Schule als beschränkt und verträumt galten – Einstein und Georges Perec sind zwei weitere Beispiele. Ein entscheidender Unterschied aber ist, dass Tati selbst zu seinen besten Zeiten von den meisten als recht minderbemittelt betrachtet wurde. Sich mit Worten auszudrücken, war nicht seine Stärke; und mindestens einer seiner engen Kollegen vermutete, dass er das Grundrechnen nie richtig kapiert habe.19 Ein amerikanischer Journalist meinte einmal, Tati hätte »einen viel besseren Kopf als Steven [Spielberg]« gehabt,20 aber die Mehrzahl derer, die mit Tati zu tun hatten, konnten sehen, dass er in keinem herkömmlichen oder landläufigen Sinn des Wortes ein intelligenter Mann war.21 »Tati war ganz und gar kein Intellektueller«, schrieb Jean-Claude Carrière, der 1957 zum ersten Mal von Tati in ein Schnittstudio gebracht worden war. »Alles andere als das.«22
Tati hat nie versucht, seinen langsamen Start ins Leben zu vertuschen, und ohne Umschweife gab er zu, eigentlich ungebildet zu sein. »Meine akademischen Leistungen könnten in vollem Umfang auf der Rückseite einer Briefmarke aufgelistet werden!«, erklärte er Jean L’Hôte gegenüber; und seiner alten Lehrerin, die ihm, als er berühmt geworden war, geschrieben und ihren Glückwunsch ausgesprochen hatte, antwortete er ohne falsche Bescheidenheit:
Ich erinnere mich sehr gut daran, wie Sie sich mit mir abgemüht haben. Ich habe alles vergessen, was Sie mit so viel Geduld versucht haben, mir in den Kopf zu trichtern, aber ich habe Sie als verständnisvolle und milde Lehrerin im Gedächtnis behalten.23
In seinen früheren Filmen spielt Tati Charaktere, die sich durch nichts anderes als ihre Stupidität auszeichnen. Der gespielte Boxer in Soigne ton gauche, der Postbote mit seinem Fahrrad in L’École des facteurs und (noch markanter) der neu erschaffene François in Jour de fête – sie alle spielen Varianten ein und desselben komischen Themas durch: »Der Schwachkopf«. M. Hulot ist eine komplexere Gestalt, aber auch er kann nicht recht verstehen, wie die Dinge eigentlich funktionieren (besonders, wenn es sich um Gerätschaften und Maschinen handelt, wie zum Beispiel in Mon Oncle). Dass Tati sich in der Rückschau als unintelligentes Kind beschrieben hat, mag zur Verbreitung seines Images als Darsteller eines dusseligen Clowns beigetragen haben, aber das ist kein Grund, die zugrundeliegende Wahrheit zu bezweifeln: Tati hatte keine nennenswerte Bildung mitbekommen – nicht aus Mangel an Gelegenheit, sondern aus Mangel an Fähigkeit und Motivation. Er war schlichtweg ein einfältiges Kind.
Aus Jacques’ Schulzeit ist nur eine Anekdote überliefert. Der Englischlehrer wandte eine frühe Form der »Direktmethode« an, nach der die Jungen die zuerst auswendig gelernten Sätze szenisch darstellen mussten. Als Tati an der Reihe war, bekam er die Sätze: »Ich öffne die Tür« und »Ich schließe die Tür«. Jetzt musste er aufsagen: »Ich öffne die Tür«, und dabei die Tür öffnen. Dann kam ihm eine Idee. »Ich schließe die Tür«, sagte er, indem er sie von außen schloss, also das Klassenzimmer verlassen hatte – nicht aus Protest, sondern als eine Art experimenteller Gag.
Dieser Streich war dem Lehrer gegenüber nicht bösartig gemeint und auch nicht als Schülerkommentar zu dessen Sprachpädagogik. Doch in seinen Erinnerungen behauptete Tati, dass er aus der Situation, in die er sich damals gebracht hatte, draußen vor der Klassentür, sehr viel über das Wesen der Komödie gelernt habe. Die ganze Klasse wartete mit angehaltenem Atem darauf, was passieren würde. Sollte er mit einem breiten Grinsen auf dem Gesicht ins Klassenzimmer zurückkehren? Sollte er sich bis zur nächsten Stunde in den Toilettenräumen verstecken? Was wäre lustiger – die Spannung im Klassenzimmer, die umso größer wurde, je länger er draußen blieb, oder seine triumphale Rückkehr? Tati stahl sich aus der Schule und ging nach Hause, und erst am nächsten Tag erfuhr er, welche Furore seine kleine Nummer gemacht hatte.
Marc Dondey beginnt seine ausgezeichnete Studie über Tati mit ebendieser Anekdote, wie schon Tati seine eigenen, auf Tonband gesprochenen Memoiren damit begonnen hat, so als wollte er sagen: Das war die Geburt des Komödianten in mir. Es ist ein Gag ohne Pointe, ohne komische Umkehrung und auch ohne Schluss. Und wie einige der seltsamen Possen des M. Hulot geschah dieser Bubenstreich eher aus Schüchternheit als aus böser Absicht.
Die Familie Tatischeff fuhr auch weiterhin regelmäßig auf Sommerurlaub in die derzeit vornehmsten Seebäder, und Jacques hinterließ auf Tonband mehr Erinnerungen an seine Ferien-Eskapaden als an seine Zeit in der Schule oder am Arbeitsplatz. Während eines dieser Urlaube, der in den Jahren unmittelbar nach dem Ende des Ersten Weltkriegs stattgefunden haben muss, tat Jacques sich in Deauville mit einem Schulkameraden zusammen, um an einem Charleston-Wettbewerb teilzunehmen, den sie zu ihrer großen Freude gewannen. Der Freund hieß Bruno Coquatrix: Später wurde er zu einem der führenden Chanson-Texter Frankreichs und vor allem Musik-Impresario und Besitzer der großen Pariser Music-Hall Olympia. (Keiner von beiden schaffte es bis zur Weltmeisterschaft, die in der Albert Hall in London ausgetragen wurde. Der Sieger von 1926 war ein ukrainischer Immigrant, der später unter dem Namen Lew Grade Englands prominentester Filmproduzent wurde und auch Baron im House of Lords.) Tatis tänzerisches Talent ist in mehreren seiner Filme zu sehen (allen voran in L’École des facteurs und Jour de fête). Leider gibt es keine Videoaufzeichnung von einem Abend des Deauville-Film-Festivals der 1970er Jahre, an dem Tati gemeinsam mit … Marguerite Duras auftrat.
Die Tatischeffs verbrachten den Sommer 1924 in Saint-Tropez, und dort dachte sich der siebzehnjährige Jacques seine erste kleine Pantomime aus, mit der er die Strandbesucher aufs Köstlichste amüsierte. Er mimte die Gesten und Bewegungen eines Fußballtorwarts und nannte diesen Sketch Football vu par un gardien de but (»Fußball aus der Sicht des Torwarts«). Aufgrund professioneller Rivalität ließ Tati später das Datum und die Art dieses ersten Auftritts durch den Generalsekretär der Fédération Française de Football Association zertifizieren.24 Es gibt keinen Grund anzunehmen, Tati habe im Alter von siebzehn Jahren ahnen können, dass dieser Sommerspaß das Samenkorn seiner ganzen Karriere in sich trug; und Georges-Emmanuel kann sich unmöglich vorgestellt haben, dass sein Sohn einmal ein Clown werden würde. Aber fünfzehn Jahre nach diesem ersten Auftritt bestätigte die FFFA, dass die am Strand von Saint-Tropez aufgeführte Szene »ohne die geringste Abänderung« identisch war mit der Pantomime, die Tati später mit großem Erfolg auf die Bühne des Varieté-Theaters brachte.
Abb. 7:Jacques Tatischeff als Teenager
Abb. 8:M. Hulot von einem Schimmel zur Strecke gebracht, 1953
Abgesehen von Tanz und Clownerie besaß Jacques keine nennenswerten Talente. Er konnte nicht besonders gut zeichnen, war musikalisch kaum begabt (obwohl er eine Melodie summen und halten konnte) und hat es – trotz des von seiner Mutter streng überwachten Übens – nie geschafft, Beethovens Türkischen Marsch in die Tasten zu hauen. Da er hochgewachsen war, konnte er im Tennis, das auch sein Vater spielte, oft gewinnen. Aber sein Lieblingshobby, die einzige Aktivität, in der er ein hohes Leistungsniveau erreichte, war das Reiten. Saint-Germain war ein dafür vorzüglich geeigneter Ort; und auf den Reitwegen und Pfaden im Wald traf er des Öfteren auf Kavallerieoffiziere der lokalen Garnison, die diesem langen Jungen, der so zünftig im Sattel saß, mit Wohlwollen entgegenkamen. Diese gelegentlichen Begegnungen bereiteten Jacques das glücklichste Jahr seiner Jugend, wie auch seine erste reale Erfahrung von Komödie – in der französischen Kavallerie.
ZWEI
Das Bilderrahmengeschäft
Als er die Schule abbrach, wurde Tatischeff jr. als Lehrling in dem von seinem Vater geführten Geschäft eingestellt, dessen Besitzer immer noch der Großvater Van Hoof war. Die Hierarchie war klar und wurde streng eingehalten. Vater und Sohn gingen jeden Morgen zu Fuß zur Bahnstation von Saint-Germain, um die kurze Strecke bis zum Gare Saint-Lazare mit dem Zug zu fahren. Der Vater stieg in einen Wagen Erster Klasse, der Sohn in ein Abteil Dritter Klasse. Am Zielbahnhof angekommen, gingen sie zu Fuß weiter zur Werkstatt in der Rue de Caumartin (bis 1929) und zur Rue de Castellane danach.
Das hochklassige Bilderrahmengeschäft vereinte Handwerk, Business und niedere Kunst im Dienst einer höheren. Es gehe darum, die Aufmerksamkeit nicht auf den Rahmen, sondern auf das Bild darin zu lenken, erklärte Tati seinen Assistenten und Anhängern bei Hunderten, wenn nicht Tausenden von Mahlzeiten in der Kantine. Der Rahmen sei perfekt, wenn man ihn kaum wahrnimmt.25 Als ein sich selbst zurücknehmendes, nicht sich selbst darstellendes Kunstwerk verkörpere der Bilderrahmen das Zwillingskonzept der Bescheidenheit-cum-Perfektion. Wenn Tati so predigte, irritierte er seine jüngeren Zuhörer oft mit der Behauptung, diese einfachen Ideen ließen sich auf den Film übertragen: Ein Film-Frame (d. h. das auf der Leinwand sichtbare Tableau (Bild)) ist eingerahmt von einem Picture-Frame (Bild-Rahmen), der selber nichts weiter als das fehlende Licht rundum ist, d. h. die so geschwärzte Umrandung der Kinoleinwand. Es wäre wohl weniger verwirrend gewesen, wenn im Filmdiskurs ein Frame als Tableau bezeichnet würde. Offensichtlich geht Tatis Vorstellung dessen, was in einem Film-Frame abgebildet zu werden verdient, auf seine Jahre langweiliger Arbeit im Bilderrahmengeschäft zurück.
Tati wurde angehalten, sich auf die Aufnahmeprüfung der École Nationale des Arts et Métiers vorzubereiten, die ihm eine grundsätzlich solide Ausbildung und anerkannte Qualifikation vermittelt hätte. Er belegte Kurse an der École professionelle Hanley in Choisy-le-Roi, hat dann aber die Prüfung nicht bestanden, weil seine Mathematikarbeiten zu schwach waren. So blieb er eben nur ein Lehrling; es gab keinen automatischen Aufstieg für ihn, nur weil er der Nachfolger war.26
Von seinem Großvater Van Hoof lernte er, wie man Bilderrahmen vergoldet: mit langsamstem, immer geduldigem Auftragen feinster Schichten von Goldfarbe in jede kleine Windung, jede Krümmung, jeden winzigen Schnörkel der reich verzierten klassischen Rahmen, die Cadres Van Hoof produzierte. In späteren Jahren hat Tati die Geduld seiner Zuhörer oft auf die Probe gestellt, wenn er mit quälender Langsamkeit vorführte, wie er sein erstes métier erlernt hatte; sie sollten miterleben, wie unendlich schwer der Weg bis hin zum perfekten Produkt ist. Einmal, als der Lehrling Tati besonders stolz auf einen fertiggestellten Rahmen war, musste er ihn auf Geheiß des Großvaters wieder auseinandernehmen – weil er zu gut für das vorgesehene Bild und daher zu sichtbar war.27 Diese Anekdote war wahrscheinlich nur ein Beispiel der überholten Vorstellungen, wie man junge Leute am besten ausbildet (indem man sie wissen lässt, wo sie hingehören, nämlich ganz unten), aber sie diente Tati wohl auch zur Rechtfertigung der oft erratischen Art und Weise, wie er mit der Arbeit seiner Assistenten, auch mit seiner eigenen, umging. Wie schon sein Großvater war auch er durchaus fähig zu sagen: Nein, das ist nicht ganz richtig. Das musst du alles noch einmal von vorne anfangen.
Der Maler Claude Schurr, den Tati für die Tanz-Sequenzen in Playtime gewonnen hatte, erinnert sich an ein Beispiel von Tatis Perfektionismus, der seine Mitarbeiter schlichtweg zur Raserei bringen konnte. Auf dem weitläufigen Set des »Royal Garden«-Restaurants hatte sich ein sehr großer Cast einen ganzen Tag lang mit den Proben und dem Shooting einer winzigen Drei-Sekunden-Szene einer tanzenden Menschenmasse abgemüht. Alles schien gut gelaufen zu sein, und man wollte Pause machen und nach Hause fahren. Aber nein. Ein Kellner, der durch das Bild läuft und sich den Hosenboden an den Knöpfen der Insignien des »Royal Garden« zerreißt, mit denen alle Stühle im Speisesaal verziert sind, trug an diesem Tag einfarbig weiße Unterhosen. Aus Gründen der Stringenz mussten es aber gestreifte Unterhosen sein. In dieser überaus bewegten Szene, dieser wirklich kurzen Sequenz, hätte kein Zuschauer diesen Makel bemerkt. Aber das war nicht gut genug. Alles musste noch einmal gemacht werden.28
Abb. 9:Die Werkstatt in der Rue de Caumartin, 1929
In seiner Jugend, und auch später, hat Tati nie sehr viel gelesen und war auch nicht geneigt, viel aufzuschreiben: »Ich habe kaum irgendetwas gelesen, und ich sehe mir auch nicht viele Filme an. Ich bin kein kultivierter Mensch.«29 Über die kulturellen Erfahrungen des jungen Tati können wir nur mutmaßen. Er wird, wie alle jungen Menschen in den 1920er Jahren, in Bars gegangen sein und auch ins Kabarett, er wird die beliebten Chansons gehört haben und wohl auch ins Kino gegangen sein. Wir können nur vermuten, dass Tati die komischen, meist in Amerika gedrehten Kurzfilme des französischen Music-Hall-Künstlers Max Linder gesehen hat, noch ehe Linder sich 1925 das Leben nahm. Chaplin kann Tati kaum entgangen sein, und Tatis Begeisterung für Buster Keaton muss sich in den Jahren des Stummfilms entwickelt haben. Mehr als dreißig Jahre später kaufte Tati gemeinsam mit Raymond Rohauer nicht weniger als 160 Kilometer der frühen Kurzstummfilme (den ganzen Bestand von Educational Pictures, Inc.);30 einige davon wollte er mit einer Tonspur versehen und dann in ganz Europa vertreiben, oder wenigstens in dem einzigen Kino zeigen, das er zu der Zeit in der Rue de Rennes gemietet hatte. Er ist nie dazu gekommen, diesen Plan auszuführen, aber es ist schwer vorstellbar, dass diese Treuebezeugung gegenüber den klassischen Komödien der 1920er Jahre nicht in lebendig gebliebenen Erinnerungen an diese Filme gründete, die er gesehen hatte, als sie noch frisch und neu waren.
Und sei es nur durch Osmose geschehen, in der Werkstatt seines Großvaters muss er sich auch eine gründliche Kenntnis vieler klassischer und zeitgenössischer europäischer Kunstwerke angeeignet haben. Auf dem Hintergrund dieser Erfahrung wird erklärlich, wieso er in späteren Jahren in der Gesellschaft von Malern wie Lagrange und Schurr völlig unbefangen war, wie auch im Umgang mit Kunsthändlern und Kunsthistorikern wie René Huyghe, der zum Freund der Familie wurde. Doch hat Tati sich selber nie als Kunstkenner ausgegeben, und er sammelte, als er die Mittel dazu hatte, wesentlich mehr Marionetten und Modelle von Clowns als alte Meister. Nichtsdestoweniger blieb für ihn im gesamten Verlauf seiner Karriere das »Auge des Malers« ein wichtiger Faktor. Erstmals im Szenario von Les Vacances des M. Hulot, dann auch in der Neuverfilmung von Jours de fète, brachte er einen Maler auf die Leinwand, der auf ganz bestimmte Weise die im Film dargestellte Welt betrachtet. Das sollte dem Zuschauer die Richtung zu einer angemessenen Sicht dieser Welt weisen. Und wenn es in seinen Filmen eine ganze Reihe von Bildern gibt, die an die Gemälde von Dufy, Toulouse-Lautrec und Cézanne erinnern, dann ist das mit großer Gewissheit nicht darauf zurückzuführen, dass Tati Bücher über Kunstgeschichte gelesen oder Museen besucht hat, sondern darauf, dass er im Atelier der Familie in stundenlanger handwerklicher Arbeit Bilder einrahmen musste. Der junge Tati zeigte keinerlei Interesse am Lernen; nur ungern arbeitete er für seinen Vater, und ganz offensichtlich lag ihm Arbeit als solche überhaupt nicht. Die Themen und Titel seiner Filme sagen es schlicht heraus: ein arbeitsfreier Tag (Jour de fête), Urlaub am Meer (Les Vacances de M. Hulot) und Zeit zum Spielen (Playtime) – Tati feierte die Muße, nicht die Arbeit; die »Aus«-Zeit, nicht die Zeit »da drin«. Es muss eine große Erleichterung für den jungen Mann gewesen sein, als er das Alter von zwanzig Jahren erreichte und einberufen wurde. Die abscheuliche Plackerei des täglichen Pendelns zu acht Stunden Fronarbeit im Bilderrahmengeschäft war nun endlich vorbei.
DREI
Der Kavallerist
In Frankreich herrschte Friede, die Armee feierte ihren Ruhm. Wer das Blutbad von 1914 bis 1918 überlebt hatte, war ein Nationalheld und trug erhobenen Hauptes seine Orden. Dank der Verträge von Versailles war Frankreich wieder eine wohlhabende Nation: 1929 gab es im ganzen Land nur eintausend Arbeitslose, und 1931 hatten die Goldreserven einen astronomischen Wert von 55 Milliarden Franken erreicht. Das Militärbudget des Landes war entsprechend hoch; das Leben in der Armee durchaus nicht beschwerlich. Es herrschte allgemeine Wehrpflicht, aber weil Frankreich sich nicht im Krieg befand, war der Wehrdienst ungefährlich und daher auch nicht unbeliebt. Für viele junge Männer, unter ihnen auch Tatischeff, bot das Militär eine Befreiung von häuslichen Zwängen und ein unvergessliches Jahr voller Burschenspaß.
Den Franzosen, wie auch den Briten, kam es nicht in den Sinn, dass die Millionen, die in den Schützengräben gestorben waren, ihr Leben vergeblich geopfert hätten: 1928 glaubten nur sehr wenige, und noch wenigere wagten es auszusprechen, dass der »Große Krieg«, der allen Kriegen ein Ende setzen sollte, je wieder gekämpft werden müsse. Und so kam es, dass die französische Armee, ganz besonders ihre Abteilung vortrefflich archaischer Kavallerieregimenter, sich darauf einstellte, den ewigen Frieden bestmöglich zu genießen.
Tati hatte großes Glück. Ein Kavallerieregiment war in der Kaserne im Zentrum von Saint-Germain-en-Laye stationiert, nur eine gute Meile vom Elternhaus entfernt, und dem Oberst bot sich reichlich Gelegenheit, einen langen, kompetenten Burschen zu sichten, der auf den lokalen Reitpfaden seine Reitkünste vorführte. So ein Mann konnte dem Oberst helfen, eines seiner ewigen Probleme zu lösen. Unter seinen Offizieren waren mehr als genug gute Reiter, aber er konnte ihnen nicht zumuten, die vielen Renn- und Paradepferde, die in seinen Reitställen standen, zu striegeln, zu pflegen oder auszureiten. Auf üblich militärische Art schickte ihm das Rekrutierungsbüro Leute, von denen die meisten nicht wussten, an welchem Ende des Pferdes sie den Futterbeutel anzubringen hatten. In »anderen Dienstgraden« waren erfahrene Reiter kaum zu finden und zu halten. So wurden einige Hebel in Bewegung gesetzt, und Tati kam zu dem Regiment, das ihn haben wollte: die XVIe Dragons (die 16. Dragoner) auf dem Hügel in unmittelbarer Nähe des Elternhauses.
Das Regiment war zu der Zeit weniger eine Streitkraft als eine gesellschaftliche Institution. Viele seiner Berufsoffiziere waren die weniger intelligenten Söhne des verarmten Adels, die kaum eine Chance hatten, in Geschäft oder Regierung ihren Reichtum wiederzuerlangen. Das Kavallerieregiment diente ihnen sowohl als Zuflucht vor den härteren Ansprüchen des Zivillebens wie auch als gesellschaftliche Startrampe. Es versorgte sie mit prächtigen Uniformen und stattlichen Pferden, auf denen sie sich in den endlosen Runden der Gymkhanas und Militärparaden zu ihrem besten Vorteil präsentieren konnten. Ohne viel mehr zu leisten, bekamen sie ihren Unterhalt und ihre Bezahlung, während sie nur darauf warteten, bei einer der Veranstaltungen, die die Armee für die Zivilbevölkerung arrangierte, einer akzeptablen Erbin vorgestellt zu werden.31
Am anderen Ende des gesellschaftlichen Spektrums vermittelte das Regiment den Rekruten unterschiedlichster sozialer und geografischer Herkunft eine gemeinsame französische Identität: Bauern, Fabrikarbeiter, Tischler, Büroangestellte und Studenten; Menschen, die Gascogne Patois sprachen, Pariser Slang und elsässische Dialekte – sie alle mussten lernen, zusammenzuleben und sich mit Regelgeschwindigkeit dieselbe militärische Routine anzueignen: wie man ein Pferd besteigt, wie man es zu Fuß führt; dann das Traben, das Galoppieren, das Springen, um schließlich mit gezogenem Säbel und unflätigem Gebrüll durchs Unterholz des Waldes von Saint-Germain auf imaginäre Boches loszustürmen. Es war ein mustergültiges Beispiel Gemeinschaft stiftender Erfahrung.
Abb. 10:Tati (rechts) und Kameraden, Saint-Germain-en-Laye, 1928
Als Soldat hat Tati sich aufs Beste amüsiert. Es ist kein Zufall, dass der Militärdienst das Einzige ist, was man in Playtime über M. Hulots sozialen Hintergrund erfährt. In einer Szene, die als Bindeglied zwischen den beiden in Hotel und Ausstellung und dem Abend im Restaurant dient, wird Hulot, der Fahrer des Lieferwagens für den »Royal Garden«, vom Portier des Restaurants (gespielt von Tony Andall) überschwänglich empfangen; dann auch von Schneider, dem korpulenten Emporkömmling und Bewohner eines der »Fishbowl«-Appartements. Diese beiden Typen begrüßen Hulot als einen lang verschollenen Freund aus der Armee: »Alors, Hulot, l’Armée!«, hören wir (gerade noch) von Tony Andall; »Hulot! Hulot! L’Armée!«, ist Schneiders Salut. Ungeachtet dessen, was die französische Armee zwischen 1928 und 1967 erleben musste, steht die militärische Anspielung im Zeichen der Lustbarkeit in der Retortenstadt aus Stahl und Glas des Spielfilms Playtime.
Tati teilte das Leben der Rekruten, blieb aber verschont von vielerlei Ungemach, das die anderen während der Ausbildung erdulden mussten, war er doch bereits ein erfahrener Reiter. »In der Rückschau«, sagte er 1980 in seinen Gesprächen mit Jean L’Hôte, »wird mir klar, dass hinsichtlich des komischen Effekts kein Clown, kein vermeintlich amüsanter Film an die erste Reitstunde eines Trupps frischer Rekruten herankommt.« Zuerst führt der Offizier ihnen alles vor und wiederholt es mehrmals, um seine Kontrolle über das Tier und über die Soldaten zu demonstrieren. Dann stellen die Rekruten sich neben ihren Pferden auf und versuchen, auf die ihnen zugebrüllten Befehle ihre Pferde zu besteigen. »Die Show, die dann folgt, muss man gesehen haben«, erklärte Tati:
Angesichts einer so enorm schwierigen Aufgabe ist es die erste Reaktion der jungen Soldaten, sich vorzustellen, dass es leichter wäre, aufs Pferd zu kommen, wenn sie die offizielle Methode ignorieren und ihre eigene, besser zu ihnen passende erfinden. So sieht es dann aus, als wollten sie versuchen, über eine Mauer zu springen, und das Ergebnis ihrer Mühen lässt viel zu wünschen übrig. Die Pferde wissen sofort, dass sie tun können, was sie wollen … Und sie spazieren im Ring herum, nicken sich im Vorübergehen zu oder beschnuppern sich gegenseitig, ob sie vielleicht Interesse hätten … Gar nicht mehr des Menschen edelste Eroberung, benehmen die Pferde sich wie Gäste auf einem distinguierten Gartenfest der Reiterelite …
Freilich ist es unterhaltsam zuzusehen, wie Menschen etwas ganz Einfaches mit großem Ungeschick ausführen; aber die hier von Tati unter die Lupe genommene komische Szene war eine Sittenkomödie, oder genauer gesagt, eine Komödie der sozialen Klassen. Der Junge aus der Arbeiterklasse hält sich an der Pferdemähne fest, als wäre sie die Lenkstange seines Fahrrads (das Fahrradfahren war zu der Zeit ein Sport der Arbeiterklasse); der Bauernjunge sitzt rittlings auf seinem Hengst, als säße er auf einem stämmigen Zugpferd; der Büroangestellte sitzt kerzengerade und zieht die Zügel an, als säße er an seinem Schreibtisch; und so weiter. Es gibt einen kurzen Film, Cours du soir, den Nicolas Ribowski 1966 auf dem Set von Playtime gedreht hat, wo zu sehen ist, wie Tati seine Gesellschaftstheorie der Reiterpose demonstriert. Diese Sequenz ist die einzige bekannte filmische Aufzeichnung von Tatis mimischer Kunst zu Pferd, die heute allerdings kaum noch sehr komisch wirkt. Viele der persiflierten Typen gibt es nicht mehr; das ganze Konzept der »sozialen Typen« scheint veraltet, wenn nicht ganz und gar reaktionär. Es trifft auch kaum auf Tatis mimische Darstellungen zu, mit denen er fast immer Tätigkeiten nachahmt, keine »Typen«.
In der Armee wurde Tati trotz seiner überlegenen reiterlichen Fähigkeiten nicht von den bescheideneren Arbeiten eines einfachen Kavalleristen befreit:
Ich bin vorher viel geritten, aber ich war nie ein Stalljunge gewesen. Diese Arbeit fordert dir das Opfer einer schlaflosen Nacht ab, denn du musst sicherstellen, dass die dreißig Pferde, für die du verantwortlich bist, eine ordentliche Ruhepause bekommen. Das Problem dabei ist, dass du am Morgen den Stall genauso peinlich sauber hinterlassen musst, wie du ihn am Anfang deiner Schicht vorgefunden hast. Das heißt: Nicht die geringste Spur von Kot darf auf dem Boden liegen bleiben.
Ein alter Hase mit vielen Nächten Stallerfahrung gab mir einmal den guten Rat: »Tatischeff! Wenn du mit dem Saubermachen bis zum Morgen wartest, schaffst du es nie!«
Da saß ich also auf einem Schemel an einem Ende des Stalls mit dreißig Pferdehintern in meiner Sichtachse. Ich musste nicht lange warten. Innerhalb weniger Minuten zerfiel die perfekte Ausrichtung von dreißig Schwänzen, weil einer sich erhob und mir so das notwendige Signal gab. Mit einem Eimer in der Hand sprang ich hin und konnte ihn im letzten Moment gerade noch unterstellen. Mein erster Sieg. Einen guten Teil der Nacht verbrachte ich mit diesem Eimer-Hin-und-Her. Und als ich wieder mal auf meinem Schemel saß, musste ich lächeln. Ich hatte gerade daran gedacht, wie stolz meine Eltern den Nachbarn mitteilten, dass ihr »Sohn in der Kavallerie« ist. – Ach ja, ich war in der Kavallerie! Bis hoch zur Nasenspitze war ich drin!32
Als geschickter Reiter in vertrauter Umgebung war Tati ein gemachter Rädelsführer bei Jux und Schabernack. Der merkwürdigste aller verübten Streiche war ein sorgfältig ausgeheckter und erfolgreich durchgeführter Plan, einem Junioroffizier, der jeden Sonntagabend volltrunken ins Quartier zurückkam, den Schreck seines Lebens einzujagen. Sein Zimmer befand sich in der ersten Etage über dem Reitstall. Als er eines Nachts angetorkelt kam, am Türschloss herumfummelte und die Tür schließlich aufbekam – fand er, über sein Bett gebeugt, einen Schimmel vor. Tatischeff hatte einen ganzen Trupp organisiert, um das Pferd die Treppe hochzubugsieren. Doch als der Streich bekannt geworden war – das ganze Regiment fand ihn offensichtlich sehr lustig –, musste Tatischeff das Pferd allein wieder nach unten bringen. Das war gar nicht einfach.
Fast fünfzig Jahre später rief Elisabeth Wennberg, die Tati von der Arbeit an Parade her gut kannte, den Maestro in Paris an. Sie hatte gehört, dass Tati zum Re-Release von Trafic nach Stockholm kommen würde: Ob er vielleicht in ihrer Talkshow auftreten wolle? Na klar, sagte Tati in seinem annähernd korrekten Englisch. »Alles, was ich für meine Nummer brauche, ist ein Schimmel – in einem Schrank.« Das war eine bizarre Bedingung, aber Tati gab nicht nach: Er werde nur dann in ihrer Show auftreten, wenn er einen Schimmel in einem Schrank bekommt. Das schwedische Fernsehen tat das Nötige. Tatis »Nummer« in dieser Show war es, den Schrank zu öffnen und das Pferd zur Musik der Rockband »Kiss« im Studio herumzuführen. Niemand – außer einem unwahrscheinlichen französischen Zuschauer des schwedischen Fernsehens, der 1928 seinen Militärdienst bei den 16. Dragonern absolviert hatte – hätte den Witz verstehen können. Tatsächlich konnte sich niemand einen Vers darauf machen, was Tati sich dabei gedacht hatte, und man nahm ihm das Ganze als Grille eines alternden Stars ab, für den die Schweden eine besondere Zuneigung hegten.
Abb. 11:Tati und ein Schimmel, Stockholm, 1975
Für Tati war der Militärdienst die Zeit, die ihm die Augen für die Komik des Lebens geöffnet hat. Zahlreiche Szenen militärischen Unsinns verblieben scharf eingraviert in seinem Gedächtnis, oder wurden im Alter wieder lebendig. Über die Hälfte der Memoiren, die er 1980 für Jean L’Hôte auf Tonband sprach, sind Anekdoten aus den zwölf Monaten, die er bei den 16. Dragonern verbracht hatte. Die Szenen, die er sich 1980 ins Gedächtnis rief, sind sich natürlich sehr ähnlich und werden, vielleicht allzu explizit, als Lehrstücke über den Aufbau komischer Gags dargeboten. Aber das ist kein Grund, die Authentizität dieser Anekdoten zu bezweifeln.
Tatischeff, befördert zum Rang eines Wachtmeisters (maréchal du logis), musste Wachdienst leisten. Das war nicht so leicht, wie es klingt, denn die Kaserne befand sich im Zentrum der Stadt, und der Wachposten stand auf der Hauptstraße. Einmal geschah es, dass Tatis Großmutter mit einem sorgsam in Papier verpackten und mit hübschem Band verschnürten Päckchen auf ihn zukam. Der Wachsoldat rührte sich nicht und schaute unbeirrt geradeaus. Die Oma trat lächelnd noch näher an ihn heran: »Sieh mal, was ich dir gebracht habe!« Tati rührte sich nicht. »Jacques, sag doch was zu deiner Oma! Ich habe dir Kuchen mitgebracht!« Jacques schaute weiter geradeaus und versuchte, durch den Mundwinkel zischend seiner Großmutter klarzumachen, dass sie sich einem Soldaten auf Wachdienst nicht einfach so nähern konnte. Es gelang ihm nicht, und er musste den Rest seiner Wache mit einem zierlichen Päckchen, das an einem hübschen Bändchen von seinem kleinen Finger baumelte, strammstehen.
Es war auch in der Armee, dass Tati auf Männer traf, die viel dümmer waren als er. Einer von ihnen bekam die Namen und Ehrenabzeichen der militärischen Ränge einfach nicht in seinen Kopf, und Tati wurde damit beauftragt, ihm Nachhilfe zu geben. Er brachte diesen Mann tatsächlich dazu, die Reihenfolge auswendig herunterzuleiern, aber wenn er ihm eine Frage außer der Reihe stellte, bekam er eine aus der Luft gegriffene Antwort. Zum Spaß trichterte er seinem Schüler eine lachhafte Parallelsequenz ein: die nach der Höhe ihrer Hüte definierte Rangordnung der politischen Führungsschichten – vom Bürgermeister zum Parlamentsmitglied zum Minister und Präsidenten. Während der formalen Befragung durch den Rittmeister rasselte der Mann in korrekter Reihenfolge nicht nur die Leiter der militärischen Ränge und ihrer jeweiligen Streifen und Sterne herunter, sondern auch die Mumpitz-Hierarchie der Politiker und ihrer Hüte. »Und wer hat dir diesen Unsinn beigebracht!!?« Das konnte ganz offensichtlich nur Tatischeff gewesen sein. Aber er ist wohl mit heiler Haut davongekommen: Das Gelächter über diesen köstlichen Streich ließ alles vergessen.
Gegen Ende seiner Militärzeit wurde das Regiment modernisiert, allerdings nur insoweit, als den traditionellen Fortbewegungsmitteln der Kavallerie motorisierte Zweiräder hinzugefügt wurden. Hin und wieder fuhr Tati eines dieser Fahrzeuge, und einmal merkte er, wie der Vorderreifen platzte. Einer der Soldaten inspizierte den Schaden und konnte erleichtert berichten: »Keine Sorge, Wachtmeister, nur der untere Teil ist geplatzt.«
Der Mensch aber, dem Tati nach eigener Aussage die stärksten Impulse für seine Wahrnehmung der Komik des Lebens verdankte, war ein Friseur namens Lalouette. Lalouette war ein fröhlicher, gutmütiger Geselle, der einfach nicht merkte, dass es in der Armee anders als draußen zuging. Er redete die Offiziere mit »mein Herr« an, und nicht, wie es sich gehörte, mon capitaine, mon colonel und so weiter, und wenn er dafür gerügt wurde, entschuldigte er sich mit aufrichtiger Höflichkeit: »Bitte um Verzeihung, mein Herr.« Als Reiter war er ein hoffnungsloser Fall, außerdem hatte er ständig etwas verlegt oder verloren. Doch unverzagt und sozusagen blind für seine reale Situation ging er freundlich auf die Offiziere zu und fragte mit normal bürgerlicher Ehrerbietung, ob sie vielleicht seine Striegelbürste irgendwo haben herumliegen sehen … Lalouette wanderte durch seinen Militärdienst wie »Iwan Durak« der russischen Folklore – einfältig und unschuldig in einem Ausmaß, das ihn unberührbar machte, fast einen heiligen Narren. Selbst die schärfsten der Ausbilder gaben es auf, ihn zurechtzuweisen, wussten sie doch, dass Lalouette alles mit derselben unerschütterlichen Gelassenheit hinnehmen würde. Tati hat wiederholt betont, dass die ursprüngliche Inspiration für die Figur des Hulot von diesem hoffnungslosen Rekruten ausging.33 Später benutzte er auch dessen Namen für einen Comedy-Sketch über »Le Rugby militaire«, den er in den 1930er Jahren mit seinen Freunden aus dem Rugby Club aufführte.34 Wie Tati einmal erklärte, war Lalouette völlig unfähig, die Witzfigur zu erkennen oder darzustellen, die er selber war; die Komik der Situation habe in den verärgerten Reaktionen der Offiziere gelegen, nicht in dem unangemessenen, aber unauffälligen und nie bösartigen Verhalten des Lalouette. Aus dieser Konstellation bezog Tati das Grundprinzip seiner Komik, die er wiederholt und emphatisch gegen die von Charlie Chaplin abgrenzte: Komik liegt nicht in den Handlungen des Komikers, sondern in der Fähigkeit des Komikers, die komische Dimension anderer aufzudecken.
Abb. 12:Militärischer Festzug, 10. Juni 1928, Tati in der Uniform eines Karabiniers von 1809
Die wenigen anekdotisch überlieferten Ereignisse aus Tatis Schulzeit, seiner Ausbildung und seinem Militärdienst summieren sich kaum zur Ausbildung eines Komikstars, geschweige denn eines kreativen Künstlers. Dennoch muss das Fundament für Tatis späteres Werk hier liegen: in den Jahren des Nichtstuns; in den bürgerlichen Konventionen, von denen er nie sagte, dass er sie als erdrückend empfunden habe; im Reiten und in der menschlichen Komödie, die sich ihm bei den 16. Dragonern auftat. Hier muss es liegen: in Ferienerlebnissen, in kirchlichen Prozessionen, in schulischen Demütigungen – nicht, weil alle Kunstwerke notwendig autobiografisch sind, sondern weil Tati das genaue Gegenteil eines Erfinders war. Er beschrieb sich gern als Beobachter und Realist. Und nichts ist so gut beobachtet, nichts so real erlebt, wie das, was wir zum ersten Mal sehen, in der Kindheit, in den Entwicklungsjahren, in der Jugend.





























