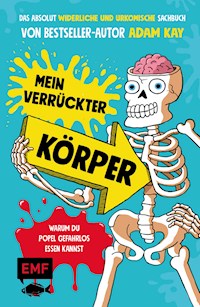11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Vorhang auf für 97-Stunden-Wochen und einen Tsunami an Körperflüssigkeiten. Entscheidungen auf Leben und Tod am laufenden Band und ein Gehalt, gegen das jede Parkuhr zu den Besserverdienern gehört. Auf Nimmerwiedersehen, Freunde und Familie ... herzlich willkommen im Leben eines Assistenzarztes! Adam Kay, jetzt in seiner Heimat England als Comedian gefeiert, gehörte viele Jahre dazu. Nach schlaflosen Nächten und durchgearbeiteten Wochenenden mobilisierte er seine letzten Kräfte, um seine Erlebnisse aus dem Alltag eines Krankenhauses aufzuschreiben. Saukomisch, erschreckend und herzerweichend zugleich: Kays Tagebücher bringen alles ans Tageslicht, was Sie jemals über den Krankenhausalltag wissen wollten – und auch einiges, was besser im Verborgenen geblieben wäre. Kein Zweifel: Diese Lektüre wird Narben hinterlassen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 358
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Das Buch
97-Stunden-Wochen und Entscheidungen auf Leben und Tod: Was der britische Comedian Adam Kay vom alltäglichen Wahnsinn im Leben eines Assistenzarztes berichtet, ist komisch, erschreckend und herzergreifend zugleich.
Phänomenaler Bestseller in Großbritannien:
»Es gibt selten Bücher, die einen sowohl zum Weinen als auch zum Lachen bringen. Jetzt tut es gleich ein bisschen weh ist so ein Buch.« Ian Rankin
»Das Lachen bleibt einem schier im Hals stecken, so geschickt pendelt Kay zwischen zum Brüllen komischen Anekdoten und Geschichten puren Grauens.« The Independent
»Ein rasantes Pingpongspiel zwischen dem Komischen und dem Tragischen, das absolut den Nerv des Publikums getroffen hat.« The Guardian
»Kay schreibt mit rasiermesserscharfer Präzision. Jeder, der Arzt werden will, sollte dieses Buch lesen. Besser noch: jeder, dem irgendwann vielleicht einmal ein Krankenhausaufenthalt bevorsteht.« Mail on Sunday
»Kay landet in diesem Bericht über das Leben eines Assistenzarztes einen Treffer nach dem anderen – er erzählt direkt aus dem Schützengraben unseres Gesundheitssystems.« Financial Times
»Das tut wirklich ein bisschen weh – zum Beispiel bei der Beschreibung einer Dame, die sich mit Weihnachtsbeleuchtung vollstopft und dann das Licht anmacht.« The Scotsman
Adam Kay
Jetzt tut es gleich
ein bisschen weh
Die geheimen Tagebücher
eines Assistenzarztes
Aus dem Englischen
von Susanne Kuhlmann-Krieg
Inhalt
Einleitung
1 House Officer – Das erste Jahr als Juniorarzt
2Zweites klinisches Jahr / erste Stelle als SHO
3Zweite Stelle als SHO
4Dritte Stelle als SHO
5Erste Stelle als Assistenzarzt
6Zweite Stelle als Assistenzarzt
7Dritte Stelle als Assistenzarzt
8Vierte Stelle als Assistenzarzt
9Stationsarzt / Leitender Oberarzt
10Nachspiel – Wie es weiterging
Offener Brief an den Gesundheitsminister
Dank
Für James
… und seine wankelmütige Unterstützung
Und für mich
… ohne den dieses Buch nicht möglich gewesen wäre
Um die Privatsphäre jener Freunde und Kollegen zu wahren, die es vorziehen würden, nicht erkannt zu werden, habe ich verschiedentlich persönliche Merkmale geändert. Um der Verschwiegenheitspflicht gegenüber Patienten gerecht zu werden, habe ich klinische Informationen geändert, die die Identität von Einzelpersonen preisgeben könnten, Daten verändert1, Namen anonymisiert.2 Weiß der Kuckuck, warum überhaupt – sie können mir gar nicht mehr drohen, mir meine Zulassung streitig zu machen.
1 Ich habe viel Zeit in Kreißsälen zugebracht, und Menschen tendieren dazu, das Geburtsdatum ihrer Kinder im Gedächtnis zu behalten.
2 Im Allgemeinen habe ich die Namen von Kleindarstellern des Harry-Potter-Universums verwendet, um einen juristischen Albtraum durch einen anderen zu ersetzen.
Einleitung
Im Jahr 2010, nach sechs Jahren Studium und weiteren sechs Jahren im klinischen Dienst, habe ich meinen Job als Assistenzarzt an den Nagel gehängt. Meine Eltern haben mir bis heute nicht verziehen.
Im vergangenen Jahr schrieb mir die Ärztekammer, man werde meinen Namen aus dem Arztregister streichen. Es war eigentlich kein allzu großer Schock, schließlich hatte ich seit einem halben Jahrzehnt3 nicht praktiziert, aber auf emotionaler Ebene empfand ich es dann doch als recht einschneidend, dieses Kapitel meines Lebens ein für alle Mal zu schließen.
Für mein Gästezimmer war es allerdings eine fantastische Neuigkeit, denn ich entsorgte Kiste um Kiste an altem Papierkram und schredderte meine Akten schneller als der Finanzberater einer Briefkastenfirma kurz vorm Eintreffen der Steuerfahnder. Eines allerdings entriss ich den Klingen des Todes: meine Ausbildungsunterlagen. Allen Ärzten wird nahegelegt, ihre Erfahrungen in der Klinik »reflektierend« zu protokollieren. Zum ersten Mal seit Jahren blätterte ich durch die Unterlagen, und es erschien mir, dass meine reflektierende Praxis darin bestanden haben musste, ins Bereitschaftsdienstzimmer hochzugehen und irgendetwas halbwegs Interessantes niederzuschreiben, das sich an jenen Tagen ereignet hatte.
Neben all dem Komischen und dem Alltäglichen, den zahllosen Gegenständen in verschiedenen Körperöffnungen und der kleinkarierten Bürokratie kamen mir die irren Arbeitszeiten wieder in den Sinn. Außerdem wurde mir erneut bewusst, wie ungeheuer das Dasein als Assistenzarzt mein Leben beeinflusst hatte. Rückblickend gelesen kam es mir extrem und unvernünftig vor, was da von einem erwartet wurde, aber damals akzeptierte ich es schlicht als Teil des Jobs. Es gab Momente, da hätte ich nicht mit der Wimper gezuckt, wenn ein Eintrag bei der Schwangerschaftsvorsorge gelautet hätte »nach Island zur Pränataldiagnostik geschwommen« oder »habe heute einen Hubschrauber essen müssen«.
Um dieselbe Zeit, da ich all das beim Lesen meiner Protokolle erneut durchlebte, gerieten britische Assistenzärzte im Hier und Jetzt in die Schusslinie der Politik. Ich konnte mich des Eindrucks nicht erwehren, dass es den Ärzten nicht richtig gelingen wollte, ihre Seite der Geschichte rüberzubringen (vermutlich, weil sie die ganze Zeit zu arbeiten hatten), und mir kam es so vor, als bekäme die Öffentlichkeit nicht die ganze Wahrheit darüber zu hören, was es wirklich heißt, Arzt zu sein. Statt schulterzuckend den Reißwolf wieder anzuwerfen, beschloss ich etwas zu unternehmen, um das Gleichgewicht wiederherzustellen.
Hier also sind sie, die Tagebücher, die ich während meiner Zeit im Nationalen Gesundheitsdienst Großbritanniens (NHS) verfasst habe – ungeschönt, mit allen Fehlern und Schwächen: Wie es ist, an vorderster Front zu arbeiten, welche Folgen es für mein persönliches Leben hatte und wie das alles eines schrecklichen Tages zu viel für mich wurde. Tut mir leid, dass ich das Ende vorwegnehme, aber Titanic haben Sie sich ja auch angesehen, obwohl Sie wussten, wie das Ganze ausgehen würde.
Ich werde Ihnen hier und da mit dem nötigen Medizinerjargon zur Seite stehen und ein bisschen umreißen, was zu den einzelnen Jobs an Aufgaben gehört. Im Unterschied zu einem frischgebackenen Assistenzarzt werden Sie nicht einfach ins Tiefe geschubst, während jeder von Ihnen erwartet, dass Sie ab dann genau wissen, was Sie zu tun haben.
3 Eine Studie des Gesundheitsministeriums aus dem Jahre 2006 kam zu dem Schluss, dass die Öffentlichkeit (ziemlich vernünftige Ansicht) davon ausgeht, dass Ärzte jährlich irgendeiner Form von Beurteilung unterworfen werden. Die Wahrheit aber ist, dass Ärzte vom Tag ihrer Zulassung bis zu dem Tag, an dem sie in den Ruhestand gehen, fröhlich vor sich hin werkeln, ohne dass jemand auch nur danach schaut, ob sie noch wissen, welches Ende der Spritze in den Patienten gepikt werden muss. Im Anschluss an die Ermittlungen zum Harold-Shipman-Prozess wurde 2012 ein Revalidierungsverfahren Standard, nach dem Ärzte nunmehr alle fünf Jahre begutachtet werden (A. d. Ü.: Harold Shipman war Arzt und hat mehr als zweihundert seiner Patienten umgebracht). Sie würden eine Menge Autos auf unseren Straßen vermutlich mit einiger Sorge betrachten, wenn sie nur alle fünf Jahre zum TÜV müssten, aber es ist immerhin besser als nichts, nehme ich an.
1
House Officer – Das erste Jahr als Juniorarzt
Mit der Entscheidung, in der Medizin zu arbeiten, verhält es sich im Prinzip so wie mit jener E-Mail Anfang Oktober, in der Sie aufgefordert werden, sich für eine der Menüoptionen bei der Weihnachtsfeier Ihrer Firma zu entscheiden. Zweifellos werden Sie auf Nummer sicher gehen und Hühnchen wählen, und es ist mehr als wahrscheinlich, dass alles glattgeht. Aber was, wenn jemand am Tag zuvor ein grausiges Video auf Facebook postet und Sie unfreiwillig Zeuge einer Massenaktion im Schnabelkürzen werden? Was, wenn Morrisey im November stirbt und Sie ihm zu Ehren von Ihrer bislang mehr oder minder ausschließlich fleischlastigen Lebensweise abrücken? Was, wenn Sie eine lebensbedrohliche Allergie gegen Hühnerfleisch entwickeln? Letztlich weiß niemand, was er sechzig Abendessen von heute zu Abend essen will.
Ärzte treffen ihre Berufsentscheidung hierzulande im Alter von sechzehn Jahren – zwei Jahre bevor ihnen unser Gesetz gestattet, ein Foto von ihren Genitalien ins Netz zu stellen. Wenn Sie sich daranmachen, Ihre Oberstufenkurse auszusuchen, begeben Sie sich auf eine ballistische Kurve, deren Verlauf bis zu Ihrer Rente oder Ihrem vorzeitigen Tod vorgezeichnet ist. Und anders als bei Ihrem Weihnachtsessen auf der Arbeit findet sich keine Janet aus der Logistik, die mit Ihnen Hühnchen gegen Grillkäsespieße tauscht – Sie bleiben auf Ihrer Wahl sitzen.
Die Gründe, die Sie im Alter von sechzehn Jahren bewegen, sich für ein Leben in der Medizin zu entscheiden, laufen im Allgemeinen auf das Muster hinaus: »Meine Mama/mein Papa ist Arzt«, »Ich finde Emergency Room so toll« oder »Ich will Krebs heilen«. Die Gründe eins und zwei sind albern, Grund drei wäre komplett in Ordnung – vielleicht ein bisschen zu ernst für Ihr Alter –, wäre da nicht der Umstand, dass dies etwas ist, das von Wissenschaftlern versucht wird, nicht von Ärzten. Davon abgesehen will es ein bisschen unfair erscheinen, jemanden dieses Alters bei seinem Wort zu nehmen – ein bisschen so, als erklärten Sie jenes »Ich will mal Astronaut werden«-Bild, das Sie mit fünf Jahren gemalt haben, zu einem rechtlich bindenden Dokument.
Was mich betrifft, erinnere ich mich nicht daran, dass Medizin in meinem Falle eine aktive Berufsentscheidung gewesen ist, es war eher so etwas wie die Werkseinstellung für mein Leben – wie der Marimba-Klingelton und das vorinstallierte Hintergrundfoto von einem Gebirgsmassiv auf Ihrem PC-Bildschirm. Ich bin in einer jüdischen Familie aufgewachsen (wobei für diese wohl vor allem das entsprechende Essen im Vordergrund stand), war auf einer Schule, die im Prinzip nichts anderes war als eine Würstchenfabrik für künftige Ärzte, Rechtsanwälte und Kabinettsmitglieder, und mein Vater war Arzt. Ich konnte gar nicht anders. Es war meine Bestimmung.
Da auf einen Platz fürs Medizinstudium mehr als zehn Bewerber kommen, müssen alle Kandidaten ein Interview über sich ergehen lassen, bei dem nur diejenigen, die sich unter Grillbedingungen am allerbesten schlagen, mit einem Studienplatz belohnt werden. Dass alle Bewerber sich in ihren Kursen auf einem glatten Einser-Niveau bewegen, wird sowieso vorausgesetzt, daher gründen die Universitäten ihre Entscheidungen auf nichtakademische Aspekte. Das freilich ergibt Sinn: Ein Arzt muss psychisch für den Job geeignet sein – imstande, unter furchterregendem Druck Entscheidungen zu treffen, verängstigten Angehörigen schlimme Neuigkeiten zu überbringen, und fähig, tagtäglich dem Tod ins Auge zu sehen. Er muss über etwas verfügen, das sich nicht auswendig lernen und benoten lässt: Ein wirklich guter Arzt muss ein riesengroßes Herz haben und dazu eine massiv erweiterte Hauptschlagader, durch die ein ganzes Meer an Mitgefühl und Menschenfreundlichkeit gepumpt wird.
Das jedenfalls ist das, was man annehmen sollte. In Wirklichkeit scheren sich die medizinischen Hochschulen nicht auch nur einen feuchten Kehricht um irgendwas davon. Sie fragen nicht mal danach, ob Sie Blut sehen können, sondern versteifen sich vielmehr auf ganz andere außerschulische Qualitäten: Der ideale Student ist Kapitän zweier Sportmannschaften, amtierender Schwimm-Champion des Landes, Leiter des Jugendorchesters und Herausgeber der Schulzeitung. Das Ganze ist im Grunde eine Miss-Wahl unter Gleichgesinnten, nur fehlt die Schärpe. Schauen Sie sich den Wikipedia-Eintrag irgendeines berühmten Arztes an, und Sie werden Dinge lesen wie: »In der Juniorliga ein versierter Rugby-Spieler, glänzte er später als Langstreckenläufer und war im letzten Schuljahr Vizekapitän der Leichtathletikmannschaft.« Diese spezielle Beschreibung passt übrigens auch auf einen gewissen Dr. H. Shipman, das System ist vielleicht doch nicht so unfehlbar.
Das Imperial College in London befand zufrieden, dass meine Lorbeeren aus acht Jahren Klavier und Saxofon sowie ein paar dilettantische Theaterrezensionen für die Schülerzeitschrift mich perfekt auf ein Leben auf Station vorbereitet hätten, sodass ich meine Sachen packte und mich auf die abenteuerliche Zehnkilometerreise von Dulwitch nach South Kensington machte.
Wie Sie sich vielleicht vorstellen können, ist das Auswendiglernen jedes einzelnen Aspekts von Anatomie und Physiologie des menschlichen Körpers samt jeder denkbaren Art und Weise, wie dieser versagen kann, eine ziemliche Herkulesaufgabe. Aber die Begeisterung, die mir das Wissen vermittelte, eines Tages Arzt zu sein – etwas so Bedeutendes, dass Sie wie ein Superheld oder ein international gesuchter Verbrecher dafür buchstäblich Ihren Namen ändern –, trieb mich jene sechs langen Jahre unaufhaltsam meinem Ziel entgegen.
Dann hatte ich es geschafft. Ich hatte meine Zulassung und trat mein erstes Jahr im Klinikdienst an.4 Ich hätte bei der Quizshow Mastermind auftreten können – Spezialgebiet »der menschliche Körper«. Jeder von den Zuschauern zu Hause hätte vor seinem Fernseher lauthals ausgerufen, dass das Gebiet viel zu weit und uferlos sei, und ich mich, wenn ich Erfolg haben wolle, besser auf etwas so Umgrenztes wie »Arteriosklerose« oder »Ballenzehen« beschränken solle, aber sie hätten falschgelegen, ich hatte es tatsächlich auf die Reihe bekommen.
Endlich war es an der Zeit, gerüstet mit all diesem erschöpfenden Wissen, hinaus auf die Stationen zu gehen und die Theorie in Praxis umzusetzen. Meine innere Sprungfeder hätte gespannter nicht sein können. Es war daher ein ziemlicher Schlag, als ich feststellen musste, dass ich ein Viertel meines bisherigen Lebens auf der Medizinhochschule zugebracht hatte und mich das nicht im Geringsten auf das Jekyll-and-Hyde-Dasein eines Arztes in der klinischen Ausbildung vorbereitet hatte.5
Tagsüber war der Job machbar, wenn auch nervig und irre zeitaufwendig. Sie erscheinen am Morgen zur Visite, bei der das Ärzteteam geschlossen jeden seiner Patienten abklappert. Sie dackeln hinterher wie ein hypnotisiertes Entchen, den Kopf in Einfühlsamkeit suggerierender Weise zur Seite geneigt, notieren sich jede Anweisung Ihres Vorgesetzten – MRT-Termin ausmachen, an die Rheumatologie überweisen, ein EEG veranlassen. Den Rest Ihres Arbeitstages (plus in der Regel weitere vier unbezahlte Stunden) verbringen Sie dann damit, diese schier nicht enden wollenden Anweisungen auszuführen, Formblätter auszufüllen, Anrufe zu tätigen. Letztlich sind Sie nichts weiter als ein persönlicher Assistent Ihres Chefs. Nicht gerade das, wofür Sie so lange studiert haben, aber was soll’s.
Die Nachtwachen hingegen lassen Dantes Hölle wie Disney erscheinen – ein erbarmungsloser Albtraum, der mich bitter bereuen ließ, jemals den Gedanken gehegt zu haben, ich sei gemessen an meiner Ausbildung hin und wieder möglicherweise eventuell nicht hinreichend ausgelastet gewesen. Nachts bekommt der Arztanfänger ein kleines Funkgerät – liebevoll Piepser oder auch Pager genannt – ausgehändigt, und damit fällt ihm die Verantwortung für jeden einzelnen Patienten in der gesamten Klinik zu. Den ganzen verdammten Haufen. Der diensthabende Senior House Officer und der Assistenzarzt sind unten in der Notaufnahme, untersuchen Patienten und nehmen Leute auf, während Sie oben auf Station das Schiff alleine segeln. Ein Schiff von ungeheuren Ausmaßen, auf dem zu allem Überfluss Wasser eindringt und Sie überhaupt nicht navigieren können. Man hat Sie gelehrt, Herz und Kreislauf eines Patienten zu untersuchen, Sie kennen die Physiologie der Herzkranzgefäße, aber selbst wenn Sie jedes kleinste Anzeichen und Symptom eines Herzinfarktes im Schlaf erkennen, ist es beim ersten Mal nicht so einfach, damit klarzukommen.
Sie werden von Station um Station angepiepst, von einer Schwester nach der anderen mit einem Notfall nach dem anderen – es hört nie auf, die ganze Nacht nicht. Ihre älteren Kollegen behandeln in der Notaufnahme Patienten mit einem speziellen Problem: einer Lungenentzündung, einem gebrochenen Bein. Ihre Patienten sind ähnliche Notfälle, aber sie befinden sich bereits in stationärer Behandlung, das heißt, sie haben grundsätzlich bereits ein ernsthaftes Problem. Es ist so eine Art »Super-Big-Mac«, bei dem sich Symptome zu Beschwerden und Beschwerden zu Krankheiten addieren: Sie haben einen Patienten mit Lungenentzündung zu behandeln, der mit Leberversagen eingeliefert worden war, oder einen mit gebrochenem Bein, der nach einem epileptischen Anfall aus dem Bett gefallen ist. Sie sind eine mobile, mehr oder weniger unausgebildete Ein-Mann-Notaufnahme, die von Körperflüssigkeiten (und zwar nicht solchen, die Spaß machen) durchweicht einen endlosen Strom an besorgniserregend kranken Patienten zu versorgen hat, um die sich zwölf Stunden zuvor noch ein ganzes Ärzteteam gekümmert hat. Plötzlich sehnen Sie sich nach einer Sechzehnstundenschicht mit lauter Schreibkram (oder idealerweise einem Job irgendwo dazwischen, der Ihre Fähigkeiten weder übersteigt noch zu wenig beansprucht).
Es heißt untergehen oder schwimmen, und Sie müssen lernen zu schwimmen, sonst gehen haufenweise Patienten mit Ihnen unter. Ich fand all das auf verdrehte Weise beglückend. Sicher, die Arbeit war brutal hart. Okay, die Arbeitszeiten grenzten ans Unmenschliche. Und es stimmt, ich habe Dinge gesehen, die sich bis heute unauslöschlich in meine Netzhaut eingegraben haben. Aber immerhin war ich Arzt.
4 Als »Junior Doctor« wird hierzulande jeder bezeichnet, der noch kein Facharzt oder niedergelassener Arzt ist (eine exakte deutsche Entsprechung fehlt, hier folgt nach dem Studium sofort der Assistenzarzt. Die eineinhalbjährige Station »Arzt im Praktikum« – kurz AiP – wurde 2004 abgeschafft). Der englische Begriff ist ein bisschen verwirrend, denn er suggeriert einen jungen Arzt frisch von der Uni, aber viele sind gar nicht mehr so jung, sondern arbeiten seit fünfzehn Jahren und haben in der Zeit einen Doktortitel sowie verschiedene andere Qualifikationen erworben. Es ist ein bisschen so, als wolle man jeden in Westminster – abgesehen vom Premierminister – als »Juniorpolitiker« bezeichnen.
5 Die Hierarchie sieht in England folgendermaßen aus: House Officer (1. Jahr), Senior House Officer (2. Jahr, in zwei verschiedenen Häusern), Registrar (Assistenzarzt) an verschiedenen Kliniken, Consultant (Facharzt), Senior Registrar (Oberarzt).
Dienstag, 3. August 2004
Tag eins. H6 hatte mir ein Lunchpaket mitgegeben. Ich bekam ein nagelneues Stethoskop7, ein neues Hemd und eine neue E-Mail-Adresse: [email protected]. Am ersten Tag tat es gut zu wissen, dass mich niemand würde beschuldigen können, der inkompetenteste Mensch der Klinik zu sein. Selbst wenn ich es wäre, konnte ich alles auf Atom schieben.
Ich weidete mich am »Eisbrecherpotenzial« dieser Geschichte, aber später im Pub verblasste mein Schicksal ziemlich gegenüber dem meiner Freundin Amanda. Ihr Nachname lautete Saunders-Vest. Bei ihr haben sie den Bindestrich mitbuchstabiert (englisch: hyphen), sodass sie zu [email protected] mutierte.
Mittwoch, 18. August 2004
Patient OM ist siebzig Jahre alt, Heizungsbauer im Ruhestand aus Stoke-on-Trent. Aber heute Abend, Matthew, ist er zu einem exzentrischen deutschen Professor mit einem ziemlich schrägen, halb deutschen Akzent mutiert. Ja, genau genommen nicht nur heute Abend, sondern auch heute Morgen, heute Nachmittag, eigentlich an jedem Tag seit seiner Einweisung – zu danken ist es seiner Demenz, die sich durch einen Harnwegsinfekt verschlimmert hat.8
Professor OMs Lieblingsspiel besteht darin, mit verkehrt herum angezogenem Krankenhaushemd (damit es einem weißen Kittel gleicht) hinter dem Visite-Tross herzustiefeln, mit oder ohne Unterwäsche … Wann immer ein Arzt etwas sagt, fährt er mit einem »Jawohl!« oder »Sehr richtig!«, gelegentlich auch »Genial!« dazwischen.
Bei Chefarzt- oder Assistenzarztrundgängen geleite ich ihn auf der Stelle zurück in sein Bett und sorge dafür, dass das Pflegepersonal ihn für ein paar Stunden aus dem Verkehr zieht. Wenn ich allein meine Runde mache, lasse ich ihn eine Weile gewähren. Ich habe nicht viel Ahnung von dem, was ich da tue, und selbst wenn, tue ich, was ich tue, nicht mit sonderlich viel Selbstvertrauen, also ist es eigentlich ganz angenehm, einen greisen deutschen Cheerleader hinter mir zu haben, der immer wieder »Das ist fantastisch!« in die Runde wirft.
Heute ist er neben mir gestürzt, sodass ich ihn traurigerweise vom aktiven Dienst entbinden musste.
Montag, 30. August 2004
Was immer uns an Freizeit abgeht, wird mehr als wettgemacht durch die Geschichten über unsere Patienten. Beim Mittagessen im Bereitschaftsraum9 tauschen wir gerne Storys aus über all die unsinnigen »Symptome«, die uns die Leute schildern. Wir hatten in den letzten Wochen Patienten mit juckenden Zähnen, einer plötzlichen Verbesserung des Hörvermögens und Armschmerzen beim Wasserlassen zu behandeln. Alle Anekdoten werden, wie die Rede eines lokalen Würdenträgers bei einer Abschlussfeier, mit höflichem Gekicher quittiert. Wie früher am Lagerfeuer beim Erzählen von Gespenstergeschichten kommt jeder in der Tischrunde an die Reihe und darf eine Story zum Besten geben. Dann ist Seamus an der Reihe. Er erzählt, er habe am Morgen in der Notaufnahme jemanden behandelt, der davon überzeugt war, dass er nur auf einer Gesichtshälfte schwitze.
Er lehnt sich zurück und erwartet stürmisches Gelächter, erntet allerdings nur Schweigen. Bis so ziemlich alle gleichzeitig murmeln: »Horner-Syndrom also?« Er hat nie davon gehört, erst recht nicht davon, dass es auf einen Tumor – nicht selten einen Lungentumor – hindeuten kann. Mit einem ohrenbetäubenden Kreischen schiebt Seamus seinen Stuhl zurück und rennt davon, um dem Patienten hinterherzutelefonieren, damit er zurück in die Klinik kommt. Ich esse sein Twix zu Ende.
Freitag, 10. September 2004
Mir fällt auf, dass bei jedem Patienten auf der Station ein Puls von 60 im Patientenblatt notiert ist, also beobachte ich heimlich die Messtechnik des Pflegenden. Er fühlt den Puls des Patienten, schaut auf die Uhr und zählt akribisch die Zahl der Sekunden pro Minute.
Sonntag, 17. Oktober 2004
Zugutehalten kann man mir, dass ich nicht in Panik geriet, als dem Patienten, den ich auf der Station zu untersuchen hatte, unerwartet Unmengen Blut aus dem Mund und auf mein Hemd sprudelten. Absolut nicht zugutehalten kann man mir hingegen, dass ich keine Ahnung hatte, was ich sonst hätte tun sollen. Ich bat die nächststehende Krankenschwester, Hugo zu holen. Er ist der für mich zuständige Assistenzarzt, der gerade auf der Nachbarstation unterwegs war. In der Zwischenzeit legte ich dem Patienten einen Zugang10 und ließ ein paar Infusionen hineinlaufen. Hugo war zur Stelle, bevor ich irgendetwas anderes tun konnte, was sehr praktisch war, weil ich an diesem Punkt absolut keine Ideen mehr hatte, was ich hätte tun können. Beim Patienten nach dem Abstellhahn suchen? Ihm eine Rolle Küchenpapier in den Rachen stopfen? Ein paar Kräuter zugeben und das Ganze zu Tomatensuppe erklären?
Hugo diagnostizierte eine Ösophagusvarizenblutung11, ein naheliegender Schluss, denn der Patient hatte die Farbe von Homer Simpson – und zwar aus den frühen Folgen, als die Farbgebung noch viel greller war und jede Figur aussah wie einem Höhlengemälde entsprungen. Er versuchte, die Blutung mit einer Sengstaken-Sonde12 unter Kontrolle zu bekommen. Da sich der Patient wand wie ein Aal und sich dagegen wehrte, dass man ihm dieses abscheuliche Teil in den Hals schob, spritzte sein Blut überallhin: auf Hugo, auf mich, die Wände, die Vorhänge, die Decke. Es kam einem vor wie eine besonders durchgeknallte Folge von Changing Rooms (das deutsche Pendant hieß Tapetenwechsel). Der Soundtrack war das Schlimmste. Mit jedem Atemzug, den der arme Mann tat, konnte man hören, wie er Blut in die Lungen sog und zu ersticken drohte.
Als die Sonde endlich saß, war die Blutung gestoppt. Jede Blutung hört irgendwann einmal auf, und diese hier kam aus dem traurigsten aller Gründe zum Stillstand. Hugo erklärte den Patienten für tot, schrieb die nötigen Papiere und bat die Schwester, der Familie Bescheid zu geben. Ich schälte mich aus meinen blutverschmierten Klamotten, und wir zogen uns schweigend OP-Kleidung für den Rest der Schicht über. Das war es also. Das erste Sterben, das ich je miterlebt hatte. Und es war jede Sekunde so furchtbar gewesen, wie es nur hatte sein können. Nichts daran war romantisch oder erhaben. Diese Geräusche. Hugo nahm mich zum Rauchen mit nach draußen – nach alledem hatten wir beide eine Zigarette nötig. Ich hatte noch nie geraucht. Manchmal muss man zu ungewöhnlichen Mitteln greifen.
Dienstag, 9. November 2004
Um drei Uhr morgens aus meinem ersten halbstündigen Schlummer in drei Schichten vom Pager geweckt worden, um einem Patienten, dessen Schlaf offensichtlich sehr viel wichtiger ist als meiner, eine Schlaftablette zu verschreiben. Meine Kräfte reichen weiter, als ich dachte. Ich treffe auf der Station ein – und finde den Patienten schlafend vor.
Freitag, 12. November 2004
Die Blutwerte einer stationär behandelten Patientin zeigen, dass ihr Gerinnungssystem aus unerfindlichen Gründen komplett aus den Fugen ist. Hugo kommt schließlich dahinter, woran es liegt: Sie nimmt seit längerer Zeit Johanniskrautkapseln aus dem Reformhaus gegen ihre Angstzustände. Hugo erklärt ihr (und um fair zu bleiben, auch mir), dass Johanneskraut mit dem Gerinnungshemmer wechselwirkt, den sie nehmen muss, und dass ihre Blutgerinnung mit Sicherheit wieder ins Lot kommt, sobald sie aufhört, das Zeug zu schlucken. Sie staunt. »Ich dachte, das sei nur was Pflanzliches – wie kann es einem dann so schaden?«
Bei den Worten »nur was Pflanzliches« scheint die Raumtemperatur um ein paar Grad zu sinken, und Hugo kann sich nur mit Mühe einen müden Seufzer verkneifen. Es ist ganz offensichtlich nicht das erste Mal, dass er diese Nummer erlebt.
»Aprikosenkerne enthalten Blausäure«, entgegnet er trocken. »Die Hälfte aller Knollenblätterpilz-Vergiftungen geht tödlich aus. Natürlich ist nicht gleichbedeutend mit ungefährlich. In meinem Garten gibt es eine Pflanze, an der Sie sterben würden, wenn Sie sich zehn Minuten einfach nur unter sie setzen.« Gute Arbeit, sie lässt die Pillen weg.
Ich frage Hugo bei einer Koloskopie später nach dieser Killerpflanze in seinem Garten.
Er antwortet: »’ne Seerose.«
Montag, 6. Dezember 2004
Alle Jungärzte der Klinik wurden aufgefordert, ein Dokument zu unterschreiben, mit dem sie ihr Einverständnis erklären, die Europäische Arbeitszeitrichtlinie13 in ihrem Fall außer Kraft zu setzen, weil sich unsere Verträge damit nicht vereinbaren lassen. Ich habe H in dieser Woche weniger als zwei Stunden gesehen und insgesamt neunundsiebzig Stunden gearbeitet. Nicht zu vereinbaren scheint ein wenig untertrieben. Mein Vertrag hat die Regelung gepackt, sie mitten in der Nacht schreiend aus dem Bett gezerrt und mit Waterboarding gefoltert.
Donnerstag, 20. Januar 2005
Sehr geehrte drogendealende Dreckskerle,
im Laufe der letzten paar Nächte mussten wir drei junge Männer und Frauen aufnehmen – allesamt ausgetrocknet wie dürres Laub, kollabiert letztlich an einem massiven Absinken ihres Blutdrucks, die Elektrolytwerte komplett aus dem Ruder.14 Die einzige Verbindung zwischen diesen Personen ist der Konsum von Kokain in jüngster Zeit. Ungeachtet all seiner herzgefährdenden und die Herzwände schädigenden Eigenschaften, ist Kokain für die oben genannten Symptome nicht verantwortlich. Ich glaube mit ziemlicher Sicherheit – und ich will einen Nobelpreis oder wenigstens einen britischen Verdienstorden für diese Erkenntnis –, dass ihr eure Lieferungen mit dem Furosemid15 eurer Oma gestreckt habt.
Abgesehen von der Tatsache, dass ihr meine Nächte und die Betten unserer Abteilung vergeudet, scheint es mir ein einigermaßen bestürzendes Geschäftsgebaren, der Kundschaft krankenhausreifen Schnee zu verticken. Benutzt freundlicherweise Kreide, wie alle anderen auch.
Mit freundlichem Gruß, Dr. Adam Kay.
Montag, 31. Januar 2005
Habe heute Nacht ein Leben gerettet. Wurde zu einem achtundsechzigjährigen Patienten gerufen, der dem Jenseits so nahe war, wie man nur sein kann – er hatte bereits die Türglocke betätigt und blickte durch das beschlagene Glas in den Korridor von Gevatter Tod. Seine Sauerstoffsättigung16 lag bei 73 Prozent – ich glaube, wenn der Süßigkeitenautomat nicht außer Betrieb gewesen wäre, sodass ich mir wie geplant unterwegs einen Riegel hätte kaufen können, wäre ich wohl zu spät gekommen.
Mir blieben nicht einmal die paar Sekunden, die einzelnen Punkte des Notfallprotokolls im Geiste durchzugehen – in einer Art Autopilotenmodus, von dem ich nicht mal wusste, dass ich ihn hatte, spulte ich einfach Schritt um Schritt ab. Sauerstoff an, intravenöser Zugang, Blutwerte, Blutgase, Diuretika, Katheter. Er fing auf der Stelle an, munterer zu werden, das Bungeeseil hatte ihn Millimeter über dem Beton zurückgeholt. Tut mir leid, Tod, den hier wirst du heute Abend nicht bei Tisch begrüßen können. Als Hugo eintrudelte, kam ich mir vor wie Superman.
Die merkwürdige Erkenntnis überkam mich, dass dies das erste Mal in meinen fünf Monaten als Arzt war, dass ich buchstäblich ein Leben gerettet hatte. Jeder Außenstehende stellt sich vor, dass wir bei unseren Streifzügen durch die Stationen tagtäglich Heldentaten vollbringen. Es ging mir selbst so, als ich hier anfing. Tatsache ist, dass obwohl auf den Krankenhausstationen des Landes tagtäglich Dutzende, wenn nicht Hunderte Leben gerettet werden, es aber nahezu ausschließlich sehr viel unaufgeregter und teamorientierter passiert. Nicht dadurch, dass ein einzelner Arzt etwas Bestimmtes tut – beispielsweise einen erprobten Ablaufplan herunterspult, den alle anderen Kollegen auch befolgen und in jedem Stadium prüfen, ob es dem Patienten besser geht (und ihr Vorgehen abändern, falls das nicht der Fall ist).
Aber manchmal läuft es auf eine Einzelperson hinaus, und heute war ich zum ersten Mal an der Reihe. Hugo schien glücklich. Wenigstens reagierte er mir gegenüber in einer maximalen Gefühlsaufwallung: »Nun, du hast für ihn ein paar mehr Wochen auf Erden herausgeschlagen.« Nun komm schon – verschon den Superhelden der Stunde mit solchen Sprüchen.
Montag, 7. Februar 2005
Mein Wechsel in die Chirurgie17 bescherte mir meine allererste Ablederungs-Verletzung.18
Patient WM ist achtzehn und war mit Freunden zum Feiern aus. Nach der Sperrstunde tanzte er auf dem Dach des Unterstands einer Bushaltestelle herum und beschloss schließlich, irgendwann den Abstieg ins Erdgeschoss wie bei der Feuerwehr zu wagen, wobei er einen benachbarten Laternenpfahl als Rutschstange zu Hilfe nahm. Er sprang hinüber zur Laterne und glitt wie ein Koalabär hinab. Unglücklicherweise hatte er die Oberflächenbeschaffenheit des Laternenpfahls falsch eingeschätzt. Es war absolut nicht der glatte Abgang, den er erwartet hatte, sondern ein scheuerndes, schmerzhaftes, raues Abwärts. Er erschien daher in der Notaufnahme mit schweren Abschürfungen an beiden Handflächen und einer kompletten Ablederung seines – Penis.
Ich hatte in meiner kurzen Zeit in der Urologie (und darüber hinaus) eine Menge Penisse zu Gesicht bekommen. Aber dieser war der bei Weitem schlimmste Fall, den ich je sah. Jede Anstecknadel wert, wenn es nur eine Stelle gegeben hätte, sie anzubringen. Ein paar Zentimeter Harnleiter, bedeckt von einer blutig-breiigen Gewebeschicht, das Ganze alles in allem von vielleicht einem halben Zentimeter Durchmesser. Es erinnerte an ein einsames Spaghetti, das in einer Pfütze Tomatensauce am Boden der Schüssel klebte. Es verwundert vielleicht nicht, dass WM außer sich war. Sein Elend wurde nicht besser, als auf seine Frage, ob man seinen Penis denn nicht wieder »neu aufledern« könne, unser Chefarzt Mr. Binns ruhig erklärte, dass »das Leder« recht gleichmäßig über zweieinhalb Meter an einem Laternenpfahl im Westen von London verteilt sei.
Montag, 21. Februar 2005
Entlasse eine Patientin nach einer Laparoskopie19 und schreibe sie zwei Wochen krank. Sie bietet mir einen Zehner, damit ich sie einen Monat krankschreibe. Ich lache, aber sie meint es ernst und erhöht ihr Angebot auf fünfzehn Öcken. Ich rate ihr, ihren Hausarzt aufzusuchen, wenn sie sich nach zwei Wochen noch nicht fit genug fühlt, um zu arbeiten.
Ich muss mich unbedingt schicker anziehen, wenn das das Niveau an Bestechungsgeldern ist, die man mir anbietet. Auf dem Heimweg überlege ich, wie viel sie mir hätte bieten müssen, damit ich ja gesagt hätte. Deprimierenderweise lande ich irgendwo bei 50 Pfund.
Montag, 14. März 2005
Mit H und ein paar Kumpels zum Essen aus – ein Pizzarestaurant mit zu viel Neon, Speisekarten auf Clipboards, einem unnötig komplizierten Bestellsystem und dem nahezu kompletten Fehlen von Servicepersonal. Sie erhalten ein Gerät, das piept und vibriert, wenn Ihre Bestellung fertig ist, woraufhin Sie sich über die kunstvoll schlecht verlegten Fliesen schleppen, um sich die Pizza bei einer komplett uninteressierten Bedienung abzuholen, die dort in dem sicheren Wissen sitzt, dass niemand je verlangen wird, die 12,5 Prozent Servicegebühr von der Rechnung zu tilgen – auch wenn niemand einen bedient.
Das Gerät bimmelt, ich keuche »Oh, mein Gott« und hüpfe reflexhaft auf. Nicht dass ich so wild auf meine »Fiorentina« wäre – es ist nur so, dass das verdammte Ding genau dieselbe Tonhöhe und -frequenz hat wie mein Pager in der Klinik. H fühlt meinen Puls: Er ist bei 140. Die Arbeit hat mich wohl hart an die Grenzen einer posttraumatischen Belastungsstörung manövriert.
Sonntag, 20. März 2005
Das Überbringen schlechter Nachrichten erschöpft sich nicht in »Ich fürchte, es ist Krebs« oder »Wir haben getan, was wir konnten«. Niemand kann Sie darauf vorbereiten, sich mit der Tochter eines Patienten zusammensetzen zu müssen, um zu erklären, dass ihrem alten gebrechlichen Vater in der Nacht etwas einigermaßen Verstörendes zugestoßen ist.
Ich musste ihr schonend beibringen, dass der Patient im Bett neben dem ihres Vaters in der Nacht zuvor extrem aufgewühlt und verwirrt gewesen sei. Dass er ihren Vater für seine Ehefrau gehalten hatte. Dass es, als die Schwestern den Tumult bemerkten und zu Hilfe eilten, bereits zu spät gewesen sei und besagter Patient rittlings auf ihrem Vater gesessen und ihm mitten ins Gesicht ejakuliert hatte.
»Wenigstens ist … nicht mehr passiert«, entgegnete die Tochter mit einer Nonchalance von Weltklasse, die aber auch noch an jeder Situation etwas Positives zu finden vermag.
Montag, 11. April 2005
Im Begriff, einen Zehnjährigen mit geplatztem Blinddarm aus der Notaufnahme in den OP zu rollen. Colin, ein bezaubernder Assistenzarzt, gibt soeben einen Meisterkurs im Umgang mit einer besorgten Mutter. Er erklärt, was im Bauch ihres Sohnes los ist, was wir tun werden, um es in Ordnung zu bringen, wie lange das dauert, wann er wieder nach Hause darf. Ich versuche, mir seine Technik abzuschauen. Es geht darum, ihr genau das richtige Maß an Information zukommen zu lassen – sie unterrichtet zu halten, aber nicht zu überfordern – und alles im richtigen Ton herüberzubringen. Nicht zu viel Fachjargon, aber nie gönnerhaft werden. Vor allem geht es darum, professionell und zugewandt zu bleiben.
Ihr Gesichtsausdruck verliert mit jeder Sekunde an Unbehagen, und ich spüre, wie die Angst gleich einem bösen Geist oder einer Blähung ihren Körper verlässt. Es wird Zeit, den Jungen nach oben zu bringen, also nickt Colin zur Mutter hinüber und fragt: »Rascher Kuss, bevor es auf die Bühne geht?« Sie beugt sich vor und küsst, nicht ihren Sohn, sondern Colin flüchtig auf die Wange. Stolz und Freude ihres Lebens rollen traurig dahin.
Dienstag, 31. Mai 2005
Vor drei Nächten hatte ich MJ aufgenommen, einen obdachlosen Mittfünfziger mit akuter Pankreatitis. Es war das dritte Mal seit meinem Beginn hier, dass wir ihn mit dieser Diagnose dabehielten. Wir verschafften ihm mit Schmerzmitteln Linderung und gaben ihm Infusionen – es ging ihm nicht gut, er fühlte sich elend.
»Wenigstens haben Sie für ein paar Nächte ein warmes Bett«, sagte ich.
»Machen Sie Witze?«, gab er zurück. »Ich werde mir hier irgendwelche verdammten multiresistenten Keime einhandeln.« Es ist ganz schön weit gekommen, wenn die Straßen außerhalb einer Klinik in Bezug auf ihre Sauberkeit einen besseren Ruf genießen als die Flure drinnen.
Ich halte nicht gerne Predigten, aber ich bin Arzt, und zu meiner Berufsbeschreibung gehört, dass ich nicht wollte, dass er starb. Also erinnerte ich ihn daran, dass er wegen seines Alkoholkonsums20 hier sei, und dass ich ihn, wenn ich ihn schon nicht dazu bringen könne, mit dem Saufen aufzuhören (was ich nicht kann), immerhin bitten würde, es zu lassen, bis wir ihn wieder draußen hätten, denn das wäre wirklich eine große Hilfe. Es wäre ein echtes Highlight, wenn er dieses Mal die Finger von den Desinfektionsmittelspendern ließe.
Er fuhr hoch, als hätte ich ihn soeben des Inzests beschuldigt, und erklärte, dass er so etwas nie und nimmer tun würde – sie hätten kürzlich die Rezeptur geändert, und jetzt schmecke das Zeug entsetzlich bitter. Er zog mich näher zu sich heran, um mir ins Ohr zu flüstern, dass man in diesem Krankenhaus am besten dran sei, wenn man an den Desinfektionstüchern lutsche. Dann klopfte er mir verschwörerisch auf den Arm, als wolle er sagen: »Geht auf mich, der Tipp«. Heute hat er sich selbst »nach Hause« entlassen, aber in ein paar Wochen wird er zweifelsohne wieder unser Gast sein.
Traditionell feiere ich das Ende unserer Nachtdienstserie mit meinem Kollegen im zweiten Jahr. Dann gehen wir zu Vingt-Quatre und leisten uns ein feudales Frühstück und eine Flasche Weißwein. Nachtdienste spielen sich so etwas wie in einer anderen Zeitzone als der Rest des Landes ab, daher kann man das Ganze kaum als Muntermacher und Start in den Tag bezeichnen, auch wenn es 9 Uhr morgens ist – es ist praktisch ein Schlaftrunk. In dem Moment, als ich unsere Gläser nachschenke, klopft es ans Fenster. Es ist MJ, der mir mit dröhnendem Lachen seinen ausgesuchtesten »Ich-hab’s-doch-gewusst!«-Blick zuwirft. Ich beschließe, mich nächstes Mal nicht so nahe ans Fenster zu setzen. Oder einfach nur in der Umkleide ein bisschen an den Desinfektionstüchern zu lutschen.
Sonntag, 5. Juni 2005
Es wäre unfair, sämtliche orthopädischen Chirurgen als knochenbrechende Neandertaler zu bezeichnen, allein auf der Basis dessen, dass dies auf 99 Prozent von ihnen zutrifft. Aber jedes Mal, wenn mich mein Pager nächtens auf ihre Station ruft, sinkt mir das Herz in die Hose.
Bis jetzt hatte ich an diesem Wochenende zwei ihrer Patienten zu betreuen. Gestern: einen Mann mit Vorhofflimmern21 im Anschluss an eine Operation wegen einer Oberschenkelhalsfraktur. Ich sehe an seinem Aufnahme-EKG, dass er bei der Aufnahme ebenfalls unter Vorhofflimmern gelitten hat, ein Umstand, der von dem Team, das ihn bei der Einlieferung untersucht hatte, komplett übersehen wurde – obwohl er mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit erklärt hätte, warum er im Kaufhaus überhaupt hingeschlagen war und sich den Bruch zugezogen hatte. Mich packte das Bedürfnis, eine Fortbildung für die Leute auf der Orthopädischen zu veranstalten mit dem Titel: »Manchmal hat es einen Grund, dass Menschen hinfallen.«
Heute wurde ich gebeten, einen Zwanzigjährigen zu untersuchen, dessen Blutwerte auf eine gestörte Nierenfunktion hindeuteten. Beide Arme waren von oben bis unten eingegipst, wie bei einem Bösewicht aus einem Slapstickfilm. Eine Infusion suchte ich vergebens, aber auf seinem Nachttisch stand ein unberührtes Glas Wasser, das zu leeren ihn auch bei allerbestem Willen seit Tagen schlicht die Physik gehindert hatte. Ich sorge dafür, dass der Patient einen Tropf bekommt, obwohl es vielleicht effizienter gewesen wäre, ein paar meiner Kollegen eine Infusion an gesundem Menschenverstand zu verordnen.
Dienstag, 7. Juni 2005
Eingeteilt auf der großen Bühne als Assistent für Not-OPs: Entfernung eines »Fremdkörpers« aus dem Rektum eines Patienten. Weniger als ein Jahr als Arzt im Dienst und bereits der vierte Gegenstand, den ich aus einem Rektum hole – inzwischen immerhin mit einiger Fachkunde.
Mein erster Fall war ein gut aussehender Italiener, dem bei der Einlieferung der Großteil einer Klobürste (mit den Borsten voran) im Anus stak, und der die Klinik mit einem künstlichen Darmausgang verließ. Seine beleibte italienische Mama war dankbar auf eine Weise, der Briten nicht mächtig sind, und überschüttete jedes einzelne Teammitglied, das ihr über den Weg lief, mit überschwänglichem Lob und Dank dafür, das Leben ihres Sohnes gerettet zu haben. Sie nahm auch den nicht minder gut aussehenden jungen Mann, der ihren Sohn ins Krankenhaus begleitet hatte, in den Arm. »Und dem Himmel sei Dank, dass sein Freund Philipp sich im Gästezimmer aufhielt und die Ambulanz rufen konnte!«
Die meisten dieser Patienten leiden unter dem Fallobst-Syndrom – »Ich bin gefallen, Herr Doktor! Ich bin gefallen!« Und die Berichte darüber, wie Dinge dahin gelangt sind, wo sie hingelangt sind, könnten gelegentlich enzyklopädische Bände füllen (wenn ich so darüber nachdenke, ist es lediglich eine Frage der Zeit, wann sich jemand auf das Londoner Gherkin setzt). Aber die Story heute war die erste, die ich einem Patienten erst einmal abgekauft habe. Es handelte sich um einen glaubhaften und schmerzhaften Unfall, an dem ein Sofa und eine Fernbedienung beteiligt waren und die mich zum Allermindesten die Stirn runzeln und denken ließ: »Nun, ich nehme an, so was könnte passieren!« Beim Entfernen der Fernbedienung im OP stellten wir allerdings fest, dass sie mit einem Kondom überzogen war. Vielleicht also doch kein reiner Unfall.
Donnerstag, 16. Juni 2005
Ich musste einem Patienten mitteilen, dass sein MRT erst nächste Woche stattfinden werde, und er drohte, mir beide Beine zu brechen. Mein erster Gedanke war: »Na ja, das wären ein paar Wochen frei.« Ich war so nahe dran, ihm anzubieten, einen Baseballschläger zu besorgen.
Sonntag, 25. Juni 2005
Wurde gerufen, um den Tod22 eines betagten Patienten festzustellen – er war sehr schwer krank und wollte nicht wiederbelebt werden. Sein Ende also alles andere als unerwartet. Die Krankenschwester nimmt mich mit in die Kabine, deutet auf den aschgrauen vormaligen Patienten und stellt mich dessen Ehefrau vor, die juristisch gesehen erst in dem Augenblick zur Witwe wird, wenn ich ihren Mann offiziell für tot erkläre. Die Natur erledigt vielleicht den Hauptteil der Arbeit, aber für das Formular brauchen Sie immer noch mich.
Ich spreche der Frau des Patienten mein Beileid aus und empfehle, dass sie draußen warten möge, während ich ein paar Formalitäten erledige, aber sie entgegnet, sie bleibe lieber. Ich bin mir nicht sicher, warum, ich glaube, sie ist es auch nicht. Vielleicht ist ihr jeder Augenblick mit ihm kostbar, auch wenn er nicht mehr unter uns weilt, oder vielleicht will sie auch sichergehen, dass ich nicht einer von den Ärzten bin, von denen sie in der Boulevardpresse gelesen hat, dass sie den Verblichenen Unaussprechliches antun. Wie dem auch sei, sie lässt sich auf ihrem Platz in der ersten Reihe nieder, ob es mir nun passt oder nicht.
Ich habe schon dreimal eine Leichenschau durchgeführt, aber das ist das erste Mal, dass mir dabei jemand gebannt zuschaut. Ich habe das Gefühl, ich hätte was zum Knabbern hinstellen sollen. Ihr ist eindeutig nicht klar, wie still und schleppend diese Abendvorstellung sein wird – eher Pinter als Priscilla, Königin der Wüste.
Ich bestätige die Identität des Patienten anhand seines Klinikarmbands, schaue, ob noch Atmungsaktivität feststellbar ist, prüfe, ob es noch irgendwelche Reaktionen auf verbale oder physische Reize gibt. Fühle den Puls der Halsschlagader, checke mit einer Taschenlampe, dass die Pupillen starr und erweitert sind. Schaue auf meine Uhr und lausche mit dem Stethoskop zwei Minuten lang auf Herztöne. Dann lausche ich weitere drei Minuten auf Lungengeräusche. Ewig scheint irgendwie ein unangemessenes Wort, aber fünf Minuten sind eine außerordentlich lange Zeit, wenn Sie reglos unter grellem weißem Licht stehen, das Stethoskop auf die Brust eines definitiv toten Mannes gepresst, von dessen trauernder Witwe mit Argusaugen beobachtet. Deshalb versuchen wir, die Angehörigen vorher aus dem Zimmer zu bugsieren.
Mir leuchtet ein, warum wir uns Zeit für dieses Unterfangen nehmen – es ist so eine Art Widerrufsklausel im Pakt mit dem Tod23. Die Fastwitwe fragt immer wieder, ob es mir gut gehe – vielleicht denkt sie, ich sei zu erschüttert, um mich zu regen, oder hätte vergessen, was als Nächstes zu tun sei. Aber jedes Mal, wenn sie etwas sagt, schrecke ich zusammen wie … nun ja, wie ein Arzt, der ein Lebensgeräusch hört, während er sorgsam den Brustkorb eines Leichnams abhört.
Als ich mich wieder eingekriegt habe, überbringe ich ihr die traurige Nachricht und schreibe meinen Befund. Es waren sicher quälende fünf Minuten, aber falls die gesamte Medizin irgendwann untergehen sollte, fehlen mir nur eine Büchse Silbertünche und ein altes Podest für eine Karriere als lebende Statue in Covent Garden.
Dienstag, 5. Juli 2005
Versuche, den Alkoholkonsum einer Siebzigjährigen zu ermitteln, um ihn in den Bericht aufzunehmen. Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass Wein ihr Gift ist.
Ich: »Und wie viel Wein trinken Sie so am Tag, würden Sie sagen?«
Patientin: »An einem guten Tag ungefähr drei Flaschen.«
Ich: »Okay … Und an einem schlechten?«
Patientin: »An einem schlechten schaffe ich nur eine.«
Donnerstag, 7. Juli 2005
Terroranschläge überall in ganz London, die Behörden erklären die Situation zur Großschadenslage, alle Ärzte sollen sich bei den Notfallambulanzen melden.
Meine Aufgabe war es, die chirurgischen Stationen abzuklappern und jeden Patienten zu entlassen, dessen Leib und Leben nicht in unmittelbarer Gefahr waren, um Platz für frisch eingelieferte Bombenopfer zu schaffen. Ich war so etwas wie ein Schneepflug mit Stethoskop – schmiss jeden raus, der bis zur dritten Silbe von »Simulant« kam, ohne das Bewusstsein zu verlieren oder Blut zu husten. Hab Hunderte der bettenblockierenden Nichtsnutze rausgeschmissen.
Mittwoch, 13. Juli 2005
Bei uns wurden keine Verletzten eingeliefert, und ohne Patienten war ich praktisch eine ganze Woche ohne Arbeit.
Samstag, 23. Juli 2005