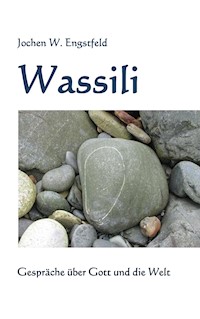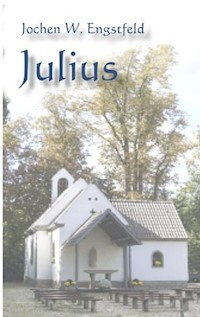
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Ein 17-jähriger, der die Schule schmeißt und von zu Hause abhaut, weil er glaubt, diese Art von Leben nicht mehr ertragen zu können, das scheint auf den ersten Blick eine Allerweltsgeschichte zu sein. Für Julius ist es allerdings der Beginn einer kleinen Odyssee, die sich am Ende als eine intensive Reise zu sich selbst, zu seinen eigenen Gefühlen, herausstellen wird. Gereift und bereichert durch zahlreiche Begegnungen beschließt er nach rund einem halben Jahr wieder heimzukehren, und ihm klingen noch lange die Worte des alten Mönches im Ohr, die wie ein Motto über dieser Zeit stehen: Wer die Reise nach innen wagt und bereit ist, die eigenen Höhen und Tiefen zu erkunden, den eigenen Engeln und Dämonen gegenüberzutreten, der kann sich eine ganz neue, eigene Welt erschaffen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 255
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ein 17-jähriger, der die Schule schmeißt und von zu Hause abhaut, weil er glaubt, diese Art von Leben nicht mehr ertragen zu können, das scheint auf den ersten Blick eine Allerweltsgeschichte zu sein.
Für Julius ist es allerdings der Beginn einer kleinen Odyssee, die sich am Ende als eine intensive Reise zu sich selbst, zu seinen eigenen Gefühlen, herausstellen wird. Gereift und bereichert durch zahlreiche Begegnungen beschließt er nach rund einem halben Jahr wieder heimzukehren, und ihm klingen noch lange die Worte des alten Mönches im Ohr, die wie ein Motto über dieser Zeit stehen:
„Wer die Reise nach innen wagt und bereit ist, die eigenen Höhen und Tiefen zu erkunden, den eigenen Engeln und Dämonen gegenüberzutreten, der kann sich eine ganz neue, eigene Welt erschaffen.“
Einst träumte Dschuang Dschou, daß er ein Schmetterling sei, ein flatternder Schmetterling, der sich wohl und glücklich fühlte und nichts wußte von Dschuang Dschou. Plötzlich wachte er auf: da war er wieder wirklich und wahrhaftig Dschuang Dschou. Nun weiß ich nicht, ob Dschuang Dschou geträumt hat, daß er ein Schmetterling sei, oder ob der Schmetterling geträumt hat, daß er Dschuang Dschou sei, obwohl doch zwischen Dschuang Dschou und dem Schmetterling sicher ein Unterschied ist. So ist es mit der Wandlung der Dinge.
Zhuang Zi: Das wahre Buch vom südlichen Blütenland (aus dem Chinesischen übertragen von Richard Wilhelm)
Inhalt:
Auf der Flucht
Der Professor
Das Kloster
Bruder Ambrosius
Bruder Leo
Der Abt
Judith
Heimwärts
1.
Auf der Flucht
„…hat voraussichtlich zwanzig Minuten Verspätung!“
Julius zuckte zusammen. Die schnarrende Stimme aus dem Bahnhofslautsprecher hatte ihn plötzlich wieder in die Realität zurückgeholt.
„Ich muß eingeschlafen sein“ schoß es ihm durch den Kopf. Verwirrt blickte er sich um. Er saß noch immer auf der Bank neben dem Getränkeautomaten, Gleis 4, und überall standen Menschen herum, die nun ein wenig in Bewegung kamen, ihrem Ärger über die angekündigte Zugverspätung Luft machten oder eifrig das Handy aus der Tasche angelten, um Angehörige oder Arbeitgeber zu informieren, bevor sie, nur wenige Minuten später, wieder in das Schweigen und die Bewegungslosigkeit verfielen, die auch vorher schon das Bild geprägt hatten.
Julius grübelte; er schien etwas in seinem Gedächtnis zu suchen, wie jemand, der gerade aus einem Traum erwacht ist und nun versucht, die sich verflüchtigenden Bilder festzuhalten; er wußte nicht mehr, was es gewesen war, aber es hatte ihn sehr beeindruckt, und schließlich fiel es ihm doch wieder ein: da war diese Frau, diese wunderschöne Frau gewesen. Sie hatte ein schillerndes, violettes Gewand getragen, und ihr Haupt war voller brauner Locken, die sich wie kleine Schlangen hin und her wanden. Ihre Lippen waren voll und in einem kräftigen Rot geschminkt, was ihrem Lächeln etwas Überhebliches und Verwegenes verlieh. Doch was ihn am tiefsten getroffen hatte, war ihr Blick gewesen. Mit ihren blaugrünen Augen hatte sie ihn lange und durchdringend angeschaut, und es war ihm, als würde sie in den tiefsten Grund seiner Seele blicken. Noch nie zuvor war ihm so etwas widerfahren, und er hätte es auch ihr verweigert, wäre nicht in diesem Blick so viel Wissen, vielleicht auch eine Spur von Hochmut und Spott, aber zugleich auch eine Flut von wärmendem Mitgefühl gewesen.
Er spürte seine eigene Sehnsucht, den tiefen Wunsch, gesehen und erkannt zu werden. Unwillkürlich mußte er an seine eigene Mutter denken. Wie oft hatte er sich danach verzehrt, einmal so von ihr angeschaut zu werden, einmal ihre ungeteilte Aufmerksamkeit und Liebe genießen zu können? Er hatte gewartet, gehofft, gebetet, aber alles, was ihm zuteil wurde, war ein flüchtiges Lächeln, ein gelegentlicher kurzer Lichtblitz in einem wolkenverhangenen Alltag voller Sorgen, Enttäuschungen und zerstörter Hoffnungen.
Verwundert rieb er sich die Augen.
„Ich muß wohl geträumt haben“, sagte er sich, während sein Blick suchend über den Bahnsteig wanderte. Weit und breit war keine auch nur annähernd vergleichbare Gestalt zu sehen, und dennoch wehrte sich in ihm ein starkes Gefühl dagegen, dieses Erlebnis einfach als Traum abzutun. Zu tief hatte es ihn berührt; sein Herzschlag war kräftiger als sonst, und ihm war ganz feierlich zumute. Er würde dieses Gesicht so schnell nicht vergessen.
Dieses „Gesicht!“ Wo hatte er das gelesen? Es mußte einer dieser Fantasy-Romane gewesen sein; dort war von einem die Rede, der „Gesichter“ hatte. „Gesichter haben“, ja, das war etwas anderes als träumen, das war eine Begegnung mit einer anderen Realität, jenseits vom Alltag, und doch nicht weniger wirklich. Das war etwas besonderes, geheimnisvolles, nur wenigen Menschen zugänglich – ja, so etwas mußte es wohl gewesen sein.
Inzwischen war der Zug hereingerollt. Julius betrachtete aufmerksam den Schwall von Menschen, der nun aus den Waggons quoll und sich zielstrebig durch die Wartenden zu den Treppen schob, während die anderen ungeduldig und hastig in den Wagen hineindrängten, um nach Möglichkeit noch einen der wenigen Sitzplätze zu ergattern. Kaum einer schaute den anderen an, geschweige denn, daß irgendwelche Worte gewechselt wurden. Der Pfiff des Schaffners ertönte, die Türen schlugen zu, und nur wenige Sekunden später setzte der Zug sich in Bewegung und rollte weiter – dem nächsten Bahnhof entgegen, wo das gleiche Schauspiel sich wiederholen würde.
Nur wenige Minuten später war der Bahnsteig wieder nahezu menschenleer. Julius tastete vorsichtig mit der Hand nach seinem Haarschopf, um sich zu vergewissern, daß die blonden Stoppeln, die er am Morgen mit Gel mühsam aufgerichtet hatte, noch ordentlich in alle Richtungen standen.
Er hatte einen Moment gezögert, ob auch er in diesen Zug steigen sollte, so wie er einige Stunden zuvor auf einem anderen Bahnhof einfach in einen x-beliebige Regionalexpress gestiegen und in diese fremde Stadt gefahren war, hatte sich aber dann anders besonnen.
Der Bahnhof war für ihn ein Symbol, weiter nichts. Hier begannen Reisen, hier war die Pforte zu neuen Erlebnissen, unbekannten Städten und Landschaften, anderen Menschen, anderen Orten, vielleicht sogar zu einem anderen Leben. Das Bewußtsein, daß er selber entscheiden konnte, ob er einsteigen würde oder nicht, schien sein Gefühl von grenzenloser Freiheit noch zu erhöhen, und wenn er von außen auf die getönten Fensterscheiben eines ICE starrte, schien dieser ein regelrechtes Mysterium zu beherbergen.
Doch die Fernzüge, das war nicht seine Welt; zu groß war außerdem das Risiko, in eine Fahrkartenkontrolle zu geraten, und was er jetzt beobachtet hatte, nämlich das Gedränge der Menschen in den abgenutzten Waggons der Regionalbahn, die müden, traurigen und bitteren Gesichter der Pendler, das hatte ihn wieder in die Wirklichkeit zurückgeholt. „Das also ist das Leben, das ich leben soll“, dachte er grimmig, „na, vielen Dank!“
Er wußte jetzt, warum er an diesem Morgen nicht zur Schule gegangen, sondern irgendeinen Zug genommen hatte und in irgendeine fremde Stadt gefahren war, und er war sich in diesem Augenblick auch ganz sicher, daß er nie wieder eine Schule besuchen würde. Das Märchen von den Bremer Stadtmusikanten, welches er als Kind dutzende Male gehört und gelesen hatte, kam ihm in den Sinn:
„Komm mit uns“, zitierte er aus dem Gedächtnis, „etwas Besseres als den Tod findest du allemal!“
Seine Hand tastete in der Hosentasche nach dem Fünfzig-Euro-Schein, den er in der Nacht heimlich aus dem Portemonnaie seiner Mutter gestohlen hatte. Damit würde er erst einmal eine Weile durchkommen. Er wußte zwar noch nicht wie und auch nicht wo, aber er fühlte sich frei und bereit, dem Schicksal zu begegnen.
Während er noch halbverträumt diesen seinen Gedanken nachhing, beschlich ihn plötzlich ein unbehagliches Gefühl. Er schaute sich um und stellte fest, daß die beiden Uniformierten vom Sicherheitsservice auf dem Bahnsteig gegenüber zu ihm herüberschauten. „Lächerliche Figuren“, schoß es ihm durch den Kopf, „Springerstiefel, ein rotes Barett, das aussieht wie schief an den Schädel geklebt, und eine Koppel mit Schlagstock und Reizgas – und schon fühlen sie sich wie die Kings. Und was man nicht im Kopf hat, muß man sich dann in der Mucki-Bude antrainieren.“
Zweifellos fühlte er sich ihnen auf gewisse Weise überlegen, ja, er verachtete sie sogar, aber dennoch wurde ihm, je länger er sie anstarrte, zunehmend mulmig zumute. Was wäre denn, wenn die beiden nun herüberkämen und ihn nach seinem Ausweis fragten? Wenn sie feststellten – und bestimmt hatten sie bereits einen Verdacht – daß er von zu Hause abgehauen ist? Ihn dann der Polizei übergäben, die ihn dann bei Mama ablieferte? Diese würde schreien und jammern, sein Stiefvater würde wüste Drohungen ausstoßen und ihm mit der Faust vor der Nase herumfuchteln, aber vor allem fürchtete er die Blamage in der Schule, denn so etwas spricht sich schneller herum als die letzten Ergebnisse der Fußball-Champions-League: Abgehauen, und sofort von den Bullen wieder einkassiert! Nein, das durfte auf keinen Fall passieren! In einem plötzlichen Impuls stand er auf und beeilte sich, den Bahnhof zu verlassen.
Als er auf den Vorplatz trat, blieb er stehen. Verwirrt mußte er feststellen, daß er offensichtlich der einzige Mensch war, der nicht augenblicklich zielstrebig eine bestimmte Richtung einschlug. Er hatte kein Ziel, das war ganz deutlich. Ein Gefühl von Einsamkeit beschlich ihn, und die Freiheit, die er eben noch so genossen hatte, fing nun an, ihn unter Druck zu setzen: Du mußt jetzt eine Entscheidung treffen! Er fühlte sich hilflos und schwach, und setzte sich erst einmal auf einen der zahlreichen Blumenkübel. Ja, es stimmte, außer einigen verwahrlosten Gestalten, die dort auf dem Boden kauerten, eine Unmenge von leeren und vollen Bierdosen um sich herum aufgereiht hatten und nur damit beschäftigt waren, die Anzahl der leeren Dosen auf Kosten der vollen zu erhöhen, war hier jeder in Bewegung, eilte hierhin oder dorthin.
Plötzlich fiel sein Blick auf einen Mann in einem weißen Trenchcoat, der, eine Aktentasche unter den Arm geklemmt, unentschlossen herumstand und ihn anstarrte. Als ihre Blicke sich begegneten, kam der Mann mit raschen kleinen Schritten auf ihn zu.
„Bist wohl neu hier?“ fragte er unvermittelt. Julius zuckte nur mit den Schultern. Er wollte etwas sagen, aber da er den ganzen Tag noch mit niemandem ein Wort gewechselt hatte, fiel es ihm schwer, aus seinem Schweigen herauszukommen.
„Hab’ dich hier noch nie gesehen“, fuhr der Fremde fort.
Er hatte sich beim Sprechen unaufhörlich nach rechts oder links umgeschaut. Nun richtete er den Blick direkt auf Julius: „Bist ein hübscher Bengel. Du willst doch sicher ein bißchen Geld verdienen, stimmt’s?“ und als dieser ihn nur fragend anschaute, fuhr er fort: „Na, nun mal nicht so schüchtern, wir beide machen das schon, wir werden viel Spaß miteinander haben“ und streckte die Hand nach ihm aus.
„Scheiße,“ fuhr es Julius durch den Kopf, „er hält mich für nen Stricher!“ und wie von einer Tarantel gestochen sprang er auf und rannte davon. „Scheiße, Scheiße“, rief er ein ums andere Mal laut aus, während seine Schritte allmählich langsamer wurden, als müsse er den Ekel, der soeben über ihn gekommen war, regelrecht ausspucken.
„In was für einer Welt lebe ich eigentlich?“ fragte er sich voller Abscheu, und stapfte weiter in die nächstbeste Straße hinein. Das Gefühl, nur noch weg zu wollen, das ihn schon seit Monaten quälte und ihn schließlich veranlaßt hatte, seine Familie ohne ein Wort des Abschieds zu verlassen, steigerte sich bis zur Verzweiflung. Aber wohin? Verwirrt blieb er stehen. Sein Herz schlug ihm bis zum Halse und er atmete schwer. Er spürte, wie seine Knie zitterten, wie bei einem Tier, das nach einer panischen Flucht vor einem unbekannten Feind wieder zur Besinnung kommt. Wo lief er eigentlich hin? Er blickte sich hilfesuchend um, als er auf zwei Jungen aufmerksam wurde, die gemächlich auf ihn zuschlenderten.
Der größere und breitere von ihnen sprach ihn direkt an: „Was geht, Alter? Keinen Plan, oder was?“
Julius hatte inzwischen seine Sprache wiedergefunden, aber mehr als ein „Weiß nicht“ brachte er nicht über die Lippen.
„Guck dir den an, völlig neben der Spur!“ meinte der Große zu seinem Kumpel, der, die Hände in die Taschen vergraben, kaugummikauend danebenstand, und zu Julius gewandt fuhr er fort: „Haste was geraucht oder so? Was ist los mit dir?“
Julius faßte sich ein Herz: „Nix weiter. Bin von zu Hause abgehauen. Das ist los.“
„Eh, cool!“ ließ sich jetzt der Kleinere anerkennend vernehmen, rückte sein Käppi gerade und verfiel wieder in seine angestrengte Kautätigkeit.
„Wir schwänzen gerade Englisch“, erläuterte der Große, merkte aber wohl selbst, daß er damit auf jemanden, der gerade von zu Hause durchgebrannt war und im Begriff stand, der Schule für immer Lebewohl zu sagen, kaum Eindruck machen konnte.
„Weißte was?“ beeilte er sich hinzuzufügen, „Wir haben noch ne halbe Stunde Zeit, und noch die Pause; das reicht voll, um mit der Bahn zum Schrebergarten von meinem Alten zu fahren. Da kannst du erst mal bleiben, und heute abend kommen wir nach und machen zusammen einen drauf!“
Julius schaute ihn mit großen Augen an. Kann ich da auch pennen?“ fragte er besorgt.
„Na klar“, erhielt er zur Antwort, „kein Thema!“
Er atmete tief durch. Ein Stein fiel ihm vom Herzen; es schien sich anscheinend doch nicht alles gegen ihn verschworen zu haben.
„Komm jetzt“, drängte der Kleinere, „wir müssen!“ Gemeinsam hasteten sie los, um die nächste U-Bahn zu erreichen. Wie betäubt heftete sich Julius an ihre Fersen, schaute nicht nach links oder rechts, und erst viel später hatte er sich soweit beruhigt, daß er wieder einige klare Gedanken fassen konnte.
---
Mehrere Stunden saß Julius nun schon alleine in dem kleinen Gartenhaus, traute sich aber nicht hinaus, weil er befürchtete, von irgend jemandem angesprochen zu werden und möglicherweise Verdacht zu erregen. Vermutlich kannte hier jeder jeden, und ein neues Gesicht mußte sofort auffallen. Dieser Garten hier war kein öffentlicher Platz wie der Bahnhof, sondern eher etwas persönliches, privates, und er fühlte sich, als sei er geradezu im Wohnzimmer einer wildfremden Person gelandet. Das lag weniger an der Hütte selber mit ihren akkurat verlegten elektrischen Leitungen und den genau eingepaßten Regalen, sondern vielmehr an dem Garten, den er durch das Fenster eingehend betrachtete. Da gediehen Lauch und Möhren, Salat und Kohl; dazwischen immer wieder Reihen von Schnittblumen, und auf dem Komposthaufen blühte eine Kürbispflanze, die mit ihren weitausladenden Blättern bereits anzukündigen schien, was für gewaltige Früchte sie hervorzubringen gedachte. Es gab ein Drahtspalier, an dem sich Bohnen emporrankten, und unter einem kleinen Dach aus Wellplastik standen die Tomatenpflanzen. Die verbleibenden drei Quadratmeter Rasen teilten sich eine Vogeltränke, ein Rehkitz aus lackiertem Beton und eine kleine, offensichtlich selbst gebaute Windmühle, die aber allen Versuchen des Windes, ihre Flügel in so etwas wie eine Drehbewegung zu versetzen, beharrlich Widerstand leistete.
Vielleicht war es nur die Langeweile, die ihn dazu trieb, sich diesen Platz in allen Einzelheiten anzuschauen. Je mehr Details er jedoch wahrnahm, desto besser konnte er ermessen, wieviel Sorgfalt und Hingabe ein ihm unbekannter Mensch in sein kleines Grundstück investiert hatte. Noch vor wenigen Wochen, ja Tagen, hätte er für diese kleinbürgerliche Idylle nichts als Spott und Verachtung übrig gehabt. Jetzt jedoch, wo er sich selber heimatlos und entwurzelt fühlte, berührten ihn diese Anstrengungen eines Mitgliedes von „Heimaterde 05 e.V.“ auf eine ganz eigenartige Weise, und er spürte sogar eine leise Sehnsucht danach, auch einmal ein kleines Fleckchen Erde sein eigen nennen zu können.
Es war später Nachmittag geworden, als seine beiden Wohltäter wieder auftauchten. Sie hatten ein Mädchen mitgebracht, eine Spindeldürre mit blondem Bürstenhaarschnitt, einer Fülle von verschiedenen Ringen im Ohr und einer Art Hundehalsband um den Hals.
„Hi!“ grüßte der Große, als er hereinkam, „das ist Nadine. Wie heißt du überhaupt?“
„Thorsten“, log Julius, einer plötzlichen Eingebung folgend. Er wollte nicht mit dem Namen angeredet werden, den seine Mutter immer benutzte; er wollte im Grunde gar nicht mehr an zu Hause erinnert werden.
„Okay, Thorsten, ich heiße Oliver und das ist Sebastian“. Dieser nickte nur, ohne dabei sein monotones Kauen zu unterbrechen. Sie setzten sich zusammen an den Tisch, und es entstand ein verlegenes Schweigen. Schließlich ergriff Nadine die Initiative.
„Du bist abgehauen zu Hause?“
„Hmm“ brummte Julius bestätigend.
„Is ja krass!“ fügte sie hinzu, lehnte sich zurück und hatte damit wohl ihr Bedürfnis nach Kommunikation restlos befriedigt, denn sie sprach von nun an kein Wort mehr.
Jetzt war Oliver an der Reihe: „Sach mal, Alter, willste was Gras kaufen? Ich hab noch was da, gutes Zeug!“
„Hab kein Geld“ log Julius, der beschlossen hatte, seine 50 Euro möglichst lange zu strecken und auf keinen Fall für saufen oder kiffen auszugeben.
„Kein Geld“ echote Oliver, „wie bist du denn drauf? Wenn du zuhause abhaust, nimmst du doch Kohle mit, ich faß es nicht!“ Er schlug sich demonstrativ mehrmals mit der flachen Hand gegen die Stirn und wandte sich dann seinem Kumpel Sebastian zu: „Was haben wir uns denn da für einen Vogel eingefangen?“
Julius schluckte. Ihm war die ganze Szene ausgesprochen unangenehm. „Hauptschüler!“ dachte er nur, als ob dieses eine Wort alles erklären würde. Er ging zwar selber zur Hauptschule, zumindest bis gestern noch, aber auch erst, seit er das Gymnasium wegen schlechter Leistungen hatte verlassen müssen. Er hatte, wie er es ausdrückte, „keinen Bock mehr“ gehabt, und sich dann auf der Hauptschule, wo der Umgangston rauher, aber direkt war, wesentlich wohler gefühlt. Er war kein Freund von vielen Worten, und für sein Empfinden wurde am Gymnasium viel zu viel herumgelabert, und von den Hauptschülern ist im übrigen bislang noch keiner auf die Idee gekommen, ihm den Spitznamen „Caesar“ anzuhängen. Dennoch hatte er von Anfang an gespürt, und merkte es auch jetzt wieder, daß er zu diesem Kreis von Menschen nie wirklich dazugehören würde.
Nun machte Sebastian einen Anlauf, das erneute Schweigen zu unterbrechen: „Eh, laß uns doch mal ne Dose Bier aufmachen!“
„Okay!“ Oliver übernahm gleich wieder das Kommando. „Trinkste mit, Alter?“
„Klar“, stimmte Julius zu, der den aufgerissenen Graben nun nicht noch weiter vertiefen wollte, und dem es außerdem mittlerweile ziemlich egal war, womit er seinen leeren Magen füllte.
„Korrekt“, antwortete Oliver, „komm, dann laß uns Dosen stechen“. Julius schaute etwas verdutzt drein, und so erklärte Oliver, während er und Sebastian eine ganze Batterie von Bierdosen aus dem Rucksack angelten: „Ganz einfach. Mit dem Schraubenzieher reinstechen. dann laufen lassen, ohne abzusetzen. Klar?“
Ehe er sich versah, hatte Julius schon die erste Dose in der Hand und mußte sich sehr zusammenreißen, um sich nicht zu verschlucken, während ihm die lauwarme schäumende Flüssigkeit durch die Gurgel strömte. Daß ihm dabei das Bier über Kinn und T-Shirt lief, störte ihn nicht weiter. Er kannte diese Spiele, bei denen sich die anderen großartig fühlen durften, wenn sie jemanden hatten, der sich dümmer anstellte als sie selber waren, und übernahm nun bereitwillig die Rolle des Tolpatsches. Kaum hatte er abgesetzt, als auch schon die nächste Dose angestochen wurde. Er fand dieses Ritual zwar reichlich albern, aber sein Körper war jetzt bereit, jede Form von Nahrung begierig aufzunehmen, und während die Jungen in einer unbeschreiblichen Geschwindigkeit eine Dose nach der anderen leerten, spürte er schon die Wirkung des Alkohols. Er schaute das Mädchen, daß an diesem Exzeß nicht teilnahm, immer wieder an, wollte auch etwas sagen, brachte aber nur noch ein Stammeln hervor. Er nahm ihre spöttischen Blicke nicht war, er hatte nur den Eindruck, daß ihre kurzgeschnittenen blonden Haare sich in braune Locken, nein, Schlangen verwandelten, die sich um ihren Kopf ringelten, und bei dem Versuch aufzustehen lallte er nur noch: „Ist mir schlecht“ und fiel dann der Länge nach zu Boden.
---
Als er aufwachte, lag er noch immer dort. Jemand hatte ihn mit einer alten, verschlissenen Steppdecke zugedeckt. Er schaute auf seine Uhr. Es war halb zehn, und da es draußen taghell war, mußte es wohl vormittag sein. Das bedeutete, wie er sich langsam und Schritt für Schritt klarmachte, daß er den Abend, die Nacht und den Morgen komplett verschlafen hatte. Er versuchte sich aufzurichten. Das war nicht so einfach, denn seine Gelenke und der Rücken schmerzten nach der Nacht auf dem harten Dielenboden, und sein Kopf dröhnte, als würde er gleich platzen. Vor allem aber mußte er dringend pinkeln, und so taumelte er zur Tür. Als er aber registrierte, daß der Garten von allen Seiten einsehbar war, und es sicher keiner von den Mitgliedern des Vereins „Heimaterde 05“ begrüßen würde, wenn er sich in aller Öffentlichkeit seiner Notdurft entledigte, beschloß er, sich erst einmal in die neben der Tür stehende Gießkanne zu erleichtern; anschließend könnte er vielleicht ganz unauffällig die Tomaten damit gießen.
Die Ausführung dieses Plans wurde allerdings jäh unterbrochen, denn gerade, als er mit der frisch gefüllten Gießkanne aus der Türe treten wollte, sah er, daß sich jemand am Gartentor zu schaffen machte. Eine Frau war es, die ein wenig umständlich versuchte, einen Kinderwagen durch das Tor zu bugsieren, und nun auf die Hütte zusteuerte. Beim Näherkommen stellte er fest, daß diese Frau eigentlich eher ein Mädchen war. „Sie muß in meinem Alter sein“, dachte er noch, als sie auch schon über den Wagen gebeugt die Tür aufstieß und sich mit einem lauten „Hi!“ bemerkbar machte. Julius stand etwas fassungslos vor ihr. Er hatte gerade noch die Gießkanne abstellen und seinen Reißverschluß zuziehen können, als sie, den Kinderwagen vor sich herschiebend, einrat und ihn mit einem Redeschwall eindeckte.
„Du bist der Thorsten, nä?“ und während er mit einem verlegenen „Nein, äh, ja doch“ versuchte, in Sekundenschnelle die Ereignisse des Vortages samt seiner angenommenen neuen Identität zu rekonstruieren, schwatzte sie unbekümmert weiter:
„Der Oliver hat mit von dir erzählt. Ist nämlich mein Bruder, weißt du? Der meinte, ich soll doch mal nach dir gucken. Ich glaube, der hatte Angst, daß du ne Alkoholvergiftung hast oder daß du hier alles, na ja, dreckig machst, du weißt schon.“ Sie grinste ihn an: „Hab dir auch was zum Essen mitgebracht, ein paar Dubbels!“ und holte ein umfangreiches Paket unter dem Wagen hervor. Sie riß das Papier auf, und ein Berg von Butterbroten kam zum Vorschein. Julius, der seit vierundzwanzig Stunden nichts mehr gegessen hatte, setzte sich und machte sich ohne Zögern über die Stullen her.
„Ich heiße übrigens Sandra“, stellte sie sich vor, „wenn es dich interessiert. Und das das“ – sie deutete auf den Kinderwagen – „ist die Yvonne“.
„Deine Schwester?“ nuschelte Julius mit vollem Mund.
„Nee, meine Tochter“, korrigierte sie ihn, und als Julius sie fassungslos mit großen Augen und offenem Mund anstarrte, ergänzte sie:
„Ist mir passiert. Wir haben nicht aufgepaßt, der Luigi und ich. Er wollte, daß ich es wegmachen lasse, aber ich nicht. Ich habe mir gedacht, wenn ich so nen Scheiß mache, da kann doch das Kind nichts für. Das muß ich dann auch ausbaden. Und meine Mama hat auch gesagt, jetzt hab ich schon vier Blagen großgekriegt, da kommt es auf eins mehr auch nicht mehr an.“ Sie grinste ihn an, und es war nicht zu übersehen, wie stolz sie war.
„Der Luigi hat dann Schluß gemacht“, fuhr sie fort, der fühlte sich nicht mehr zuständig. Vielleicht, wenn es ein Junge geworden wäre... aber egal!“ und während Julius ein Brot nach dem anderen herunterschlang, plauderte sie unverdrossen weiter.
„Ich hab jetzt noch Mutterschaft, noch drei Wochen, dann geh ich wieder in die Schule. Ich mach die 9 noch mal, für die Quali, ich will auf jeden Fall mittlere Reife und vielleicht auch noch Abi oder Fachabi oder so. Meine Mama paßt auf das Kind auf. Hast du auch Geschwister?“
Diese unvermittelte Frage traf ihn wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Julius bekam einen Hustenanfall; er hatte sich verschluckt und griff nun hastig nach der Wasserflasche, die sie ihm hingestellt hatte. Es dauerte eine Weile, bis er sich wieder beruhigt hatte.
„Eine Schwester“, krächzte er leise und mit rotem Kopf. Tränen standen ihm in den Augen, und er wußte selbst nicht, ob sie ein Produkt des Hustens waren, oder ob sie durch die plötzliche Erinnerung an seine Schwester ausgelöst worden waren. Er fühlte sich beschämt, als er registrierte, daß er seit seinem Aufbruch von zu Hause keinen einzigen Gedanken an seine kleine Schwester verschwendet hatte; aber er wußte auch, warum.
„Sie ist erst zehn“, fügte er leise hinzu.
„Dann wird sie sicher sehr traurig sein, daß du nicht mehr da bist“, erwiderte Sandra, und sprach damit gnadenlos den Gedanken aus, den er gerade zu verdrängen versuchte. Er schluckte betreten. Betroffenheit mischte sich mit Ärger. Das hatte ihm gerade noch gefehlt, daß ihm jetzt jemand Vorhaltungen machte! Er hätte gerne das Thema gewechselt, aber Sandra war nun richtig in Fahrt.
„Ich fand meine großen Brüder immer Klasse“, fuhr sie fort, „ich könnte das gar nicht aushalten, wenn einer von ihnen weggeht“. Sie schaute ihn durchdringend an: „Und deine Mama? Was sagt die dazu?“
„Weiß ich doch nicht“, brummte Julius mürrisch. „Ich hatte die Faxen dicke. Vor allem wegen meinem Stiefvater. Den ganzen Tag das Rumgemeckere; richtig Krach hab‘ ich mit dem Alten gekriegt. Ich laß mir doch von so einem nichts sagen! Und meine Mutter dann immer gleich: ‚Du machst mich noch wahnsinnig!’ - Nee, keinen Bock mehr. Nicht mit mir, nicht mehr. Die sind wahrscheinlich auch froh, daß sie mich los sind.“
Es bereitete ihm Genugtuung, diesen Groll zu spüren und auszudrücken, der ihn ein wenig von den unangenehmeren Gefühlen ablenkte. Finster und mit gerunzelten Augenbrauen schaute er Sandra an, als erwartete er jetzt eine zustimmende Bemerkung. Diese hatte sich jedoch gerade zum Kinderwagen umgewendet und hob vorsichtig ihr kleines Baby heraus. Sie schaute das Kind unverwandt an und erwiderte, ohne Julius eines Blickes zu würdigen:
„So habe ich bis vor kurzem auch noch geredet. Aber dann ist die hier gekommen, und jetzt ist alles ganz anders.“ Sie nickte der Kleinen zu und begann mit ihr in einer Babysprache zu brabbeln, was die Kleine mit einem Strahlen und heftigen Arm- und Beinbewegungen beantwortete. Julius war gerührt, denn er konnte sich noch durchaus erinnern, daß er als sechsjähriger seine kleine Schwester genauso gehalten und mit ihr herumgealbert hatte.
„Schau mal, das ist der Thorsten“, sagte sie zu der Kleinen und drehte sie zu ihm hin.
„Ich heiß’ gar nicht Thorsten“, stammelte er verlegen, denn mit einem Mal konnte er die Anwesenheit einer Lüge in diesem Raum nicht mehr ertragen, „Ich heiße Julius, in Wirklichkeit“.
Sandra nickte nur und lächelte ihn an.
„Weißt du, du kannst mir viel erzählen, und es ist mir auch egal, ob es die Wahrheit ist oder nicht. Aber daß deine Mutter dich einfach gehen läßt oder froh darüber ist, das glaube ich dir nicht“, und ohne auf eine Antwort zu warten, wendete sie sich wieder ihrer Tochter zu und setzte das Gespräch mit der Kleinen fort: “Du kleine Süße Maus du, du Knuddelmaus, jetzt könnte ich dich wieder ohne Ende knuddeln, aber weißt du, manchmal könnt’ ich dir ja schon eine klatschen, wenn du so gar nicht aufhören willst zu schreien, und wenn du größer wirst, kriegst du auch bestimmt mal auf den Popo...“
Sie drehte sich abrupt wieder zu Julius. „Und wenn sie mal richtig groß ist, und richtig Ärger macht, zum Beispiel auf Drogen geht oder mit irgendwelchen Nazis herummacht, oder was weiß ich – sie wird trotzdem immer meine Tochter bleiben, das schwör’ ich!“
Ihre Augen blitzten, während sie ihn ansah: „Du kannst dir das nämlich einfach gar nicht vorstellen, wie das ist, ein Kind in deinem Bauch zu haben, monatelang, unter dem Herzen, und dann bringst du es zur Welt, und es lebt.“ sie senkte ihre Stimme: „Ich konnt’ mir das auch nicht vorstellen, bis ich’s selbst erlebt habe. Ich sehe meine Mama jetzt mit ganz anderen Augen.“ und als Julius beharrlich schwieg, fuhr sie fort: “Und du? Was ist mit dir? Du siehst doch deine Mam gar nicht, du willst sie auch gar nicht sehen, du hast doch nur noch Augen für dich selbst!“
Sie hielt plötzlich betroffen inne. War sie jetzt zu weit gegangen? Sie hatte sich selbst noch nie so reden gehört; es war ihr, als hätte jemand anderes durch sie gesprochen. Und doch fühlte sie, daß sie im Recht war und daß es ihrem Gegenüber einmal so deutlich gesagt werden mußte.
Julius fühlte sich unbehaglich und fing an, zielstrebig die Brotkrümel auf dem Tisch einzusammeln, zu Kugeln zu kneten und in den Mund zu stecken.
„Blöde Kuh“, dachte er verärgert, „was nimmt die sich eigentlich raus? Nur weil sie ein Kind hat, fängt sie an, altklug wie alle Erwachsenen daherzureden!“ Er schwieg beharrlich, hin- und hergerissen zwischen seinem Trotz und einem Gefühl von Bewunderung, das sich seiner bemächtigte, wenn er zusah, wie selbstverständlich Sandra mit dem kleinen Lebewesen auf ihrem Schoß verkehrte. Sie schauten einander betroffen an, und das junge Mädchen mußte plötzlich lachen.
„Entschuldige“, sagte sie versöhnlich, „manchmal geht es mit mir durch. Aber wenn ich immer so sehe, wie meine Brüder sich gegenüber der Mama verhalten, dann denke ich oft, ihr Jungs, egal wie alt, habt doch eigentlich überhaupt keine Ahnung“.
Julius mußte ebenfalls lächeln, und ihm wurde ganz merkwürdig zumute. Er machte sich normalerweise nicht viel aus Mädchen, und diese Sandra war auch gar nicht sein Typ, und doch war sie ihm auf irgendeine Weise sehr nahe. Sie hatte, ungeachtet ihres geringen Alters, zweifellos etwas sehr Reifes, als wäre sie soeben eingeweiht worden in den Kreis der weisen Frauen, der Mütter; und er fragte sich, ob sie, wenn sie noch kein eigenes Kind hätte, ihn wohl ebenfalls so fürsorglich mit Broten und Wasser versorgt hätte. Ein wenig peinlich war ihm diese ganze Szene schon gewesen, aber gleichzeitig spürte er auch, daß er diese fürsorgliche Zuwendung genießen konnte und wollte.
Seine Gedankengänge wurden allerdings, bevor er sie weiterspinnen konnte, jäh unterbrochen. als plötzlich die Tür aufgerissen wurde und Oliver hereinplatzte.
„Du bist ja immer noch hier“, ächzte er, „du mußt jetzt weg! Mein Alter kommt gleich. Wenn der dich hier sieht, dann...“
Er verstummte, als er den Blick seiner Schwester bemerkte, und statt weiterer Ausführungen, was dann alles passieren würde, ließ er nur ein „Stimmt doch?“ folgen.
Julius war bereits aufgesprungen und schaute unschlüssig zwischen den beiden hin und her.
„Er hat recht“, bestätigte Sandra nun, „der Papa versteht keinen Spaß, wenn es um sein Gartenhaus geht.“ Sie nahm das Kind auf den Arm und schob den leeren Wagen hinaus. „Tschau, Torsten!“ rief sie ihm augenzwinkernd zu, „war nett, dich kennenzulernen, ehrlich!“ und schon war sie nach draußen verschwunden.
Wieder einmal war alles für Julius viel zu schnell gegangen, als daß er noch etwas hätte sagen können. Er spürte, daß er sie, wäre Oliver nicht dabeigewesen, gerne in den Arm genommen und ihr einen Kuß gegeben hätte; und er war sich sicher, daß es ihr genauso ging.
Während er noch gedankenverloren hinter ihr herschaute, durchzuckte ihn plötzlich ein eisiger Schreck: Er hatte gerade die Hände in die Hosentaschen gesteckt, als ihm auf einmal klar wurde, daß sein Geld verschwunden war.
„Scheiße!“ entfuhr es ihm.
„Was ist los?“ fragte Oliver, der gerade die Decke zusammengefaltet und im Regal verstaut hatte.
„Mein Geld!“ –
„Was für Geld? Ich denke, du hast kein Geld?“ hakte Oliver nach.
„Meine 50 Euro! Gestern hatte ich noch 50 Euro!“ entgegnete Julius entsetzt.