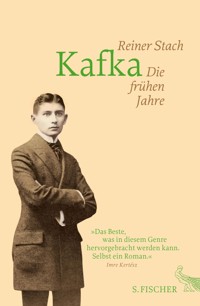
12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
DER ABSCHLUSS DER GROSSEN KAFKA-BIOGRAPHIE »Das Beste, was in diesem Genre hervorgebracht werden kann. Selbst ein Roman.« Imre Kertész Nach den fulminant gefeierten ersten zwei Bänden seiner Kafka-Biographie schließt Reiner Stach sein großes Werk mit Kafkas Kindheit und Jugend, Studium und ersten Berufsjahren ab. Die Entfaltung von Kafkas Sprachtalent, seine Bildungserlebnisse, die Reifung seiner Sexualität und nicht zuletzt die Auseinandersetzung mit neuen Technologien und Medien sind die entscheidenden Wegmarken. Reiner Stachs Kafka-Biographie genießt schon jetzt den Ruf eines internationalen Standardwerks, das die Möglichkeiten der literarischen Biographie neu ausgelotet hat. Erneut bietet Reiner Stach ein erzählerisch dichtes und farbiges Panorama der Zeit und zugleich die einfühlsame Studie eines außergewöhnlichen Menschen. Das Gesamtwerk: Kafka. Die frühen Jahre (1883 - 1910) Kafka. Die Jahre der Entscheidung (1910 - 1915) Kafka. Die Jahre der Erkenntnis (1916 - 1924)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 989
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Dr. Reiner Stach
Kafka
Die frühen Jahre
Über dieses Buch
Nach den fulminant gefeierten ersten zwei Bänden seiner Kafka-Biographie schließt Reiner Stach sein großes Werk mit Kafkas Kindheit und Jugend, Studium und ersten Berufsjahren ab. Die Entfaltung von Kafkas Sprachtalent, seine Bildungserlebnisse, die Reifung seiner Sexualität und nicht zuletzt die Auseinandersetzung mit neuen Technologien und Medien sind die entscheidenden Wegmarken. Reiner Stachs Kafka-Biographie genießt schon jetzt den Ruf eines internationalen Standardwerks, das die Möglichkeiten der literarischen Biographie neu ausgelotet hat. Erneut bietet Reiner Stach ein erzählerisch dichtes und farbiges Panorama der Zeit und zugleich die einfühlsame Studie eines außergewöhnlichen Menschen.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
© 2014 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: hißmann, heilmann, hamburg
Coverabbildung: Atelier Jacobi, Schiller Nationalmuseum, Marbach
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-403158-3
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Motto
Nichts los in Prag
Beginn der Vorstellung
Riesenmenschen: Die Kafkas aus Wosek
Frau Löwy
Verlustgeschäfte
Gedanken an Freud
Kafka Franz, Vorzugsschüler
Stadt unter Strom
Elli, Valli, Ottla
Latein, Böhmisch, Mathematik und andere Herzensangelegenheiten
Jüdische Lektionen
Unschuld und Frechheit
Der Weg ins Freie
Zur Hölle mit der Germanistik
Freund Max
Verführungen
Informierte Kreise: Utitz, Weltsch, Fanta, Bergmann
Autonomie und Heilung
Die innere Landschaft: Beschreibung eines Kampfes
Promovierter Jurist sucht Beschäftigung
Bei den Dirnen
Cafés, Geishas, Kunst und Kino
Der formidable Hilfsbeamte
Die geheime Dichterschule
Landung in Brescia
Im Herzen des Westens
Ideen und Gespenster: Buber, Steiner, Einstein
Literatur und Fremdenverkehr
Anhang
Bildteil
Bildnachweis
Dank
Siglen und Zitierweise
Literaturverzeichnis
a. Kafka
b. Literatur und Literaturwissenschaft
c. Philosophie. Soziologie. Psychologie. Pädagogik. Naturwissenschaften
d. Judentum
Für Ursula
Nichts los in Prag
Think you heard this all before,
Now you’re gonna hear some more.
Devo, GOING UNDER
3. Juli 1883, ein freundlicher, klarer Sommertag, nur schwach streicht die Luft durch die engen Gassen der Prager Altstadt, die sich schon um die Mittagszeit bis auf 30 Grad Celsius erhitzen. Zum Glück ist es keine schwüle Wärme; die wenigen Wolken, die am Nachmittag heraufziehen, sind harmlos, und so freuen sich Tausende von Pragern auf einen lauen Abend in einem der zahllosen Gartenlokale, bei Pilsener, Wein und Blasmusik. Heute ist Dienstag, da gibt es besonders viele ›Militär-Concerte‹, und im weitläufigen Biergarten auf der Sophieninsel geht der Rummel sogar um 16 Uhr schon los. Das ist die Zeit der Touristen, der Studenten und der kleinbürgerlichen Privatiers, denn gearbeitet wird natürlich noch einige Stunden länger, und für die wenig Beneidenswerten, die ihr Brot in irgendeinem Ladenkontor verdienen, spielt die Musik leider erst nach Sonnenuntergang. Selbst der Besuch einer Theatervorstellung hängt dann bisweilen von der Gutmütigkeit des Prinzipals ab. Für die Tschechen gibt es heute FEDORA, das neueste Melodram des französischen Erfolgsautors Victorien Sardou; die Deutschen hingegen dürfen sich im Volkstheater mit Nestroy amüsieren: EINEN JUX WILL ER SICH MACHEN. Und wem auch das zu anspruchsvoll ist, dem bleibt der Gang in ›Wanda’s Singspiel-Halle‹, wo Fräulein Mirzl Lehner, genannt »die fesche Wienerin«, samt weiteren, »neu engagierten Kunstkräften« ihr »amusantes und äußerst anständiges Programm« präsentiert. Ein überschaubares Angebot für fast 160000 Stadtbewohner.
Prag im Sommer, Prag im Frieden, die Stunden verstreichen, die Börsenkurse pendeln schwach (aber das tun sie seit zehn Jahren schon), das Leben scheint wie ermattet, selbst die üblichen, von den Lesern des Prager Tagblatt und der Bohemia begierig aufgesogenen Meldungen über Hochstapler, Selbstmörderinnen und durchgebrannte Kassierer bleiben aus. In der ›Civil-Schwimmschule‹, dem öffentlichen Flussbad, fällt ein Kleinkind in die Moldau und wird von einem 13-jährigen Jungen gerettet. Das ist schon das einzige Unglück an diesem 3. Juli, das berichtenswert ist. Abgesehen von den natürlichen Todesfällen, die in so winziger Schrift vermeldet werden, dass man sie suchen muss. In der Hibernergasse stirbt ein 18 Tage alter, schwächlicher Säugling namens Augustin, und eine zweijährige Amalia stirbt an Tuberkulose. Aber wer will das wissen.
Und dennoch wird dieser Tag in die Annalen der Stadt Prag eingehen, aus zwei Gründen sogar, einem öffentlich sichtbaren und einem vorläufig verborgenen. Ein politischer und mentaler Schock trifft heute die Stadt, noch sind erst wenige informiert, doch in den Kaffeehäusern spricht sich das Unfassbare schnell herum, noch ehe die Presse reagieren kann. Soeben finden nämlich Wahlen zum böhmischen Landtag statt, der Kaiser selbst hat sie angeordnet, und zwar – das ist das Fatale – mit völlig neuen Konditionen. Wahlberechtigt sind, seit es Parlamente gibt, nur Männer, die einen Mindestbetrag an jährlichen Steuern zahlen, und dieses Limit hat die österreichische Regierung unversehens halbiert – mit kaiserlicher Billigung und zum Entsetzen eines kleinen, aber maßgeblichen Teils der Bevölkerung. Denn welche Folgen diese Entscheidung haben würde, das konnten sich auch politisch Ahnungslose an den Fingern abzählen: mehr Wahlberechtigte, also mehr Tschechen. Und das ist heute prompt eingetroffen, die Tschechen haben die Deutschen im Landtag überflügelt, sie besitzen eine solide Mehrheit, zum ersten Mal und sehr wahrscheinlich für immer. Denn wer würde es je wagen, das neue Wahlrecht anzutasten? Auch die Großgrundbesitzer votieren ja nun überwiegend tschechisch, die Handelskammern ebenso, und etliche wohlhabende Juden ziehen mit. Die Deutschen im Geschäftsviertel um den Altstädter Ring greifen sich an den Kopf: Selbst ihre unmittelbaren Nachbarn, die Bewohner der ›Josefstadt‹, des alten Prager Ghettos, haben mehrheitlich tschechisch gewählt, und wie zum Hohn sickert die Pointe durch, dass es wohl die jüdischen Metzger waren, die hier den Ausschlag gaben, Leute also, die zuvor noch niemals an die Wahlurne durften …
Natürlich ist es nur eine Minderheit der Prager Bevölkerung, die sich für die Arbeit des böhmischen Landtags interessiert, und selbst im gebildeten Bürgertum beider Sprachen sind es nur die zähesten Zeitungsleser, die einigermaßen Bescheid darüber wissen, welche Kompetenzen dieser Landtag eigentlich hat und welchen Einfluss auf den deutsch-tschechischen Alltag. Aber es ist ein symbolischer Sieg der Tschechen, der bei weitem wichtigste bisher, das verstehen alle, und darum ist er ›historisch‹. Auch die Verlierer sehen das so. Ihr Ton ist gedämpft, die deutschsprachige Presse hält sich zurück, man will die Tschechen, mit denen man doch in allen Stadtteilen auf Tuchfühlung zusammenlebt, nicht reizen und die eigenen Abonnenten nicht aufwiegeln. Nur die Neue Freie Presse aus Wien redet Tacheles, sie kann es sich leisten, die Leib- und Magenpostille der Liberalen, die selbstredend auch in Prag überall ausliegt. Hier erfahren die böhmischen Bürger, dass sie mit ihrem dummen Wahlverhalten das Ende des Abendlandes riskieren: »Sollte es wirklich dahin kommen, dass auch Prag rettungslos untergeht in der slavischen Fluth?« Nein und abermals nein. »Aus der Landstube mögen die deutschen Abgeordneten der Hauptstadt verschwinden, aber das Volk, welches die Straßen und Häuser füllt, wird bleiben, bis endlich der Tag kommt, welcher der slavischen Gegen-Reformation ein Ende macht, und Prag wieder wird, was es war, ein Mittelpunkt menschlicher, deutscher Cultur.«[1]
Das ist starker Tobak, zu stark selbst für die staatliche Zensur in Wien, die das Blatt wenige Tage später konfiszieren wird. Doch der aggressive Tonfall, der chauvinistische Aufruhr verraten, wie gut man die epochale Bedeutung dieses Tages verstanden hat. Es ist immer eine Elite gewesen, welche die Macht in ihren Händen bündelte, doch von nun an wird die Mehrheit herrschen, legitimiert durch die bloße Proportion, die in Prag – daran ist nicht zu rütteln – nun einmal 4:1 zugunsten der Tschechen lautet. Was, wenn sich dieses Mehrheitsprinzip in der gesamten Monarchie durchsetzte? Dann wird man den Böhmen vorhalten, dass sie das schwächste Glied in der Kette waren und dass in ihrer Hauptstadt, exakt am 3. Juli 1883, die Kette gerissen ist.
Nicht alle Prager registrieren den Erdrutsch im böhmischen Landtag, bei weitem nicht. Das wirkliche Leben findet woanders statt, und wem ein kleines Kind namens Augustin oder Amalia stirbt, für den ist alles Politische ausgelöscht für lange Zeit. Ebenso aber auch denen, die ein Neugeborenes begrüßen. Auch sie überschreiten eine Epochenschwelle, erleben den Anbruch einer neuen Zeit, hinter die es kein Zurück mehr gibt, und vor der warmen körperlichen Präsenz versinkt die übrige Welt.
Ebendies ereignet sich heute in einem Haus unmittelbar neben der St.-Niklas-Kirche, Ecke Maiselgasse/Karpfengasse, wo das seit erst zehn Monaten verheiratete jüdische Ehepaar Kafka lebt. Keine besonders gute Adresse, das Haus hat schon bessere Tage gesehen, einst war dies die Prälatur des berühmten Klosters Strachov, aber abgesehen von der Barockfassade ist von der Pracht nicht viel übrig. Seit langem dient das Gebäude als gewöhnliches Wohnhaus, die Nachbarschaft ist alles andere als repräsentativ und zum Anknüpfen neuer Kontakte nur wenig geeignet: auf der einen Seite die Kirche, in der seit einiger Zeit die Russisch-Orthodoxen ihre düsteren Gottesdienste halten, auf der anderen Seite mehrere verdächtige Spelunken und sogar Bordelle, die beinahe schon zur Josefstadt gehören, ein verwahrloster Kiez, dessen Abriss, so hört man, beschlossene Sache ist.
Die Kafkas werden hier nicht lange bleiben, das versteht sich, aber vorläufig müssen sie sparen. Denn ihr ganzes Vermögen – das heißt vor allem: die Mitgift von Frau Julie – haben sie in ein neu gegründetes Geschäft gesteckt, einen Handel mit Zwirn und Baumwolle, der nur wenige Schritte entfernt an der Nordseite des Altstädter Rings auf Kunden wartet. Alleiniger Inhaber ist der dreißigjährige Hermann, doch seine Frau, drei Jahre jünger, muss hier ganztags mitarbeiten, sonst wird das Geschäft nicht überleben. Den beiden bleibt wenig Zeit, selbst die Flitterwochen haben sie sich versagt, um in Prag nichts zu versäumen, und so ist auch eine Schwangerschaft nicht eben förderlich für den kaum etablierten Laden, ganz zu schweigen von Amme und Kindermädchen, die man sich von nun an wird leisten müssen.
Aber es ist ein Junge, und in einer patriarchal organisierten Welt – eine andere kennen Hermann und Julie nicht – bedeutet das männliche Kind den Garanten der Zukunft. Er ist das nächste Glied der Generationenkette, die den Einzelnen hält und führt und die seinem Tun erst überzeitlichen Sinn verleiht. Bisher wussten die Kafkas nur, dass sie sozial nach oben wollen, jetzt fühlen sie auch, dass dieses Ziel ihre eigene irdische Existenz überschreitet und damit unanfechtbar wird. Das Neugeborene ist ›Erbe‹, noch ehe ihm die ersten Schritte gelingen, und dies keineswegs nur in den Augen der Eltern. Auch gegenüber den Verwandten, den Angestellten und Kunden hat sich die soziale Position der Kafkas von einem auf den anderen Tag verändert, es ist wie eine Beförderung, und mehr als das, denn der neue Status ist unkündbar – es sei denn durch den Tod. Doch daran will jetzt niemand denken, der Kleine ist »ein zartes, aber gesundes Kind«, wie die Mutter sehr viel später notieren wird,[2] er wird überleben, er wird der Erbe sein, für den wir uns opfern und um dessentwillen wir jetzt dazugehören zum großen Ganzen. Und darum ist es nur recht und billig, wenn er den Namen unseres Kaisers trägt. Ja, Franz soll er heißen.
Dass es ganz und gar anders gekommen ist, als die Kafkas es sich erträumten, weiß hundert Jahre später die Welt. An ihrer ersten gemeinsamen Wohnstätte wird eine Gedenktafel hängen, die nicht auf einen erfolgreichen Kaufmann verweist, sondern auf einen Schriftsteller. Die lineare Aufeinanderfolge der Generationen, welche die Familie immer aufs Neue verjüngt und in der Welt organisch verankert, wird sich als ebenso verletzlich und vergänglich zeigen wie die isolierte Existenz des Einzelnen. Hunderttausende solcher Linien werden abgebrochen, sogar gewaltsam ausgelöscht noch zu Lebzeiten von Franz Kafkas Eltern. Jenes Datum aber, der 3. Juli 1883, der für so viele Prager der Tag einer unwiderruflichen Ernüchterung und für die Kafkas der Tag des Stolzes und der Freude war – jenes Datum wird eine neue, andere Bedeutung gewinnen.
Auch Kafkas Namenspatron, der 52 Jahre alte Kaiser Franz Joseph I., verbringt diesen Tag in aufgeräumter Stimmung. Er weilt in Graz und absolviert das gewohnte Besuchsprogramm: Messe im Dom, Eröffnung einer landeskundlichen Ausstellung, Besichtigung der Feuerwehr und des Militärspitals, Empfang von Deputationen und Nobilitäten, lange Diners. Dazwischen die Lektüre einlaufender Depeschen, darunter auch einige aus Prag, wo die Tschechen – wie vorhergesehen – endlich ihren Willen bekommen haben. Aber dieses Ärgernis wird sogleich überdeckt von den Hochrufen der vollzählig aufmarschierten Grazer Bevölkerung und von erfreulicheren Pflichten, die den Kaiser wieder aufheitern. Zum Beispiel bei den steirischen Schützen, den Treuesten der Treuen, in der flaggen- und blumengeschmückten ›Landesschießstätte‹, die er nicht zum ersten Mal besucht. Sie sind etwas übereifrig, diese Schützen, haben mit ihren ewigen Salutschüssen sogar die Pferde der kaiserlichen Karosse scheu gemacht, so dass Franz Joseph ein Machtwort sprechen muss. Doch der Empfang am Schießstand ist überwältigend, trachtengeschmückte Frauen sind auch dabei, und fesche Madeln überreichen Blumensträuße. Die Schützen aber möchten von ihrem höchsten Herrn keineswegs nur huldvolle Worte hören, nein, er soll und darf heute Hand anlegen, der Kaiser selbst soll sich am Schießstand versuchen und das allgemeine Festschießen eröffnen. Zeremoniell führt man ihn zu den vorbereiteten Büchsen, die Zuschauer warten atemlos. Zweimal visiert er die Laufende Scheibe an, einmal trifft er die Ringe, es ist eine ›Eins‹. Böllerschüsse ertönen, damit die ganze Stadt es erfährt, dann der Jubel einer tausendköpfigen Menge, endloser Jubel.
Beginn der Vorstellung
Gott handelt immer en gros.
Kierkegaard, STADIEN AUF DES LEBENS WEG
Das alte Zentrum der Stadt Prag ist eine Bühne: ein weitläufiger, beinahe einen Hektar beanspruchender, von mehreren Seiten zugänglicher Schauplatz, doch wohlgegliedert und übersichtlich genug, um das Gefühl eines abgegrenzten und symbolisch erhöhten Raums zu vermitteln. Altstädter Ring heißt dieses Areal, ein Brennpunkt, an dem die sozialen Energien einer ganzen Region sich verdichten.
Schon in der frühen Neuzeit galt es als bürgerliches Privileg, am ›Ring‹ in der ersten Reihe zu wohnen. Denn während Prag im Weltgeschehen nicht mehr mitzureden hatte und ganz Böhmen zum Spielball fremder Dynastien wurde, blieb der heimische Ring die große Plattform der sozialen Repräsentation. Dort wurde Markt gehalten, dort wurden unter freiem Himmel Geschäfte abgemacht und politische Händel ausgetragen, dort sah man und wurde gesehen, und da man nicht selten auch den Klang fremder Dialekte und Sprachen zu hören bekam, war für ein Ferment von Weltläufigkeit gesorgt, das den tatsächlichen Bedeutungsverlust der Stadt überdeckte. Die Prager wussten, dass ihr von prächtigen Bauten gesäumter Ring einen Ruf hatte in Europa, und altvertraut war ihnen der Anblick von Reisenden, die von weither kamen, nur um das sinnverwirrende Wunderwerk der riesigen astronomischen Uhr am Altstädter Rathaus zu betrachten. »Die alte Stadt Prag«, so erklärte ein Reiseführer, der mitten im Dreißigjährigen Krieg gedruckt wurde und der seine Leser schon im ersten Satz an den entscheidenden Punkt lenkte, »liegt auf der rechten Seite der Molda, in der Ebene des Thals, darinn viel herrliche Gebäu zu sehen seyn, unter welchen sonderlich das Rathhaus ist, so einen hohen Thurm hat, daran ein sehr künstliches Uhrwerk, desgleichen, so viel die Kunst anbelanget, in der ganzen Welt kaum solle zu finden seyn …«[1] Als diese Zeilen erschienen, war die Uhr schon mehr als zweihundert Jahre alt, und in jener unvordenklichen Zeit, da ihre meterlangen Zeiger sich in Bewegung setzten, war Prag der Sitz eines Kaisers gewesen.
Nicht selten in der Geschichte Prags diente der Altstädter Ring auch als soziale Bühne im buchstäblichen Sinn. Prozessionen überquerten den Platz, politische Ansprachen wurden gehalten, darunter Huldigungen und Hasstiraden. Denkmäler wurden auf dem Ring errichtet, es wurde demonstriert, proklamiert und akklamiert. Wer die Macht übernahm in Prag, präsentierte sich auf dem Ring – das kam selbst im 20. Jahrhundert noch vor, als die vitale Flaniermeile des Wenzelsplatzes längst das alte Zentrum überstrahlte und zur historischen Sehenswürdigkeit herabgestuft hatte. So wurde der Beginn der kommunistischen Alleinherrschaft im Februar 1948 in den Kulissen des Altstädter Rings zelebriert – ein freilich nicht sehr glücklicher Einfall, wie sich bald herausstellte. Denn damit berührten die Putschisten schmerzhaft den Nerv der kollektiven Erinnerung, in die sich eine weitaus brutalere Inszenierung eingegraben hatte, eine Inszenierung, die mehr als drei Jahrhunderte zurücklag und über die trotzdem jeder tschechische Gymnasiast genau Bescheid wusste. Die Installation eines neuen Regimes, vollzogen auf dem Altstädter Ring, mit öffentlicher Folter, mit Strick und Henkersschwert.
In der Nacht zum 21. Juni 1621 herrschte in der Prager Altstadt eine von Angst erfüllte Spannung. Kaum jemand war imstande, sich dem Schlaf zu überlassen, man flüsterte und betete miteinander, überprüfte die Riegel an den Türen und lauschte angestrengt nach draußen, wo martialische Geräusche die Schrecken des folgenden Tages ankündigten. Die neuen Herren im Dienste der Habsburger Dynastie hatten eine Ausgangssperre verhängt, Hunderte von Bewaffneten mit Fackeln und klirrendem Eisen durchstreiften die Straßen, um jeden Bürger, dessen sie habhaft wurden, auf der Stelle niederzumachen. Auch der Altstädter Ring war von zahlreichen Fackeln erleuchtet, und die Anwohner erzitterten hier stundenlang unter den Hammerschlägen der Zimmerleute, die unmittelbar am Rathaus eine zweieinhalb Meter hohe und etwa 300 Quadratmeter umfassende Bühne errichteten. ›Blutgerüst‹ nannte man diese Art Bühne, und welche Vorstellung hier in wenigen Stunden gegeben werden sollte, war den entsetzten Bewohnern Prags bereits nachdrücklich kundgetan worden.
Sie hatten einen Aufstand riskiert, und sie hatten verloren. Es war eine zugleich religiöse und politische Erhebung gewesen, mit der sie sich der zunehmenden Dominanz der katholischen Habsburger zu entwinden suchten, eine Erhebung der böhmischen Stände gegen den sich formierenden Absolutismus. Wie weit dieser Widerstand gehen durfte, darüber waren sich Adel, protestantische Geistlichkeit und Bürgertum durchaus nicht einig, doch im Mai 1618 entschlossen sich die Prager Anführer, alle Brücken hinter sich abzubrechen und den offenen Krieg zu provozieren: Sie warfen auf der Prager Burg zwei katholische Statthalter und deren Schreiber kurzerhand aus dem Fenster und schickten ihnen noch einige Kugeln nach. Der keineswegs spontane, sondern wohlinszenierte Gewaltakt wurde in ganz Europa als lokale Posse belacht (zumal die drei Opfer mit Verletzungen davonkamen), doch im folgenden Jahr wurde deutlich, dass es den böhmischen Ständen und ihren Verbündeten in Mähren und Schlesien ernst war und dass sie an den Fundamenten des europäischen Machtgefüges rüttelten: Sie setzten den Habsburger Ferdinand II. als König von Böhmen ab (nur wenige Tage bevor er zum Kaiser gewählt wurde) und hoben stattdessen einen pfälzischen Kurfürsten auf den Prager Thron, einen überzeugten Calvinisten und selbsternannten »Kreuzritter des Protestantismus«.
Die ungemein verworrenen diplomatischen und militärischen Aktionen, die nun folgten, wurden populärwissenschaftlich vielfach aufbereitet und gehören heute zum Treibsand historischen Spezialwissens. In öffentlicher Erinnerung blieb jedoch, dass der Fenstersturz von Prag (die Juristen sprachen vornehm von Defenestration) zum Auslöser eines jahrzehntelangen Flächenbrands werden sollte, der weite Teile Mitteleuropas verwüstete und entvölkerte, und in die kollektive Erinnerung förmlich eingraviert blieb das sensationelle Debakel, das die Aufständischen im November 1620 im entscheidenden showdown erlitten. Nicht einmal zwei Stunden dauerte die ›Schlacht am Weißen Berg‹, auf einem Plateau nur wenige Kilometer vom Zentrum Prags, und sie endete mit einer vernichtenden Niederlage der schlecht besoldeten Truppen der böhmischen Rebellen, mit der überstürzten Flucht des calvinistischen Ersatz-Königs Friedrich von der Pfalz (der unter dem Spottnamen ›Winterkönig‹ in die Prager Historie einging) und mit dem totalen Triumph der ›Katholischen Liga‹. Die Schlacht am Weißen Berg war – nach tschechischer Überlieferung – der Beginn einer drei Jahrhunderte währenden Zeit der Finsternis (temno), des katholischen Zeitalters der Habsburger also, die sich in Böhmen nicht nur die absolute Herrschaft sicherten, sondern auch sogleich ein blutiges Exempel statuierten.
Tatsächlich war es weniger die militärische Niederlage, die später als nationale Wunde interpretiert wurde und die in Böhmen noch viele weitere Generationen in der Überzeugung aufwachsen ließ, mit ›den Wienern‹ eine Rechnung offen zu haben; es war vielmehr die fatale Strategie der Sieger, durch größtmögliche Demütigung jeden Gedanken an eine neuerliche Rebellion zu ersticken. Es genügte Ferdinand II. nicht, sämtliche protestantischen Adligen zu enteignen und außer Landes zu jagen, die auch nur im Verdacht standen, mitgemacht zu haben – er zwang sie überdies, sich selbst anzuzeigen, um dem Henker zu entrinnen. Ebenso hart traf es die nichtkatholischen Geistlichen, denn das neue Regime hielt sich nicht lange damit auf, irgendwelche Unterscheidungen zu treffen zwischen gemäßigten Lutheranern und radikaleren Calvinisten, Hussiten oder Wiedertäufern. Den erst ein Jahrzehnt zuvor erlassenen ›Majestätsbrief‹ Kaiser Rudolfs II., auf den die Protestanten sich wütend beriefen und der ihnen freie Ausübung der Religion zusicherte, ignorierte Ferdinand nicht nur, er zerstörte ihn eigenhändig samt kaiserlichem Siegel. Und er gab sich nicht damit zufrieden, die Initiatoren des Aufstands, deren er habhaft werden konnte, nach Recht und Gesetz abzustrafen, sondern er installierte in Prag ein Sondergericht, das die böhmische Rechtsordnung mit Füßen trat und das ausschließlich den politischen Weisungen aus Wien unterworfen war. Schließlich inszenierte er den Tod der völlig entrechteten Angeklagten auf derart grausame Weise, dass er selbst den zahlreichen unpolitischen Bürgern, die von Aufständen überhaupt nichts hielten und die sich viel lieber mit den neuen Herren arrangiert hätten, einen über Generationen fortdauernden Hass gegen Habsburg einpflanzte.
Siebenundzwanzig zum Tod verurteilte Männer, fast alle grauhaarig und überwiegend auf der Prager Burg gefangen gehalten, wurden zum Altstädter Rathaus gebracht, um bei Beginn der Vorstellung pünktlich zur Stelle zu sein: drei von ihnen aus dem Herrenstand, sieben Ritter und siebzehn Bürgerliche, unter ihnen als Prominentester Dr. Jan Jessenius (Jesenský), der Rektor der Prager Universität. Als es hell wurde, stand das Blutgerüst in düsterem Gepränge, mit schwarzem Stoff dekoriert, und die ersten Gaffer näherten sich vorsichtig dem Ort des Spektakels. Gegen fünf Uhr ertönte von der Burg ein Kanonenschuss, das Zeichen zum ersten Akt. Die von Wien bestallten Richter des Schauprozesses nahmen ihre Plätze ein, neben ihnen die verdientesten katholischen Heerführer, darunter Albrecht von Waldstein (alias Wallenstein). Ein medizinisch geschulter Henker namens Jan Mydlár – auch sein Name überdauerte – stieg auf die Bühne, gefolgt von einigen vermummten Gehilfen, welche die geschärften Schwerter trugen. Dann wurde als Erster, aufrecht und ohne Fesseln, der sozial höchstrangige Verurteilte hinaufgeführt: der 52-jährige Joachim Andreas Graf Schlick, einer der Verantwortlichen für den Prager Fenstersturz. Ein jesuitischer Geistlicher, über dessen Zudringlichkeit sich Schlick schon am Abend zuvor beklagt hatte, machte einen letzten Versuch der religiösen Bekehrung, wurde jedoch abgewiesen. Den Rest erledigte der Henker, der den knienden Grafen mit zwei Hieben in zerstörtes, totes Fleisch verwandelte: erst der Kopf, dann die rechte Hand. Die Gehilfen schafften die in Tücher geschlagene Leiche beiseite.
Und so einer nach dem anderen, fast vier Stunden lang, mit entsetzlicher Monotonie. Es mutet heute seltsam an, dass kein einziger der Zeitzeugen, die von dieser Szene berichten, den augenfälligen Gegensatz erwähnt zwischen dem archaischen Gemetzel, das sich vor der Ostseite des Altstädter Rathauses abspielte, und jenem subtilen, hochartifiziellen technischen Glanzstück, der astronomischen Uhr, die wenige Schritte entfernt auf der Südseite prangte.[2] Auch ist kaum abzuschätzen, wie viele Zuschauer das blutige Geschehen verfolgten – unter ihnen zahlreiche Angehörige der Opfer –, und noch weniger wissen wir darüber, ob die Menge eher mit Trauer oder mit Wut reagierte. Doch war dafür Sorge getragen, dass niemand daran denken durfte, das Bestrafungsritual zu stören. Denn nicht nur diese Stadt sollte es treffen, auch auf die verbliebenen Gegner in ganz Europa sollte die Inszenierung wie ein Schock wirken. Die Bühne war weiträumig gesichert von einem Kordon bewaffneter Reiter und von Landsknechten, die in martialisch wirkenden Karrees aufgestellt waren. Weder Schmährufe noch die letzten Worte der Verurteilten hatten eine Chance gegen die zahllosen Trommler, die ebenfalls auf dem Ring postiert waren und die nahezu ununterbrochen, Stunde um Stunde, einen betäubenden Lärm erzeugten. Es war, als hätten die neuen Herren den Pragern die Münder verstopft – hier drang nicht einmal ein Schluchzen mehr durch.
Doch damit waren die Demütigungen noch nicht zu Ende, man hatte sich Steigerungen des Horrors ausgedacht, die niemand so schnell vergessen sollte. Besonders schlimm traf es den einflussreichsten aller Angeklagten, den humanistisch gebildeten und politisch agilen Mediziner Jessenius, dem man vor der Enthauptung auch noch die Zunge herausschnitt und dessen Leiche öffentlich gevierteilt wurde. Drei der Angeklagten wurden noch länger gequält, sie endeten nicht auf dem Blutgerüst, sondern baumelten, langsam erstickend, an Henkersseilen. Schließlich wurden zwölf der abgeschlagenen Köpfe auf die Zinnen des alten kaiserlichen Brückenturms gesteckt (eine Maßnahme, die man den Engländern abgeschaut hatte). Dort blieben sie volle zehn Jahre lang vor den Augen der Prager Bürger, die ihren Kindern begreiflich machen mussten, was geschehen war. Ende der Lektion.
Dass auch vernichtende Niederlagen dazu beitragen können, über sehr lange Zeiträume kollektives Selbstbewusstsein zu formen, ist historisch nicht neu und spielte nicht zuletzt in der Geschichte des Judentums und des modernen Zionismus eine gewichtige Rolle. Die Legenden um den Juden Schimon ben Kosiba (genannt Bar-Kochba, ›Sohn des Sterns‹), der im Jahr 132 einen Aufstand gegen die römische Besatzungsmacht in Palästina entfesselte, bieten ein eindrucksvolles Beispiel. Obwohl diese Aktion schließlich in einer Katastrophe endete und einer halben Million Juden (darunter ihn selbst) das Leben kostete, wurde Bar-Kochba noch mehr als 1800 Jahre später zur Identifikationsfigur des jüdischen Widerstands, ja zu einem Garanten nationaljüdischer Identität. Offenbar blieb hier die Frage nach der historischen Ratio weitgehend ausgeblendet: Was zählt, ist die heroische Geste, die aus der Entfernung wie eingefroren erscheint, und das Wir, das durch solche Erzählungen gestiftet wird, ist überzeitlich, eine Substanz jenseits der Geschichte. Darum auch geht die Frage, was denn die Taten solcher heldischer Figuren mit ›uns‹ konkret zu tun haben, am Wesentlichen vorbei: Das Volk ist ewig.
Ebenso wenig bewirken skeptische Fragen, die auf die historische Wahrheit der Überlieferung abzielen. Fast niemals verlaufen ja die historischen Frontlinien so gerade und übersichtlich, wie die späteren (und manchmal sehr späten) Mythen es glauben machen. Über die Motive und Ziele des wirklichen Bar-Kochba ist so gut wie nichts bekannt, und die spärlichen Indizien lassen allenfalls die Vermutung zu, dass hier religiöse (Auto-)Suggestion in ein politisch sinnloses und selbstmörderisches Unternehmen führte. Der Mythos aber will, dass diese Menschen in gewissem Sinn ›für uns‹ gekämpft haben und dass infolgedessen ihre Taten zeitlose Geltung behalten: als moralischer Maßstab, ja als Verpflichtung für unser eigenes Tun. Dieser moralische Druck ist es, den sich die Virtuosen der Identitätspolitik seit dem 19. Jahrhundert zunutze machen, es ist das schlechte Gewissen gegenüber dem eigenen Kollektiv und die Furcht vor der Ausgrenzung, die es so schwer machen, durch all die historischen Vereinfachungen, Stilisierungen und Fälschungen zur Wirklichkeit durchzudringen.
Die Schlacht am Weißen Berg bei Prag und die öffentlich vollzogene Rache der Sieger ist unter all den Niederlagen, auf die sich identitätsstiftende Mythen gründeten, eines der aufschlussreichsten, freilich auch verwickeltsten Beispiele – ein historischer Vorgang von solcher Komplexität, dass er ohne drastische Vereinfachungen gar nicht überlieferbar scheint. Unstrittig ist allein, dass am Weißen Berg über das Schicksal Böhmens und Mährens entschieden wurde und dass es, wie sich zeigen sollte, eine Entscheidung für Jahrhunderte war. An welchem Gegensatz aber hatte sich der Konflikt eigentlich entzündet, für welche Ziele, um welche Prinzipien war gekämpft worden? Um Legitimität, behaupteten die Habsburger. Um Religionsfreiheit, sagten die Aufständischen. Um Befreiung vom deutschen Joch, glaubten die tschechischen Nationalisten späterer Zeit.
Ein Streit der Deutungen, der selbstverständlich seit Anbeginn an Interessen gebunden war. So hatte Kaiser Ferdinand II. Rücksicht zu nehmen auf die Duldung auch einiger protestantischer Fürsten, und daher suchte er fortwährend der öffentlichen Meinung entgegenzuwirken, er führe gegen die Prager einen Religionskrieg – um genau diesem Eindruck zu begegnen, ließ er auf dem Altstädter Ring sogar einen Katholiken hinrichten, und dass der Henker Protestant war, kam auch nicht ungelegen.[3] Die Aufständischen hingegen sprachen mit Vorliebe über Religion, sie pochten darauf, dass ihr protestantisches Glaubensbekenntnis ihnen keine sozialen oder materiellen Nachteile eintragen dürfe, und den Verdacht, sie seien gegen jeden starken Kaiser, also letztlich nur am eigenen Machtzuwachs interessiert, wiesen sie weit von sich – auch sie mit Rücksicht auf mächtige Verbündete. Die tschechische Geschichtsschreibung des 19. Jahrhunderts nahm dann die Ereignisse in den Dienst der eigenen nationalen Ideologie: Ihr zufolge war es den Habsburgern vor allem um die Vormachtstellung des ›Deutschtums‹ in Böhmen gegangen. Hatten sie nicht in den Jahren nach ihrem Sieg alle wichtigen administrativen Posten mit ›Deutschen‹ besetzt – gegen die tschechische Mehrheit –, und hatten sie nicht sogar in der neuen Landesverfassung festgeschrieben, dass die deutsche Sprache fortan der tschechischen gleichgestellt sei?
Es zählt zu den vielen ironischen Wendungen in der Geschichte Böhmens, dass sich ausgerechnet diese dritte, bei weitem schwächste und mit den historischen Fakten am wenigsten in Einklang zu bringende Interpretation schließlich durchsetzte und dass die Hingerichteten auf dem Altstädter Ring (von denen tatsächlich mindestens ein Drittel deutschsprachig war) nicht als Vorkämpfer bürgerlicher Freiheiten, auch nicht als Opfer religiöser Unterdrückung, vielmehr als nationale Märtyrer im kollektiven Gedächtnis lebendig blieben. Der Weiße Berg, von dem die ›Finsternis‹ sich einst über das ganze Land verbreitet hatte, wurde zum Wallfahrtsort tschechischer Nationalisten, und nach dem Untergang des Habsburger Regimes, der den Tschechen die nationale Emanzipation brachte, wurde dort ein Denkmal errichtet. Die gewaltig hohe Mariensäule auf dem Altstädter Ring, mit der die Habsburger einst ihre so brutale wie erfolgreiche Rekatholisierung des Landes gefeiert hatten, wurde hingegen nach dem Ersten Weltkrieg zerstört – von einem Zug tschechischer Demonstranten, die sich zuvor auf dem Weißen Berg in entsprechende Stimmung gebracht hatten. Und noch heute markieren ins Pflaster eingelassene Kreuze die Stelle auf dem Ring, an dem das Blut der Opfer von 1621 floss.
Die Vielzahl solcher historischer Markierungen ist für Prag außerordentlich charakteristisch, sie liegen wie ein Netz über der Stadt, und insbesondere im 19. und frühen 20. Jahrhundert, als Prag noch mit seinem alten Kern identifiziert wurde, bestimmte diese allgegenwärtige und demonstrative Geschichtlichkeit, ja Geschichtsversessenheit das Lebensgefühl des gebildeten Bürgertums. »Jedes Haus«, so erinnerte sich Johannes Urzidil, »jede Gasse, jeder Platz in Prag rief unaufhörlich die ganze Geschichte entlang: ›Vergiß nicht das! Vergiß nicht jenes!‹, so daß man vor lauter Erinnerung und Vergeltungssucht das gegenwärtige Leben schier vergaß.«[4] Es war das bedrängende Gefühl, von einem Spinngewebe historischer Konfliktlinien und Verantwortlichkeiten umfangen zu sein und das eigene Leben, solange man an diesem Ort verweilte, einem gleichsam aus der Vergangenheit wirkenden Kraftfeld fortwährend entziehen zu müssen. Und dieses Gefühl wurde noch beträchtlich intensiviert durch das Stadtbild des alten Prag, in dem sich auf engem Raum die herrschenden Stile verschiedener Epochen sichtbar, ja demonstrativ übereinanderlegten und miteinander verschränkten, nicht selten in Gestalt und Fassade ein und desselben Gebäudes. Es war, als lebte man auf den hochgeschichteten Ablagerungen Dutzender untergegangener Generationen, deren Schicksale, Leiden und Leistungen das eigene Denken wie unter einem Bann hielten. Nicht nur der Bildungsfundus, der an Schule und Universität vermittelt wurde, sondern der gesamte öffentliche Diskurs nahm unaufhörlich Bezug auf das, was sich einst hier abgespielt hatte – jedoch nicht im Sinne einer genießenden, nachschmeckenden Teilnahme aus sicherer Entfernung, vielmehr als Mahnung daran, dass die Geschichte noch nicht abgegolten war und dass noch immer Rechnungen offenstanden. Wer in der Prager Altstadt aufwuchs – und in der unmittelbar benachbarten, wohlhabenderen ›Neustadt‹ war es nicht viel anders, denn auch diesen Stadtbezirk gab es schon seit einem halben Jahrtausend –, wer hier aufwuchs, hatte sich daran zu gewöhnen, mit der Vergangenheit zu leben wie in der Wohnung eines Greises: Hier durfte allenfalls abgestaubt, aber nichts verrückt, geschweige denn weggeworfen werden. So dass man durchaus auf den Gedanken verfallen konnte, ob nicht die berühmten Heiligenstatuen auf der Karlsbrücke die eigentlichen Bewohner Prags, die Lebendigen aber nur flüchtige Gäste seien.[5]
Das alles galt freilich für die Deutschen mehr als für die Tschechen, für das Bürgertum mehr als für die Arbeiter. Altstadt und Neustadt, die sich allmählich zu musealen Zonen entwickelten, waren vor allem von Deutschen geprägt, für die der Ort der Erinnerung zugleich der Ort gegenwärtigen und künftigen Lebens war. Anders die Tschechen, die mit den rasch expandierenden Vorstädten und Industrievierteln über Korrektive verfügten, die sie vor einer allzu lähmenden Fixierung aufs Vergangene bewahrten. Schon vor 1900 gab es Zigtausende Prager Tschechen, die sich im Stadtkern tatsächlich eher als Besucher denn als Einwohner fühlten, Besucher eines Museums, dessen Schaustücke zwar von der eigenen Geschichte handelten, mit dem beschleunigten und technisierten Leben in der Moderne jedoch nur wenig zu tun hatten. Daran änderten dann auch die tschechischen Cafés, Kinos und Straßenschilder nichts. Die tschechische Zukunft – und welcher Prager zweifelte daran, dass die Zukunft dieser Stadt, wie fern auch immer, tschechisch sein würde – sollte ihre historischen Wurzeln im alten Zentrum behalten, gewiss. Ihre Bühne jedoch würde sie woanders aufschlagen.
Prag also wurde von zwei Kollektiven bewohnt, die nicht nur in verschiedenen Sprachen, sondern auch in unterschiedlichen symbolischen Ordnungen lebten: Ordnungen, die städtebaulich fixiert waren und deren Gegensatz man sehr sinnlich erfahren konnte, wenn man den Baedeker einmal beiseitelegte und von der Kleinseite mit ihren Barock-Palais – der Stil der Sieger von 1620 – in die Industriezone von Smíchov oder über den Altstädter Ring zu den nicht sonderlich ›sehenswürdigen‹, von Tschechen bevölkerten Mietskasernen von Žižkov wanderte. Dort herrschte gleichsam geschichtslose Gegenwart, unter Strom gesetzt von immer wieder aufflackernden Aufbruchsstimmungen und allmählich sich intensivierenden Zukunftsphantasien. Prag, die einstige Königsstadt, mochte de facto herabgesunken sein zu einem regionalen Zentrum – empfunden und erfahren wurde diese Provinzialität jedoch fast ausschließlich von Deutschen, denen die Zeugnisse einer größeren Vergangenheit und die Abhängigkeit von Wien fortwährend vor Augen standen, während die Prager Tschechen weiterhin in ihrem Zentrum lebten, im Zentrum der tschechischen Besiedelung, der tschechischen Kultur. Es war, als hielten die einen die Quellen besetzt, während den anderen das zwar eindrucksvollere, doch leider stehende und allmählich faulende Gewässer blieb.
»Dieses Haus hasst, liebt, straft, schützt, verehrt
Nichtswürdigkeit, Frieden, Verbrechen, Rechte, Redlichkeit.«
Es war eine sonderbare Inschrift, die bis zum Ende des 18. Jahrhunderts am Altstädter Rathaus prangte, grammatisch widerborstig und darum erst auf den zweiten Blick verständlich. Doch es war eine durchaus passende Parole, denn die Engführung von Frieden, Verbrechen und Recht war Prager Wirklichkeit seit unvordenklichen Zeiten. Die Stadt war gezeichnet von schlecht verheilten Wunden, und ganz anders als in Wien hat hier offenbar kein Reisender je die Freuden einer gänzlich ungetrübten ›Gemütlichkeit‹ erfahren, trotz der heimelig-verwinkelten Gassen und Stiegen, der zahllosen Beisln und ihrer kauzigen Insassen. Stattdessen verbreitete sich im 19. Jahrhundert allmählich das Image eines düster-kulissenhaften, ›magischen‹ Prag – ursprünglich eine touristische Erfindung, doch mit einem Kern authentischer Erfahrung, der bis heute überdauert hat. Denn tatsächlich steigert sich in manchen Winkeln dieser Stadt die Präsenz der Geschichte bis ins Unheimliche, so eng benachbart scheinen hier Vergangenheit und Gegenwart, Tod und Leben.
Freilich, diese von Reiseführern, Dichtern und dann auch Filmregisseuren liebevoll gepflegte Stadtfolklore lieferte von Anbeginn an kaum mehr als ein Zerrbild. Denn tatsächlich war auch das alte Prag, das Prag vor den Weltkriegen, weder ein Museum noch ein historischer Themenpark. Was sich dem Touristen als geheimnisvolle Fülle von Zeichen, Inschriften und Stilmustern bot, hatte für die Bewohner der Stadt durchaus nichts Magisches, sondern repräsentierte Konfliktlinien, die fortdauerten, auch unter den Bedingungen einer rasch sich modernisierenden Provinzmetropole. Für den Prager waren das alles Narben, die ihn daran erinnerten, dass er in einer urbanen Kampfzone lebte, und was aus der Vergangenheit der Stadt herüberragte, waren nicht Gespenster oder magische Verheißungen, sondern ungelöste soziale, ethnische, nationale und religiöse Konflikte, wachgehalten und befeuert durch eine Rhetorik der offenen Rechnungen.
Es war vor allem die jüdische Minderheit Prags, die zwischen historischen Erfahrungen und städtischen Mythen genau zu unterscheiden wusste. Juden spielten in der wirtschaftlichen Entwicklung Prags von jeher eine bedeutende Rolle, und innerhalb des Areals, das ihnen zugewiesen war – im Ghetto, unmittelbar neben der christlichen Altstadt gelegen –, verfügten sie jahrhundertelang über eine Autonomie, die weit über religiöse und kultische Belange hinausging. Selbst die Prager Gerichtsbarkeit hatte hier keinen Zugriff. Diesen Privilegien standen aber eine Fülle kollektiver Zwangsmaßnahmen entgegen, deren unberechenbares Auf und Ab die Juden in tausendjähriger Furcht hielt: Sondersteuern, Berufs- und Heiratsverbote, Einschränkungen der Bewegungsfreiheit, erzwungene ›Bekehrungen‹, Ausweisungen, organisierte Plünderungen. Den Außenstehenden erschien das Ghetto als ein großer, leidender Organismus, der aber doch über geheime Kräfte und Verbindungen verfügen musste, denn er schien unausrottbar und erholte sich selbst von tiefen Wunden sehr rasch. Juden wurden verachtet und gefürchtet, aber auch gebraucht, und so konnte man ihre städtische Enklave durchaus nicht nach Belieben attackieren, ohne das übrige Prag, ja die ganze Region ökonomisch in Mitleidenschaft zu ziehen. Das musste schließlich auch Kaiserin Maria Theresia einsehen, die von einem Böhmen ohne Juden träumte und die ihre 1744 erlassene gnadenlose Ausweisungsverfügung bereits nach wenigen Jahren zurücknehmen, ja die wirtschaftlichen Spielräume der Juden sogar noch erweitern musste.
Auch wenn die christlich-antisemitische Propaganda darüber hinwegzutäuschen suchte: Was man den Juden am meisten verübelte, war keineswegs ihr ›Unglaube‹, ihr Geschäftssinn oder irgendwelche magischen Praktiken, vielmehr die Tatsache, dass sie sich der sozialen Pyramide niemals fugenlos eingliederten und selbst auf dem Feld der Politik autonome Entscheidungen trafen. Stets suchten sie die Nähe derjenigen Mächtigen, die das höchste Maß an Rechtssicherheit versprachen – wie anders? Doch allein schon darum lebten sie unter dem niemals erlöschenden Generalverdacht des Verrats. Standen irgendwelche Feinde vor dem Tor, so wurde das Verhalten der Juden besonders scharf beobachtet, und jedes Anzeichen dafür, dass sie sich mit dem Gegner verständigten, konnte flächendeckende Repressalien auslösen – wie etwa die von 1744. Maria Theresia war der Ansicht, dass sich die Prager Juden mit französischen und preußischen Besatzern ein wenig zu gut vertragen hatten: Sie waren Opportunisten, Verräter, die an nichts als den eigenen Vorteil dachten.
Tatsächlich waren die Juden lediglich zwischen die Mühlsteine eines Erbfolgekriegs geraten, der sie nichts anging, und es wurde ihnen Loyalität zu einem Regime abverlangt, das ihnen noch kurz zuvor eine Reihe fundamentaler Rechte aberkannt hatte. Schlimmer noch, die Habsburger betrieben Biopolitik und griffen massiv in die jüdische Familienplanung ein. Denn nach dem 1727 erlassenen ›Familiantengesetz‹ – verantwortlich dafür war Karl VI., der Vater Maria Theresias – konnte nur noch der jeweils älteste Sohn eine eigene Familie begründen, und die Zahl der jüdischen Familien, die in Böhmen geduldet waren, wurde eingefroren. Ein Erlass, der Tausende junger Leute vor die Wahl stellte, entweder das Land, und damit ihren Clan, für immer zu verlassen oder aber ihr Leben als rechtlose Hausierer zu fristen. In einem Böhmen unter preußischem Einfluss – das blieb natürlich ein Wunschtraum – hätte ein derart barbarisches Gesetz gewiss nicht lange Bestand gehabt.
Offenbar hatten die Habsburger vergessen, dass im Jahrhundert zuvor, in jener böhmischen Stunde null, die in der Schlacht am Weißen Berg kulminierte, die Juden einen nicht unbeträchtlichen Anteil am Sieg des österreichischen Kaisers gehabt hatten. Auch damals, im Schicksalsjahr 1620, votierten die Juden ganz pragmatisch, nach den Kriterien von Wohlstand und Rechtssicherheit, und das konnte nur heißen: katholisch. Denn die geschäftlichen Beziehungen mit den katholischen Herrschern waren bestens eingespielt, der Wiener Hof stand daher zumindest als Appellationsinstanz immer offen. Was hatten hingegen die protestantischen Rebellen zu bieten, was hatten sie mit den Juden vor, im Fall ihres Sieges? Das blieb durchaus unklar, und wenn man sich die Predigten ihrer geistlichen Anführer vergegenwärtigte, unter denen sich etliche aggressive Antisemiten Lutherscher Prägung fanden, dann war hier nicht viel Gutes zu erwarten.
Kein Zweifel daher, dass Jacob Bassevi, der reichste Jude Prags, mit seiner konservativen, doch weit über die Landesgrenzen ausgreifenden Geschäftspolitik die große Mehrzahl der Ghettobewohner hinter sich wusste, einschließlich der Rabbiner. Bassevi war der typische ›Hofjude‹, im besten Einvernehmen mit den Habsburger Herrschern Rudolf II., Matthias und Ferdinand II., und als das entscheidende militärische Duell zwischen dem Kaiser und den böhmischen Ständen nahte, flossen Bassevis gewaltige Kredite selbstverständlich nicht an die Nachbarn vom Altstädter Ring, sondern an deren Gegner in Wien, die ihre Truppen damit gut zu motivieren wussten. Auf den Ausgang der Schlacht am Weißen Berg hatte Bassevi somit einen zwar nur indirekten, aber doch beachtlichen Einfluss, und Ferdinand II. wusste es ihm zu danken: Er ordnete an, dass bei der unvermeidlichen wochenlangen Plünderung Prags durch katholische Truppen das Ghetto verschont bleiben solle – ein politisches ›Wunder‹, das die Prager Juden noch über lange Zeit mit einem alljährlichen Festtag würdigten. Bassevi selbst wurde von allen Steuerzahlungen befreit und als erster Jude nördlich der Alpen in den Adelsstand erhoben: Jacob Bassevi von Treuenberg hieß er von nun an. Dass er seine neuen Spielräume sofort nutzte und sich als Mitglied des ›Böhmischen Münzkonsortiums‹ am größten Währungsbetrug der frühen Neuzeit bereicherte, tat seiner Popularität unter Juden keinerlei Abbruch – schließlich war Bassevi im Ghetto stets äußerst freigebig –, während er für die unterlegenen und durch öffentliche Massenhinrichtung ohnehin schwer gedemütigten Protestanten nun natürlich erst recht zur Hassfigur wurde.
Gewiss, die Rolle der Prager Juden war eine eher marginale Frage angesichts der immer weiter sich verzweigenden Frontlinien eines Religionskrieges, der schließlich den größeren Teil Europas erfasste. Auch wurden die Juden nicht als politische Subjekte, sondern eher als Störfaktor wahrgenommen – sie führten keine Kriege, besaßen kein eigenes Territorium und kamen daher als Verbündete oder Gegner im eigentlichen, politisch-rechtlichen Sinn gar nicht in Betracht. Dennoch: die Art und Weise, wie sie als ›teilnehmende Beobachter‹ eines innerchristlichen Konflikts agierten, die Unverfrorenheit, mit der sie den Prager Unglückstag zu einem Festtag umwidmeten, schließlich der Gewinn, der ihnen am Tisch des Siegers zufiel – all das stand in denkbar krassem Gegensatz zu den vernichtenden Sanktionen, welche die protestantischen Stände zu ertragen hatten. Auf der Liste der offenen Rechnungen konnte dieser Posten daher keineswegs vernachlässigt werden, und wenn noch Jahrhunderte später der antideutsche, der antikatholische und der antijüdische Affekt zu einem einzigen Ressentiment verschmolzen, dann findet sich der wohl wichtigste Schlüssel zu diesem sonderbaren Phänomen unmittelbar vor den Toren Prags, am Weißen Berg, im Jahr 1620.
Es war weit mehr als eine militärische und politische Niederlage – es war tatsächlich eine böhmische Zeitenwende, bei der kein Stein auf dem anderen blieb. Denn kaum waren die letzten protestantischen Widerstandsaktionen erstickt und die Lage einigermaßen stabil, entschlossen sich die Sieger zu einer radikalen wirtschaftlichen Neuordnung Böhmens, einem Revirement fast der gesamten Führungsschicht, wie es Europa seit einem halben Jahrtausend nicht mehr gesehen hatte:[6] Mindestens zwei Drittel des adligen Grundbesitzes in Böhmen und Mähren sowie zahllose städtische Gebäude wurden enteignet oder mit geringer Entschädigung zwangsverkauft, und die Familien der bisherigen Eigentümer wurden – sofern sie am Protestantismus festhielten – samt Gesinde und Geistlichen aus dem Land gejagt: insgesamt etwa 36000 Familien mit mehr als 150000 Menschen. Nutznießer dieser Strafaktion waren vor allem katholische Adlige, die als Geldgeber und Heerführer den Sieg ermöglicht hatten und die nun teils gratis, teils zu Preisen weit unter Wert in den Besitz ungeheurer Ländereien kamen: Wallenstein, Liechtenstein, Eggenberg, Trauttmansdorff, Metternich – das waren die Namen der neuen Herren.[7] Auch in den Städten wechselten jetzt wertvolle Immobilien den Besitzer, und einige der leerstehenden Häuser, die von Protestanten überstürzt verlassen worden waren, gingen per Ausnahmedekret auch an jüdische Interessenten.
Ein derartiger Aderlass konnte freilich nicht durch die bloße Vergabe neuer Besitzurkunden kompensiert werden. Ganz Böhmen war jetzt sozial ausgedünnt, manche Landstriche gespenstisch entvölkert, vor allem an Handwerkern und Händlern fehlte es überall, Felder und Forste verwahrlosten, und der fortdauernde europäische Krieg, der immer wieder nach Böhmen übergriff – auch Prag wurde noch mehrmals attackiert –, zog Verwüstungen, Seuchen und weitere Massenwanderungen nach sich. Am Ende des Dreißigjährigen Krieges hatte Böhmen nur noch eine Million Einwohner – ein Drittel weniger als zu Beginn –, und in Prag stand die Hälfte aller Wohnungen leer.
Doch ohne Menschen kein Kapital: Sollten die billig erworbenen ›Herrschaften‹ ihren neuen Besitzern auch etwas abwerfen, dann musste dort endlich wieder gearbeitet werden. Erneut wurden Familien umgesiedelt, und mit großem Aufwand versuchte man, Arbeitskräfte von fern her in das böhmische Vakuum zu locken. Eine gute Zeit für Menschen, die ohnehin nichts zu verlieren hatten, eine gute Zeit also auch für Juden, die immer in genügend großer Zahl unterwegs waren, irgendwo vertrieben oder beraubt und auf der Suche nach Sicherheit. Gerade jetzt, in den ersten Jahren nach dem Krieg, strömten sie wieder einmal von Osten her ins Land, aus der polnischen Ukraine, wo die aufständischen Kosaken unter der begeisterten Mitwirkung der übrigen russisch-orthodoxen Landbevölkerung ungeheuerliche Massaker verübten. Vermutlich mehr als eine Viertelmillion Juden starben gewaltsam. Die Überlebenden waren für jedes Angebot dankbar, und wo man ihnen erlaubte, sich niederzulassen, waren sie bereit, sich auch auf harte Konditionen einzulassen. Für die neuen katholischen Gutsbesitzer in Böhmen eine schöne Gelegenheit, Juden auf ihre herrschaftlichen Dörfer zu ›setzen‹ (wie der geläufige Ausdruck lautete) und die Ökonomie wieder in Schwung zu bringen. Denn nützlich waren diese Leute gleich in mehrfacher Hinsicht: Sie waren fleißig, sie zahlten pünktlich ihre Kontributionen, und man konnte sie dazu zwingen, alles aufzukaufen, was die Güter an Produkten nur hergaben. Es waren etliche Kleinhändler unter ihnen, die würden die Ware schon an den Mann bringen, im eigenen Interesse.
Auch das kleine südböhmische Gut Wosek,[8] sieben Kilometer nördlich von Strakonice, gehörte vor der Katastrophe am Weißen Berg einem tschechischen Adligen. Nach schweren Kämpfen in der nächsten Umgebung – die Kreisstadt Písek wurde 1619/20 von den Habsburgern dreimal erobert und schließlich verwüstet – musste der Protestant Zdenko Čejka das Land verlassen. Sein Schloss und das Dominium wurden beschlagnahmt, und so gelangten die weitgehend entvölkerten Dörfchen, darunter Wosek selbst, in den Besitz ausgerechnet jenes Kriegsgewinners, der die landesweiten Enteignungen persönlich überwachte: in den Besitz des mächtigen Karl von Liechtenstein, des gefürchteten Organisators der Prager Hinrichtungen, dessen katholische Treue mit dem Titel eines Statthalters und Vizekönigs von Böhmen belohnt worden war. Für ihn, den Herrn über Tausende Quadratkilometer Land, war Wosek zweifellos kaum mehr als ein Rechnungsposten, eine von zahllosen Möglichkeiten, neu erworbenes Vermögen urkundlich sicherzustellen – der dreibändigen Familiengeschichte der Liechtensteinischen war Wosek nicht einmal eine Fußnote wert.[9] Auch ist es sehr unwahrscheinlich, dass das Gut während des jahrzehntelangen Krieges irgendwelche nennenswerten Erträge abwarf, denn immer wieder zogen fremde Heere durch oder quartierten sich sogar für Monate ein. Erst in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts erholte sich die Region, Arbeitskräfte und Kapital waren hochwillkommen, leerstehende Häuser gab es mehr als genug, und so siedelten sich auch in Strakonice, Písek und den umliegenden Dörfern die Vertreter einer neuen sozialen Spezies an: sogenannte Landjuden, Einwanderer aus Polen und der polnischen Ukraine.[10]
Diese Juden blieben einander eng benachbart – vor allem aus Gründen des religiösen Ritus –, sie sammelten sich an geeigneten Orten und bildeten Ghettos en miniature, sogenannte Judengassen, in denen man unter sich blieb, wo es eine kleine Synagoge und häufig auch einen jüdischen Medicus gab und wo man weder mit Gesang und Gebet noch mit den Gerüchen der eigenen Küche den christlichen Teil der Bevölkerung belästigen musste. Eine solche Judengasse entstand auch in Wosek. Wie viele Menschen dort ursprünglich lebten, ist unbekannt, etwa hundert Jahre nach der großen Einwanderung waren es wohl sechzehn Familien, zu denen im 19. Jahrhundert noch einige hinzukamen.
Eine dieser Familien hieß KAFKA. Das war ein nicht eben seltener Name in Böhmen, auch in Prag gab es ihn schon seit langem, abgeleitet offenbar vom Namen eines Vogels.[11] Einige dieser ›Dohlen‹ – tschechisch kavka, polnisch kawka – fanden sich auch in der weiteren Umgebung Woseks, und in einer Chronik von Písek ist ein gewisser Löbl Kafka sogar schon im 17. Jahrhundert dokumentiert. Vermutlich war der Clan der polnischen Dohlen dort zuerst gestrandet, hatte sich erst später verzweigt und schließlich auch auf dem Gut Wosek angesiedelt – wann genau, wissen wir nicht.
Dieses Dunkel lichtet sich erst am Anfang des 19. Jahrhunderts, als in Wosek die Stelle eines jüdischen ›Familianten‹ frei wurde. Noch immer markierte dieser Begriff eine gezielte soziale Demütigung, die absolute Verfügungsgewalt des christlichen Staates, der seine jüdischen Untertanen biopolitisch verwaltete, als ginge es um die Pflege einer Viehherde. Diesem Staat kam es einzig und allein auf die Zahl an, auf den ›Bestand‹, der möglichst nicht weiter anwachsen sollte: 8541 Familien in Böhmen, 5106 in Mähren und keine mehr. Jeder männliche Jude, der nicht den seltenen Sonderstatus eines ›Schutz-‹ oder ›Hofjuden‹ besaß, jeder, der heiraten, Kinder haben und diesen Kindern auch etwas vererben wollte, musste also zunächst einmal darauf warten, dass ein Familienvorstand starb – irgendein Familienvorstand. Das war in der Regel der eigene Vater, es konnte aber auch ein ganz fremder Jude sein, sofern der nicht eigene Söhne hatte. In beiden Fällen war der Bestand jüdischer Familien um eine Ziffer gemindert, und die Frage, ob es sich um eine unmittelbare Erbfolge handelte oder nicht, blieb biopolitisch ohne jeden Belang. War kein Sohn zur Stelle, dann galt die Position des Familianten als unbesetzt, Punktum!, und wer sie haben und dafür auch bezahlen wollte, der konnte sie erwerben.
Ebendies geschah in Wosek im Jahr 1802. Da starb ein Jude namens Fischel, und wenige Wochen nach ihm sein einziges Kind, ein Säugling noch. Weil Ehefrauen und Witwen nicht Familianten sein konnten, war die Stelle anderweitig zu vergeben. Und so bekam ein gewisser Josef Kafka die Chance, sich das staatlich garantierte Recht zur Fortpflanzung zu erkaufen. Josef Kafka, der Urgroßvater des Schriftstellers Franz Kafka.
Keine intellektuelle Biographie, die sich vor den Kulissen der böhmischen Metropole entfaltet, ist verständlich ohne die Geschichte dieser Stadt und ihrer Region. Das gilt für Deutsche wie für Tschechen, für Juden wie Christen. Es gilt für Politiker wie Tomáš Masaryk, der aus seiner Stadt erst vertrieben und dann von ihr verehrt wurde; für Publizisten wie Egon Erwin Kisch, der von dem sozialgeschichtlichen Anschauungsmaterial Prags ein Leben lang zehrte; es gilt für die Generation der jungen Zionisten um 1900, die inmitten des nationalen Gezänks in Prag aufwuchsen und denen daher der Begriff einer ›jüdischen Nation‹ problematisch wurde; und es gilt selbstverständlich für Schriftsteller wie Rilke und Werfel, deren Imaginationskraft schon früh befeuert wurde von einem Stadtbild, in das die sozialen Verwerfungen eines ganzen Jahrtausends sich wie Runzeln und Narben eingegraben hatten, und die schließlich glaubten, auf diesem Krämermarkt der offenen Rechnungen nicht mehr atmen zu können.
»Prag lässt nicht los«, schrieb Kafka als 19-Jähriger an seinen engsten Freund. »Uns beide nicht. Dieses Mütterchen hat Krallen. Da muß man sich fügen oder –. An zwei Seiten müssten wir es anzünden, am Vyšehrad und am Hradschin, dann wäre es möglich, daß wir loskommen.«[12] Ein schön erdachter existentialistischer Akt, zu dem sich Kafka dann doch nicht entschließen konnte. Er hat nichts angezündet, ist nicht losgekommen, bis kurz vor seinem Ende, und als die Krallen endlich lockerließen, war es zu spät.
Dass ein Werk wie das seine nur in Prag entstehen konnte, dass es die historische und soziale Atmosphäre Prags auf jeder Seite atmet, ist inzwischen Gemeinplatz: wahr gewiss, doch nicht wirklich erhellend. Denn das Gleiche gilt ja für viele der flüchtigen Produkte dritt- und viertrangiger literarischer Amateure, die in erstaunlicher Zahl die Prager Kaffeehäuser und zum wachsenden Verdruss des Publikums auch die Feuilletons bevölkerten. Von allen diesen jedoch setzte sich Kafka radikal ab. Wodurch, in welcher Weise? Zunächst durch sprachliches Können, Gespür für literarische Formen und durch den Verzicht auf jegliche Stadtfolklore. Was er schreibt, ist in ganz anderem Sinne magisch als das angeblich magische Prag. Denn jede Zeile von seiner Hand geht durch den Filter einer erschreckenden, oft eisigen intellektuellen Wachheit und einer bildgesättigten, unnachgiebigen Reflexivität. Kafka war seiner Geburtsstadt nicht bloß ›verhaftet‹ wie Tausende andere, sondern er bezog daraus auch den Impuls, ja gleichsam den Auftrag, dem Rätsel dieser Bindung auf den Grund zu gehen. Daher gehören zu seinen Lebensthemen die Macht der Vergangenheit über die Gegenwart, das gespenstische Rumoren der ›Vorwelt‹ (besonders vernehmbar im August 1914) und die jederzeit zu gewärtigende, jähe Wiederauferstehung dessen, was historisch bereits abgetan schien: all das Ausdruck eines eigentümlichen, in seiner Prager Lebenswelt verankerten Bewusstseins von Zeit und Geschichte. Und dieses Bewusstsein trug Kafka offenbar schon als Jugendlicher in sich. Denn wenn er darüber nachdenkt, wie Prag am sichersten in Schutt und Asche zu legen wäre, dann belässt er es nicht bei Pennälerträumen. Das Nächstliegende kommt ihm gar nicht in den Sinn, die Schulen, Universitäten, Synagogen und Galanteriewarenläden – nein, brennen sollen zuerst die alten Kerne des Prager Siedlungsgebiets, die beiden Burgen, der Hradschin und der Vyšehrad, in deren Schatten einst, vor tausend Jahren, die ersten Prager Gassen entstanden. Es ist nur ein Überschuss an Imagination, spielerisch und harmlos noch, aber selbst im Spiel legt Kafka sogleich die Hand an die Wurzel.
Woher hatte er diese Fähigkeiten? »Bedenken Sie auch Milena«, schrieb er gegen Ende seines Lebens in einem Brief, »wie ich zu Ihnen komme, welche 38jährige Reise hinter mir liegt (und da ich Jude bin, eine noch so viel längere).«[13] Offenbar empfand er diese Verflechtung von individuellem und historischem Schicksal schon außergewöhnlich früh, und seine eigene Existenz bot ihm dafür Anschauungsmaterial genug. Er wurde am Rand des Prager Ghettos geboren, kurz vor dessen endgültigem Untergang. Er war einem antisemitischen Denken und Sprechen ausgesetzt, in dem das Mittelalter scheinbar ungebrochen fortdauerte. Er lernte Menschen kennen, die daran glaubten, dass Juden rituelle Morde begingen, und die im selben Atemzug von der Zukunft der tschechischen Nation schwärmten. Er traf Ältere, die sich noch an die letzten öffentlichen Hinrichtungen in Prag erinnern konnten und die jetzt die ersten Autos und Kinematographen bestaunten. Und er wohnte viele Jahre am Altstädter Ring, an jener sozialen Bühne also, auf der man immer aufs Neue die Ereignisse von 1620/21 beschwor, den Weißen Berg, die Exekutionen und Vertreibungen, ganz so als handle es sich um vitale Erinnerungen derer, die sich hier versammelten. Wie vieles davon Inszenierung war, durchschaute Kafka; wie wenig an Inszenierung es aber bedurfte, um der realen Gewalt des Vergangenen neue Bahn zu brechen, das fühlte und erlebte er.
Zeitschichten, die sich unter äußerem Druck wie Eisschollen über- und ineinanderschieben, waren Kafka auch aus der jüdischen Vorstellungswelt vertraut, wie unzulänglich auch immer sie ihm überliefert wurde. Dass man den Juden als gleichsam überzeitlichem Kollektiv Verbrechen vorwarf, die sie vor zwei Jahrtausenden begangen haben sollten (»ihr habt unseren Herrn ans Kreuz geschlagen«), das erschien ihnen ungerecht, gewiss. Aber doch nur wegen des Inhalts der Anklage, während ihnen diese Form des historischen Kurzschlusses völlig vertraut und durchaus nachvollziehbar schien. Nicht nur die jüdische Identität als ›Volk‹, vielmehr jeder einzelne jüdische Festtag, selbst rituelle Handlungen des Alltags bezogen (und beziehen) ihre Bedeutung ausdrücklich aus Ereignissen aus alttestamentarischer Zeit. Solche Fernbeziehungen hatten ihren höheren Sinn, darin waren sich die Juden mit ihren Gegnern völlig einig, und ob man die historischen Begebenheiten tatsächlich belegen konnte, war demgegenüber durchaus nachrangig – ihr Fortwirken war Beweis genug. Auch dieses eigentümliche Zeitbewusstsein, an dem die Aufklärung scheinbar spurlos vorübergegangen war, gehörte wesentlich zu jenem Resonanzboden, auf dem sich Kafkas geschichtliche Reflexionskraft entfaltete.
Von Prag kam man nicht los, vom Judentum ebenso wenig, und beides aus Gründen, die einander sehr ähnlich sahen. »Das Vergangene ist nicht tot, es ist nicht einmal vergangen« – das berühmte Paradox stammt von William Faulkner, doch entdeckten wir es in einem jener Notizhefte, die Kafka später vollkritzelte, es würde uns nicht verwundern. Unterschrieben hätte er diesen Satz gewiss. Denn wer hatte dazu mehr Anlass, mehr Berechtigung als ein Jude aus Prag?
Riesenmenschen: Die Kafkas aus Wosek
Nicht jeder ist auf der Welt,
der geboren wurde.
Dezső Szomory, LEHRER HORÉB
»Euch geht’s zu gut!« Der dröhnende Refrain war wohlbekannt in der Wohnstube der Kafkas, bekannt bis zum Überdruss. Denn zu hören bekam ihn jeder, der mit irgendwelchen Sorgen kam, mit ›persönlichen‹ Sorgen gar, die der Stoff- und Zwirnhändler Hermann Kafka fast ausnahmslos als Belästigungen abtat. »Euch geht’s zu gut«, das war eine durch allzu häufigen Gebrauch schon ein wenig schartige, aber noch immer brauchbare Waffe, mit der sich jede Diskussion beenden, jeder Widerspruch im Keim ersticken ließ. Wer an seinem Esstisch würde denn ernstlich leugnen, dass er gut versorgt war – den dampfenden Fleischteller beinahe täglich vor Augen? Hatte es in diesem Heim jemals an etwas gefehlt? Nur darum, weil hier niemals etwas fehlte, konnten lächerliche Angelegenheiten den Anschein ernstzunehmender Sorgen gewinnen. Was wirkliche Nöte bedeuteten, das wusste der Vorstand der Familie sehr genau, ja, bisweilen schien es ihm, als wisse nur er es allein. Und da er alle anderen vor dieser Erfahrung bewahrte, war es nicht nur legitim, sondern auch erzieherisch notwendig, sie an die vergangene wie gegenwärtige Mühsal so oft wie möglich zu erinnern.
Freilich saß ihm an ebenjenem Tisch ein Beobachter gegenüber, der nicht einfach weghörte oder abstumpfte gegen die immer gleichen Vorhaltungen des Vaters, sondern der auch die halbbewussten Impulse, welche diese Monologe in Gang hielten, bis auf den Grund durchschaute.
»Unangenehm ist es, zuzuhören, wenn der Vater mit unaufhörlichen Seitenhieben auf die glückliche Lage der Zeitgenossen und vor allem seiner Kinder von den Leiden erzählt, die er in seiner Jugend auszustehen hatte. Niemand leugnet es, dass er jahrelang infolge ungenügender Winterkleidung offene Wunden an den Beinen hatte, dass er häufig gehungert hat, dass er schon mit 10 Jahren ein Wägelchen auch im Winter und sehr früh am Morgen durch die Dörfer schieben musste – nur erlauben, was er nicht verstehen will, diese richtigen Tatsachen im Vergleich mit der weiteren richtigen Tatsache, dass ich das alles nicht erlitten habe, nicht den geringsten Schluss darauf, dass ich glücklicher gewesen bin als er, dass er sich wegen dieser Wunden an den Beinen überheben darf, dass er von allem Anfang an annimmt und behauptet, dass ich seine damaligen Leiden nicht würdigen kann und dass ich ihm schliesslich gerade deshalb, weil ich nicht die gleichen Leiden hatte, grenzenlos dankbar sein muss. Wie gern würde ich zuhören, wenn er ununterbrochen von seiner Jugend und seinen Eltern erzählen würde, aber alles dies im Tone der Prahlerei und des Zankens anzuhören, ist quälend.«[1]
Diese mit Widerwillen vernommenen, aber präzise gespeicherten Ansprachen waren es, die Kafka schon früh zu der Überzeugung führten, dass gerade unter bürgerlichen Verhältnissen die Beziehungen zwischen Eltern und Kindern im Wesentlichen Machtbeziehungen seien: Selbst das Gute, das die Eltern tun, dient stets dem Nebenzweck, ihre absolute Verfügungsgewalt über die Kinder abzusichern und auf Dauer zu stellen. Diese Gewalt nämlich – so erfuhr Kafka tagtäglich – lässt sich viel wirksamer im moralischen Konto der Kinder verankern als in deren unbeständiger Liebe. Die Eltern belasten daher absichtsvoll dieses Konto, indem sie den Gegensatz zwischen dem eigenen, von Verantwortung beschwerten Lebenskampf und der scheinbaren Sorglosigkeit der Kinder fortwährend zum Thema machen. Wirkliche Dankbarkeit erzwingen sie mit diesem psycho-strategischen Kalkül in den seltensten Fällen, sehr häufig aber Schuldgefühle – und umso nachhaltigere und tiefere, je steiniger ihr eigener Weg tatsächlich ist (oder war). Daher der offenkundige Genuss, das Auftrumpfen, die befremdliche »Prahlerei«, mit der Kafkas Vater über lange zurückliegende Leiden sprach – geradeso, als seien es Verdienste. »Wer weiß das heute!«, rief er ein ums andere Mal, »was wissen die Kinder! Das hat niemand gelitten! Versteht das heute ein Kind!«[2] Mindestens eines seiner Kinder hatte verstanden.
Hermann Kafka wurde am 14. September 1852 in der Judengasse von Wosek geboren, in einem Teil des Dorfs, der ›Klein-Wosek‹ genannt wurde.[3] Dass er als eheliches Kind zur Welt kam, war ein Privileg, das er der erst drei Jahre zuvor erkämpften bürgerlichen Emanzipation der Juden und damit dem Erlöschen des Familiantengesetzes verdankte. Noch seinem Vater, dem Fleischhauer (Fleischer) Jakob Kafka, hatte dieses Gesetz harte Restriktionen auferlegt. Denn Jakob war weder der Älteste unter seinen Geschwistern, noch erhielt er (wie sein eigener Vater) in dem sehr übersichtlichen Klein-Wosek mit seinen etwa 150 Einwohnern[4] je die Chance, eine unbesetzte Familiantenstelle zu ergattern. So war er genötigt, seine Geliebte Franziska (Fanny) Platowski[5], die im Haus gegenüber wohnte, ›in der Dachkammer zu heiraten‹, wie man sagte, und mit ihr in einer von der jüdischen Gemeinde akzeptierten, rechtlich aber völlig ungesicherten Verbindung zu leben. Die ersten beiden Kinder, die daraus hervorgingen, waren daher unehelich und trugen vorläufig den Namen der Mutter.





























