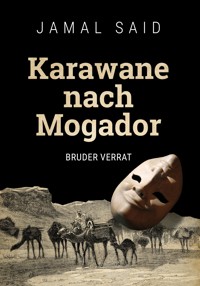
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
In den 1960er Jahren erzählt Lalla Rkia ihrem Enkelsohn in bewegenden Bildern aus ihrer Kindheit in Marokko, über das Leben ihres Vaters als Verantwortlicher im Sultanspalast, über ihre ungewöhnliche dreimonatige Reise als Zehnjährige mit einer Karawane von Fez nach Mogador, durch einsame und wilde Gegenden über eine Irrfahrt der Merzaka – einer Großtante des Autors – die mit dreizehn Jahren geraubt und auf einem Sklavenmarkt verkauft wurde. Der Autor berichtet über die Zeit der französischen Besatzung, über den vergessenen Krieg des Rif, einem Völkermord und einem Verbrechen gegen die Menschheit durch die Spanier, damals unterstützt durch französische und deutsche Giftgasspezialisten, die Senfgasbomben auf Zivilisten abwarfen und 150.000 töteten. Er schildert, wie ein einfaches Foto ein ganzes Volk in eine Massenhysterie führte, die sich in jeder Vollmondnacht wiederholte und bis zum Aufstand führte. Gleichzeitig erzählt uns der Autor über seine verschiedene Traumata, die er in seiner frühen Kindheit durchleben musste, da er mit zwei verschiedenen Vornamen leben musste, über die schmerzhafte Beschneidung, durch einen einfachen Bader oder über Misshandlungen in der Koranschule? Immer wieder tauchen erstaunliche, mündliche Überlieferungen über die marokkanische Kultur und Tradition auf, von denen heute im Ausland kaum jemand weiß. Es folgen die Jahre der Verzweiflung, die den Wunsch auslösen, ferne Horizonte zu entdecken und das alte Leben hinter sich zu lassen. Es führt ihn über den Ozean nach Irland und England. Durch ein zufälliges Zusammentreffen findet er schließlich seine große Liebe in London. Angekommen im Herbst seines Lebens, ahnte er nichts von einem gemeinen Verrat – begangen durch seinen Halbbruder und den ehemaligen Freund Hassoun.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
JAMAL SAID
KARAWANE NACH MOGADOR
*****
BRUDER VERRAT
FÜR EDITH
Im Gedächtnis an meine Großmutter Lalla Rkia
Mein Dank an Anne Faissolle für ihre Ermunterung bei der Originalversion
Andreas Wagner für seine positiven Anregungen und Anmerkungen bei der Deutschen Version
Aus dem Französischen von René Kremer
VORWORT
TEIL IMAROKKO ZUR ZEIT MEINER GROSSELTERN
TEIL IIDAS LEBEN DES JAMALS UND DES SAIDS
TEIL IIIVERRATGESICHTER VON MAROKKO – UNGEWÖHNLICH UND VERSCHLEIERT
GLOSSAR
VORWORT
Auf den folgenden Seiten, erzähle ich eine wahre Geschichte. Meine Geschichte.
Als ich seinerzeit anfing, über diese Ereignisse zu berichten, kamen mir bei jedem Schritt weitere, kleine Episoden aus meinem früheren Leben ins Gedächtnis.
Menschen, die ich mit mehr oder weniger Vergnügen erwähne, haben allesamt meine Kindheit, meine Jugend, ja, und sogar teilweise mein ganzes Leben als Erwachsener beeinflusst – jeder auf seine Art und Weise.
Alle diese Personen haben meinen Charakter geprägt. So habe ich mir das Ziel gesetzt, auch die kleinen, scheinbar unbedeutenden, sowohl angenehmen als auch schmerzhaften Fakten hervorzuheben, die die Grundlage meiner Existenz bilden.
Deshalb habe ich eine lange Reise in meine Erinnerungen unternommen und mich langsam durch die Verflechtung der vergangenen Ereignisse vorgearbeitet. Um meine Geschichte abzurunden, soll sie in einen größeren Kontext eingebettet werden. Daher greife ich einige Besonderheiten meiner Kultur, meiner Traditionen und meines Umfeldes auf, um schließlich zu einer für mich persönlich sehr schmerzhaften Episode zu gelangen: Ein Trauma hat in meiner Kindheit unauslöschliche Spuren hinterlassen und mich fortan daran gehindert, mich selbst zu entfalten. In meiner Jugend gab es dadurch vermehrt Zeiten der Unsicherheit und Verwirrung.
Irgendwann fühlte ich mich durch jene Gebote und moralische Regeln, die bei uns festgeschrieben waren, derart eingeengt, dass ich einen Ausweg suchte: Meine Heimat Marokko, damals extrem eingeschränkt und engstirnig, konnte einfach meinen Bestrebungen, meinem Wunsch nach Freiheit und Erfüllung nicht mehr entsprechen.
Schon sehr früh zeichnete sich bei mir ein Verlangen für die Ferne, für das Unbekannte ab: Ich sehnte mich danach, dem Ruf nach Abenteuern zu folgen, nach Möglichkeiten, eine mir noch unerforschte Welt zu entdecken – durch all jene Reisen, welche mittlerweile meine Persönlichkeit geprägt haben und mir mehrere Identitäten schenkten. Mit 20 Jahren war ich zu einem durchaus attraktiven Mann herangewachsen: mir wurde nachgesagt, ein angenehmes Erscheinungsbild, mit markanten Gesichtszügen, zu besitzen – insgesamt hatte ich wohl ein gefälliges, sportliches Aussehen. Ich interessierte mich schon immer für Mode und Trends, liebte die schönen Dinge und die hübschen Mädchen, auf die ich überaus anziehend wirkte.
Es war die Zeit der Flower-Power, der Freiheit, der freien Liebe, der langen Haare, der mythischen Musikgruppen. Es war eine traumhafte Phase.
Das Leben in Irland, England und München hat mir lange Zeit das Gefühl gegeben, im Exil zu leben. Dann, nach und nach, im Laufe der Jahre hatte ich zwei „Zuhause“. Ich fand mich gefangen in dieser doppelten Zugehörigkeit, immer treu verbunden geblieben mit meinen Wurzeln und doch wunderbar angepasst an meine Aufenthaltsländer, die ich alle mit der gleichen Leidenschaft und Loyalität liebte.
In regelmäßigen Abständen brachte mich ein Anfall von Melancholie zurück nach Marokko, jedoch schaffte ich es allmählich nicht mehr, dieses Land, das mein Land war, zu verstehen.
Jene geliebten Menschen, die mich seit Kindesbeinen umgeben hatten, und die meine Bezugspunkte geworden waren, sind einer nach dem anderen verschwunden.
Einige hatten sich im Laufe der Zeit charakterlich stark verändert.
Die nachfolgende Generation war mir völlig fremd.
Die Lebensweise, die Gewohnheiten, die Landschaft und vor allem die Mentalität und die Geisteshaltung änderten sich in schwindelerregender Geschwindigkeit.
Ironischerweise hat die Loslösung von diesem Land mir geholfen, mich mehr für die Vergangenheit, für meine Wurzeln zu interessieren und die Sehnsucht nach dem, was Marokko früher einmal war, in mir wieder geweckt. Ich erinnere mich zum Beispiel an die Wochenenden der 1960er Jahre, die ich alle mit meiner Großmutter verbrachte. So entdeckte ich nach und nach ihre Kindheit und ihr Leben, die mir unbekannt waren, durch nächtelange Gespräche, die wir beide gemeinsam führten.
Im Laufe der Jahre löste ich mich dann allmählich von meinem Heimatland und erkannte, dass nach fast vierzig Jahren mein wahres Zuhause München geworden ist. Ich habe mich hier immer gut und geborgen gefühlt. Hier bin ich aufgeblüht, hier habe ich mich an die Denkart seiner Einwohner gewöhnt, hier habe ich meine Öffnung zur Welt und die große Liebe meines Lebens gefunden.
Es ist mir gelungen, die Kulturen Marokkos und Europas in mir zusammenzuführen. Ich fühle mich in Deutschland ebenso wohl wie in Marokko, in Frankreich, in Irland oder in England, wo ich einige Jahre gelebt habe. Übrigens, warum sollte ich mich vom Reichtum all dieser Welten, die sich so sehr voneinander unterscheiden, abschotten? Heute liebe ich sowohl Hussein Slaoui, Abdel Halim Hafez, als auch Queen und Brel, Elvis, die Rolling Stones oder Ozzi Osborne. Ich verbringe meinen Urlaub mit meiner Frau gerne in der Einsamkeit der marokkanischen Wüste, aber auch an der Nord- oder an der Ostsee, für die ich eine tiefe Faszination entdeckt habe und die ich nicht mehr missen möchte. Ich liebe auch die wilde Westküste des County Kerry oder Galway in Irland oder die Atlantikküste in St. Jean-du-Mont oder Les Sables d’Olonne in Frankreich.
*************
TEIL I MAROKKO ZUR ZEIT MEINER GROSSELTERN
(Ende 19. bis Anfang 20. Jahrhundert)
MEINE GROSSMUTTER LALLA RKIA
Meine Großmutter, Lalla Rkia, die ich zärtlich Lalla Rackouch nannte, lebte seit dem Tod ihres Mannes vor der sechziger Jahre Jahren bei meinem Onkel. Ihre von den Jahren geprägten Gesichtszüge waren angenehm und anmutig geblieben. Lalla Rkia hatte den hellen Teint der Einwohner von Fez und musste, nach einer kürzlich erfolgten Augen-Operation zur Behandlung des Grauen Stars, jetzt eine Brille tragen. Getreu der althergebrachten Mode trug sie ein „Ktib“[1], das ihren Kopf umhüllte und ihr Haar verdeckte. Sie fügte einen Schal hinzu, den sie hinter ihren Kopf band, der ihre Stirn und Schläfen bedeckte.
Wenn sie in Gedanken versunken war, legte sie ihre Hände auf den Bauch, die Finger ineinander, während sie sich gegen ein dickes Wollkissen lehnte. Dann nahm sie ihre bevorzugte Haltung ein, kreuzte die Beine auf dem Bett in die Lotusstellung, obwohl sie mit dem Alter etwas fülliger geworden war.
Ihr ganzes Leben behielt sie ihre Liebe zu den Farben Himmelblau und Lila bei. Ihre Vorliebe für diese Blautöne spiegelte sich in den Kaftanen und großzügigen „Dfinats“[2] wider, die ihren Körper umhüllten und die Formen gemäß der Sitte verbargen. Sie wurden von ihrer „Mdamma“[3], einem breiten, mit Silberfäden fein verzierten Seidengürtel, in der Taille gehalten.
Meine Großmutter war der traditionellen Mode der Frauen aus Fez treu geblieben.
Sie bleibt bis heute eine der bemerkenswertesten Personen, die ich in meinem Leben gekannt habe. Sie besaß eine starke und charismatische Persönlichkeit, war entschlossen in ihren Entscheidungen sowie offen und direkt in ihren Aussagen. Ihr Verhalten und ihre Manieren zeugten von natürlicher Würde und Entschlossenheit. Selbst unter der Last der Jahre blieb sie instinktiv allgegenwärtig und verband in ihren Handlungen Gelassenheit und Selbstsicherheit. Diese Eigenschaften waren verbunden mit der Freundlichkeit und Sorge, die sie immer wieder an alle ihre Kinder und später an ihre Enkelkinder weitergab.
Die Generation meiner Großmutter, vom europäischen Einfluss noch unberührt, war die letzte, die alle althergebrachten Riten in ihrem ursprünglichen Zustand bewahrte, bevor die Modernisierung, die unweigerlich mit der Ankunft der Franzosen folgte, begann. Obwohl sie Analphabetin war, hatte sich meine Großmutter im Laufe ihres Lebens durch Erzählung der Älteren einen Schatz an Wissen und Praktiken angeeignet, der noch sehr lebendig geblieben war.
Diese mündlichen Überlieferungen konnten in keiner Schule, in keinem Buch erworben werden: Mütter, Großmütter, Tanten, Sklavinnen haben sie über Jahrhunderte, im engsten Familienkreis unter Frauen weitergegeben.
Es handelte sich um jene ständigen und kostbaren Werte, über tausende von Jahren hinweg geformt, die eine geheimnisvolle, unzugängliche Welt symbolisierten, aus der unsere Traditionen entstanden waren. Diese Werte waren tief und fest verankert und sowohl vom Islam als auch von den Bräuchen der Berber geprägt, als Ergebnis aus dem Gemisch von Dutzender Generationen, die seit der Gründung der Stadt hier gelebt hatten. Unsere Werte wurden stolz und hartnäckig geschützt, waren über die Zeit erstarrt, um ständig wieder zum Leben erweckt zu werden. Sie löschten das Misstrauen und die Abstände der Jahrhunderte, um die Vergangenheit zu verewigen und sie in die Gegenwart zu verlängern. Einer der Hauptbestandteile dieser Werte, besser bekannt unter dem Namen „Quaïda“[4] war eine Reihe festgelegter, ungeschriebener Regeln und uralter Traditionen. Diese Regeln bestimmten den täglichen zwischenmenschlichen Umgang untereinander.
Meine Großmutter war diesen Werten und Regeln leidenschaftlich verbunden. Das bedeutet mündlich weitergegebene, nicht religiöse Verhaltensregeln, die einem von frühester Kindheit an beigebracht werden. Es sind im Großen und Ganzen die Regeln des Savoir-vivre, klar und präzis, die darin bestehen, das Verhalten untereinander, wie das allgemeine Benehmen und die Zeremonien im täglichen Zusammenleben, zu harmonisieren, zu kräftigen und zu stärken. Quaïda ist eine außerordentliche Kraft, fast ein Zwang, allgegenwärtig in der Sprache, in den Gesten, die alle Lebensbereiche einnehmen und betreffen. Tiefgreifend verwurzelt in jeder Person erlaubt sie unter keinen Umständen irgendwelche Abweichungen, Befreiungen oder eigenmächtigen Ungehorsam auf die Gefahr hin eine Zurechtweisung zu erhalten.
Die „Quaïda“ bestimmt auch den Bereich der „Âada“. Das sind Kulthandlungen und Riten, die Gesamtheit der jahrhundertelangen Regeln untereinander, wie sie sich im Laufe der Zeit geformt haben, aber die durchaus voneinander abweichen und unterscheiden können in den verschiedenen Regionen des Landes.
Eine der unübersehbaren und häufigsten Demonstration der Quaïda ist die „Souab“: Das sind die Höflichkeitsformeln und der Anstand. Die verschiedenen Gedankenmuster und Formulierungen, die in der marokkanischen Souab variieren, sind langwierig, blumig, reichhaltig und aufwändiger als in den Kulturen des Abendlandes.
Dann gibt es noch den Begriff „Hschouma“, ein Fauxpas anderen gegenüber, umfasst aber mehr oder weniger harmlose Verhaltensformen, die von Bescheidenheit bis zu Schande und Entehrung reichen können.
In der Tat hatten die Einwohner von Fez eine tiefe Verachtung für allzu heftige Veränderungen und Wirbelstürme des Lebens. Diese eher zarten, zurückhaltenden, würdevollen Menschen führten ein kultiviertes, komfortables Leben. Sie genossen gutes Essen und schätzten den Wohlstand.
Im Falle zum Beispiel von Streitigkeiten verpflichtet die „Hschouma“, Konfrontationen zu vermeiden. Man sucht die Vermittlung von ehrenwerten Personen, die „Kelma“ besitzen („das Wort“). Respektvolle Persönlichkeiten für schwierige oder sensible Verhandlungen. Das Augenmerk der Marokkaner liegt auf mystisches und emotionales Vorgehen. „Was werden die anderen denken? Was würden sie sagen?“, sind die entscheidenden Parameter, um Entschlüsse zu fassen.
Man könnte ein Buch füllen über die Quaïda, über ihre absolute Macht und Unveränderlichkeit. Im Gegensatz zu den Landessitten im Abendland, die ständig Entwicklungen und Veränderungen durchmachen, umfassen die Einzelheiten der Quaïda, alle Schritte von der Geburt bis nach dem Tod. Nichts in der Quaïda wird dem Zufall oder dem Willen des Menschen überlassen. Und das ist ohne Zweifel etwas, das ihre Bedeutung und Dauer ausmacht.
******************
In der Jugendzeit meiner Großmutter war die moderne westliche Medizin, damals noch in den Kinderschuhen, in Marokko wenig bekannt, um nicht zu sagen gar nicht vertreten. Da meine Großmutter sehr neugierig war, beeinflussten zahlreiche Beobachtungen und Lernprozesse ihr Leben. Sie hatte sich zum Beispiel mit der Anwendung der Heilmittel ihrer Vorfahren vertraut gemacht. Sie wusste, wie man wilde oder gezüchtete Kräuter und ihre Eigenschaften erkennt, und vor allem hatte sie die Kunst erlernt, mit zahlreichen Gewürzen aus fernen Ländern umzugehen, und schätzte deren Wohltaten für die Gesundheit.
Geprägt von Mystizismus und Spiritualität war sie in der Lage, die Geschicklichkeit und Fähigkeiten bekannter Heiler zu beurteilen. Sie glaubte fest an die „Baraka“*[5] und die starken Tugenden dessen, was wir gemeinhin „Nnia“[6] nennen. Nnia ist nichts anderes als der Einfluss des Denkens auf das Unterbewusstsein, mit anderen Worten, Suggestion oder Autosuggestion, der Placebo-Effekt.
So wusste sie, an welche „Marabuts“[7] sie sich wenden konnte. Sie kannte ihre Besonderheiten, ihre Attribute und die Schritte, die man mittels der Nnia unternehmen musste, um an ihre Baraka zu glauben und bei leidtragenden oder in Schwierigkeiten geratenen Verwandten die Autosuggestion anzustoßen. In den meisten Fällen waren die Ergebnisse unwiderlegbar, mit positiven Folgen, da sie zu einer Erleichterung oder sogar zur Genesung führten. Bei uns eine jahrtausendalte Praxis, die mich aber auf seltsame Weise an die Methode erinnert, mit der Emile Coué[8] in ganz Europa und Amerika zur selben Zeit vor gut hundert Jahren berühmt wurde. Einer der Züge, die meine Großmutter charakterisierten, war ihre grenzenlose Hingabe und ihre Nähe zu denjenigen unter uns, die aus welchem Grund auch immer litten oder unglücklich waren.
Sie nahm sich die nötige Zeit, um uns, ihren Kindern, Schwiegertöchtern und Enkeln zu helfen, saß nahe bei uns, hörte zu, analysierte, schlug Lösungen vor oder ergriff sogar die Initiative, bestimmte Aufgaben zu erfüllen. Sie war eine Quelle des Trostes.
Ich weiß nicht, durch welches Geheimnis eine solche Aura von ihrer Person ausging. Sie strahlte Wellen des Wohlwollens aus, und allein ihre Anwesenheit genügte, damit wir diesen Schutz, dieses Gefühl der Unverwundbarkeit spüren konnten. Sie war gleichzeitig für uns eine Unterstützung, und eine Zuflucht.
Sie gab mir mein Taschengeld und sorgte auch für mein seelisches Wohlbefinden, indem sie mir jeden Tag ihre „Baraka“[9] gab. Sie betete für mein Glück und mein Wohlergehen. Vor allem hatte ich den Eindruck, dass sie mich mit dieser tiefen und unsichtbaren Zärtlichkeit überhäufte, die nur Großmütter zu geben imstande sind.
Ihr zuliebe taten wir alles Mögliche, um sie nicht zu verstimmen. Ihre Kinder, sogar als Erwachsene, ihre Schwiegertöchter und wir, ihre Enkelkinder, alle ohne Ausnahme, begrüßten sie mit Respekt, indem wir ihre Hand jeden Morgen beim Frühstück und abends beim Nachhause kommen küssten. So wollte es die Tradition gegenüber unseren Vorfahren; eine Tradition, die leider mit der Zeit verschwunden ist.
Jeden Samstag, spät abends, wenn alle zu Bett gegangen waren, blieb ich länger bei ihr. Wir redeten über alles oder nichts. In unseren Gesprächen kam es vor, dass sie mir ab und zu von ihren Erinnerungen an eine Zeit, die längst entschwunden war, erzählte.
Von der Neugier angestachelt wurde mir klar, dass ein Teil des Lebens dieser Frau, der ich seit meiner Geburt so nahestand, mir eigentlich unbekannt war.
Von diesem Augenblick an entstand in mir ein intensiver Wunsch, sie besser zu ergründen: die Schattenzonen zu verstehen und mir ein Bild von ihrem vergangenen Leben, von ihrer Umgebung zu machen und gleichzeitig ein Gefühl für das Marokko ihrer Kindheit und Jugend zu bekommen.
Ihr umfangreiches Gedächtnis verdiente Respekt. Ich war so bewegt, so beeindruckt, dass sie mir auch im hohen Alter, mit erlesener Beredsamkeit, mit aller notwendigen Klarheit und Gründlichkeit, noch Fakten und Details erzählen konnte, die sich mehr als ein halbes Jahrhundert zuvor ereignet hatten. Ich war fasziniert, wenn sie genauestens den Wochentag, die Jahreszeit eines Ereignisses nannte, sogar die Speisen, die bei dieser Gelegenheit gekocht wurden.
Ich ließ mich dann durch ihre Erzählungen verzaubern. Diese, indem sie mir ein köstliches Vergnügen bereiteten, beförderten mich in die jeweilige Zeit hinein. So reiste ich durch ihre Berichte in einer Welt umher, die mir so geheimnisvoll und faszinierend erschien, dass es für mich dringend notwendig war, in sie einzudringen.
Monatelang stillte sie allmählich meinen Wissensdurst. Diese Gespräche unter vier Augen mit meiner Großmutter waren zu einem Ritual geworden, das mir erlaubte, ihre Kindheit, meinen Großvater, meinen Urgroßvater und die Gründe für ihren Umzug von Fez nach Mogador zu wissen und sie so besser zu verstehen.
Es ist jetzt an der Zeit, dass ich einige Episoden und Details aus ihrem Leben erzähle. Meine Wahl hat sich nur an den Ereignissen orientiert, die mich am meisten beeindruckt haben.
Meine Großmutter wurde in Fez geboren. Ihre Vorfahren waren über Generationen hinweg Nachkommen von Fassis[10]. Ihr genaues Geburtsdatum kannte sie nicht, weil sich die Menschen früher nicht um persönliche Daten sorgten. Die Zeitrechnung folgte der Regierung der Sultane.
Nach bestimmten in Marokko bekannten historischen Fakten zu urteilen, schätzte ich, dass ihr Geburtsjahr im ausgehenden neunzehnten Jahrhundert lag.
Als kleines Mädchen brachte ihr ihre Mutter das Sticken bei, unter den wachsamen Augen einer fachkundigen Nachbarin. Ihrem Vater, Si Guennoun, wurde das niemals erzählt, da er jedes Ausgehen kategorisch verboten hatte. So wollte es die Tradition der damaligen Zeit.
Die Fassi-Stickerei-Kunst, mehrere hundert Jahre alt und auch heute noch berühmt, wurde im ganzen Land hochgeschätzt. Somit hat meine Großmutter seit frühester Kindheit einen Beruf erlernt. Bereits als Jugendliche beherrschte sie in höchster Vollendung die Kunst der Makhzenischen[11] (königlichen) Küche, bestehend aus mehreren Geschmacksrichtungen. Sie hatte ein gewisses Talent für die Herstellung der raffinierten Kuchen, die ich so sehr liebte, gewürzt mit Honig, Zimt und Mandeln. Später gab sie diese Rezepte unverändert an ihre Tochter (meine Mutter) und Schwiegertöchter weiter. Später erzählte mir meine Großmutter, wie sie gelernt hatte, diese originelle Küche zuzubereiten. Ähnlich und doch anders als die Küche aus Fez, unterschieden von der marokkanischen oder beduinischen Hausmannskost. Sie hatte ein bemerkenswertes Geschick bei der Organisation von „Diffa“[12] und leitete taktvoll jeden Schritt in der Küchenarbeit, wobei alles, wie von der „Quaïda“ vorgeschrieben, von Hand erledigt wurde.
*******************
MEIN URGROSSVATER IM DIENST DES SULTANS
Meine Großmutter sprach gern und mit großem Stolz über ihren Vater Si Abdelmajid Guennoun. Er stand in den Diensten von Sultan Moulay Hassan I, der in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts regierte. Dieser Sultan, von dem man sagte: „Sein Pferd ist sein Thron“, war ein charismatischer Führer, der während seiner Herrschaft ständig durch Marokko umherreiste. Umgeben von seinem Hof und einem Heer von dreißig- bis vierzigtausend Soldaten behauptete er seine Präsenz in den Gebieten der Sahara. Er befriedete die arabischen oder berberischen Stämme, die in Revolte gegen die Zentralmacht standen.
Das „Cherifianische Reich“ war schon immer ein Staat mit einer variablen Geometrie gewesen. Seine Form und seine Fläche änderten sich je nach Prestige und Autorität der Makhzen. Es setzte sich aus dem „bled Makhzen“[13] und dem „bled Siba“[14] zusammen. Erstere waren Territorien bevölkert mit loyalen Stämmen unter der effektiven Kontrolle des Sultans, letztere waren Hochburgen aufständischer Stämme, die sich in regelmäßigen Abständen gegen die zentrale Autorität auflehnten.
Die aufständischen Regionen waren bunt zusammengewürfelt, untereinander sehr gegensätzlich, unfähig sich zu strukturieren und zu vereinigen, sie neigten dazu, ständig auseinander zu driften und waren so nur eine geringe Gefahr für die Staatsmacht.
Sie lehnten sich auf gegen die eingeforderten überhöhten Steuern und Abgaben, aber sie anerkannten vor allem die Legitimität des Sultans als geistliche und religiöse Autorität, ein direkter Nachkomme des Propheten, der über die „Baraka*“ verfügte. Infolge dessen, könnte die vergängliche weltliche und politische Macht des Sultans ihm streitig gemacht werden, aber seine religiöse Macht als „Amir El Mouminin“ (Oberhaupt der Gläubigen) und seine heilige Abstammung machten ihn unantastbar.
Man vergötterte und verehrte ihn, grüßte ihn mit der allergrößten Ehrerbietung, da er die geistliche und moralische Autorität repräsentierte.
In einigen ländlichen Gebieten mit knallharter kriegerischer Veranlagung kam es seit Jahrhunderten regelmäßig zu Rebellionen. Nur eine Machtdemonstration konnte diese Stämme dazu bewegen, einen Führer anzuerkennen und ihre Steuern zu zahlen. Dies zwang den Sultan manchmal zu „Mehallas“[15], um deren Kampfeslust zu brechen und sie seiner Autorität zu unterwerfen.
Es war allgemein üblich, die Aufwiegler und Anführer zu enthaupten, andere landeten in den Gefängnissen und sahen das Tageslicht nie wieder. Ihre Häuser wurden dem Erdboden gleichgemacht und ihre Familien zerstreut. Die abgetrennten Köpfe wurden eingesalzen und an die großen Tore der Städte Fez, Meknès oder Marrakesch aufgehängt. Diese Methoden sollten mögliche Widerspenstige abschrecken. Hatte der Sultan seinen Zorn besänftigt und Verzeihung gewährt, wurden neue, fügsamere Fürsten in diesen Regionen ernannt, die wieder Ruhe herstellten und regelmäßig Steuern zahlten.
Mein Urgroßvater war Teil dieser Königlichen Suite; er war tief geprägt vom Makhzen, der Regierung von Marokko, damals „Empire chérifien“[16] genannt.
Die Sultane hatten schon immer ihre Mitarbeiter unter den Fassis ausgewählt. Diese dominante, gebildete Klasse übte ihre Macht in allen Bereichen aus. Sie hatte das, was man „Kelma“[17] nannte.
Sein „Wort“, d. h. seine Stimme, zu behaupten, war der Ehrgeiz des Gefolges des Sultans. Das „Kelma“ ist auch heute noch das Streben eines jeden Marokkaners. Der Besitz des Kelma ermöglicht es, die Probleme zu verflachen und zu ebnen, es bringt Selbstgefälligkeit und schafft Privilegien.
Im Laufe der Zeit entwickelten die Mitarbeiter des Makhzen ihre Bräuche, Überzeugungen und Verhaltensweisen. Ihr besonderer Kleidungsstil unterschied sie deutlich vom Rest der Bevölkerung.
Diese privilegierte, geschickte, disziplinierte und dem Thron unterworfene Klasse bildete einen Kontrast zur Anarchie und Disziplinlosigkeit der übrigen marokkanischen Bevölkerung. Diese Mitglieder im Makhzen waren dem Sultan lebenslang treu ergeben. Sie bewiesen Arroganz und Verachtung für die Regierten, obwohl sie wussten, dass sie über Nacht in Ungnade fallen könnten.
An diese Lebensweise angepasst, begleitete Si Guennoun den Sultan auf all seinen Reisen oder „Mehallas“. Er nahm die Position ein, die man damals „Amine Schakkara“ nannte. Diese Funktion entspricht dem, was man heute mit Finanzverwalter oder Schatzmeister am Hofe des Sultans übersetzen könnte. Diese Funktion hatte Si Guennoun offensichtlich von seinem Vater geerbt, so wie es damals üblich war.
Si Guennoun verantwortete die Verwaltung der Schatzkammer und die Versorgung des Palastes, damit nichts dem Wohlergehen und dem Komfort des Sultans schaden konnte. Er musste sicherstellen, dass die an der königlichen Tafel servierten Gerichte gemäß der Makhzenischen Tradition und in Übereinstimmung mit dem Protokoll zubereitet wurden. Mit viel Aufmerksamkeit fürs Detail kostete er jedes Gericht, bevor es aufgetragen wurde.
Selbst während der langen Reisen und häufigen Auseinandersetzungen zwischen den Kriegern mussten die Mahlzeiten nach dem Geschmack des Sultans auf raffinierte und exquisite Weise zubereitet werden.
Im Laufe der Zeit ließ mein Urgroßvater diese Küche vorschriftsmäßig in seinem Haus einführen. Seine Frau M’ftaha, meine Urgroßmutter, übernahm sie zur Vollendung. Später brachte sie sie meiner Großmutter, als diese noch ein junges Mädchen war, bei. Diese brachte sie wiederum meiner Mutter und anschließend ihren Schwiegertöchtern bei. Diese königliche Küche war nun „unsere Küche“ geworden; unsere Gäste schätzen sie noch heute.
****************
Sultan Moulay Hassan I. verließ 1894 Marrakesch, um eine Rebellion in der Region Tadla zu unterwerfen. Aber, wie es der Zufall wollte, verstarb er unterwegs im Dissidentengebiet, da er bereits durch eine Hepatitis geschwächt war.
Die Lage war nun mehr als angespannt und man befürchtete, dass die Nachricht einen plötzlichen Angriff feindseliger Stämme oder irgendeine Form der Revolte durch andere, in der Defensive befindliche Stämme auslösen würde. Also hielt man seinen Tod geheim und der Tross setzte seinen Weg fort.
Im Lager war das königliche Zelt immer in der Mitte aufgebaut, verschanzt hinter Zeltwänden. Ringsherum waren weitere Zelte aufgestellt, in denen der Harem des Sultans untergebracht war, alles abgeschirmt hinter großen Leinwänden, mit einem gewissen Abstand zur Truppe.
Mit Ausnahme einer kleinen Anzahl Bediensteter konnten sich nur wenige Personen dem Sultan nähern. Si Guennoun hatte wahrscheinlich bis zu einer gewissen Entfernung Zugang zu ihm, da er das Protokoll der Mahlzeiten überwachte. Der engste Mitarbeiter des Sultans war der mächtige und allgegenwärtige Kammerherr, der alle seine politischen oder militärischen Befehle bekannt gab. Er wurde Ba H’mad genannt, aber sein richtiger Name war Ahmed ben Moussa, ein ehemaliger Mokhazni[18], Sohn eines Sklaven. Er war gerissen, grausam, mit einem unbeugsamen Willen, wie er sich noch zeigen sollte. Denn nach dem Tod des Sultans sollte er eine entscheidende Rolle im politischen Leben des Landes spielen.
Ba H’mad unterbrach jeglichen Kontakt zwischen dem Zelt und der Außenwelt und ordnete sofort an, dass der Körper des verstorbenen Sultans gewaschen und heimlich angezogen werden sollte. Am nächsten Tag nach dem Fajr-Gebet im Morgengrauen wurde er in seiner Sänfte, die von zwei Maultieren getragen wurde, festgebunden. Ein Vorhang wurde über die Fenster gezogen, aber man konnte ihn drinnen sitzen sehen.
Von Zeit zu Zeit eilte Ba H’mad zur Sänfte hin, verbeugte sich, öffnete die Tür und bückte sich respektvoll, um die Hand des Sultans zu küssen. Er tat so, als würde er ihm zuhören, und antwortete laut: „Ja, mein Herr, Ihre Befehle werden sofort ausgeführt!“. Dann rief er diesen oder jenen Wesir oder Kaïd herbei, der sich aus einer gewissen Entfernung näherte und übermittelte ihm die vermeintlich gehörten Befehle des Sultans.
Sein Tod wurde erst einige Tage später offiziell bekannt gegeben, als die Kolonne in Rabat eintraf. Hier wurde er neben seinem Vater beigesetzt.
Infolge der Intrigen von Ba H’mad wurde der älteste Sohn des verstorbenen Sultans von der Erbfolge ausgeschlossen, übrigens nicht ohne Probleme und Spannungen. Ba H’mad behauptete, dass Moulay Hassan, als er starb, ihm seinen letzten Wunsch ins Ohr flüsterte, dass sein jüngster Sohn Abdelaziz, damals vierzehn Jahre alt, sein Nachfolger werden sollte. Es gab jedoch kein schriftliches Dokument, um diese Anordnung zu belegen.
Der erstgeborene Sohn wurde unter Hausarrest gestellt. Aber er hatte seine Sympathisanten, die die vollendeten Tatsachen ablehnten. Überall im Land entstanden Rebellionen, da mehrere Stämme und die Ulemas von Fez lieber den ältesten Sohn Moulay M’hemed auf dem Thron sehen wollten. Freiwillig oder mit Gewalt überzeugte Ba H’mad die Widerspenstigen, proklamierte sich selbst zum Großwesir und regierte das Reich im Namen des jungen Sultans bis zu seinem Tod. Er nutzte die Gelegenheit, um ein kolossales Vermögen anzuhäufen, und ließ in Marrakesch den Palast „Bahia“ errichten, der noch heute besichtigt werden kann.
Der Makhzen wusste, dass die großen Würdenträger ihren Reichtum auf dem Rücken des Volkes anhäuften. Nach ihrem Tod enteignete man sie von all ihren Gütern, vereinnahmte sie und zerstreute ihre Familien. Dies war auch bei Ba H’mad der Fall.
******************
Ich kenne den Grund nicht, warum Si Guennoun nach dem Tod des Sultans seinen Posten im Palast aufgab. Vielleicht war er nicht damit einverstanden, dass ein „Jugendlicher“ zum Sultan gemacht werden sollte in solchen stürmischen und turbulenten Zeiten, die sich bereits angekündigt hatten. Meine Großmutter war damals noch nicht geboren.
Meine Urgroßmutter, die bereits zwei Knaben zur Welt gebracht hatte, war mit meiner Großmutter schwanger, als Si Guennoun die Entscheidung traf, allein in den Senegal zu ziehen, um dort Handel zu treiben. Meine Großmutter war erst drei Jahre alt, als ihr Vater nach Marokko zurückkehrte: Jedoch vertraute sie mir an, dass sie sofort eine Verbundenheit mit diesem für sie Fremden empfand.
Si Guennoun hatte schwarze Sklavinnen mitgebracht, die seine Konkubinen wurden. Seine Favoritin war Dada Messouda, sie sprach kaum Arabisch und schenkte ihm einen Sohn. Später nahm sie einen dominierenden Platz in der Familie ein, indem sie die Kinder aufzog, einschließlich meiner Großmutter, die sie verehrte.
Mein Urgroßvater hatte auch einen roten Papagei mitgebracht. Dieser war jahrzehntelang sein Begleiter.
Die Sklavinnen waren getrennt untergebracht, aber sie wurden weder angekettet noch in irgendeiner Weise misshandelt. Im Gegenteil, sie genossen eine gewisse Freiheit und waren ordentlich gekleidet und ernährt. Sie trugen Gold- oder Silberschmuck, waren Teil des Harems, kümmerten sich um das Haus und standen Si Guennoun, wie ich vermute, für seine persönlichen Bedürfnisse zur Verfügung. Meine Großmutter ging jedoch nicht gerne auf diese intimen Details ein.
Einige Zeit später rief der Großwesir Ba H’mad Si Guennoun zu sich und drückte ihm seinen Unmut darüber aus, dass er Marokko verlassen hatte, ohne seine Vorgesetzten zu informieren. Er forderte ihn unverzüglich auf, an seinen Posten im Palast zurückzukehren. Mein scharfsichtiger Urgroßvater, der vielleicht dunkle Ereignisse aufkommen sah, bat darum, von dieser Verantwortung befreit zu werden. Er erklärte sich jedoch damit einverstanden, im Dienst des Makhzen zu bleiben. Er bewarb sich um eine Stelle fernab der Hauptstadt. Seinem Antrag wurde stattgegeben, und einige Monate später wurde er zum „Amine“, d. h. zum Verwalter, eines Hafens ernannt. Er hatte die Wahl zwischen Tanger und Mogador.
Si Guennoun entschied sich für Mogador. Er begab sich auf eigene Faust dorthin und machte sich auf die Suche nach einem Zuhause für seine Familie, die später zu ihm nachkommen sollte.
*******************
Während seiner Regentschaft konnte der neue junge Sultan Moulay Abdelaziz seinen Aufgaben nicht gerecht werden, er hatte weder das Kaliber noch das Charisma seines Vaters. Unerfahren, schwach, mittelmäßig und ohne große Bildung verbrachte er seine Zeit mit Unterhaltung und Vergnügen. Gerne umgab er sich mit Europäern, vor allem mit Engländern, welche geschickt und findig die Gunst zu nutzen wussten, ihn mit sämtlichen mechanischen oder elektrischen Neuheiten auszustatten. Um ihn zu beschäftigen, lieferten sie Fahrräder, Automobile, Waffen, Fotoapparate und sogar eine richtige Lokomotive, alle diese Dinge um Vorteile für sich selbst oder auch für ihr Land zu erlangen.
In seiner gesamten Regentschaft von 15 Jahren gab es dauerhaft Aufruhr und Aufstände, die einen gegen die anderen. Kaum wurde hier ein Brand gelöscht, fing dort schon wieder ein neuer Herd an zu brennen.
Die Steuereinnahmen wurden immer weniger, mussten mit „Harkat“[19] eingetrieben werden. Die meisten Stämme weigerten sich, Steuern zu zahlen, jagten die Truppen des Sultans in die Flucht, trotz der Unterstützung einiger englischer, französischer oder türkischer Offiziere.
Der junge Sultan leerte die Staatskasse aufgrund seiner exorbitanten Ausgaben.
Fahnenflucht und Desertieren der Soldaten häuften sich, da ihr Sold nicht mehr bezahlt werden konnte. Einzige Zahlungsmittel waren die Darlehen und Kredite der europäischen Mächte, die das Königreich schwerlich zurückzuzahlen in der Lage war.
Das „Empire chérifien“ (Königsreich Marokko), weit entfernt vom Ruhm vergangener Zeiten, als es sich noch von Andalusien bis nach Schwarzafrika erstreckte oder als es jahrhundertelang die ottomanisch-türkischen Ambitionen an seiner Ostgrenze in Schach hielt, war im Laufe der Jahre geschrumpft und erstarrt. Es war immer unverändert und mit sich selbst identisch geblieben. Man sah seinen Niedergang beginnen bis zum unausweichlichen Verfall. Marokko hatte sich von den Fortschritten der industriellen Revolution, die Europa mitgerissen hatte, abgewendet und sich auf sich selbst zurückgezogen. Es war somit veraltet und ins Stocken geraten. Das Land stand am Rande des Abgrunds und hatte seine Existenz fast aufgegeben. Es erlebte eine Epoche der Dämmerung seiner Geschichte und wurde deshalb die Beute rivalisierender europäischer Mächte, die darauf erpicht waren, es zu kolonisieren.
Plötzlich kamen an sämtlichen Orten Aufwiegler zum Vorschein, um die Menschenmengen aufzuhetzen und Aufstände zu provozieren.
So geschehen im Süden, „Maa El Ainin“ (Wasseraugen), ein Stammesführer in der Sahara, rief zum heiligen Krieg gegen die Franzosen auf wegen Übergriffen aus Algerien. So im Norden, dort formte ein Schurke namens Raissouni eine kleine Armee, verbreitete Terror und Angst, entführte englische und amerikanische Staatsbürger, nahm sie im Jahr 1904 als Geiseln und entließ sie erst gegen Zahlung eines Lösegeldes. Er wollte dadurch einen internationalen Zwischenfall provozieren, um den Sultan von Marokko in Bedrängnis zu bringen.
Amerikanische Kriegsschiffe tauchten auf vor der Küste in Tanger, um jederzeit sofort einzugreifen.
Schließlich fasste man den Berber Raissouni, sperrte ihn im Gefängnis auf der Insel vor Mogador ein. Von dort konnte er ausbrechen, streifte einige Tage in der Stadt herum und nahm seine ursprünglichen Aktivitäten wieder auf. Er verlangte ab sofort „Pascha von Tanger“ genannt zu werden. (Diese Geschichte wurde mit Sean Connery verfilmt mit dem Titel „Der Löwe und der Wind“). Fast zur gleichen Zeit tauchte ein anderer exzentrischer Abenteurer namens Bou Hmara (Mann mit dem Esel) auf, der vorgab, der älteste Sohn des verstorbenen Sultans zu sein, wie er auch, behauptete, Träger der Baraka (Segenskraft) zu sein. Ein Mann mit großer Redegabe, überzeugend, ein Menschenführer geschickt und raffiniert.
Es gelang ihm, eine richtige Armee zu bilden, um mehrere Stämme im Norden gegen den Sultan aufzubringen. Bou Hmara trotzte dem Sultan während einiger Jahre zwischen Taza, Oujda und dem Rif Gebirge. Man organisierte mehrere militärische Expeditionen, an denen sich auch ausländische Söldner beteiligten, um ihn zu besiegen und ihn nach beachtlichen Anstrengungen einzusperren. Schließlich beförderten diese Unruhen einen zu einem glücklichen Mann: den machiavellistischen Moulay Hafid, ein älterer Bruder des Sultans Moulay Abdelaziz, und sein Khalifa (Vizekönig) in Marrakesch rebellierte gegen ihn. Er gründete seine eigene Armee, vereinte die Stämme Marokkos und bekämpfte seinen Bruder. Der Sultan wurde besiegt und von allen im Stich gelassen.
Moulay Hafid wurde 1909 zum Sultan erkoren, war aber gezwungen Frankreich, als die Schutzmacht anzuerkennen. 1913 musste er abdanken.
Ohne Zweifel hatte Si Guennoun sehr gute Gründe, sich für eine entfernte Stadt zu entscheiden, weit weg von den Unruhen im Norden.
*****************
Mogador, weit von der Hauptstadt entfernt, war eine angenehme Stadt, immer noch dynamisch und voller Geschäftsmöglichkeiten, obwohl ihre Blütezeit vorbei war. Es war der einzige Zugang zur See für das gesamte Südmarokko. Unzählige Kamelkarawanen strömten dorthin und brachten exotische und seltene Waren aus Marrakesch, Timbuktu, Agadez oder anderen Gebieten des Sudan[20] mit.
Von Mogador aus wurden Leder, Häute, Teppiche, Elfenbein, Straußenfedern, Datteln, Oliven, Honig, Mandeln, Feigen und Rosinen nach Europa ausgeführt. Dieser Handel wurde insbesondere mit Marseille, London, Manchester, Amsterdam oder Livorno abgewickelt. Aus Europa wurden vor allem Metallwaren, viel Tee, Zucker und Baumwolle eingeführt.
Eine große jüdische und muslimische Gemeinschaft, die sich auf den internationalen Handel spezialisiert hatte, lebte seit Generationen in Mogador.
******************
DAS LEBEN DER FRAUEN IN FEZ ZUR JAHRHUNDERTWENDE
Eines Abends während eines unserer Gespräche offenbarte mir meine Großmutter nebenbei, dass in ihrer Kindheit, als sie das Leben und die Bräuche ihrer Zeit noch erlernte, die guten Sitten den Frauen aus guter Gesellschaft vorschrieben, niemals auf die Straße zu gehen. Ich war entsetzt und fragte sie: „Aber was taten diese Frauen, wenn sie den ganzen Tag eingesperrt waren denn anderes, als sich zu Tode zu langweilen?“
So erfuhr ich, dass diese Frauen, entgegen dem, was ich mir bisher vorgestellt hatte, einen Zeitvertreib und eine tägliche Beschäftigung hatten. Die Terrassen auf den Dächern der Häuser, für Männer nicht zugänglich, waren ein „Königreich“, das ausschließlich der Frauen vorbehalten war, die sich dort versammelten. Je mehr sie mir aus ihren Erinnerungen erzählte, spürte ich, wie sich in ihrem Blick die Freuden ihrer Kindheit und eine gewisse Nostalgie widerspiegelten. Ich konnte mir die Atmosphäre dieser Szenen vorstellen, deren Zeugin sie gewesen war. Ich glaubte, einen poetischen, traumhaften, ja märchenhaften Orient wieder zu erleben. Nachmittags und früh abends war meine Vorstellung am eindrucksvollsten, wenn die Altstadt sonnendurchflutet war, angenehm und wunderschön.
Die Luft duftete nach Frühling, Orangenblüten, Rosen oder Weihrauch. Der azurblaue Himmel über der Stadt war belebt vom Flug umherwirbelnden Tauben, die mit lautem Flügelschlagen im Zickzackkurs zwischen den Häusern und Gassen auf der Suche nach jedem verlorenen Getreidekorn oder Krümel waren. Die pfeilschnellen Schwalben flogen ihre Streifen durch die Luft und stürzten sich jagend auf Insekten. Die Störche, die hoch oben in der heiligen Stadt weilten, segelten, glitten, schwebten lässig umher und kehrten dann in ihre Nester zurück. Stolz breiteten sie ihre eleganten Silhouetten, ihre langen Schnäbel und Stelzen aus, thronten auf den Ruinen der Stadtmauern oder hockten auf den Spitzen der Minarette.
Wenn die Ehemänner am Nachmittag, nach der Siesta und dem „Assr“-Gebet[21], ihren Geschäften nachgingen, stiegen die Frauen behäbig auf die Terrassen hinauf. Zu ihren Füßen, soweit das Auge reichte, lagen die weißen Terrassen der Altstadt, der unendlichen Medina, die Minarette, die smaragdgrünen „Koubas“[22] der Marabuts und die Stadtmauern, die über die Jahrhunderte von der Sonne verbrannt und rissig geworden waren. Mittendrin schlängelten sich die „Souks“[23] mit ihren exotischen und malerischen Farben, ihrem dunklen, geheimnisvollen, Gassengewirr, welche die Vergangenheit wieder aufrührten. Der die Stadt durchquerende Oued Fez[24] brachte das unerschöpfliche Wasser aus dem Atlasgebirge, das den Durst der Bewohner des Ortes löschte, die Gärten bewässerte, durch die Paläste floss und im Sommer die Stadt erfrischte. Als Kulisse hatte die Medina auf der einen Seite Olivenbäume, die in den Tälern und auf den grünen und bläulichen Hügeln gepflanzt waren, und auf der anderen Seite die Gersten- und Weizenfelder, die Weinberge, die die Täler grün und gelb überzogen.
Treppen führten in den Häusern auf die Terrassen. Durch eine oberste Tür marschierten die Frauen, große, rassige, raffinierte, schlanke Gestalten, auf die Dächer ihrer Häuser und ließen sich auf weißgetünchten und sonnengebadeten Trennmauern zwischen den Häusern nieder. Sie schminkten sich die Augen mit Antimon, ihre Wangen rosa und ihre Hände mit Henna. So waren alle Terrassen in Fez von bemerkenswerten Frauen bevölkert. Unter ihnen befanden sich ältere Frauen, aber auch Kinder. Ihre Kleidung zeugte von ihrem großen Wohlstand.
Gekleidet waren sie mit schönen Tuniken und Kaftanen aus Seide, in glitzernden Farben verziert, durchgewirkt und bestickt. Die Taille war mit breiten, silber- oder goldverzierten „Mdamma“[25] umwickelt. Ihre Häupter waren bedeckt mit Ktibs, die ihre langen, schwarzen Haare durchscheinen ließen. Ihre Stirn war mit Perlen oder alten Goldmünzen geschmückt, die mit einer dünnen Kette um den Ktib gebunden waren. Die langen, weiten Ärmel ihrer Fassi-Gewänder waren hochgekrempelt und durch dünne Schulterriemen aus Gold- oder Silberseide festgehalten.
Die Ärmel bedeckten kaum ihre nackten Arme, geschmückt mit sieben Goldarmbändern, fein mit orientalischen Motiven ziseliert. An ihren Füßen konnte man Lederpantoffeln in verschiedenen Farben erkennen und manchmal sogar Ringe an den Knöcheln. Es war ihr Ziel, ihren Wohlstand zu zeigen und ihre Nachbarinnen eifersüchtig zu machen. Sie verbargen ihre Eitelkeit nicht. Im Gegenteil, mit Begeisterung veränderten sie täglich ihre Kleidung und ihren Schmuck. Der leichte Frühlingswind brachte den Musselin und die Seide zum Vibrieren, das Licht spielte sanft in diese Farbenfülle hinein und ließ die Juwelen funkeln.
Die Häuser waren untereinander verbunden und nur durch kleine Mauern getrennt. Die Frauen konnten sich dadurch mit Hilfe von kleinen Leitern von einer Terrasse zur anderen begeben. Sie besuchten sich gegenseitig, wandelten in kleinen Gruppen umher und beobachteten den Trubel in den Straßen. Sie verständigten sich mit den Frauen auf den etwas entfernteren Terrassen mittels eingespielter Zeichen. Sie setzten sich auf niedrige Mauern, Brüstungen, weiche Kissen, Wollteppiche, um sich dem Tratsch und der Heiterkeit zu widmen und die neuesten Nachrichten auszutauschen. Wie von Sinnen lachten sie schallend, vertrieben sich die Zeit mit dem Kosten von Honig-, Zimt- und Mandelkuchen oder parfümierten sich mit Tropfen von „Ouerd“[26] oder „Zehr[27]“. Die Sklavinnen bereiteten mit rituellen Gesten Pfefferminztee zu.
Es war eine außergewöhnliche Tatsache, dass jede Frau immer von einigen gut gekleideten schwarzen Frauen oder Mulattinnen mit üppiger Figur begleitet wurde, die große silberne Ringe an ihren Ohren trugen. Das waren die Konkubinen, die mit den Karawanen aus Afrika gekommen oder auf dem Sklavenmarkt gekauft worden waren. Paradoxerweise hüpften, tanzten, lachten, scherzten und vergnügten sich Herrinnen und Sklavinnen in perfekter Harmonie und ohne Diskriminierung.
In Fez regte man sich auch nicht weiter auf über das Schicksal der Sklavinnen und Sklaven in den Häusern der Bourgeoisie und der Honoratioren. Die hochgeschätzten schwarzen Frauen zeigten den Reichtum und den Prunk der wohlhabenden Fassi-Männer. Im Gegensatz zu ihren nach Amerika verschifften Zeitgenossinnen erfreuten sich diese Konkubinen über eine ungeahnte Freiheit und Leichtigkeit des Seins und hatten oft einen gewissen Einfluss auf das Familienleben.
In dieser Atmosphäre von erlesener Sanftmut und Raffinesse lebten die bürgerlichen Fassi-Frauen. Sie verbrachten dort ihre Tage, angenehm und ohne Aufregung, gemäß dem göttlichen Willen und unter dem Schutz von Moulay Driss[28], dem heiligen Schutzpatron und Gründer der Stadt im 8. Jahrhundert.
Die Männer verbrachten meistens ihre Zeit zwischen ihren Geschäften und den kurzen Augenblicken der Andacht und des Gebets in den Moscheen. Sie kehrten nach Hause zurück, um die Sinnlichkeit und Leidenschaft ihrer schwarzen Sklavinnen in der Kühle der „Riads“[29] und Wasserfontänen zu genießen. Marokko, das sich auf seinen Niedergang zubewegte und sich in lauter Schläfrigkeit versteifte, war ironischerweise genießerisch, hedonistisch und galant geblieben.
Eines Tages im Jahr 1909 ereignete sich etwas, das meine Großmutter, die damals noch ein Kind war, tief beeindruckte. Von ihrer Terrasse aus sah sie, wie eine gefangene Person in einem Eisenkäfig auf dem Rücken eines Kamels vorbeigezogen wurde, gefolgt von einer riesigen, randalierenden Menge. Der Mann konnte kaum in dem Käfig sitzen. Er war von bewaffneten Soldaten umgeben, die versuchten, sich ihren Weg durch die Menge zu bahnen. Dieser Mann war Bou Hmara, den man soeben gefangen hat und von dem schon oben die Rede war. Er war ohne Zweifel der meist gefolterte Mann in der marokkanischen Geschichte. Einige Tage später erfuhr man, dass er bei lebendigem Leibe den Löwen zum Fraß vorgeworfen wurde. Aber sie haben ihm nur einem Arm ausgerissen. Danach wurde er erschossen und man verweigerte ihm eine Beerdigung.
Meine Großmutter beschrieb mir diese Episoden aus Respekt und Bescheidenheit nicht allzu realistisch. Jahre später vervollständigten meine Mutter, dann mein Vater, ein geschichtsträchtiger Mann, sowie meine Onkel dieses Bild. Ich konnte mir diese Szenen gut veranschaulichen, während ich die Erzählungen der einen und der anderen gegenüberstellte.
*******************
DIE REISE MEINER GROSSMUTTER NACH MOGADOR
Seit seiner Versetzung war nun mehr als ein Jahr vergangen, als Si Guennoun seinem Bruder in Fez durch einen „Raquâsse“[30] einen Brief zukommen ließ, indem er ihn bat, seine Familie persönlich nach Mogador zu begleiten.
Dieser plante und koordinierte den Umzug der Familie, was sicherlich mehrere Monate in Anspruch nahm. Er bestellte die Möbel, die Si Guennoun benötigen würde und die speziell in Fez für das neue Haus in Mogador hergestellt wurden, außerdem alles andere, was für diese lange Reise gebraucht würde, da sie bestimmt drei Monate dauern würde.
Für den Transport von Reisenden und Waren, sowie für die gesamte Ausrüstung zum Campieren, heuerte er Karawanenführer an, die über Packtiere (Esel, Maultiere und Kamele), verfügten. Er stellte bewaffnete Männer ein, um die Frauen und Güter vor den lauernden Räubern, die das Land heimsuchten, zu schützen.
Dieses Ereignis fand in einer Zeit vor dem französischen Protektorat statt.
Man muss sich die ländlichen Gegenden vorstellen, in einem riesigen Land, in dem es keine Infrastruktur, keine Straßen, keine Eisenbahn, keine Autos, keine Kutschen und keine Brücken gab, nur endlose Wildnis, wo eine Reise nur mit Karawanen unternommen werden konnte, auf Reittieren, die sich langsam, lautlos und auf schmalen Pfaden bewegten.
Die Wege waren durch die jahrhundertelange, wiederholte Begehung durch die Hufe der Lasttiere markiert worden. Die verstaubten Wege, die während der Sommerhitze ausgetrocknet waren, wurden in der Regenzeit unpassierbar. Sie durchquerten Felder, Raine, Täler und Hügel.
Wer kann schon sagen, ob unsere Vorfahren in der Jungsteinzeit oder später die Mesopotamier und Assyrer anders gereist sind? Eine paradoxe Situation. Das Rad war zwar in Marokko nicht unbekannt, hatte sich aber nicht durchsetzen können. Ausgerechnet in einem Land, in dem Algebra, Astronomie und andere Wissenschaften an der Karaouyine gelehrt wurden und wo sich geniale Handwerker mit kunstvollen Arabesken in den Palästen verewigten.
Zu dieser Zeit fand also die erste Reise meiner Großmutter statt. Sie war damals etwa zehn Jahre alt. Sie verließ ihre Heimatstadt, die sie erst Jahre später, um 1930, wiedersehen würde, als das Regime des französischen Protektorates eine Straße gebaut hatte und ein regelmäßiger Transportdienst eingerichtet worden war.
Wie meine Großmutter mir erzählte, verfügte jeder in der Karawane über ein Reittier für die Reise; sie war sehr stolz darauf, ein eigenes Maultier gehabt zu haben. Diese Maultiere, die für ihren ruhigen und sicheren Gang geschätzt wurden, waren den Frauen vorbehalten, die in „Haiks“[31] eingewickelt rittlings darauf saßen. Man konnte die Augen der Frauen kaum sehen, sie verwandelten sich von Kopf bis Fuß in große einförmige, sperrige Pakete. Sogar meine Großmutter war verschleiert.
Man kam in einer ununterbrochenen Karawane voran. Die Lasttiere, deren Rückgrat durch riesige und schwere Körbe bedrückt war, mit angelegten Ohren ihrem traurigen Schicksal ergeben, liefen so lange, bis sie erschöpft waren. Manchmal fiel ein Esel oder ein Maultier tot um und wurde aufgegeben, wie die Tierkadaver bewiesen, die am Wegesrand herumlagen.
Die Diener, die für den Aufbau der Zelte, die Vorbereitung des Lagers, die Beschaffung von Vorräten aus den umliegenden Dörfern und das Kochen zuständig waren, ritten der Karawane voraus. Manchmal kamen ihnen Anwohner aus den umliegenden Dörfern entgegen, um ihnen Butter, Honig, Milch in großen Kannen oder Tonkrügen, Körbe mit Eiern, Brot, heimisches Obst, lebende Hühner und Schafe anzubieten und zu verkaufen; alles für ein paar „Hassani Sous“[32].
Hinter ihnen folgten die Gruppe der Frauen und ihre Maultiere mit dem Gepäck beladen. Sie waren umgeben von Wächtern, die mit Schrotflinten und „Khandjaren“[33] bewaffnet waren. Anschließend kam das Personal, die das Lager nach dem Verlassen aufräumten.
Laut meiner Großmutter brach die Karawane beim ersten Tageslicht auf, nach dem Morgengebet.
Beim Verlassen von Fez, überrascht und gerührt, entdeckte sie aus nächster Nähe das, was sie von ihrer Terrasse aus immer sehen konnte: die ländliche Umgebung und den unendlich leeren Raum. Mit ihren Kindesaugen sah sie, fasziniert, die unendlichen Weiten gelber oder weißer Blumenbeete, die reiche und schwarze Erde und atmete die so nahe Natur. Manchmal sah sie grüne Täler oder Hochebenen, bedeckt mit Kräutern und Gebüsch sowie mit Blumen und jede Art Vegetation übersät, soweit das Auge reichte. Bläuliche Gipfel tauchten regelmäßig am Horizont auf. Sobald man an ihnen vorbei gekommen war, erschienen weitere Bergrücken, die in einen gräulichen und unsicheren Schleier gehüllt waren: Man stieg in die Berge mit ihren spitzen Kämmen, um dann in die mit Gerste bebauten und mit Mohn bewachsenen Täler hinabzusteigen.
Die Tage folgten einander, ähnelten sich, aber jeder brachte seine Überraschungen und unvorhergesehenen Ereignisse mit sich.
Die Überquerung der großen Flüsse war für die Frauen eine Quelle der Besorgnis und ab und zu auch der Angst. Die breiten Flüsse schlängelten und wanden sich zwischen Hügeln und schroffen Schluchten, manchmal inmitten endloser Ebenen und endeten im Atlantik. Oft schwollen sie durch schnelle und unregelmäßige Zuflüsse an. Stellenweise war das Wasser, das sich durch versunkene Gänge schlängelte, schlammig und änderte seine Farbe bei Regenfällen und Überschwemmungen.
Auf beiden Seiten der Flüsse tauchten wilde Ufer auf. Manchmal ragten sie senkrecht und furchterregend auf, manchmal bestanden die Ufer aus schlammigem und glitschigem Lehm.
Man musste diese Flüsse überqueren. Es gab keine Brücken. Üblicherweise hielten sich zwei oder drei Fährleute mit Booten in Ufernähe auf. Diese Boote sahen oft deutlich verschlissen aus, sie waren bereits Gegenstand vieler Reparaturen gewesen und waren mit Holzbruchstücken seitlich und im Inneren oder unter dem Rumpf verfestigt worden. Sie hatten den Jahren getrotzt und schwammen nur dank der Wunder einer „Baraka“. Manchmal war Geduld angesagt, um sie zusammenzuflicken, bevor man sich wieder auf den Weg machen konnte.
Meine Großmutter und ihre Familie mussten von den Reittieren absteigen. Um sich auf den behelfsmäßigen Booten niederlassen zu können, mussten sie gegen Schlamm und glitschiges Wasser antreten. Die Karawane musste sich auf die Geschicklichkeit der Ruderer verlassen, die mit lauter Stimme die Barmherzigkeit Allahs und des Propheten erflehten, damit beim Rudern alles gut ging. Als die Frauen hinübergesetzt waren, in zwei oder drei Überfahrten, musste man die verängstigten Tiere mit großer Mühe aus den Booten schieben.
An den Ufern der etwas schmaleren Flüsse gab es keine Boote, so dass man sie über eine flache Furt, auf den Maultieren reitend, überqueren musste. Diese sanken bis zum Bauch ins schlammige Wasser, dabei wurden die Körbe teilweise unter Wasser gesetzt. Es konnte vorkommen, dass die Beine einiger von ihnen im Lehm und im Schlamm versanken. Sie mussten vom Ufer aus mit langen Seilen herausgezogen werden. Gelegentlich kam es zu Tierverlusten und die Überquerungen dauerten einige Stunden.
Dann beschritt die Karawane wieder die ausgetretenen Pfade, zog bis zum frühen Nachmittag weiter und machte ihren Halt für die Nacht. Die viel zu große Hitze ließ nicht zu, dass man den Marsch bis zum Ende des Tages fortsetzten konnte. Aus Sicherheitsgründen und um Wasser beschaffen zu können, wurden die Nachtlager in der Nähe eines einsamen Marabuts oder eines Dorfes aufgeschlagen, wo es oft einen Brunnen oder eine Quelle gab.
Bei der Ankunft der Reisenden wurden Pfähle eingeschlagen, Seile gespannt, um die Zelte auf dem Gras hochzuziehen, und anschließend noch die Tiere aufgereiht und angeleint. Nachdem sie ihr Lager aufgeschlagen hatten, zogen die Karawanenführer in die umliegenden Dörfer, um Proviant für die Mahlzeiten zu besorgen. Sie sammelten eine Menge getrockneter Äste und entzündeten damit die Lagerfeuer. Die Hühner oder Schafe wurden geschlachtet, und man bereitete dann das Mittag- und Abendessen für Alle.
Meine Großmutter konnte sich noch daran erinnern, dass die Quaïda den Frauen vorschrieb, in den Biwaks weder die Zelte zu verlassen noch vor den Männern zu erscheinen. Sie erzählte mir, dass sie durch Löcher, die in den Zeltplanen eingelassen waren, heimlich spionieren konnten.
Sobald die Dunkelheit über das Lager hereinbrach, und nach dem Ende der Mahlzeit, verschmolz sich von Zeit zu Zeit der Qualm von Kif (Droge aus der Hanfpflanze, wird geraucht, Hasch ist die Variante zum Essen) mit der Luft. Dann begann man das Säuseln und Schwingen der Saiten eines „Guembri“[34], das Tönen einer Flöte oder das Schlagen eines Tamburins der Kameltreiber zu hören.
Nach und nach verblasste dann der Klang der Musik und sie verstummte in der Nacht. Die schwachen Flammen der Kerzen erhellten das Innere der Zelte. Jeder legte seine Matte oder Matratze zum Schlafen aus. Ab und zu verzerrte der Wind die Zeltplanen, so dass sich Falten bildeten.
Wenig später funkelten Milliarden von Sternen im dunklen Himmel. Sie schienen so dicht beieinander zu liegen, dass man die Illusion hatte, man könne sie mit der Hand herunterholen.
Selbst die abgehärteten Männer mussten sich mit Umsicht und Wachsamkeit bewaffnen, wenn sie sich aus den Schutzhütten herauswagten. Für das menschliche Auge nicht wahrnehmbare Schatten machten einen großen Lärm. Horden von ausgehungerten Wildhunden, Schakalen oder einsamen Füchsen, die sich tagsüber versteckt und lautlos hielten, hatten den Geruch von frischem Fleisch und von Lebensmitteln erschnuppert. Sie bellten, heulten und streunten die ganze Nacht rund um das Lager und schlichen zwischen den Zelten, auf der Suche nach Essensresten. Das Risiko einer Bisswunde und somit der Ansteckung mit Tollwut war eine ständige Bedrohung.
Das Land wimmelte vor flüchtigen Schlangen, Skorpionen, die in der Dunkelheit der Nacht überall zwischen Sträuchern und Steinen herumkrochen und sich schlängelten. Zwischen den Büscheln und Büschen brummte, flüsterte, rauschte, murmelte die Erde und verursachte allerhand Geräusche ausgehend von Insekten, Spinnen, Raupen, Heuschrecken, Ameisen, Termiten, Käfern, die auf dem Boden umherirrten und manchmal für Verwirrung und Panik unter den Frauen sorgten. Fliegen, Moskitos und Läuse gab es wie Sand am Meer, angezogen vom Körpergeruch der Menschen. Etwas weiter hörte man das Gequake der Frösche, die Rufe der Kröten, die einander erst zuhörten, dann verstummten und in regelmäßigen Abständen wieder begannen. Vögel, in der Dunkelheit der Zweige versteckt, ließen sich hören mit Zwitschern, Schreien und Murmeln. Bis in die Morgenstunden erklang dann nach Mitternacht das Krähen der Hähne.
Schließlich schlichen auch Plünderer in bestimmten Abständen umher, um Tiere und Menschen zu überfallen, die keinen Unterschlupf gefunden hatten. Das wussten die Wächter und schliefen deshalb mit ihren Pulvergewehren im Arm nur mit einem offenen Auge. Sie schürten große Holzfeuer, die Tiere und Zelte hell erleuchteten. Sie verständigten sich gegenseitig durch regelmäßige Signale und Warnungen, indem sie laute Schreie ausstießen und Lärm machten, um potenzielle Raubtiere und Räuber wissen zu lassen, dass sie „auf der Hut waren“.
Diese Landschaft, tagsüber so still und friedlich, nachts so laut und beunruhigend, und diese merkwürdige und seltsame Atmosphäre waren bestimmt unseren entfernten Vorfahren während der Steinzeit bereits bekannt. Natürlich gehörten die „Dschinns“[35], Gespenster und unsichtbare Phantasmen, die sich in der Dunkelheit verbargen, bereits damals zum Volksglauben.
Dieses Szenarium dauerte solange, bis die ersten Lichtstrahlen am Horizont sichtbar wurden: ein vager Strahlenkranz, der sich sehr schnell ausbreitete, in die gesamte Ebene eindrang und sie mit Licht überflutete, dabei die Landschaft verwandelte und die Luft erwärmte.
Bei Tagesanbruch wurde das Frühstück fertiggestellt, und dann ging man weiter.
Weiter südlich, nach der Überquerung des Oum Rabîi[36], erschienen Kaktushaine, Schilfgebüsche, Feigen- und Olivenbäume. Dann strahlte der Himmel in immer ausgeprägten wunderbaren Blautönen.
Der Horizont flachte sich ab und die Landschaft weitete sich. Weiter auf dem Weg wurde die Erde trockener, intensiver, abwechslungsreicher und färbte sich mit rötlichen, bernsteinfarbenen oder kupferfarbenen Schattierungen.
Die Luft wurde trockener, heißer, und das wahre Licht der heißen Regionen, so eigentümlich und charakteristisch für Südmarokko, umhüllte und durchdrang alles. Dieses Licht war strahlend hell, prächtig und von großer Intensität. An manchen Tagen musste man über Hochebenen ziehen, die entlang eines lebensfeindlichen Gebietes verliefen, und andere tiefe, unerforschte Schluchten oder steiniges Hinterland durchqueren.
In der Unermesslichkeit dieser leeren Räume verschmolzen sich ab und zu kleine, bescheidene Dörfer aus Erdhäusern, Strohhütten oder „Noualas“[37] mit der Natur. Sie waren über die Zeit verloren und vergessen worden. Einige waren von Schilf, Kakteen und Aloe umgeben und von einschüchternden, misstrauischen und grimmig dreinblickenden Menschen bevölkert.
Neben diesem traurigen Anblick gab es Bewohner, die in einer Lethargie versteinert waren, in einer Schläfrigkeit, in der die Zeit seit Jahrhunderten angehalten worden und erstarrt war.
Für die Einwohner von Fez galten diese Landbewohner als unkultiviert und rückständig. Doch diese Menschen begnügten sich mit einem harten Leben und empfanden nichts als Verachtung für die Bewohner der Städte. Mensch zu sein, bedeutete für sie in erster Linie, genügsam zu leben, sich in Lumpen zu kleiden und in der Lage zu sein, sich an eine strenge Umgebung anzupassen. Zwischen beiden Bevölkerungsgruppen bestand eine unsichtbare, aber dennoch echte und tiefe Grenze.
Meine Großmutter erinnerte sich mit etwas Unbehagen daran, dass der Weg in regelmäßigen Abständen mit toten Maultieren, Eseln, Hunden und Kamelen übersät war, deren steife Gerippe vor Ort verfaulten. Es tat dem Auge weh, wie sich die düsteren Phasen jeder Zersetzungsstufe enthüllten. Versteinerte, zerfetzte oder nackte und ausgetrocknete Leichen dienten als Festmahl für Raubvögel und Wildhunde, die die Eingeweide herausrissen und die Gebeine zerstückelten. Man musste den Atem anhalten, denn wegen der sengenden Hitze der Sonne verbreiteten sich üble Gerüche. Diese Ausdünstungen verpesteten die Luft.
Von Zeit zu Zeit beruhigte sich meine Großmutter beim Anblick von Schaf- oder Ziegenherden, die friedlich unter der Obhut eines zerlumpten Jungen grasten. Sein rasierter Schädel war mit einem langen Zopf verziert, der hinter seinem Kopf hing, dessen Augen, von einer Fliegenwolke umgeben, jedoch das Mitleid erregten.
Als sie sich den Städten näherten, kamen ihnen oft andere Karawanen entgegen, meist angeführt von verachtend dreinblickenden Kamelen, die unter der Last ihrer Bürde lässig schwankten.
Der erste Straßenabschnitt, der zurückgelegt wurde, führte von Fez über Meknès nach Salé. Die Karawane ruhte für zwei Wochen bei Mitgliedern der Familie meiner Urgroßmutter. Dann ging man weiter nach Settat, einem großen Handelszentrum in einer reichen landwirtschaftlichen Region. Denn zu dieser Zeit war Casablanca nur ein kleines Dorf und noch nicht so bekannt. Nach einer wohlverdienten Ruhepause dort machten sie sich auf den Weg nach Marrakesch. In der Ferne konnte man bereits das große Atlasgebirge sehen, mit seiner monumentalen Kette aus schneeweißen Gipfeln und einem riesigen Palmenhain.
Nach ihrer Ankunft verblieben sie bei Familienangehörigen, um sich zu erholen und neue Kraft zu schöpfen. Ein Hotel, so wie wir es heute kennen, gab es damals noch nicht. Während ihrer Reisen hielten sich die Marokkaner gewöhnlich mehrere Wochen bei Familienmitgliedern oder Freunden auf. Bei jedem Zwischenstopp war der erste Wunsch eines jeden, den Hammam zu besuchen.
Schließlich wurde die letzte Teilstrecke der Reise nach Mogador angetreten. Den ganzen Weg entlang war meine Großmutter tief beeindruckt, als sie zum ersten Mal sah, wie Hunderte von Ziegen mit unglaublichem Geschick auf zigtausende schlanke Äste der Arganbäume[38] kletterten und schaukelten, die über die riesigen Flächen in steiniger roter Erde standen.
Schlussendlich hatte die Reise drei Monate gedauert. Mogador sollte nun das Zuhause meiner Großmutter bis Anfang der 1950er Jahre sein. Sie war damals ungefähr elf Jahre alt.
********************
DER UMZUG UND SEINE RITUALE
Bei ihrer Ankunft in Mogador durfte die Karawane die Tore der Stadtmauern nicht passieren. Meine Großmutter, die junge Rkia, und ihre Familie zelteten in einiger Entfernung. Die Landessitte (Quaïda) verlangte, dass man auf die Erlaubnis von Si Guennoun warten müsse, um die Stadt zu betreten.
Gemäß unseren marokkanischen Traditionen war es für neue Stadt-Bewohner vorgeschrieben, einem genau festgelegten Ritual zu folgen, bevor sie die erste Nacht in einem ihnen noch unbekannten und unbewohnten Haus verbringen durften. Die Menschen glaubten, dass zwei parallele Welten neben einander existieren: unsere Welt und eine andere, für den Menschen unsichtbare und mystische Welt. Über die Jahrhunderte hinweg hatte sich der Glaube an das Übernatürliche an unsere Wahrnehmung der Welt angefügt. Die Existenz und die Macht des Irrationalen mussten nicht mehr bewiesen werden. Zeremonien, das Übermächtige zu bannen, wurden treu zelebriert. Dieser Glaube an das Irrationale und Okkulte, eng mit dem täglichen Leben verbunden, äußerte sich insbesondere im Kult der „Dschinns“ (Geister), der von eigenen Riten und Praktiken beherrscht wurde. Dschinns sind für den Menschen unsichtbar oder können jederzeit je nach Fantasie die Gestalt eines beliebigen Tieres annehmen: einer Katze, eines Hundes, eines Dromedars.
Im Volksglauben galten dunkle und verlassene Orte wie Keller, Hauswinkel, Hammams und Abwasserkanäle als Lieblingsaufenthaltsorte der Dschinns. Sie hatten ihre eigene Welt, hassten es, gestört zu werden, waren leicht reizbar und zornig. Deshalb flößten sie der Bevölkerung Angst und Respekt ein. Da sie allmächtig waren, konnten sie sich leicht an denjenigen rächen, die sie aus Unvernunft verärgern oder belästigen, indem sie sie plagten und verhexten. Sie waren sogar in der Lage, eine Seele zu „besitzen“ und einen Körper zu „bewohnen“. Das Opfer wurde dann „meskoun(a)“[39] (bewohnt) und war für Krisen, Depressionen, verschiedene Krankheiten, Wahn, vielfältiges Leiden und Pech anfällig.
Bevor man ein neues Haus bezog, war es Sitte, prophylaktische Maßnahmen zu ergreifen, um unliebsame Begegnungen mit den Dschinns, die die Räumlichkeiten bereits bewohnten, zu vermeiden. Das primäre Ziel war es, ihnen seine guten Absichten mitzuteilen und ihr Wohlwollen zu gewinnen. Für dieses grundlegende Ritual waren die Frauen zuständig. Dieses Ritual wird auch heute noch praktiziert, bleibt aber für Ausländer weitgehend unbekannt.
Meine Urgroßmutter und ihre Weggefährtinnen, die gerade erst vor den Toren von Mogador angekommen waren, brachten Milch und einen kleinen Reisigbesen mit ins neue Haus. Hier suchten die Frauen alle Winkel der Räume ab, besprengten sie und sagten dabei besondere Beschwörungsformeln auf. Danach wurden Kerzen aufgestellt, die alle Räume des Hauses erhellten. Anschließend wurde das Haus von Grund auf geputzt und die Möbel wurden aufgestellt.
Bei dieser Gelegenheit richtete Si Guennoun einen religiösen Abend aus mit großen Mengen Couscous. Dies ist ein alter Brauch in unserem Land. Er lud „Tolbas“[40] ein, um stundenlang aus dem Koran vorzubeten und gleichzeitig das Haus zu segnen. Neugierig und verwundert folgte meine Großmutter diesen Praktiken und machte sich mit ihnen vertraut, da sie ihr Leben für immer prägen sollten.
Nachdem diese Rituale vollzogen waren, konnte man endlich mit Frieden in der Seele in dem neuen Haus leben. Die „Nnia“ spielte eine herausragende Rolle.
Übrigens hatte ich selbst die Gelegenheit, während meiner Kindheit und Jugend, Zeuge dieser Praktiken zu sein, die auch heutzutage noch sehr lebendig sind.
******************
MEIN URGROSSVATER IN MOGADOR
Meine Großmutter sagte über ihren Vater Si Guennoun, dass er ein gebildeter Mann war, wortgewandt, von stattlichem Aussehen, aber mit einem unflexiblen und strengen Charakter. Er blieb sehr pedantisch in Etikette und Konventionen, was er sicherlich aus der Zeit des Makhzen geerbt hatte.
Er wohnte im ersten Stock eines maurischen Hauses, unter freiem Himmel. Hier hatte er sein Schlafzimmer, sein Wohnzimmer und einen „Menzeh“[41] oder Patio, der sich zum Erdgeschoss hin öffnete. Dieser Teil des Hauses war seine Privatwohnung. Gerne saß er in der Menzeh und arbeitete allein, indem er gleichzeitig die Aktivitäten seiner Familienmitglieder im Erdgeschoss verfolgte. Niemand durfte sich ihm nähern, ohne gerufen worden zu sein. Er aß meistens allein. Gelegentlich lud er einen Freund zu sich ein, um mit ihm zu essen oder sich mit ihm zu unterhalten. Er schlief allein und wählte aus seinen Frauen diejenige aus, die das Privileg haben sollte, sein Bett für die Nacht zu teilen.
Alle anderen Mitglieder der Familie teilten sich das Erdgeschoss. Hier gab es einen großen, mit Mosaiken verzierten Innenhof. In dessen Zentrum thronte ein Brunnen in der Mitte eines flachen Beckens, in das Wasser hineinfloss. Die langen, engen Räume waren zum Hof hin ausgerichtet. Auf einer Seite öffnete sich dieser zu einem Korridor mit weiteren Räumen für die Konkubinen und die Kinder. Außerhalb des Hauses gab es keine Fenster, keine Öffnungen, nur eine hohe, breite Mauer, die das Haus von der Straße isolierte. Der Eingang wurde durch eine dicke blaue Holztür in den Farben von Mogador hervorgehoben, die mit riesigen runden schwarzen Nägeln verziert war.
Nachdem er sich in Mogador endgültig niedergelassen hatte, ergänzte mein Urgroßvater seine offizielle Funktion am Hafen mit einem Handelsgeschäft. Somit wurde er sowohl Beamter als auch Importeur. Auf den ersten Blick erscheinen solche Funktionen gegensätzlich, aber es war damals üblich.
Die Einkünfte waren unregelmäßig, angesichts der katastrophalen politischen Lage im Land, was erklärte, warum die Beamten des Makhzen parallel zu ihren offiziellen Aufgaben noch Handel trieben.
Si Guennoun war besonders in den Handel mit Manchester verwickelt. Von hier konnte er luxuriöses „Sheffield“-Silberbesteck, Teegeschirr, Serviertabletts, viktorianische Teekannen, feines englisches Porzellan aus „Bone China“ von Wedgwood, Royal Albert oder Ridgway einführen. Aus Frankreich importierte er hauptsächlich Kristallglas aus Arques. Er hatte eine riesige Galerie in seiner Wohnung, die er stets verschlossen hielt. Nach der Beschreibung meiner Großmutter war diese Galerie einer echten Höhle des Ali Baba würdig. Hier fand man Tafelsilber, Kristall, Truhen gefüllt mit Louis d’or und Bündel von Banknoten. Si Guennoun bestreute sie regelmäßig mit sehr scharfem Chilipulver, um sie vor Termiten zu schützen. In seiner Galerie befanden sich auch „tausend-und-eine“ weitere Wertsachen.
Als Erwachsene hatte nur meine Großmutter allein gelegentlich Zugang zu diesem Raum, aber niemals seine Söhne, denen er misstraute und die er auf Distanz hielt.
So wie sich die politischen Ereignisse entwickelten, beschaffte sich Si Guennoun bald die englische „Protection“, (H’maïa N’gliz)[42].





























